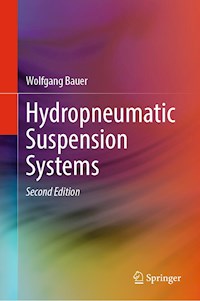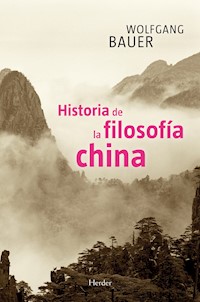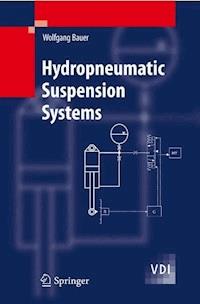19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die afghanische Ring Road. Eine Straße, die real existiert und dennoch ein Mysterium ist. Der 2200 Kilometer lange kreisförmige Highway verbindet die wichtigsten Städte des Landes. Er versprach Einheit und Aufschwung. Seit sechzig Jahren wird an ihm gebaut, doch fertig ist er noch immer nicht. Korruption und Misswirtschaft haben riesige Summen verschlungen. Nach dem Einmarsch der westlichen Truppen wurde die Straße zu einem blutigen Schlachtfeld.
Kaum ein deutscher Journalist kennt Afghanistan so gut wie Wolfgang Bauer. Der Zeit-Reporter war viele Male vor Ort, machte die Schicksale der Menschen in preisgekrönten Reportagen anschaulich. Früh warnte er vor einer Rückkehr der Taliban. Im August 2021 wurde einer seiner engsten Mitarbeiter ermordet.
Nach dem Fall Kabuls kehrt Wolfgang Bauer noch einmal zurück. Er bereist die Ring Road, sucht Orte auf, die er in den letzten 20 Jahren besucht hat – und geht der Frage nach: Warum ist der Westen in Afghanistan gescheitert? Was hat dieses Scheitern mit der milliardenschweren Entwicklungshilfe zu tun? Und wie geht es weiter? Seine Reportage ist eine Parabel über Hoffnung und Scheitern am Hindukusch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Wolfgang Bauer
Am Ende der Strasse
Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern
Eine Reportage
Suhrkamp
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: Jim Huylebroek
eISBN 978-3-518-77386-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Notizen
Drei Landeanflüge
November 2002
November 2011
November 2021
Kilometer 0 Kabul. Mauern aus Knochen
Kilometer 5 Kabul. Wo die Stürme ihren Anfang nehmen
August 2021
Dezember 2021
Kilometer 126 Dschalalabad. Von den Abgründen
Kilometer 207 Abdul Khel. Geburtsstätten des Krieges
November 2017
Februar 2018
Dezember 2021
Kilometer 460 Maidan Shahr. In der Lüge die Hoffnung
Februar 2020
Dezember 2021
Kilometer 565 Ghazni. Von den Krankheiten
Kilometer 633 Raschidan. Geisterland
August 2020
Dezember 2021
Kilometer 701 Ghazni. Begegnung mit einer Nymphe
Kilometer 726 Nyazullah. Als das Foltern noch etwas half
11.Juni 2007, 6:30 Uhr
Kilometer 1050 Kandahar. Drei Hotels und zwei Absagen
Kilometer 1152 Spin Boldak. Die Blutspur
Kilometer 1254 Kandahar. The Californian Dream
Kilometer 1833 Herat. Vom Wahnsinn der Liebe
Oktober 2011
Dezember 2021
Kilometer 2101 Bala Murghab. Am Ende der Straße
Kilometer 2641 Deh Warda. Das Dorf der Glücklichen
2005
Dezember 2021
Kilometer 2898 Kunduz. In der Ruine der Entwicklungshilfe
2018
Dezember 2021
Kilometer 3112 Salang. Die angekündigte Katastrophe
Kilometer 3231 Kabul. Eine Talfahrt
Kilometer 0 Alles noch einmal von vorn?
Literaturhinweise
Fußnoten
Abbildungsnachweis
Informationen zum Buch
Notizen
Die Seiten sind eingerissen. Sie wellen sich, ihre Ränder sind ausgefranst. Sie riechen. Oft ist noch alter Sand auf ihnen. Andere sind ranzig vom Schweiß, meinem Schweiß. Die Heftspiralen meiner Notizblöcke lösen sich, und etliche haben sich ineinander verhakt. Die Blöcke in meinen Regalen sind keiner Ordnung unterworfen. Sie liegen dort, wo sich durch Zufall Platz gefunden hat. Das Lesen wird erschwert durch die Luftwurzeln längst abgestorbener Topfpflanzen, die durch sie hindurchgewachsen sind. Ihre Rinden haften an den Seiten, wurden eins mit der Tinte.
Seit Jahren hebe ich alle meine Notizen auf, ein Reflex ohne viele Hintergedanken. Inzwischen ist das Bewahren zu einer Art Aberglauben geworden. Ich mache es ähnlich wie die Voodoo-Kulturen Afrikas: Die Notizen sind zu Fetischen geworden. Geister in der Flasche. Sie bannen Gefühle in Materielles, fassen sie, bändigen sie, überführen sie in eine feste, unschädlichere Form. Der Lärm des Erlebten wird leiser. Das Leid, das Sehnen, das Hoffen. Es verstummt nicht, aber es dröhnt nicht mehr.
Die Notizen sind Gesprächsprotokolle, Rohstoff für meine Reportagen, Beschreibungen von Orten und Menschen aus den letzten zwanzig Jahren, Einschätzungen, Korrekturen, hin und wieder auch Zeichnungen, weil sie manchmal die Dinge besser beschreiben können als Worte. Es sind Versuche, ein Land zu verstehen, das mich provoziert, mit meinen Werten in Frage stellt, mich verwirrt, nach vielen Jahren noch. Kein Land geht mir so sehr unter die Haut und in meine Träume wie Afghanistan. Ich träume häufig von Afghanistan.
Meine erste Reise nach Afghanistan habe ich nicht angetreten, aus Angst. Im Auftrag eines deutschen Magazins sollte ich im November 2001 über den Krieg gegen die Taliban berichten. Die USA hatten sich nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11.September dem Sturz des Taliban-Regimes verschrieben. Ich fuhr nicht, aber ein Bekannter von mir, Volker Handloik, der vom Stern entsandt wurde und wenig später in den Kämpfen ums Leben kam. Kurz davor hatten wir noch zusammengesessen.
Ich reiste zum ersten Mal in dieses Land, als die Taliban bereits gestürzt waren, wenige Monate später, für eine Woche zunächst nur, immer noch sehr unsicher und nervös. Und ich würde in den darauffolgenden Jahren immer wieder kommen, manchmal für Tage, für Wochen, manchmal für mehrere Monate. Ich bereiste die meisten Provinzen, traf Viehhirten in Kunar, Archäologen in Ghor, Höhlenbewohner in Bamiyan, ich traf Diplomaten und Politiker, Lehrer, Händler, Drogenhändler, Gauner und Gefängniswärter – auch Gefängniswärterinnen. Ich traf nicht so viele Frauen, wie ich es mir wünschte. Ich traf Menschen, vor denen ich mich zutiefst fürchtete, und andere, die ich bewunderte. Welche Kraft in vielen Afghaninnen und Afghanen steckt! Ich konnte mich nicht sattsehen an diesem Land. Ich wurde betrogen, bestohlen, ich wurde in die Irre geführt und reich beschenkt. Und immer wieder verstört.
Meine Notizblöcke öffne ich nur selten – genauer gesagt: nie.
Bis zu dieser Nacht Ende November 2021. Es ist die letzte Nacht, bevor ich wieder das Flugzeug nach Kabul besteigen werde.
Drei Monate zuvor, am 15.August 2021, ist der afghanische Präsident Aschraf Ghani aus Kabul geflohen. Seither herrschen wieder die Taliban, nach den Jahren 1996 bis 2001 zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Landes. Damit ist viel mehr als die Islamische Republik Afghanistan untergegangen. Die Hoffnung ist gescheitert, das Land mit vierzig Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in eine Demokratie zu verwandeln. Gescheitert sind die Versuche, die Frauen zu befreien, Minderheiten zu schützen, Afghanistan wirtschaftlich aufzubauen. Viele sagen sogar, der 15.August markiert das Ende des humanitären Zeitalters. Das Ende der Hoffnung, die Welt etwas besser machen zu können.
Es war zu Beginn ein großartiges Gefühl, geteilt von fast allen, die versuchten, in Afghanistan etwas aufzubauen. Die Welt hatte sich zusammengetan für ein Ziel: eines der ärmsten Länder auf dem Planeten in die Moderne zu führen.
Doch Afghanistan war uns im Westen unvertraut wie kaum eine andere Region auf der Welt. Seine archaischen Berge und Wüsten haben die Helfer aus Übersee gerne mit Mondlandschaften verglichen. Die ersten Spaziergänge auf der Oberfläche eines fremden Planeten, mit Sauerstofftanks auf unseren Rücken, mit Pasta und Air-Conditioning. Wir Afghanauten. Vom Nirgendwo aus dem Himmel herabgefallen. Wir haben viele Jahre versucht, in Afghanistan eine Atmosphäre zu erzeugen, die auch wir atmen konnten. Offiziell betrieben wir Nation-Building, tatsächlich aber versuchten wir Terraforming. Ein Projekt zum radikalen Umbau von Umwelt und Kultur.
Im Jahr 2002 erschien uns das alles politisch unumgänglich, moralisch zwingend und vor allem: möglich.
Wir erlagen einer Illusion. Unsere Raumkapsel, die Islamische Republik Afghanistan, mit der wir Freiheit und Demokratie bringen wollten, ist zertrümmert. Die, die sich dort in den letzten Jahrzehnten an unsere Atmosphäre angepasst hatten und jetzt zurückgeblieben sind, drohen zu ersticken.
Sind wir mit allen unseren hochfahrenden Zielen erbärmlich gescheitert? Alles für nichts? Wurden in Afghanistan im August 2021 mit der Flucht des Präsidenten und dem Abzug der letzten US-Truppen die Uhren einfach wieder um zwanzig Jahre zurückgedreht? Vom Jahr 2021 auf das Jahr 2001, als schon einmal die Taliban herrschten, Afghanistan schon einmal international völlig isoliert war? Ist das Land, und mit ihm auch wir, gefangen in einem endlosen Kreis? Einer Schleife des Schmerzes und des Elends, die sich ständig wiederholt?
Bilder der Schande standen am Ende des Versuches, in Afghanistan das Gute zu tun. Flugzeuge, an denen sich beim Abheben Verzweifelte klammerten. Menschen, die sich gegenseitig zu Tode trampelten. Mütter, die ihre Kleinkinder über eine Flughafenmauer schleuderten. Die Hoffnung, die die Welt einst dem ganzen Land geben wollte, war nun auf die wenigen Quadratkilometer des Flughafens in Kabul geschrumpft, Hoffnung, aus der nun blanke Verzweiflung wurde.
Ist es nicht an der Zeit, sich einzugestehen, dass wir nicht helfen können? Müssen wir uns der bitteren Erkenntnis fügen, dass unsere Hilfsgelder, diese Millionen und Milliarden und Billionen, mehr Böses als Gutes fördern, dass alles Geld in der Entwicklungszusammenarbeit unweigerlich zu Gift wird? Ist es nicht an der Zeit, internationale Solidarität neu zu definieren, nüchterner, erwachsener auch?
Entlarvt der Fall von Kabul das humanitäre Zeitalter mit all seinen Hilfsorganisationen und Entwicklungshelfern endgültig als das, was es von Anfang an womöglich war, die Fortsetzung des Kolonialismus mit mildtätigen Mitteln?
Nicht das Militär hat in Afghanistan versagt. Dieser Krieg ging nicht verloren, weil Soldaten nicht kämpften oder die falschen Waffen eingesetzt wurden. Geld hat dieses Land mindestens so zerstört wie Gewehrkugeln.
Was sollen wir jetzt tun? Es einfach geschehen lassen? Dem Elend zusehen? Besser: wegsehen? Ich glaube: Wir müssen lernen.
Am Ende dieser langen Nacht packe ich meine Notizblöcke in meinen Rucksack, lege alte Fotos dazu. Ich möchte Orte und Menschen wieder besuchen, über die ich in diesen letzten zwanzig Jahren berichtet habe, möchte meine Texte von damals, die auch Teil dieses Buches sind, abgleichen mit dem Wissen von heute. Ich möchte wissen, ob ich diesen Menschen gerecht geworden bin. Ich möchte erfahren, was aus ihnen wurde, aus ihren Träumen, aus ihrer Verzweiflung. Ich möchte wissen, wie ihre Geschichten weitergingen. Zu vielen dieser Menschen ist in der Zwischenzeit der Kontakt abgerissen. Ihre alten Telefonnummern, die an den Rändern meiner Notizen stehen, funktionieren nicht mehr. Nach all den Jahren sind die Chancen gering, aber ich hoffe, sie zu finden. Ich trete diese Reise an, um zu verstehen, warum wir, nicht nur der Westen, mehr noch die Weltgemeinschaft, damit gescheitert sind: das Gute zu tun.
Dieses Buch ist der Versuch, die Hoffnung wiederzufinden.
Explosionswolke über den Bergen im Distrikt Atschin in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan, 2017. Foto: Andy Spyra.
Drei Landeanflüge
November 2002
Selbst Luftwege nach Kabul sind Schotterpisten. Das Flugzeug rüttelt in den Turbulenzen über dem Hindukusch. Es fliegt enge Schleifen. Die Taliban sind erst seit wenigen Monaten besiegt. Ich sitze in einem der ersten Direktflüge, die die staatliche Fluglinie Ariana nach dem Krieg wiederaufgenommen hat. Frankfurt – Kabul direkt. »Ein seltsames Gefühl, nach Kabul zu fliegen«, sagt der Fotograf neben mir. Er war schon oft in Afghanistan, war bisher aber immer nur über Landwege von Pakistan aus eingereist, den damals halsbrecherischen Chaiber-Pass. Von Deutschland aus dauerte die Reise nach Afghanistan mehrere Tage – jetzt nur noch acht Stunden. An Bord sind viele Afghanen, die in den letzten Jahren nach Deutschland geflohen sind und nun erkunden wollen, ob sie beim Aufbau des Landes helfen können.
Im Jahr 2002 ist Kabul eine noch verhältnismäßig kleine Stadt mit wenigen Hunderttausend Einwohnern. Eine Stadt in den Ruinen des Bürgerkrieges, der hier Anfang der neunziger Jahre fürchterlich getobt hatte. Nur wenige Straßen sind geteert, und nur wenige Autos fahren auf ihnen. Strom gibt es selten. Kabul ist damals eine Stadt, die tagsüber dem Staub gehört und nachts der fast völligen Dunkelheit.
Die Stimmung an Bord beim Landeanflug ist angespannt. Es gibt Gerüchte, wonach im Umkreis Kabuls immer noch Taliban-Gruppen operieren. Neulich sollen sie Raketen auf landende Flugzeuge geschossen haben. Der Airbus ist alt, aber, so heißt es, Lufthansa-Techniker in Frankfurt helfen bei der Wartung. Hart setzt die Maschine im Morgengrauen auf die Landebahn auf. Applaus der Erleichterung. Zu Fuß überqueren wir die Rollbahn. Das Terminal besteht aus einer einzigen Halle. Über fast zehn Jahre ist der Flughafen kaum genutzt worden. Durch die wechselnden Kämpfe in der Stadt war das Landen hier zu gefährlich, und die Taliban hatten kein Geld für Flugbenzin. Unsere Koffer sind Teil eines beeindruckenden Gepäckberges. Er ist mehrere Meter hoch, auf seiner Spitze steht ein langbärtiger Flughafenmitarbeiter. Brüllend versucht er Ordnung ins Chaos zu bringen.
Hinter dem Abfertigungsgebäude erwartet uns ein mühseliger Weg in die Stadt. Wir laufen vorbei an langen Reihen von Flugzeugwracks, Wracks von Passagierflugzeugen aller Größen, russischer und amerikanischer Produktion, Wracks von ausgeschlachteten Kampfjets, Übungsflugzeugen, ein Schrottplatz aus Triebwerksturbinen, zerbrochenen Tragflächen, Heckflügeln ohne Rumpf. Die Schädelstätte eines Landes, das immer wieder versucht hatte, Anschluss an die Welt zu gewinnen, ihn aber immer wieder verlor.
Kurz nach unserem Flug wird die Direktverbindung wieder eingestellt, angeblich ist der Airbus doch nicht sicher genug.
November 2011
Sanft landet die Boeing aus Istanbul. Es macht jetzt schon fast keinen Unterschied mehr, ob man nach Kabul fliegt oder nach Dubai. Die Routine des Jetsets. Der Flieger ist gut gebucht, auch die Businessclass. Ich sehe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausländischer Hilfsorganisationen, die alle paar Wochen ein- und ausfliegen. Die neue Pendlerklasse. Die Angestellten größerer Organisationen wie die der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) fliegen Businessclass, die der kleineren, meist also ärmeren, Economy. In Kabul wurde mit Geldern der Weltbank ein neues Terminal gebaut. Die Abfertigung ist reibungslos. An der Passkontrolle stehen deutsche Polizeibeamte mit dem Bundesadler auf der Uniform, die afghanische Anwärter ausbilden. Das fühlt sich fast so an, als hätte man sich nicht aus Frankfurt fortbewegt.
November 2021
Der Pilot setzt zur Landung an, fast schon berührt der Airbus der afghanischen Fluglinie Kam Air die Rollbahn. Ich ziehe meinen Gurt so fest es geht, wie immer bei Landungen, da reißt der Pilot die Maschine plötzlich wieder ganz steil nach oben. In engen Kurven schraubt er sie höher und höher, die wenigen Passagiere beginnen zu tuscheln. Die mit Fensterplatz drücken ihre Gesichter an die Scheiben, einige beginnen zu beten. Das Beten macht mich am meisten nervös. Viele von ihnen sind abgeschobene Afghanen, die an unserem Abflugort Abu Dhabi von der Polizei zum Gate eskortiert wurden. Die Gründe kenne ich nicht.
Am Vorabend war ich aus Frankfurt angekommen. Ich hasse diese Nachtflüge. Frankfurt in der Nacht, Dubai oder Abu Dhabi im Morgengrauen, Kabul zur grellen Mittagsstunde. Es bleibt unklar, warum der Pilot die Landung so hart abgebrochen hat. Mehrere Monate lang war der Flughafen geschlossen gewesen. Wir kreisen und kreisen, meine Knie zittern. Ich habe einen Trick gegen Flugangst. Wenn sie aufkommt, denke ich an Darmkrebs. Besser etwas, das nur wenige Minuten dauert, als Darmkrebs. Wirkt manchmal, nicht immer. Der Pilot leitet zum zweiten Mal das Landemanöver ein. Es gelingt! Als wir ausrollen, sehe ich, dass die Taliban den Flughafen mittlerweile von Hamid Karzai International Airport in Kabul International Airport umbenannt haben. An den Außenmauern liegen immer noch massenweise aufgebrochene Koffer, Kleidungsstücke, Schuhe, der Besitz Zehntausender, die im Sommer versucht hatten, sich hierherzuretten. Taliban kontrollieren mein Gepäck.
Ich bin zurück in Afghanistan.
Kabul, 2021. Foto: Kaveh Rostamkhani.
Kilometer 0
Kabul
Mauern aus Knochen
Die Straße beginnt unmittelbar vor dem Flughafen. Sie ist eine afghanische Legende. Die Ring Road. So wird sie meistens genannt. Eine Straße, die fast ein Mysterium ist, obwohl sie real existiert. Nur wenige haben sie jemals komplett befahren. Sie beginnt in Kabul und führt dann in einer gewaltigen Kreisbewegung durch das gesamte Land. Gesamtlänge: 2200 Kilometer. Sie verbindet die wichtigsten Städte Afghanistans. Von Kabul aus führt sie nach Kandahar im Süden, Herat im Westen, Mazar-i-Sharif im Norden. Ein etwa 150 Kilometer langer Seitenarm verbindet die Hauptstadt mit Dschalalabad im Osten. Die Ring Road durchquert die Wüsten des Südens, die Grassteppen des Nordens und das Hochgebirge des Hindukusch. Sie ist die Lebensader des Landes. Alle, die Afghanistan zu einem modernen Nationalstaat machen wollten, haben an ihr gebaut. Der letzte König, Mohammed Zahir Schah, hatte vor siebzig Jahren damit begonnen. Als er nach einer vierzigjährigen Regentschaft 1973 ins Exil gezwungen wurde, führte Mohammed Daoud Khan, der erste Präsident der Republik Afghanistan, das Projekt weiter. In rascher Folge stürzten sich seitdem die Herrscher des Landes, jagten sich gegenseitig davon oder töteten einander, aber der jeweils Nachfolgende, egal welcher Ideologie, baute weiter an dieser einen Straße.
Afghanistan ist eines der letzten Länder auf der Welt, die nie zu einem Staat zusammengewachsen sind. Es ist ein Konglomerat aus 14 Ethnien völlig unterschiedlicher Kulturen – schon die genaue Zahl ist hochumstritten –, die insgesamt 14 Sprachen sprechen, zum Teil einander nicht verstehen, und mächtigen bis zu 7400 Meter hohen Gebirgsriegeln, die das Land topografisch zerschneiden. Afghanistan ist der Sammelbegriff für eine Handvoll Städte und ein Universum an Dörfern, die nur selten Kontakt zueinander haben. Afghanistan war lange das Übriggebliebene, der Rest, die Trümmerhalde zweier Großreiche, des britischen und des russischen, die hier aufeinanderstießen. Die Straße, diese Straße, sollte das ändern. Alle, die in der Vergangenheit an ihr bauten, teilten dieselbe Vision: aus Asphalt, aus Bitumen, aus Schotter eine Nation zu formen.
Große Hoffnungen legten auch die Amerikaner auf den Bau der Ring Road. Mit Asphalt wollten sie den Frieden gewinnen. US-Präsident George W.Bush, der soeben die Taliban niedergeworfen hatte, machte die Ring Road zu einer seiner Prioritäten, Nation-Building im ureigenen Sinne. Es heißt, täglich habe er sich persönlich über die Fortschritte informieren lassen. »Wo die Straßen in Afghanistan enden, beginnt die Herrschaft der Taliban«, zitierte er bei einer Rede den vormaligen US-Oberkommandierenden Karl Eikenberry. »Straßen«, erklärte Bush, »schaffen Jobs für Männer, die sonst von den Taliban rekrutiert werden. Sie fördern Handel. Straßen fördern Unternehmergeist. Unternehmergeist fördert Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was die Ideologie der Dunkelheit besiegt.«
So dachte seinerzeit auch der heutige US-Präsident und damalige Senator Joe Biden: »Wie buchstabiert man in Paschtu und Dari das Wort Hoffnung? A.S.P.H.A.L.T!«
Es kam anders. Die Straße ist bis heute unvollendet. Ihre Geschichte ist die von Korruption und Intrigen. Sie hat weder Wohlstand noch Demokratie gebracht. Wo sie gebaut wurde, war sie bald umkämpft. Der Asphalt, kaum ausgerollt, wurde zum Schlachtfeld. Die heftigsten Kämpfe des Krieges fanden entlang dieser Straße statt. Sie war als Lebensader Afghanistans gedacht und wurde zu seiner Blutspur.
Dieser Straße will ich die nächsten fünf Wochen folgen, so weit es geht. Zusammen mit meinen Begleitern plane ich, was bisher nur wenigen gelang – sie vollständig abzufahren: Die Fahrt wird mich von Kabul aus zunächst in den Osten führen, an den Grenzübergang zu Pakistan, um dann im Uhrzeigersinn der Ring Road nach Ghazni und Kandahar im Süden, nach Herat im Westen, nach Mazar-i-Sharif im Norden und schließlich über Kunduz zurück nach Kabul zu folgen. Bisher waren mir auf meinen Reisen im Land enge Grenzen gesetzt. Unmittelbar hinter dem Ortsrand von Kabul begann der Einflussbereich der Taliban, und auch innerhalb von Kabul war man gut beraten, sich nicht unnötig auf den Straßen aufzuhalten. Zu groß war das Risiko, von Banditen entführt oder ausgeraubt zu werden.
Die Absolutheit, mit der das alte Regime besiegt wurde, hat fast über Nacht eine völlig andere Situation geschaffen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten herrscht Frieden in Afghanistan. Fast überall schweigen die Waffen. Niemand hindert ausländische Journalistinnen und Journalisten am Reisen. Das Land ist im wahrsten Sinne erfahrbar geworden. Im Moment herrscht eine Schockstarre. Große Müdigkeit hat sich über das Land gelegt. Afghanistan sortiert sich neu. Koalitionen zwischen den Stämmen werden neu kalkuliert, Seilschaften im lokalen Machtgefüge neu verhandelt. Die Ruhe nach dem Sturm oder die Ruhe zwischen den Stürmen. Niemand weiß, wie lange sie anhalten wird. Diese Zeit wollen wir nutzen.
Die Reise wird für mich eine Neuerkundung Afghanistans. Sie ist für mich persönlich auch eine Art Zeitreise. Eine Reise in meine eigene Vergangenheit. Die Fahrt ist immer noch ein Wagnis, aber ein kalkulierbares, glaube ich, hoffe ich, sagt man mir. »Solange ich am Leben bin«, sagt mein Fahrer Rafik Hamadi, »musst du dir keine Sorgen machen.« In den nächsten Wochen wird er diesen Satz noch oft wiederholen.
Rafik. Er wartet mit müdem Blick vor dem Flughafen auf mich. Häufig wird er für einen Inder gehalten, mit seinem pechschwarzen Haar, dem dunklen Teint. Geboren wurde er in Dschalalabad, der einzigen Stadt Afghanistans mit tropisch-indischem Klima. Über seinem weißen traditionellen Salwar Kameez trägt er eine schwarze Winterjacke mit strahlenförmigem Kunstfellkragen. Eine große Locke fällt ihm oft ins Gesicht, die er wie eine lästige Fliege unentwegt mit einer Handbewegung verscheucht. Ende zwanzig, drei Kinder, das dritte ist vor wenigen Wochen zur Welt gekommen. Er ist ein Rassist, dem alles Fremde zutiefst unheimlich ist, ein Sexist. Mit großer Hingabe erzählt er Witze über Homosexuelle und die schiitische Volksgruppe der Hazara. Rafik mag es deftig, auch beim Essen. Er ist eitel, schnell zu kränken, nicht nachtragend und einer der liberalsten Afghanen, die ich kenne.
Mit an Bord ist Lutfullah Qasimyar, der als Übersetzer die Reise begleitet, nur ein paar Jahre jünger als Rafik, aber völlig anderer Natur. Ausnahmslos gelassen, die Ruhe selbst. Er ist der geborene Vermittler, der in den nächsten Wochen in unserem Toyota immer wieder Konflikte schlichtet. Ein bisschen sieht er sogar aus, er wird es mir verzeihen, wie ein in sich ruhender Buddha. Schon zu Republikzeiten hat er als Übersetzer für Firmen und Institute gearbeitet. Er ist tiefreligiös, verfügt über einen bewundernswerten Verstand und ein fotografisches Gedächtnis. Er kommt aus Badachschan im äußersten Nordosten, ist aber in Kabul aufgewachsen, spricht fließend Dari wie Paschtu. Seit wenigen Wochen erst ist er verheiratet, eine arrangierte Ehe wie die meisten Ehen hier. Fast stündlich ist er mit seiner jungen Frau in Kontakt. »Sorge dich nicht, mein Augenstern«, säuselt er, »es wird nichts passieren.«
Mitglied unserer kleinen Reisegemeinschaft ist auch Kaveh Rostamkhani. Er dokumentiert unsere Fahrt fotografisch.
Die Straßen Kabuls. Rafiks Revier. Exzellente Qualität. Bester Asphalt, oft vierspurig. Der pompöse Auftakt der Ring Road. Rafik kennt jede Abkürzung, nutzt jede Lücke zwischen zwei Staus, um auf fast hundert zu beschleunigen. Im Halbschlaf sehe ich auf die Stadt, die ich noch nie mochte. Wer mag schon diese Stadt? Ihre Einwohner mit Sicherheit nicht. Das Schöne, das es hier einst gegeben hatte, die Altstadthäuser mit ihren entzückenden Gärten, die vielen Bäume, die früher hier blühten, all dies fiel fast ausnahmslos den Kriegen und der Gier zum Opfer. Kabuls Architektur ist brutal.
Über die Stadtmauern, die steil in die Berghänge hineingebaut wurden, heißt es, dass sie deshalb noch stehen, weil die Knochen der Arbeiter in ihr verbaut wurden. Vor 1100 Jahren sollen der tyrannische König Zanburak und sein schrecklicher Bruder Zanbilak Kabul regiert haben. Aus Angst vor Invasionen ließen sie eine gewaltige Mauer errichten und zwangen jede Familie, mindestens einen ihrer Söhne dafür abzustellen. Arbeiter, die ihr Soll nicht erfüllten, zu schwach waren, sollen auf der Stelle hingerichtet worden sein. Die Lebenden, den eigenen Tod vor Augen, sollen gezwungen worden sein, die Toten in den Lehmwall mit einzubauen.
Kabul ist obszöne Hässlichkeit, mit dicker Schminke kaschiert. Unverputzte, billige Betonbauten mit verdreckten Blendfassaden. Die grauen Plattenbauten, die Mikrorajons, von den Sowjets in den achtziger Jahren errichtet, muten lieblich an im Vergleich zu den Apartmentblöcken, die in den letzten Jahren entstanden sind. Monströse Schlafbatterien, dreißig Stockwerke hoch, in denen kein Raum ist für Träume. Bauten der Gier, die keine Kompromisse kennen. Niederschmetternde Eintönigkeit. Kabuls beliebteste Fotomotive sind nicht grundlos Trauben bunter Luftballons, die Straßenhändler an Kinder verkaufen. Der Kitt dieser Stadt besteht aus Kot und Müll. Der Himmel über Kabul ist im Winter ein Pfropf aus klebrigem Ruß, der Auswurf Hunderttausender Hausheizungen, Gase brennenden Plastiks. Das Glück der Menschen in dieser Stadt ist das bloße Überleben.
Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert, seit die Taliban zurück sind. Kabul ist ohnehin längst am Rande der Unregierbarkeit. Sind es sechs Millionen Menschen, die hier leben, sind es zwölf? Niemand weiß es. Die Verkehrspolizisten in ihren silber-blauen Uniformen sind wieder auf den Straßen. Der Verkehr ist immer noch merklich ausgedünnt. Es gibt kaum noch jene Konvois, mit denen sich früher Politiker und Warlords durch die Stadt gezwungen haben. Nachts kontrollieren alle paar hundert Meter die Taliban, jetzt aber, am Tag, sind kaum welche zu sehen. Wir passieren den Präsidentenpalast, über dem nun die weißen Flaggen des Islamischen Emirats wehen.
Die Stadt raubt mir jede Orientierung. Das hat sie schon immer getan. Und jedes Mal wundere ich mich, warum das so ist. Ich war schon so oft hier. Die Stadt hat sich alle Horizonte einverleibt. Nach allen Richtungen greifen ihre Bauten aus Beton und Backsteinen aus. An den Ufern des gleichnamigen Flusses, der heute nur noch eine Kloake ist, der Kabul-Fluss, ein Strom aus träge dahinfließenden Exkrementen, wurde einst die Stadt errichtet. Sie wucherte in die Talgründe, wuchs um mehrere Berge herum, wuchs diese Berge hinauf, machte auch vor den steilsten Hängen nicht halt. In den vergangenen zwanzig Jahren ist die Zahl der Einwohner Afghanistans explodiert. Zahlen sind nur Schein in diesem Land, in dem es seit Menschengedenken keinen Zensus mehr gab. Dennoch: In den letzten zwei Jahrzehnten soll die Bevölkerung von 21 Millionen auf 40 Millionen gestiegen sein. Geschätzt ein Drittel davon lebt in Kabul.
Die Stadt schoss über die Fläche der Hochebenen, Dutzende Kilometer weit, und näherte sich mit großer Geschwindigkeit dem Vorgebirge des Hindukusch, als dann im Sommer 2021 der Präsident aus Kabul floh. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren erstarrte die Stadt in ihrem Wachstum. Aber das wird vermutlich nur vorübergehend sein. Je größer das Elend in diesem Land, das zeigt die Erfahrung, desto größer wird Kabul.
Wir halten vor einem Tor, das aussieht wie viele andere Tore. Eine durchschnittliche gehobene Wohngegend. Hupen. Rafik legt ungeduldig den Kopf schief. Hupen. Es ist kein Schild an dem Tor, nichts weist auf die Identität seiner Bewohner hin. Ich übernachte in den leeren Büroräumen einer kleinen Hilfsorganisation. Hotels sind mir in Kabul noch zu gefährlich. Rafik hat für die NGO als Fahrer gearbeitet. Er hupt noch einmal. Endlich öffnet jemand das Tor.
An der Tür einer dreistöckigen Betonvilla stehen sie und begrüßen mich. Der Projektleiter, der IT-Spezialist, der Koch. Sie alle kenne ich erst seit wenigen Wochen, Rafik mit eingeschlossen. Die Ankunft in der Stadt ist für mich seit dem Sturz des alten Regimes ein verstörendes Gefühl. Es ist, als würde ich zu alten Freunden nach Hause kommen und dort nur noch Fremde vorfinden.
Meine Welt aus Vertrauten und Netzwerken gibt es nicht mehr. Sie alle haben mittlerweile das Land verlassen. Mein Übersetzer, mein großer Lehrer, der für viele meiner Recherchen sein Leben riskiert, der mir so viel über das Land beigebracht hatte – in Deutschland. Viele andere – geflohen in die USA, Türkei, nach Australien, Indien. Amdadullah Hamdard, mein Freund und Mitarbeiter – nur Tage vor dem Kriegsende erschossen.
Kabuls Geister. Meine Geister. Ich jage ihre Schatten. Die Stadt ist voll von ihnen. Ich sehe sie an den vertrauten Orten, den Restaurants, Cafés und Gärten. Es war alles erst gestern.
Das Haus des afghanischen Journalisten, in dem ich immer wohnte, wenn ich in der Stadt war, das in den letzten Jahren Ausgangspunkt fast aller meiner Reisen durch Afghanistan gewesen ist. Sein Schreibtisch steht noch in seinem Büro, sein Stuhl dahinter. Die Bücher sind in den Regalen, viele englischsprachige. Wenige hatte er gelesen, aber die Bücher machten sich gut als Hintergrund für seine Live-Schalten. In den letzten Monaten gab er Interviews im Viertelstundentakt, für TV-Kanäle in aller Welt.
Es ist, als wäre er gerade erst gegangen. In dem Haus leben noch zwei seiner Brüder, auch sie warten auf die Ausreise. Der eine, der jüngere, immer schon ein Verlorener, ist dem Alkohol verfallen. Er hält die Angst nicht mehr aus, die zermürbende Untätigkeit. Der ältere hat bei einer NGO gearbeitet, die wie fast alle ihre Projekte eingestellt hat. Ihnen geht das Geld aus. Sie wohnen im früher liberalsten Viertel von Kabul, die letzte Zuflucht letzter Freigeister, aber nur selten verlassen sie das Haus, aus Furcht, an einem Kontrollpunkt der Taliban festgehalten zu werden. In einen Checkpoint zu geraten, an dem man sie als Brüder des berühmten Journalisten erkennt. Was sehr unwahrscheinlich ist. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, und warum ein Risiko eingehen? Ihr berühmter Bruder lebt mittlerweile in einer Provinzstadt in Kanada und richtet sich ein neues Büro ein, wieder für Live-Schalten über Afghanistan, die allerdings kaum noch jemanden interessieren.
Das Haus, das für mich immer für Offenheit stand, wurde für seine letzten Bewohner zu einem Gefängnis.
Ich fahre mit Rafik weiter durch Kabul, weiter durch meine Welt der Schatten. Ein moderner Bungalow in einem der besten Wohnviertel der Stadt. Es ist das Haus eines afghanischen Diplomaten. Er lebt mittlerweile im Exil in Deutschland. Vor meiner Abreise bat er mich, bei ihm zuhause in Kabul vorbeizuschauen. Ich solle einige persönliche Erinnerungsstücke für ihn mitnehmen und überprüfen, ob das Haus in einem gepflegten Zustand ist. Das treibt ihn um in der Ferne, das ist ihm wichtig.
Der langjährige Diener des Diplomaten macht mir auf, mein Besuch ist angekündigt. Er schaut am Metalltor nach links und rechts und lässt mich ein.
Viele Abende habe ich hier verbracht. Ich sehe vor dem Haus die Terrasse, auf der fast jeden Abend ein Buffet angerichtet war. Es gab Weißwein und Rotwein und Scotch. Der Diplomat liebte seine Abendrunden, liebte es, im Mittelpunkt zu stehen, lud Menschen unterschiedlicher Meinung ein, reiche Unternehmer, Minister, Dichter, Militärführer, afghanische Geheimdienstleute, die in seiner Nachbarschaft wohnten. Viel gestritten wurde an diesen Abenden, manchmal geschrien. Voll Zorn haben sich die Diskutanten gelegentlich verabschiedet, aber sie sind immer wiedergekommen.
Welkes Laub liegt jetzt auf der Terrasse. Ich trete ins Wohnzimmer, amerikanischer Stil, Sofas und Sessel. Die Wände waren früher behängt mit vielen gold- und silbergerahmten Fotografien, in ihrer Anordnung sorgsamst arrangiert, Lebensstationen, Belege der Bedeutung des Diplomaten. Die Wände sind leer.
Nur einige kalligrafische Kunst ist geblieben, unfigürliche Darstellungen, die die Taliban tolerieren. »Ich habe sie alle sicher verwahrt«, sagt der Diener. Er bittet mich zu warten, verlässt das Zimmer, will mir unbedingt die Fotografien zeigen. Dann kommt er zurück, mit einem ganzen Stapel von ihnen. Er breitet sie auf dem Boden aus. Der Diplomat mit Angela Merkel. Er mit Steinmeier. Der Diplomat mit George W. Bush. Er mit gewesenen und gegenwärtigen Präsidenten. »Bitte sage dem Herrn, dass ich mich gut kümmere«, trägt er mir auf.
Er legt Goldrahmen auf Goldrahmen, Glas knirscht auf Glas, einige haben schon Risse, aber es gibt sie noch.
Alle Häuser in der Straße, die in der alten Zeit ausschließlich der Regierungselite vorbehalten war, seien seit der Wende von Taliban-Kommandeuren bezogen worden. Nur dieses eine Haus nicht, so erklärt mir der Diener stolz. Auch hier seien sie zunächst eingezogen, aber dann sei er – ein Trick! –, der getreue Diener, mit seiner Familie und der seines Bruders eingezogen und habe erklärt, das Haus werde von seiner Familie privat genutzt. Daraufhin seien die Taliban gegangen. Sie besetzten nur Regierungseigentum. Aber, gelegentlich, alle paar Wochen, übernachteten noch einige von ihnen hier. Deshalb hütet er die Präsidenten.
»Kommen Sie, kommen Sie!«, drängt er mich, ihm ins obere Stockwerk zu folgen, ins Schlafzimmer des Diplomaten. Er zeigt mir die Schuhe, die er frisch gewienert hat, die Anzüge, die mit Plastiküberzügen fein säuberlich im Schrank hängen. Es ist alles bereitet für die Wiederkehr seines Herrn.
Noch bekommt er seinen Lohn aus Deutschland überwiesen, aber es ist unklar, wie lange. »Ich weiß nicht, wie es weitergeht für mich. Aber ich kann doch dieses Haus nicht verlassen«, sagt er. »Wer sorgt dann für dieses Haus?« Er hat für seinen Herrn einen Koffer gepackt, den er mir anvertraut. Anzüge, Schuhe, Nüsse. Die Süßigkeiten aus der Lieblingsbäckerei des Diplomaten. Er lädt mich ein, zu verweilen, zu Tee und Gebäck, wie zu früheren Zeiten, ich nehme an, aus Höflichkeit. Ich nippe, ich nehme ein, zwei Bissen, dann drängt es mich hinaus, weg von diesem Ort der Traurigkeit und vertanen Hoffnung. An der Tür, bevor er sie schließt, sieht der Diener wieder nach links und rechts. »Sagen Sie meinem Herrn, wie gut ich mich kümmere.«
Auf der Straße stehen Taliban.
An vielen Häusern, in denen ich oft zu Gast war, fahre ich nur vorbei; es gibt dort niemanden mehr zu besuchen. Ich erhasche kurze, fast verstohlene Blicke. Die Häuser sind leer und verlassen. Womöglich sind Verwandte vom Dorf oder Nachbarn eingezogen. Ich esse in den vertrauten Restaurants, trinke Kaffee in den alten Cafés. Sie sind halb verwaist. Ich sehe keine bekannten Gesichter mehr, auf die ich hier früher unweigerlich gestoßen wäre. In einer Cafeteria, einem dieser Orte, dann plötzlich Ahmad, der Musiker. Ich freue mich. »Ahmad, Ahmad!«, sage ich. Die Taliban, flüstert er, haben sein Musikstudio gestürmt, die Instrumente zerstört. Er wirkt wie unter Drogen, vermutlich hat er kurz zuvor etwas genommen.
»Hilf mir«, sagt er. »Hol mich hier raus.«
Ein leerer Lesesaal der Kabul University, 2021. Foto: Kaveh Rostamkhani.
Kilometer 5
Kabul
Wo die Stürme ihren Anfang nehmen
Für die nächsten insgesamt 3300 Kilometer ist ein Toyota Corolla, Baujahr 2006, weiß lackiert, Automatik, unser Zuhause. Rafik, der sich kein eigenes Auto leisten kann, hat ihn sich von einem Freund geliehen. Beide sind sich sicher, dass er die Strecke meistern wird. Bremsen neu, Stoßdämpfer neu, Wagenheber an Bord, Reservereifen, sogar eine »Air machine« ist mit dabei, Lutfullah hat sie beigesteuert, ein praktischer Wunderapparat, der immer wieder den Reifendruck stabilisiert. Wir werden ihn brauchen, und nicht nur ein Mal.
Die Fahrt zu unserem ersten Ziel ist kurz und komfortabel, eine halbe Stunde nur. Wir fahren dorthin, wo fast alle Modernisierungsversuche der jüngeren Geschichte Afghanistans ihren Ausgang genommen haben, zur Kabul University, auf der anderen Seite der Stadt, im Südwesten gelegen. Die älteste Universität des Landes, gegründet in den fünfziger Jahren. Für mich ein magischer Ort. In Rom ist es für mich der Vatikan, in Istanbul die Hagia Sophia, in Kabul ist es die Kabul University.
Sie ist nicht einfach nur eine Lehranstalt. Sie ist das geistige Zentrum Afghanistans, die Mutter von fast allem. Die meisten gesellschaftlichen Bewegungen der jüngeren Geschichte des Landes hatten hier ihren Ursprung. Nahezu alle politischen Umwälzungen gingen von hier aus. Eine Universität, geschaffen, um aus den vielen Völkern Afghanistans eine Nation zu formen, Alma Mater, übergroß.
Ich frage mich, wie die Universität die ersten Monate der Taliban-Herrschaft überstanden hat. Noch ist unklar, wie viel Wissen sie diesem Land zugestehen werden. Wollen sie Afghanistan wirklich wieder in die Steinzeit zurückführen? Welche Wissenschaften werden verboten? Und welche Horizonte bleiben den Afghaninnen und Afghanen in der Zukunft noch zugänglich?
Vor drei Monaten war ich das letzte Mal hier, nur Tage nach dem Sturz des alten Regimes. Ich wurde auf dem Campus Zeuge eines allmählichen Machtwechsels, unsicher, fast tastend vollzogen. Der alte Kanzler war noch in seinem Amt, noch gab es keinen neuen.
»Leere lange Wege führen über den Campus zum Büro des Kanzlers. Alleen mit Kiefern, die sanft im Wind schaukeln.« So beginnen meine Notizen von damals. Der Übersetzer, mit dem ich auf jener Reise zusammengearbeitet hatte, ist mittlerweile nach Pakistan geflohen. Taliban haben ihn vor seinem Haus in Kabul zusammengeschlagen.
***
August 2021
Der Kanzler, sehr dünn geworden, sitzt in seinem Büro. Mit krummem Rücken wartet er in seinem Sessel, übernächtigt und unrasiert. Nur noch selten verlässt er tagsüber diesen Raum, und nur noch wenige besuchen ihn hier. Bis vor Kurzem galt es als Ehre, zu ihm vorgelassen zu werden. Jetzt haben die meisten Angst, mit ihm, dem Kanzler, gesehen zu werden. Als wir eintreten, wartet er, bis die Tür zum Vorzimmer ins Schloss gefallen ist. Stockend beginnt er zu reden. Er spricht von »unglücklichen Entwicklungen«, sucht nach den richtigen Worten. Oft gibt er es auf. Dann bricht er die Sätze ab, verstummt und lächelt ein papierdünnes Lächeln. Professor Dr.Mohammad Osman Babury, 1962 in Herat geboren, ist Kanzler der Universität, und in diesen Wochen ist er ihr Gefangener.
Er wisse nicht, was jetzt passiert, mit dem Land, mit ihm, sagt der Kanzler in seinem Amtszimmer. Niemand habe mit alldem gerechnet. Noch vor wenigen Jahren residierte in diesem Büro Aschraf Ghani, der für einige Zeit Kanzler war, dann afghanischer Präsident wurde. Babury dreht immer wieder seinen Kopf zur Tür, um zu sehen, ob sie sich nicht einen Spalt weit geöffnet hat.
Nur ein Vorzimmer von ihm entfernt, auf der gegenüberliegenden Flurseite, ist vor wenigen Tagen der neue Sondergesandte der Taliban-Regierung eingezogen. Mohammed Aschraf Ghairat ist erst Anfang dreißig, ein Mann mit zauseligem Bart, tief liegenden ernsten Augen und der Gebetskappe des frommen Gläubigen. Ein Mullah. Bisher war er im Untergrund Mitglied eines Bildungskomitees der Taliban. »Diese Universität ist zu einem Hort der Sünde verkommen«, verkündet er in diesen Tagen wiederholt der Öffentlichkeit.
»Ich hoffe«, sagt Babury, der alte Kanzler, ein gelernter Pharmakologe, »dass es gelingt, die Fortschritte zu retten, die wir beim Aufbau dieser Universität gemacht haben. Ich werbe bei den Dozenten um Geduld und bei den Taliban um Verständnis. Wir dürfen die Universität nicht verlieren.«
Wenige Tage nach der Machtergreifung der Taliban war Mohammed Aschraf Ghairat vor dem Tor der Universität erschienen, in der Hand eine abgenutzte braune Aktentasche. Er stellte sich als Sonderbeauftragter der neuen Regierung vor und zog in das Büro von Baburys Assistenten. Kaum jemand auf dem Campus kannte bis dahin seinen Namen, nur wenige konnten sich an ihn erinnern, doch für Ghairat war es eine Wiederkehr. Als junger Mann hatte er bis 2008 an der Kabul University Journalismus studiert, dann schloss er sich den Taliban an und ging in den Untergrund, aus dem er nun, nach dreizehn Jahren, zurückgekehrt ist.
»Vor mir muss niemand Angst haben«, sagt Ghairat im Büro des Assistenten, der ins Ausland geflohen ist. Er spricht leise und sanft, wie es sich für einen Mullah geziemt. Ein Leibwächter mit Pistolenhalfter sitzt neben ihm auf dem Teppichboden. Er sei nicht hierhergekommen, um etwas zu zerstören, sagt der junge Sonderbeauftragte. Er wolle aufbauen, die Fortschritte erhalten, die die Universität in den vergangenen Jahren gemacht habe. »Wir wollen alle internationalen Kooperationen weiterführen«, sagt er. »Natürlich, die Welt ist heute ein globales Dorf.« Ghairat spricht davon, die Universität zu einem »Zentrum der Innovation« zu machen. Er weiß, welchen Wohlklang solche Wörter im Westen haben.
Über sich selbst gibt Ghairat wenig Auskunft. Er scheint im Geiste immer noch der Untergrundaktivist zu sein, der er bis vor wenigen Wochen war. Der Sieg der Taliban, das merkt man jeder seiner Gesten an, war auch sein Sieg. »Keine Angst«, wiederholt er immer wieder. Er sei vom neuen Bildungsminister entsandt, um zu untersuchen, wie die Universität im Sinne des Islams reformiert werden könne. Er habe in diesen ersten Tagen zwei Prioritäten. Das Plündern zu verhindern. Das sei gelungen. Und die Unzucht zu unterbinden. Das Campusleben müsse so umorganisiert werden, dass sich Frauen und Männer nicht länger begegneten. Dafür werde er demnächst neue Verhaltensregeln verkünden.
Er öffnet seine Aktentasche und zieht ein Bündel Papiere heraus. Die Fahrpläne von elf neuen Buslinien, mit denen Studentinnen aus allen Teilen Kabuls zu ihren Vorlesungen transportiert werden sollen. Allerdings wisse er noch nicht, woher er das Geld für die Busse nehmen soll. »Ich habe die Fahrpläne durchgerechnet«, sagt Ghairat und fährt die Tabellen mit dem Finger ab, Distrikt 4, Distrikt 7, man merkt ihm den Stolz an. Er wirkt wie ein ausgezehrter Musterschüler, ehrlich bemüht und mit aller Kraft auf das Ziel konzentriert. Nur, fragen sich Tausende Studierende und Hunderte Lehrende, was ist das Ziel?
Die Revolution verliert ihren Schrecken, sie tarnt sich als bürokratischer Akt. Er sei nur Berater, betont Ghairat. Er entscheide nicht, Kanzler Babury bleibe das Oberhaupt. Mit ihm sitze er oft zusammen und diskutiere die Zukunft der Universität. Ghairat weiß, dass zwar Kabul gewonnen ist, aber noch nicht diese Hochschule.
Die Universität ist sehr jung. Nur zaghaft waren die Könige an die Gründung einer Hochschule gegangen. Jahrhundertelang hatte sich in den abgelegenen Gebirgstälern kaum ein Staatsapparat herausgebildet. Es gab nur wenige Beamte. Die Herrscher kontrollierten die Städte, die Dörfer und die Provinzen blieben sich selbst überlassen. Nur vier höhere Schulen waren im Land bis Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, und sie wurden von den Menschen mit Misstrauen aufgenommen. Schon damals: Welche Fragen darf der Mensch stellen, ohne vom Glauben abzukommen? Ist Wissen, das nicht im Koran steht, nicht automatisch Blasphemie?
Erst 1932 öffnete in Kabul eine medizinische Fakultät ihre Tore. 1938 folgte die Fakultät für Rechtswissenschaft. In den sechziger Jahren wurden dann die über die Stadt verteilten Seminare zu einem Campus zusammengefasst. Die USA gaben das Geld, eine deutsche Firma baute. Die Universität orientierte sich zunächst streng nach dem Westen. Bärte waren verboten, traditionelle Tracht wurde als rückständig verpönt. Die Seminarzeiten nahmen keine Rücksicht auf Ramadan und Gebetszeiten. Binnen weniger Jahre sollte die neue Hochschule das leisten, was jahrhundertelang versäumt worden war. Die Schaffung eines Beamtenstandes, einer gebildeten Mittelschicht.
Zum ersten Mal in der Geschichte Afghanistans gab es einen Ort, an dem junge Männer, bald auch junge Frauen, aus den Provinzen des Landes mit ihren unterschiedlichen Kulturen zusammenkamen. Paschtunen und Tadschiken, Hazara, Usbeken und Turkmenen. Sunniten und Schiiten. Fast ausschließlich Söhne und Töchter der Elite, der Großgrundbesitzer. Doch auch sie hatten bisher kaum mehr als ihre Dörfer gekannt. Der neue Campus war für sie beides: die Befreiung aus der Gedankenwelt ihrer Vorväter und eine Bedrohung all dessen, was ihre Welt bisher zusammengehalten hatte.
Die Universität, so das Kalkül des Königs in den sechziger Jahren, sollte sein Land davor bewahren, zwischen den Nachbarstaaten zerrieben zu werden. Doch das Kalkül ging nicht auf. Tatsächlich beschleunigte der neue Campus die Spaltung Afghanistans.
Während das Leben in den Dörfern unberührt weiterging, im gleichbleibenden Takt jahrhundertealter Traditionen, wurde die Kabul University zu einem Druckkessel der Moderne. Die kommunistische Bewegung erhielt unter den Studentinnen und Studenten immer mehr Zulauf. Soziale Gerechtigkeit forderten sie und endlich eine demokratische Verfassung. Es gab ein Parlament, doch das Parlament war machtlos. Die Zeit der Unruhen brach an, immer wieder schloss die Regierung den Campus für Wochen. Fast alle Präsidenten der späteren kommunistischen Regime studierten an der Kabul University.
Der Aufstieg der Kommunisten brachte eine ebenso radikale Gegenbewegung hervor. Im April 1969 gründeten acht Studenten die Muslimische Jugend, inspiriert durch einen Professor, Ghulam Mohammed Niazi, der in Ägypten studiert und dort die Muslimbrüder kennengelernt hatte. Sie stemmten sich gegen die Dominanz des Westens und predigten, der Islam sei mehr als eine Privatsache. Beseelt von diesen Eindrücken, lehrte der Professor Niazi nun an der neuen Scharia-Fakultät, dem Institut für islamisches Recht. Der ägyptische Staat hatte die Patenschaft für den Aufbau der Fakultät übernommen: ein zweistöckiges Gebäude mit lichten Fensterreihen ganz am Rand des Campus. Über diese Seminarräume gelangte der politische Islam nach Afghanistan.
An der Kabul University bildeten die Aktivisten der Muslimischen Jugend zunächst eine Art Schutzgemeinschaft. Sie wollten der Leugnung Gottes durch die Kommunisten etwas entgegenstellen. Ihre erste Tat war die Einrichtung eines Gebetsraums; bis dahin hatte es auf dem Campus keinen gegeben. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte ein Student, der sich kurz zuvor in die Fakultät für Ingenieurwissenschaften eingeschrieben hatte: Gulbuddin Hekmatjar. Zwanzig Jahre später wird er sich den Beinamen »Der Schlächter von Kabul« erwerben. Dreißig Jahre später wird er Osama bin Laden und al-Qaida nach Afghanistan einladen.
Bald konkurrierten die beiden Bewegungen auf dem Campus um Einfluss. Mit Knüppeln und Messern gingen Kommunisten und Islamisten aufeinander los. Wie schreckliche Zwillinge. Sie wuchsen an der Angst vor dem jeweils anderen. Auf dem Gelände der Universität von Kabul wurde schon der Bürgerkrieg geprobt.
Die Hardliner unter den Kommunisten putschten sich 1978 an die Macht, die Khalqis, die aus allen Afghanen im Schockverfahren Atheisten machen wollten. Im Land der Koranschulen verboten sie die Religion per Gesetz. Viele auf der Universität begrüßten zunächst den Umsturz, vorbei die Zeit der Stagnation. Doch die neuen Machthaber, selbst Verschwörer, witterten überall Verschwörungen.
Der Campus wurde zu einem Ort der Angst. In den Seminaren fanden Säuberungen statt. Oft wurden Studierende und Lehrende aus dem Unterricht heraus verhaftet. Die, die später freigelassen wurden, berichteten von Folterungen und Vergewaltigungen. Zehntausende Menschen verschwanden während der Herrschaft der Hardliner. Der erste kommunistische Präsident: im Gefängnis mit einem Kissen erstickt. Der zweite Präsident: vergiftet. Provoziert durch den radikalen Kurs, erhoben sich Teile der Landbevölkerung. Die konservativen Dorfbewohner, die nun zu den Waffen griffen, nannten sich »Mudschahedin«: Glaubenskämpfer.
Im Dezember 1979 wurden auch die kommunistischen Hardliner gestürzt. Um dem Chaos ein Ende zu bereiten und um Afghanistan unter ihre Kontrolle zu bringen, marschierten sowjetische Truppen ein. Als Herrscher installierten sie einen Gemäßigten, Babrak Karmal. Er ließ, so wird vermutet, den Kanzler der Universität vergiften, weil der dem Flügel der Hardliner angehörte. Die Zahl der Verhaftungen aber auf dem Campus ging zurück. Die Universität wurde nun nach sowjetischem Vorbild umgebaut. Die Lehrenden aus dem Westen wurden durch Professoren aus dem Ostblock ersetzt. Marxismus wurde zum Pflichtfach.
Mit der Freiheit, die ihr die Kommunisten nahmen, verlor die Universität in den achtziger Jahren ihre Bedeutung. Die intellektuellen Diskurse Afghanistans fanden fortan im Exil statt, im Iran, in Pakistan, in Europa. Der Anteil der Studentinnen stieg auf vierzig Prozent, allerdings nur weil große Teile der männlichen Jahrgänge für das Militär zwangsrekrutiert wurden. Am Ende des kommunistischen Regimes, das Land nach dem Abzug der sowjetischen Truppen in Trümmern, ein Großteil der Bevölkerung auf der Flucht, verfolgte Präsident Mohammed Nadjibullah einen versöhnlicheren Kurs. Er nahm den Dialog mit den Gegnern auf, ließ auch auf dem Campus Kritik zu. Doch da war es zu spät. Mit großer Wucht kam Anfang der neunziger Jahre der Krieg über Kabul und über die Universität.
Der Campus wurde zum Schlachtfeld, buchstäblich. Die Front verlief quer durch die Kabul University. Nach dem Sturz der Kommunisten bekämpften sich zwei Mudschahedin-Fraktionen auf dem Gelände der Universität, die Hizb-i-Wahdat, die Einheitspartei, ein Bündnis der schiitischen Hazara, und die Jamiat-i-Islami, die Islamische Vereinigung, die vorwiegend aus sunnitischen Tadschiken bestand. Zwischen den Gebäuden wurden Schützengräben und Tunnel ausgehoben. Es wurden Sperrgürtel aus Minen gegraben. Die Universitätsbibliothek mit ihren damals 175000 Büchern wurde gebrandschatzt.
Währenddessen rückten seit 1994 Kämpfer der neu gegründeten Taliban – Paschtunen, Sunniten – immer dichter an Kabul heran. Als sie dann 1996 die Hauptstadt einnahmen, war von der Universität nicht viel mehr als ein Ruinenfeld geblieben. Wenige hundert Studenten kehrten hierher zurück. Frauen wurde das Studium untersagt. Forschung und Lehre waren extrem limitiert. Aus den Lehrbüchern der medizinischen Fakultät wurden die Darstellungen menschlicher Körper gerissen, weil sie angeblich dem Koran widersprachen. Die Mullahs führten Koranunterricht für jeden Studenten ein. Der umfasste anfänglich ein, zwei Stunden und in den letzten Jahren ihrer Herrschaft oft den ganzen Vorlesungstag.
2001 dann der Sturz der Taliban, noch einmal Hoffnung! Noch einmal wird die Universität mit internationaler Hilfe aufgebaut, noch einmal soll sie das Land in die Zukunft führen. Viele Absolventen kamen aus dem Exil zurück, um beim Aufbau der Uni zu helfen. Es kamen internationale Dozenten, es flossen Gelder aus vielen Ländern, weil sie alle an die Zukunft glaubten.
Die Zukunft heute: Mohammed Aschraf Ghairat.
In der dritten Woche nach seiner Ankunft lässt er im September 2021 das neue Regelwerk in den Fakultäten aushängen.
Alle Frauen auf dem Universitätsgelände sind angehalten, den Hidschab zu tragen. Tragen sie ihn nicht, haben sie nicht die Erlaubnis, das Universitätsgelände zu betreten.
Fakultäten, in denen der Frauenanteil weniger als zwanzig Prozent beträgt, sollten die Frauen in eine verwandte Fakultät überstellen – falls möglich.
Ist das Zahlenverhältnis von Männern und Frauen ungefähr gleich, müssen in den Unterrichtsräumen Trennwände zwischen den Geschlechtern aufgestellt werden. Im rückwärtigen Bereich haben die Frauen Platz zu nehmen, im vorderen Bereich die Männer. Die Frauen sollten zehn Minuten vor den Männern in den Raum geführt werden. Am Unterrichtsende verlassen die Männer den Raum zuerst.
In Fakultäten, in denen der Frauenanteil mehr als zwanzig Prozent beträgt, aber weniger als fünfzig Prozent, soll in unterschiedlichen Räumen nach Geschlechtern getrennt unterrichtet werden.
In Fakultäten, in denen der Frauenanteil mehr als fünfzig Prozent beträgt, aber weniger als siebzig Prozent, sollten die Trennwände auf der Längsachse des Raumes aufgestellt werden.
In Fakultäten, in denen der Frauenanteil mehr als siebzig Prozent beträgt, kann nach den bisherigen Regeln unterrichtet werden.
Auf dem gesamten Gelände müssen Frauen und Männer so viel Distanz wie möglich zueinander halten. Sollte beobachtet werden, dass eine illegale Beziehung zwischen Personen vorliegt, sind die Sicherheitskräfte verpflichtet, diese den Justizbehörden zu überstellen.
Die Universität sei für Frauen ein Ort des Grauens gewesen, begründet Ghairat die Maßnahmen. Es geschehe alles nur zum Schutz der Frauen. So viele Studentinnen seien in der Vergangenheit Opfer von sexuellen Übergriffen geworden, Vergewaltigungen und Missbrauch – womit er recht hat. Die Konsequenz, die die Taliban daraus ziehen, ist, den Frauen den Universitätsbesuch in der Praxis ganz zu verwehren. Die Maßnahmen auf Ghairats Liste sind zunächst nicht zu realisieren. Wäre die Universität geöffnet, was sie nicht ist, wären Frauen zugelassen, was sie nicht sind, gäbe es ohnehin nur wenige, die an den Seminaren teilnehmen würden. Fast alle Studentinnen sind eingeschüchtert.
Wenn Mohammed Aschraf Ghairat in diesen Tagen in seinem Assistentenbüro Besucher empfängt, wenn er mit Dozenten redet oder mit dem Gärtner, der mit ihm Bewässerungsprobleme besprechen will, mit Unternehmern, die den Campus beliefert haben und jetzt wissen wollen, ob die Universität ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann – dann fragt er immer wieder: »Was denken Sie über die Fakultät der Künste? Wie ist Ihre Meinung dazu? Brauchen wir sie?«
Ein großes Vorhängeschloss versperrt das Tor der Fakultät. Im Unterschied zu anderen Fakultäten, wo nach einem Aufruf von Ghairat wenigstens einige Dozenten in ihre Büros zurückgekehrt sind, ist diese völlig verlassen. Der neue Paria auf dem Campus. Die meisten Menschen, die hier lehrten und lernten, 1230 Studierende und 56 Lehrende, verstecken sich seit dem Einmarsch der Taliban. In einem Restaurant, weit weg von der Universität, treffen wir den Dekan der Fakultät.
Er hat versucht, sich zu verkleiden, ein Tuch um seinen Kopf gespannt, eine Sonnenbrille aufgesetzt. Seine Hände zittern. Er muss sie ineinander verschränken, um das Zittern zu beherrschen.
»Sie nennen uns ›Haus der Tänzerinnen‹. Nicht nur die Taliban. Ganz normale Leute in Kabul. Die Vorurteile sitzen tief. Mit Tanzen meinen sie die Schauspielerei. Die ist für sie wie Prostitution. Auch früher gab es schon Spannungen zwischen unseren Studenten und denen anderer Fakultäten. Die haben sich oft mit den unseren geprügelt.
Am Tag, als die Taliban nach Kabul kamen, saß ich in meinem Büro, mit einem ehemaligen Minister. Wir wollten ein großes Festival vorbesprechen, aber dann klingelte das Telefon des früheren Ministers. ›Die Taliban greifen die Stadt an‹, sagte er mir entsetzt. Der war auch völlig überrascht. Ich habe dann alle Seminare informiert und alle nach Hause geschickt. Mit zwei Wächtern habe ich den ganzen Tag lang versucht, unsere Kunst zu retten. Wir haben alle Werke abgehängt, die Gesichter zeigen. 200 Gemälde und Zeichnungen! Wir haben alle Skulpturen in Decken eingerollt. Wir haben alles auf sieben Verstecke aufgeteilt. Wenn die Taliban jetzt eines davon finden, sind die anderen sechs immer noch geschützt.
Vor ein paar Tagen hat ein Kollege versucht, eine Büste vom Campus zu schaffen. Er hat den Taliban-Wächtern am Tor gesagt, dass die Büste seinen Kopf darstellt und dass seine Studenten sie ihm als Geschenk gegeben haben. Ein Talib hat ihm geantwortet: ›Erst hältst du deine Studenten an, eine Sünde zu begehen und diese Figur zu erschaffen – und jetzt willst du eine zweite Sünde begehen und sie mit nach Hause nehmen?‹ Sie sagten ihm, er dürfe die Büste erst mit nach draußen nehmen, wenn sie sie in tausend Stücke geschlagen hätten.
Ich habe im August mit meiner Familie vier Tage und vier Nächte lang versucht, die Evakuierungsflüge am Flughafen zu erreichen. Stundenlang standen wir im Wassergraben, dann wurde meine kleinste Tochter krank, und wir sind nach Hause gegangen. Sie ist erst sechs. Sie hat uns alle gerettet. Denn am nächsten Tag ist dort, wo wir gewartet hatten, eine Bombe explodiert.
Meine Frau ist psychisch stark angeschlagen. Jedes Mal, wenn es an unserer Tür klopft, zucken wir zusammen, dann denken wir, sie sind es, sie holen mich ab. Sie suchen nach mir, das weiß ich von Bekannten. Wir haben in der Fakultät auch Filme gedreht, die die afghanische Armee unterstützen. Glaubst du, die werden mich am Leben lassen? Sie werden sich an uns rächen.«
Am 20.September, einem Montag, betritt der alte Kanzler zum letzten Mal sein Büro. Der Sonderbeauftragte Ghairat verkündet es über die sozialen Medien. Professor Babury ziehe sich zurück, heißt es in der Meldung. Das Bildungsministerium ernenne stattdessen einen neuen Kanzler: ihn, Mohammed Aschraf Ghairat. Die Presse ist nicht anwesend, sie wurde nicht vorab informiert. Das offizielle Foto von der Amtsübergabe, das die Taliban anschließend in Umlauf bringen, zeigt Ghairat bereits hinter dem Schreibtisch des Kanzlers, wie er Babury strahlend die Hand reicht. Er sitzt. Babury steht und muss sich zu ihm hinunterbeugen. Ein ehrloser Abschied. Ein letzter Akt der Unterwerfung.
Doch damit beginnen für Ghairat die Probleme. So heiter wie auf diesem Bild wird man ihn lange nicht mehr sehen.
Hohn ergießt sich aus unzähligen Twitter-Kanälen über den neuen Kanzler. »Lieber arbeite ich unter einem Esel als unter ihm!«, textet ein Dozent. Professoren drohen mit ihrem Rücktritt, sollte das Bildungsministerium die Ernennung nicht binnen einer Woche widerrufen. Die Taliban haben die Institution gedemütigt, indem sie einen Mann mit einfachem Bachelorabschluss zum Kanzler machten. Noch ist die Universität nicht gleichgeschaltet, noch gibt es Widerstand.
»Ich habe mich über viele Jahre auf diesen Posten vorbereitet!«, sagt Ghairat bei unserem zweiten Gespräch. Er ist angespannter als beim ersten Treffen. Er muss Sorge haben, dass der Protest von außen bei den Taliban Eindruck macht und seine Position gefährdet. »Ich sage unseren Kritikern: Lasst uns erst mal arbeiten.« Er wolle die Lehre praxisnäher gestalten. Viele Studiengänge seien früher zu theorielastig gewesen. »Wir müssen jetzt schauen, was wird zum Aufbau des Landes gebraucht?«
Alle Fakultäten wolle er nach diesem Prinzip durchforsten. Die angehenden Ingenieure etwa, die bisher fast nur an Computern gesessen hätten, sollten einen Teil ihrer Ausbildung auf Baustellen absolvieren. Der Umbau der Hochschule zur Berufsschule. Das hatten die Taliban schon während ihrer ersten Regierungszeit in den neunziger Jahren propagiert.
»Ihr müsst jetzt gehen«, sagt Ghairat zu mir, dem Reporter. »Ihr haltet mich auf. Ihr habt zu viel meiner Zeit verbraucht. Sogar fünf Minuten davon sind kostbar.« Anschließend, da haben wir bereits sein Büro verlassen, erteilt er uns per Whatsapp Campusverbot. Bis auf Weiteres. Er untersagt uns auch den Besuch der mit deutschen Entwicklungsgeldern geförderten Bibliothek. So ergeht es allen Journalisten. Die Kabul University wird Sperrgebiet.
Der Propagandakrieg in den sozialen Medien droht den neu ernannten Kanzler zu verschlingen. Die Welle der Aufregung scheint ihn zu überraschen. Auf einem alten Facebook-Profil soll er ein Jahr zuvor zur Ermordung von Journalisten aufgerufen haben. Ghairat dementiert das. Er eröffnet seinen eigenen Twitter-Account, wehrt sich. »Beruhigt euch!«, schreibt er dort. Er habe zwar nur einen Bachelor, dafür aber Erfahrung in den Untergrund-Ausschüssen der Taliban. Seine Kompetenz sei real erworben, im Unterschied zu den vielen, die sich unter dem alten Regime akademische Würden nur erkauft hätten.
Es mehren sich Gerüchte, dass die Taliban-Führung Ghairat ablösen will, es kursieren diverse Namen für seine Nachfolge. Noch einmal treffen wir ihn, bevor wir Kabul verlassen. Er gestattet uns ein letztes Gespräch. Umgeben von den Insignien akademischer Macht empfängt er uns diesmal im Büro des alten Kanzlers, der mittlerweile nach Deutschland geflohen ist. Er hat die dunkle Kleidung abgelegt, die er bei unseren ersten beiden Begegnungen trug, und trägt nur noch Weiß, die Farbe der Würde. Doch machtvoller wirkt er keineswegs. Da ist kein Triumph mehr in seinen Augen, kein Sendungsbewusstsein. Er ist kein Jäger mehr, er ist ein Gejagter.
Ghairat atmet schwer, sieht zu Boden, knetet die Hände. »Die Menschen überschütten mich mit Vorwürfen und Lügen.« Ehemalige Studienkollegen, die im Ausland leben, bezichtigen ihn, ein durchschnittlicher Student und übergriffig gegenüber Frauen gewesen zu sein. »Das sind keine Patrioten«, sagt er. »Das sind Feinde unseres Landes und dieser Universität.« Der Krieg der Hacker tobe, und er könne nichts dagegen tun. Auf Twitter tragen mehrere Konten seinen Namen. Sie seien fast alle fake, sagt Ghairat.
Warum er nicht eine Pressekonferenz abhalte, nicht direkt zur Öffentlichkeit spreche, frage ich ihn. »Die glauben mir ja nicht. Die glauben mir erst, wenn sie sehen, wie ich arbeite.« Er öffnet die abgetragene Aktentasche, die er stets bei sich trägt, fingert Dokumente heraus, einige flattern auf den Boden. Pläne für die Zukunft der Universität, die angeblich schon sein Vorgänger entwickelt hat und die er, Ghairat, jetzt umsetzen wolle. Er möchte nicht mehr fotografiert werden, aus Angst davor, dass man das Foto im Internet manipuliert.
Immer noch finden keine Seminare statt, immer noch ist der Campus draußen vor Ghairats Büro nahezu leer. Die Verhandlungen mit dem Finanzministerium der Taliban verlaufen schleppend, klagt er. Immer noch seien die Gehälter der Lehrenden nicht freigegeben, auch nicht die Aufwendungen für die Verpflegung der Studierenden. Die Gelder seien da, hingen aber in der Taliban-Bürokratie fest. »Ich hoffe sehr, dass wir sie bald bekommen«, sagt Ghairat und wirkt dabei wenig zuversichtlich. Der Sieger von heute sieht aus wie der Besiegte von morgen.
Zum Abschied sagt ein erschöpfter Mohammed Aschraf Ghairat: »Betet für mich.«
***
Dezember 2021
Drei Monate später sind wir nicht sicher, ob die Wachen uns hereinlassen werden, doch sie tun es. Die Kontrollen sind mittlerweile entspannter geworden. Ghairat wurde vor einigen Wochen entlassen. Ein Dr.Osama Azizi hat seinen Platz eingenommen. Ein islamischer Rechtsgelehrter, Mitglied der Scharia-Fakultät. Er trägt einen Doktortitel, kein Bachelor nur wie Ghairat, aber ansonsten ist über ihn fast noch weniger als über seinen Vorgänger in Erfahrung zu bringen. In seinem Büro ist er nicht anzutreffen. Über Whatsapp vertröstet er meine Interviewanfragen auf nächste Woche. Das wird er so lange tun, bis ich wieder außer Landes bin. Offenbar scheut er die Presse, noch hat er kein einziges Interview gegeben, wird er auch nicht.