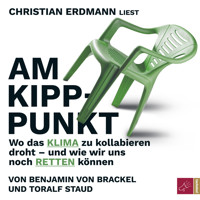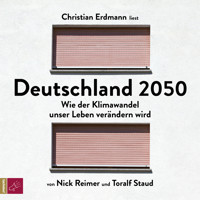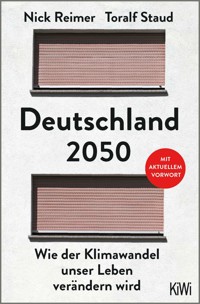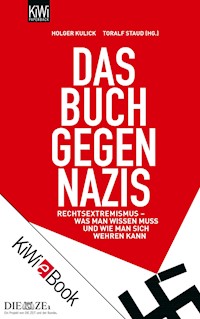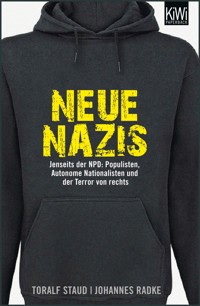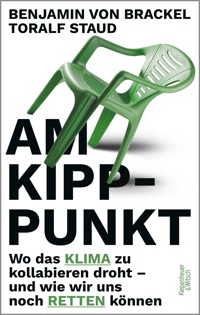
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was man wirklich über Klima-Kipppunkte wissen muss Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren, Waldbrände – die Auswirkungen des immer extremeren Wetters sind auch hierzulande zunehmend spürbar. Aber all das ist erst der Anfang: Weil das 1,5-Grad-Limit nicht mehr zu halten ist und die Erderhitzung fortschreitet, drohen in naher Zukunft im Klimasystem mehrere sogenannte Kipppunkte überschritten zu werden. Die Folgen wären einschneidend, auch für Deutschland. Benjamin von Brackel und Toralf Staud liefern, was man über Kipppunkte wirklich wissen muss. Sie schildern die jahrzehntelange Erforschung der Kipppunkte, ihre möglichen Folgen und die Kontroversen der Fachwelt – eine der größten Detektivgeschichten unserer Zeit, deren Ausgang über nichts weniger entscheidet als über das Schicksal unserer Zivilisation. Die Autoren nehmen uns mit auf eine Weltreise zu den wichtigsten Kippelementen im Erdsystem: von den eisigen Landschaften der Pole über die Warmwasserheizung Europas bis zum Amazonas-Regenwald. Sie erklären, wie unsere Erde – und auch die Klimawissenschaft – funktioniert. Am Ende weiß man, welche Kipppunkte einem tatsächlich Sorge bereiten sollten und welche weniger. Nicht zuletzt zeigt das Buch positive Kipppunkte in Technologie und Gesellschaft auf. Diese könnten exponentielles Wachstum beim Klimaschutz ermöglichen und uns noch davor bewahren, in ein chaotisches Klima abzustürzen. Ein dramatisches Wettrennen gegen die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Toralf Staud / Benjamin von Brackel
Am Kipppunkt
Wo das Klima zu kollabieren droht – und wie wir uns noch retten können
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Toralf Staud / Benjamin von Brackel
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Toralf Staud / Benjamin von Brackel
Toralf Staud war von 1998 bis 2005 Politikredakteur der ZEIT, seither ist er freier Autor und beschäftigt sich hauptsächlich mit der extremen Rechten sowie dem Klimawandel. 2007 erschien »Wir Klimaretter« (mit Nick Reimer). Seit 2011 hat er das gemeinnützige Wissenschaftsportal klimafakten.de mitaufgebaut. Sein letztes Buch »Deutschland 2050« (wieder mit Nick Reimer) stand monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Benjamin von Brackel ist freier Autor und Wissenschaftsjournalist. Seit mehr als zehn Jahren schreibt er über den Klimawandel, vorwiegend für die Süddeutsche Zeitung. Er hat das Onlinemagazin klimareporter.de mitbegründet. 2019 erschien »Wütendes Wetter« (mit Friederike Otto). Es stand auf der Sachbuchbestenliste und mehrere Wochen lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Benjamin von Brackel lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürren, Waldbrände – die Auswirkungen des immer extremeren Wetters sind auch hierzulande zunehmend spürbar. Aber all das ist erst der Anfang: Weil das 1,5-Grad-Limit nicht mehr zu halten ist und die Erderhitzung fortschreitet, drohen in naher Zukunft im Klimasystem mehrere sogenannte Kipppunkte überschritten zu werden. Die Folgen wären einschneidend, auch für Deutschland.
Benjamin von Brackel und Toralf Staud liefern, was man über Kipppunkte wirklich wissen muss. Sie schildern die jahrzehntelange Erforschung der Kipppunkte, ihre möglichen Folgen und die Kontroversen der Fachwelt – eine der größten Detektivgeschichten unserer Zeit, deren Ausgang über nichts weniger entscheidet als über das Schicksal unserer Zivilisation. Die Autoren nehmen uns mit auf eine Weltreise zu den wichtigsten Kippelementen im Erdsystem: von den eisigen Landschaften der Pole über die Warmwasserheizung Europas bis zum Amazonas-Regenwald. Sie erklären, wie unsere Erde – und auch die Klimawissenschaft – funktioniert. Am Ende weiß man, welche Kipppunkte einem tatsächlich Sorge bereiten sollten und welche weniger. Nicht zuletzt zeigt das Buch positive Kipppunkte in Technologie und Gesellschaft auf. Diese könnten exponentielles Wachstum beim Klimaschutz ermöglichen und uns noch davor bewahren, in ein chaotisches Klima abzustürzen. Ein dramatisches Wettrennen gegen die Zeit.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Miriam Bröckel
Covermotiv: © Miriam Bröckel × Adobe Firefly
Graphiken: Oliver Wetterauer, Stuttgart
ISBN978-3-462-31334-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/karte-zu-am-kipppunkt
Inhaltsverzeichnis
Prolog Neue Welt
Einleitung Ein unverantwortbares Risiko
Teil I Die Entdeckung der Kipppunkte
Kapitel 1 Die Urkatastrophe
Kapitel 2 Das Geheimnis im Eis
Kapitel 3 Unschöne Überraschungen im Treibhaus
Kapitel 4 Die Kipppunkte-Kontroverse
Teil II Negative Kipppunkte im Klimasystem
EIS
Kapitel 5 Arktisches Meereis, Gletscher, Permafrost: Die Erde taut auf
Kapitel 6 Der Westantarktische Eisschild: Auf Talfahrt
Kapitel 7 Der Grönländische Eisschild: Ein Riese wankt
WASSER
Kapitel 8 Die Atlantische Umwälzzirkulation: Die schlafende Bestie
Kapitel 9 Der Subpolarwirbel: Die Achillesferse im Nordatlantik
LUFT
Kapitel 10 Der Jetstream: Die Wettermaschine
Kapitel 11 Der westafrikanische Monsun: Der Regen kehrt zurück
NATUR
Kapitel 12 Tropische Korallenriffe: Das verblassende Weltwunder
Kapitel 13 Amazonas-Regenwald: Wenn die lebende Wasserpumpe versiegt
Kapitel 14 Boreale Nadelwälder: Das CO2-Lager im hohen Norden
Kapitel 15 Bringt uns eine Kippkaskade auf die Venus?
Zwischenüberlegungen und Überleitung
Teil III Positive Kipppunkte beim Klimaschutz
Kapitel 16 Erneuerbare Energien: Das Solarwunder
Kapitel 17 Elektromobilität: Die E-Auto-Revolution
Kapitel 18 Ernährung: Die zähe Fleischwende
Ausblick Am Kipppunkt
Dank
Anmerkungen
Register
PrologNeue Welt
Stellen Sie sich eine große, komplexe Maschine vor, in der unzählige Zahnräder und andere mechanische Teile fein austariert ineinandergreifen. Über Hebel wird die Maschine gesteuert. Nun ziehen Sie an einem davon, ganz langsam, gleichmäßig. Eines der Zahnräder wandert auf seiner Welle, ebenfalls langsam, gleichmäßig. Sonst passiert nichts. Irgendwann aber ist es so weit verschoben, dass ein anderes Zahnrad in Reichweite gerät. Sie greifen ineinander, das Getriebe knirscht, ruckelt – und ändert plötzlich die Drehrichtung.
Genauso abrupt könnte sich auch unser Erdsystem umstellen.
Es beginnt mit dem Eis: Von den Ozeanen rund um die Pole wird die weiße Decke gezogen; die Böden in den nördlichsten Breiten tauen auf, und in den Gebirgen kriechen die Gletscher in die Höhe zurück, wie ein scheues Tier. Überall knackt und knistert es, es tropft und rauscht. Die Erde taut.
Dann kommt der Knall.
Der Reihe nach zerplatzen die Schelfeise der Antarktischen Halbinsel, dann jene der Westantarktis. Aufs Meer hinausragende Eisplatten von der Größe ganzer Länder, die jahrtausendelang am Festlandeis gehaftet haben, brechen ab, zersplittern, und eine Armada an Eisbergen treibt in den Südozean hinaus. Warmes Wasser dringt nun unter den entblößten Eisschild und höhlt ihn unaufhörlich aus.
Derweil, am anderen Ende der Welt, schrumpft der Grönländische Eispanzer, und seine höchsten Lagen geraten in immer tiefere und wärmere Luftschichten, woraufhin er noch schneller schmilzt und ab einem gewissen Punkt unumkehrbar zerfließt. Bis der ganze Eisschild verschwunden ist, wird es Jahrhunderte oder Jahrtausende dauern, aber schon viel früher verändert sein Schmelzwasser etwas Entscheidendes im Ozean, nämlich die chemische Zusammensetzung.
Im Nordatlantik richtet sich daraufhin eine mächtige Meeresströmung neu aus, die über Jahrtausende Wärme nach Europa befördert hat. Wie ein am Boden liegender Gartenschlauch, der bei zu starkem Wasserdruck sich schlängelnd verschiebt und anderswo zum Liegen kommt. Und das hat einen paradoxen Effekt: Während der Großteil der Welt unter Hitze leidet, erleben Teile Europas einen Kälterückfall. Die Luft kühlt ab, um mehrere Grad. Im Winter ziehen Stürme auf, wie sie die Menschen seit Beginn der Zivilisationen nicht erlebt haben. Das arktische Meereis breitet sich wieder aus und berührt im Winter die Nordküste Schottlands und Norwegens; bisweilen gar die deutsche Nordseeküste. Es schneit wieder mehr.
Gleichzeitig erlebt die Südhalbkugel einen zusätzlichen Hitzeschub, schließlich hat die Erderwärmung ja nicht aufgehört – nur verteilt sich die Energie auf dem Planeten um und staut sich nun in der südlichen Hemisphäre.
Auf dieses Ungleichgewicht reagiert in der riesigen Maschinerie des Erdsystems auch die Luftzirkulation: Die tropischen Regenbänder verschieben sich gen Süden. Sie hängen kaum mehr über den Regenwäldern samt deren Bewohnern; stattdessen schieben sie sich über Savannen und andere Vegetationszonen, die auf die nassen Bedingungen gar nicht eingestellt sind.
Selbst bis ans südliche Ende der Welt reichen die Nachwehen der globalen Neujustierung: Im Westen der Antarktis beschleunigt sich der Rückzug des Eisschildes, und selbst in der Ostantarktis destabilisieren sich die Eismassen, die seit Jahrmillionen ruhten. Der Meeresspiegel hebt sich, unaufhaltbar – egal, was die Menschheit fortan noch tut. Die Küstenlinien zeichnen sich neu. Metropolen werden erst immer häufiger überflutet, schließlich müssen sie aufgegeben werden. Sie enden als Fossile auf dem Meeresgrund. Zeugnisse einer alten Welt und Zeit.
Die Erde hat sich umgestellt, ohne Rücksicht auf das Leben auf ihr. Das System, die Maschine, funktioniert in einem neuen Modus.
Teil IDie Entdeckung der Kipppunkte
Kapitel 1 Die Urkatastrophe
»Wir können nicht einfach zurück in den Wald und jagen und sammeln gehen. Wir haben uns auf ein System eingelassen und sind deshalb sehr viel verletzlicher.«
Tobias Richter, Archäologe
Im Juni 1897 durchstreiften zwei Männer, bekleidet mit Hut, Weste und Anzug, das Gelände einer Ziegelei nördlich von Kopenhagen. Immer wieder blickten sie sich um, machten sich Notizen. Über ihnen erhob sich ein Schornstein. Um sie herum klafften die Löcher der Lehmgruben und Gräben, durch die beide Männer liefen.
Die perfekte Kulisse für einen Tatort.
Und nichts anderes war das hier. Allerdings ein Tatort aus einer längst vergangenen Epoche, in dem sich ein Weltereignis abgespielt hatte, für den es keinen Kriminalermittler brauchte, sondern Geologen und Botaniker wie Nikolaj Hartz und Vilhelm Milthers.
Seit einigen Jahrzehnten begannen die Menschen, im großen Stil Erde auszuheben, um Eisenbahnstrecken und Kanäle zu errichten. Oder eben um Tongruben zu öffnen und Ziegel zu produzieren für die rasant wachsenden Städte. Allein auf der Eisenbahnfahrt über die flachwellige Moränenlandschaft zwischen Kopenhagen und Allerød zogen an Nikolaj Hartz, einem 29-jährigen Assistenten am Moorlabor der Geologischen Forschungsanstalt Dänemarks, vier Ziegelwerke vorbei, aus deren Schloten es qualmte.
An den Steilwänden der Grubenränder wurden die Bodenprofile sichtbar, und auf einmal blickten die Menschen auf ein Abbild der Erdgeschichte, das ihnen bis dahin verborgen geblieben war. Sedimentschichten hatten sich im Laufe der Zeiten übereinandergestapelt; die ältesten ganz unten, die jüngsten ganz oben, so viel war schon bekannt. Auch, dass die Erde deutlich älter war als die 6.000 Jahre, die Geologen lange aus der Bibel abgeleitet hatten.
Nun aber wurde Geologen und Botanikern klar, dass sich unter der Erde ein wahres Archiv früherer Welten befand. Zum Beispiel die der Weichsel-Eiszeit, der jüngsten Vergletscherungsperiode in Nordeuropa. Nikolaj Hartz und sein Kollege Vilhelm Milthers wollten herausfinden, welche Pflanzen und Tiere einst in Dänemark gelebt hatten; sie wollten die arktische Flora und Fauna systematisch erfassen. Dafür waren sie rausgefahren nach Allerød. Sie gingen zur Westseite der Tongrube und betrachteten eine Abbruchkante. Mit einem scharfen Messer schnitten sie ein paar Proben der Sedimente ab, um diese später im Labor zu schlemmen und mit Salpetersäure zu behandeln. Nie wieder sollten sie das Profil »so gut« vorfinden wie an jenem Tag, schrieben sie rückblickend in ihrem berühmt gewordenen Aufsatz über die Entdeckung.[7]
Unter einer vermoderten Torfablagerung fanden sie eine Tonschicht, die mehrere Meter hinab bis zur Grundmoräne reichte, dem Geschiebelehm der Gletscher, die sich nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren zurückgezogen hatten. Und in den Tonablagerungen fanden Hartz und Milthers die ledrigen Blätter der Weißen Silberwurz, Dryas octopetala, einer arktischen Pflanze mit hübschen weißen Blütenblättern. An sich war das keine Überraschung, spiegelte diese doch das damalige eiszeitliche Klima wider. Genauso wie die Überreste von Rentieren, die ebenfalls im Ton überliefert waren.
Zu denken gab den beiden Wissenschaftlern aber eine Schicht, die inmitten des Tones lag: ein bis zu dreißig Zentimeter dickes braun-schwarzes Band, das sich rund um die Tongrube zog. »Gytje« nannten sie dieses. Ein Sediment, das sich am Boden von Torfmooren ansammelt und reich an organischem Material ist. Zweige und Früchte der Moorbirke oder Überreste von Elchen fanden Hartz und Milthers in diesem Faulschlamm. Aber keinerlei Spuren der Weißen Silberwurz oder von Rentieren. Was sie da vor sich hatten, war die Flora und Fauna einer gemäßigteren, schon deutlich wärmeren Welt, ähnlich der im heutigen Skandinavien.
Aber was hatte die bloß in der Spätphase der vergangenen Eiszeit zu suchen?
Warum war es damals auf einmal wärmer geworden, woraufhin sich das Eis um »mehrere Meilen« zurückzog und die subarktische Vegetation »vollständig verdrängt« wurde, wie Hartz später notierte. Und warum kühlte es nach diesem Hunderte Jahre währenden Intermezzo wieder ab und kehrte das Eis noch einmal in großem Stil zurück?
Gemäß der damals herrschenden Lehrmeinung durfte es solch eine Klimaschwankung gar nicht gegeben haben!
Die Vorstellung, dass sich das Klima abrupt wandeln kann, galt damals unter Wissenschaftlern als verpönt, als Idee christlicher Spinner, die den Weltenlauf mit apokalyptischen Geschichten aus der Bibel erklärten; etwa der Geschichte von Noah und der Sintflut. Das lag in erster Linie an zwei schottischen Geologen, James Hutton und Charles Lyell. Diese hatten sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts dafür eingesetzt, die Geologie endlich auf eine rationale Grundlage zu stellen und sie von den Fesseln des christlichen Dogmatismus zu befreien. Sie sahen sich in einer Reihe mit Kopernikus, Kepler und Galilei, die die vatikanische Lehrmeinung von der Erde als Zentrum des Universums zum Einsturz gebracht hatten.
Allen voran Lyell. Vor rund 200 Jahren durchritt der halb blinde Schotte mit dem Feldherrenkinn und den Riesenkoteletten Europa – von seiner Heimat bis hinunter nach Sizilien. Dabei studierte er die Gipfel der Alpen und Pyrenäen, ihre Schneefelder, Gletscher und Seen, kletterte auf den Vesuv und Ätna sowie die Buckel längst erloschener Vulkane in der Auvergne und der Eifel. Weil er schlecht sah, musste er sich alles von seinen Reisebegleitern zeigen lassen, ehe er umgehend Spekulationen anstellte.[8] Indem Lyell die Schaffens- und Zerstörungskraft der Natur untersuchte, sammelte er Indizien für seine große Theorie, die auf den Erkenntnissen seines Landsmanns Hutton aufbaute und Generationen an Wissenschaftlern nach ihm prägen sollte. Sein Prinzip vom Aktualismus folgt einer einfachen Idee: Alle geologischen Phänomene und Naturprozesse in der Vergangenheit haben sich auf gleiche Weise abgespielt, wie sie es heute tun. Die Kräfte, die Eis, Fels, Meer und Luft formen, ändern sich nicht im Laufe der Erdgeschichte.
Auch das Klima folge diesem Prinzip: Es fluktuiere nur langsam und gleichmäßig um einen Mittelwert, weil Landflächen und Ozeane ihre Position verändern. Aber eben unglaublich langsam. Die Erfahrung der Menschen zeige, dass Temperaturen nicht in weniger als einem Jahrtausend radikal ansteigen oder fallen. Das hätten sie deshalb auch früher nicht getan und würden es auch in Zukunft nicht tun.
Zu jener Zeit war die Idee des Aktualismus revolutionär und traf auf erbitterten Widerstand. Nicht nur in den Sitzungen der Geologischen Gesellschaft in London trug Lyell Wortgefechte aus, auch in Paris mit seinem ärgsten Widersacher, dem französischen Paläontologen Georges de Cuvier, dem Hauptvertreter des »Katastrophismus«. Dieser war der Ansicht, dass die Erdgeschichte mit katastrophalen Ereignissen gespickt sei, Cuvier sprach von »Revolutionen« in der Entwicklung des Lebens auf der Erde sowie Revolutionen der Gesteinsschichtung. Abrupte Umbrüche durch Meteoriteneinschläge, gigantische Vulkanausbrüche oder rapide Hebungen oder Senkungen des Meeresspiegels hätten in der Erdgeschichte immer wieder zu Massenaussterben in der Tier- und Pflanzenwelt geführt.
Lyell freundete sich mit Cuvier an, verspottete aber dessen Thesen als bemitleidenswerte Versuche, die Schöpfungslehre zu verteidigen (obwohl er wusste, dass Cuvier das gar nicht im Sinn hatte). Abrupte Umbrüche, meinte Lyell, habe es nie gegeben. 1830 veröffentlichte er sein epochales Werk, die Principles of Geology, mit dem er dem Aktualismus zum Durchbruch verhalf.
Nachdem Cuvier im Jahr 1832 gestorben war, versanken die Katastrophisten in der Bedeutungslosigkeit. Lyells Theorie hingegen machte Schule und inspirierte Charles Darwin zu seiner Evolutionstheorie: Der Engländer übertrug das Prinzip des Aktualismus auf die Biologie: Die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten vollziehe sich nach den immer gleichen Evolutionsfaktoren wie Mutation und Selektion, meinte Darwin.
Lyell hatte ein Fundament der modernen Naturwissenschaften gelegt. Erst das Prinzip, dass alle Kräfte, die auf die Erde wirken, und damit auch alle Naturgesetze, seit Millionen von Jahren die gleichen sind (und auch in Zukunft bleiben werden), ermöglicht es beispielsweise, das Klima in ausgeklügelten Computermodellen zu simulieren. Oder beurteilen zu können, was passiert, wenn der Mensch in ökologische Systeme eingreift.
Nachdem Nikolaj Hartz die Sedimentschichten mit und ohne Blätter der Dryas octopetala untersucht hatte, bekam er Zweifel. Auch er hatte selbstverständlich Lyells Principles of Geology gelesen. Waren die Klimaschwankungen, deren Spuren er in der Tongrube in Allerød gefunden hatte, vielleicht nur eine lokale Besonderheit?
Um das zu überprüfen, reiste er weit umher und hielt überall nach »Gytje« Ausschau. Er fand dieses braun-schwarze Sedimentband auch in anderen Teilen Dänemarks, auf Seeland, Fünen und Bornholm, außerdem am Kaiser-Wilhelm-Kanal, der noch heute Schleswig-Holstein durchschneidet und Nord- und Ostsee verbindet. Die »allgemeine Ausbreitung« der Gytje-Schicht »rings um die Ostsee zeigt, dass sie ein allgemeines Phänomen repräsentiert, und von einer temporären Klimaverbesserung herrührt«, erklärte Hartz im Jahr 1912 in seiner Rede vor der allgemeinen Versammlung der Deutschen Geologischen Gesellschaft.[9]
Was Hartz so positiv ausdrückte, könnte man auch anders formulieren, wenn man die Geschichte weitererzählt. Dafür hätte der dänische Geologe nur seinen Finger an dem Erdprofil über die Grenze der Gytje-Schicht weiter nach oben führen müssen, in den jüngeren eiszeitlichen Ton hinein. Dieser nun wieder deutlich kühlere Abschnitt in der Erdgeschichte, der vor 12.800 Jahren begann, wie wir heute wissen, war die eigentliche Überraschung. Jüngere Dryas nannte Hartz diese Periode, in Anlehnung an das Arktispflänzchen mit den weißen Blüten, das er in der Ziegeleigrube gefunden hatte.[10] 1.000 Jahre sollte die Kälte noch anhalten, ehe sie von den heutigen gemäßigten Klimabedingungen abgelöst wurde.
Die Geschichte der Endphase der Weichsel-Eiszeit lässt sich also auch so zusammenfassen: Gerade als die Erde dabei war, ihren eisigen Mantel abzustreifen, gerade als Pflanzen und Tiere in die Räume vordrangen, die ihnen die zurückweichenden Eispanzer boten, gerade also, als das Leben in den hohen und mittleren Breiten nach mehr als 100.000 Jahren Eiszeit aufzuatmen begann, da schlug das Klima noch einmal mit voller Härte und Plötzlichkeit um: ein Kälterückfall von fast biblischen Ausmaßen.
Was war damals bloß passiert?
An einem heißen Sommertag im Jahr 2023 steht Tobias Richter auf einer Anhöhe rund zwanzig Kilometer nördlich der dänischen Hauptstadt und blickt durch seine Sonnenbrille auf eine Hügellandschaft. Rennradfahrer schießen auf einer Straße vorbei. Rundherum Wiesen, Pferdekoppeln und Mischwälder. Unten liegen Kühe träge von der Hitze an einem Weiher.
Richter überquert die Straße und studiert eine Tafel, die man leicht übersehen könnte. Darauf der Hinweis auf die »international bekannte geologische Lokalität« und die Entdeckung von Hartz und Milthers im Jahr 1897. Von der Industrielandschaft, die die beiden Dänen vor mehr als 120 Jahren vorfanden, zeugt heute kaum noch etwas.
Der Archäologe von der Universität Kopenhagen stiefelt zum Weiher hinab, ein Teil der ehemaligen Tongrube ist längst mit Wasser vollgelaufen. Am Ufer umgreift er seinen Feldstecher und blickt auf die gegenüberliegende Seite. »Dort hinten muss es gewesen sein«, sagt der 45-Jährige. »Man kann die Abbruchkante erahnen.«
Richter ist das erste Mal hier, obwohl sein Büro nicht mal eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt liegt und sein Forschungsfeld hier seinen Anfang nahm: die Auswirkungen der sogenannten Jüngeren Dryaszeit auf die Menschheit. Bis heute umgibt diesen bislang letzten großen Kälteeinbruch auf der Erde ein Mysterium.
Seit mehr als hundert Jahren versuchen Archäologen, Biologen und Klimaforscher, ihre Puzzleteile zusammenzusetzen. Sie waten durch Moore, rudern auf Seen hinaus und bohren in deren Grund, nehmen Proben aus dem Tiefseeboden der Ozeane und graben urzeitliche Siedlungen aus. Aus all dem haben sie eine ungefähre Vorstellung von jener Urkatastrophe an der Schwelle der menschlichen Zivilisation gewonnen. Eine Katastrophe, die sich – wenn auch unter ganz anderen klimatischen Ausgangsbedingungen – in nicht allzu ferner Zukunft wiederholen könnte. Deshalb lohnt es, sich mit ihr näher zu beschäftigen.
Was die Menschen zu Beginn der Jüngeren Dryaszeit zuerst bemerkt haben mussten, war der Wind. Starke Westwinde zogen vor rund 12.800 Jahren auf und bliesen eine eisige Luft über Mitteleuropa. Um drei bis vier Grad Celsius kühlte Nordeuropa im Schnitt ab. Die Gletscher Skandinaviens und der Alpen breiteten sich die Hänge hinab aus, das Meereis im Arktischen Ozean verdickte sich und stieß nach Süden vor, und der Boden der Norddeutschen Tiefebene gefror. Die Eiszeit war plötzlich zurück.[11]
Kiefern- und Birkenwälder, die sich nach dem Höhepunkt der langen Eiszeit erst langsam wieder ausgebreitet hatten (wie es im Profil in der dänischen Tongrube in der »Gytje«-Schicht abzulesen war), wichen erneut zurück bis nach Süddeutschland und gaben den Raum frei für offene Gras- und Strauchlandschaften. In diese kehrten von Norden kommend die großen Rentierherden zurück. Die Jäger und Sammler, die zuvor Hasen, Rehe und Hirsche in den Wäldern gejagt hatten, mussten lernen, die Rentiere im Offenland in die Enge zu treiben und mit Pfeil und Bogen, Speeren und Speerschleudern zu erlegen. Aber auch erste Angelhaken wurden aus jener Zeit gefunden, was auf Fischfang an der Nord- und Ostseeküste hindeutete, die damals noch 400 Kilometer weiter nördlich verlief als heute, da der Meeresspiegel um einige Dutzend Meter tiefer lag.[12]
Die Steinzeitmenschen, die zu dem Zeitpunkt bereits bis nach Südskandinavien vorgestoßen waren, stellte der Kälteeinbruch zweifellos vor Herausforderungen. Doch für die Menschheitsgeschichte war das nicht entscheidend. Anders verhielt es sich mit Veränderungen, die sich weit im Süden abspielten, in einer Region, die sich in einem Halbkreis über das heutige Israel, Palästina, Libanon, Syrien, die Türkei und den Irak spannt. Selbst dort noch, im Fruchtbaren Halbmond, hinterließ die Jüngere Dryaszeit ihren Abdruck.
Tobias Richter ist einer der führenden Experten für das sogenannte Natufian, die Jäger- und Sammler-Kultur, die sich damals in jener Region entwickelte. Er will verstehen, ob der Klimawechsel damals einen der größten Entwicklungssprünge der Menschheit befördert hat: den Übergang von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern. Dieser Fokus erklärt, warum er noch nie in Allerød war. Getreidestoppeln knistern unter seinen Trekkingschuhen, während er die einstige Tongrube umrundet. Richter taucht ein in einen Buchen-Ahorn-Wald. Eine Art Damm kreuzt den Weg. Der Archäologe nimmt an, dass hier einst Loren fuhren, um Ton in die Ziegelfabrik zu transportieren. Dann bleibt er vor einem Zaun aus zwei Metalldrähten stehen, der den weiteren Weg zum Sedimentprofil versperrt, das Hartz und Milthers einst betrachteten. »Ist da Strom drauf?«, fragt Richter.
In der Region des Fruchtbaren Halbmonds, so viel weiß man heute, wurde es nach der kurzen Allerød-Wärmeperiode wieder kühler und trockener. Die mediterranen Wälder wichen zurück, an ihre Stelle traten Steppen und Wüsten. Damit schrumpfte das Habitat der Gazellen, deren Herden verkleinerten sich oder wanderten ab. Die Menschen dort verloren eine ihrer wichtigsten Nahrungsquellen.
Sie hätten damals zwei Möglichkeiten gehabt, meint Tobias Richter: wegziehen oder sich anpassen. Zwischen 2012 und 2015 hat er mit Kollegen eine Siedlung namens Shubayqa im Nordosten Jordaniens freigelegt, eine der ältesten bislang entdeckten Siedlungen der Kultur des Natufians. Dort fanden sie verkohlte Nahrungsreste, die auf eine Zeit vor 14.600 bis 11.600 Jahren zurückdatiert werden konnten. Daraus schlossen die Wissenschaftler, dass die Bewohner bereits eine Art Brot buken.[13] In der Pressemitteilung war vom »ältesten Brot der Welt« die Rede. Das Archäologenteam stellte jedoch fest, dass die Siedlung – Grubenhäuser, deren Boden bereits mit Steinen ausgelegt war – kurz vor Beginn der Jüngeren Dryas aufgegeben worden war. Womöglich, weil sich Shubayqa bereits am Rande der ariden, trockenen Zone befand und nun infolge der sich anbahnenden Klimaveränderung vollends unter die Schwelle des nötigen Regenfalls rutschte, den es braucht, um Getreide anzubauen.
Auch anderswo beendeten die Menschen zu jener Zeit ihr Herantasten an den Ackerbau. Sie gaben Siedlungen auf und schlüpften in ihre alte Rolle der Jäger und Sammler zurück. Oder sie zogen als Nomaden mit ihren Herden in die Wüste. Wieder anders entschieden sie sich zum Beispiel in Abu Hureyra, einer Siedlung im heutigen Syrien, die Anfang der 1970er-Jahre freigelegt worden war. Deren Bewohner blieben trotz der widriger werdenden Bedingungen.
Warum, weiß man nicht. »Ich finde es faszinierend, darüber nachzudenken, ob sie so engstirnig waren und ihre Sesshaftigkeit nicht aufgeben wollten«, sagt Richter. Vielleicht hatten sie sich einfach an die Annehmlichkeiten des neuen Lebensstils gewöhnt. Um diesen trotz der zunehmenden Kälte und Trockenheit nicht preisgeben zu müssen und alle Bewohner weiter ernähren zu können, mussten sie allerdings etwas verändern: Sie fingen an, bewusst Wildgetreide und großsamige Hülsenfrüchte anzubauen, wohl um den Ertrag hochzuhalten. Für diese Theorie spricht die Ausprägung von Getreidehülsen und Samenkörnern, aber auch gefundene Werkzeuge wie Sichelklingen und Reibsteine, in denen man das Getreide zu Mehl zerreibt.
Anfangs jagten die Bewohner von Abu Hureyra weiterhin Gazellen. Als diese abwanderten, waren sie gezwungen, sich auf neue Nahrungsquellen zu verlegen. Sie begannen, Wildschafe und Auerochsen vor ihren Wohnhäusern zu halten, wie eine Analyse von Dungresten ergab.[14] »Sie haben sich also an die neue Situation angepasst«, sagt Richter.
Allerdings scheint diese Strategie irgendwann an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Um das Jahr 12.500 herum wurde die Siedlung dann doch aufgegeben. »Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie risikobehaftet das Leben damals war«, kommentiert Richter. »Ein Jahr ohne Regen konnte schon ausreichen, um eine Gemeinschaft zusammenbrechen zu lassen, zum Beispiel wenn zeitgleich Ratten in der Lagerstätte waren.«
Nach Shubayqa wiederum kehrten die Menschen erst nach rund 700 Jahren wieder zurück. Noch immer aber herrschten die trockenen und kälteren Bedingungen der Jüngeren Dryaszeit. Knochenfunde deuten darauf hin, dass die Jäger und Sammler damals auch begannen, Hasen und Füchsen nachzustellen, und zwar mithilfe von Hunden. »Dadurch verengte sich das Jagdgebiet auf einen kleineren Umkreis um die Siedlungsplätze, wodurch wiederum die Sesshaftigkeit verstärkt wurde«, schreibt Franz Mauelshagen in seinem Buch Geschichte des Klimas. »Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Jüngere Dryaszeit für ökologische Bedingungen sorgte, die die Domestikation von Tieren und Getreide förderten und die sozialen Veränderungen begünstigten, die bereits lange zuvor in der Region begonnen haben.«[15]
Der Kälterückfall verlangte den Menschen zu jener Zeit also eine große Anpassungsleistung ab. Je nach Ort fanden sie ihre ganz eigenen Antworten. »Die Menschen standen vor ähnlichen Problemen, fanden aber verschiedene Lösungen«, sagt Richter. »Alle marschierten in die gleiche Richtung, nahmen aber verschiedene Wege.«
Tobias Richter zieht daraus einen Schluss: Die Menschen wurden damals keineswegs einfach von der Klimakatastrophe überwältigt. Sie reagierten nicht nur und rannten davon. Stattdessen trafen sie Entscheidungen, um das Problem zu lösen.
Wie würden wir heute handeln?
Einerseits haben wir ganz andere Möglichkeiten, auf einen Sprung im Klima zu reagieren: Wir können Getreide modifizieren und dessen Wachstum beschleunigen, Maschinen einsetzen und Nahrung global umverteilen. Andererseits sind wir unflexibler: Mehr als acht Milliarden Menschen bevölkern heute die Erde. Bis in die letzten Winkel der Welt haben wir Flächen vereinnahmt und mit Städten, Straßen und Kanälen überzogen, mit Eisenbahnlinien, Ackerflächen und Nutzwäldern. »Wir können nicht einfach zurück in den Wald und jagen und sammeln gehen«, sagt Richter. »Wir haben uns auf ein System eingelassen und sind deshalb sehr viel verletzlicher.«
Vor dem Zaun an der Tongrube von Allerød macht der Archäologe schon Anstalten umzukehren. Aber weil er sieht, wie der Besucher neben ihm unwillig stehen bleibt, greift er doch nach einem Ast, drückt den unteren Draht hinunter. Es knistert. Richter schlüpft durch die Lücke.
Nach einigen Schritten bleibt er stehen, nimmt Schwung und erklimmt eine rund zwei Meter hohe Erhebung. Ist das da unter ihm die Stelle, an der die beiden dänischen Geologen die Allerød-Warmphase und die anschließende Jüngere Dryaszeit entdeckten? »Ich gehe stark davon aus«, sagt Richter. »Den genauen Ort wird man aber wahrscheinlich nie wiederfinden.«
Die Erosion hat das Profil der Erdschichten verwischt, ehe Moose und Gräser es überwuchsen. Hätte Richter einen Spaten dabei, könnte er die Abbruchkante wieder freilegen. Aber das braucht er gar nicht. Denn für die weitere Erforschung der Jüngeren Dryaszeit und anderer abrupter Wendungen im Klima standen schon ein paar Jahrzehnte nach Hartz und Milthers viel bessere Methoden und Umweltarchive zur Verfügung. Und erst sie ermöglichten es, der Antwort auf eine Schlüsselfrage näher zu kommen, deren Beantwortung für uns heute von Bedeutung ist: Wie schnell brachen die kalten und trockenen Bedingungen damals wirklich über die Welt herein? Und wie schnell machte die Jüngere Dryaszeit den Weg dann endgültig frei fürs Holozän? Abrupt? Oder doch deutlich gemächlicher, wie es zu den Theorien von Charles Lyell passen würde?
Mit anderen Worten: Zu welchen Sprüngen ist das Erdklima fähig?
Vor 11.650 Jahren endete die Jüngere Dryaszeit so plötzlich, wie sie gekommen war. In der Tongrube in Allerød konnten Hartz und Milthers diesen Schlusspunkt im Profil der Sedimentschichten an der Trennlinie zwischen der jüngeren Tonschicht und der vermoderten Torfschicht an der Oberfläche erkennen, die mit Überresten von Buchen- und Eichenstämmen durchsetzt war – ein Hinweis auf das Einsetzen der noch heute andauernden Warmzeit des Holozäns, der Blütezeit der Menschheit.
Es wurde damals wieder feuchter und wärmer, Birken und Kiefern breiteten sich in Nordeuropa aus, und die Rentierherden zogen sich endgültig in den Norden zurück. Die Menschen mussten sich abermals an die kleinräumigere Lebensweise in Wäldern gewöhnen – oder weit nach Norden ausweichen, wo es nach wie vor eine offene Tundra gab.
Auch in der Region des Fruchtbaren Halbmonds kehrten die Wälder zurück, die Wüste schrumpfte. Mehr Siedlungen entstanden, sie wuchsen zu Städten, und die Menschen blieben dort, manchmal für Tausende von Jahren oder sogar bis heute, wie in Jericho.
Wie schnell die Menschheit tatsächlich in die heutige Warmzeit befördert wurde, wie schnell also die Jüngere Dryas nicht nur begonnen, sondern auch geendet hatte, sollte sich erst viele Jahrzehnte später klären: Anfang der 1990er-Jahre. An einem der kältesten Orte der Welt.
Kapitel 2Das Geheimnis im Eis
»Lange Zeit passierte überhaupt nichts.
Und dann ging alles die Klippe hinunter.«
Richard Alley, Geowissenschaftler
An einem Sommertag im Jahr 1992 saugte Paul Mayewski eisige Luft in die Lungen. Sein Körper sagte ihm, dass es okay war, tiefer einzuatmen, als er es sich in der Stadt, in der er lebte, je erlaubt hätte. Es fühlte sich gut an. Erfrischend. Hier, am höchsten Punkt Grönlands, war es so still, dass der Eis-Chemiker von der University of New Hampshire sein Herz schlagen hören konnte.
Auch an diesem wolkenlosen Tag krochen die Temperaturen nicht über den Gefrierpunkt hinaus. Erst Jahre später sollten die verrückten Sommer einsetzen, in denen es sogar an diesem Ort regnete, ein Schmelzfilm die gesamte Oberfläche des Eisschilds überzog und an den Rändern Wassermassen in Richtung der Küsten rauschten. Aber noch war es nicht so weit: Wenn Niederschlag fiel, dann in Form von Schnee. Von Jahr zu Jahr legte sich eine Schneeschicht auf die andere. Erst verdichtete sich der Schnee zu Firn – altem Schnee –, dann zu blauem Eis.
Über Hunderttausende von Jahren war so auf Grönland ein mehr als drei Kilometer hoher Eispanzer gewachsen.
Zwei Sommer lang hatte der Leiter des U.S. Greenland Ice Sheet Project Two (GISP2) damit verbracht, diese Stelle zu finden. Sie war ideal: Das sich ansammelnde Eis verbreitete sich von hier aus nach allen Seiten. Deshalb erwartete Mayewski, dass es selbst am Felsgrund noch intakt sei und nicht durch Bewegungen im Eispanzer deformiert war. Wenn alles klappte, würden sie deshalb an diesem Ort weit zurückreisen können durch die Klimageschichte, bis zu den Anfängen der jüngsten Eiszeit. Von Jahr zu Jahr zurück; in solch einer Auflösung hatte das vor ihnen noch niemand geschafft.
Für diesen Zweck stand hinter Mayewski eine weiße Kuppel, die wie ein Rieseniglu aussah. Aus ihr heraus ragte ein Turm von dreißig Metern Höhe. Er glich einem Ölbohrturm – nur wurde hier nach Eis gebohrt. Und zwar mit einem Schneidekopf, der innen hohl war und lange, dicke Stäbe von Eis barg. Wenn Mayewski die Kuppel betrat, fühlte er sich wie in einer Fabrik. Arbeiter holten einen Eisbohrkern aus der Maschine; sie mussten Atemschutzmasken tragen, denn um das Bohrloch zu stabilisieren, war eine Flüssigkeit nötig, die einem scharf in die Nase stieg und Kopfschmerzen verursachte.
Verließ Mayewski die Kuppel wieder, konnte er weit über die Eiswüste blicken. An manchen Tagen brach das Licht auf eine bestimmte Weise, und die Luft spiegelte sich. Dann konnte er in der Ferne einen weiteren Turm erahnen. Dort, 28 Kilometer entfernt, bohrten die Kollegen aus Europa.
Ursprünglich hatten Amerikaner und Europäer kooperieren wollen, aber das hatte sich zerschlagen. Ein Glücksfall, einerseits. Denn dank der Parallelbohrungen würden sich die Funde gegenseitig verifizieren lassen. Andererseits machte jene Entscheidung beide Teams zu Konkurrenten. Jedes Mal, wenn sich der achtzehn Meter lange Bohrer mithilfe eines Schneidekopfes in die Tiefe zwirbelte, um die nächste, fünf Meter lange Eisstange herauszuschneiden, dachte der GISP2-Chefwissenschaftler: »Oh mein Gott, das wird ein Wettlauf!« So erinnert er sich mehr als drei Jahrzehnte später in einem Videotelefonat.
Jeder wollte der Erste sein, der dem Geheimnis auf die Spur kam: Konnte das Klimasystem tatsächlich abrupt umschlagen? Jeder wollte der Erste sein, der seine Ergebnisse publiziert, der Wissenschaftsgeschichte schreibt. Und das konnte nun jeden Tag passieren, denn ihre Zeitreise durchs Eis näherte sich dem bislang letzten großen Klimawechsel vor mehr als 10.000 Jahren, dem Ende der sogenannten Jüngeren Dryaszeit. Einige Wissenschaftler nahmen damals bereits an, dass auch dieser Wechsel – neben dem Beginn jener Kälteperiode – abrupt verlaufen war. Aber dafür gab es nur Indizien, keine Beweise.
Erst seit den 1950er-Jahren konnten Anfangs- und Endpunkt der Jüngeren Dryas mithilfe der neuen Radiokarbonmethode grob abgesteckt werden. Demnach begann diese Phase der Erdgeschichte vor rund 11.000 Jahren und endete vor etwa 10.000 Jahren – und zwar beide Male »abrupt«.[16] Was genau allerdings »abrupt« hieß, blieb zunächst ebenso offen wie eine exaktere Eingrenzung der Dauer der Jüngeren Dryas, weil die Methode damals erst eine relativ geringe Genauigkeit erreichte.
Aber die Daten und Methoden verbesserten sich. In den 1960er- und 1970er-Jahren untersuchten Forscher Sedimentkerne aus der Tiefsee und aus Binnengewässern sowie Pollen, die in Mooren erhalten geblieben sind – so fanden sie heraus, dass sich das Klima schon innerhalb von Jahrhunderten wandeln kann. Außerdem begannen Europäer und Amerikaner zu jener Zeit, ein neues Klimaarchiv anzuzapfen, an dem auch Paul Mayewski arbeitete: Eis. Die Forscherteams bohrten in den Grönländischen Eisschild und verfolgten die darin eingeschlossenen Luftbläschen über mehr als 100.000 Jahre zurück. Auf diese Weise konnten sie Oszillationen im Klima identifizieren, deren Wechsel gerade mal ein oder zwei Jahrhunderte dauerten – darunter das Ende der Jüngeren Dryas. Noch immer gab es aber große Ungewissheiten. Unklar war etwa, ob es sich hierbei vielleicht bloß um lokale Phänomene handelte. Oder ob der Eisbohrkern, der tief aus dem Eispanzer geborgen wurde, nicht durch Druck und Bewegungen des Eises verzogen sein könnte.
Doch über die Jahre verdichteten sich die Funde, die auf Klimasprünge hindeuteten. Aus Tiefsee-Bohrkernen aus dem Golf von Mexiko ließ sich Mitte der 1970er-Jahre ein Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern pro Jahrzehnt am Ende der Jüngeren Dryas ablesen. Auf Grundlage weiterer Sedimentbohrkerne urteilte ein Wissenschaftler sogar, dass in der Vergangenheit Temperatursprünge von fünf Grad Celsius in weniger als fünfzig Jahren möglich gewesen sein könnten. »Für viele Wissenschaftler waren solche Spekulationen nach wie vor kaum besser als Science-Fiction«, schreibt der Wissenschaftshistoriker Spencer Weart, der sich wie kein Zweiter mit der Geschichte der Klimaforschung beschäftigt hat. »Die Hinweise auf abrupte Veränderungen, die in gelegentlichen Studien auftauchten, mögen im Nachhinein stark erscheinen, waren aber damals nicht besonders überzeugend.«[17]
Als Maß der Dinge galten weiterhin Tiefseesedimente aus dem Atlantik. Hunderte Bohrkerne waren seit den 1970er-Jahren geborgen worden. Besonders interessierte die Wissenschaftler die Überreste planktonischer Foramiferen, Einzellern, die Kalk bilden. Weil ihre Schalen sehr empfindlich auf Klimaveränderungen reagieren, eignen sie sich gut als Klimaarchive. Die Sauerstoffisotopen-Analyse ergab relativ gleichmäßige Verläufe früherer Klimaübergänge.[18] Zumindest für die trägen Wassermassen der Ozeane lautete die Schlussfolgerung also, dass sie sich nur über Jahrtausende verändern konnten.
Auch Computermodelle kamen zu diesem Ergebnis. Sie waren erst in den 1960er- und 1970er-Jahren von Syukuro Manabe entwickelt worden, der an der Princeton University in New Jersey forschte und dem dafür 2021 gemeinsam mit dem Hamburger Klaus Hasselmann und dem Italiener Giorgio Parisi der Nobelpreis verliehen werden sollte. Für diese Methode braucht es unter anderem einen Großrechner und eine Software, die ein mathematisches Abbild des Klimasystems erschafft, also die Welt nachbaut: Ozeane, Land, Atmosphäre. Das Modell simuliert dann, wie alle Teile miteinander interagieren und sich das Klima insgesamt verändert. Sie erlauben so sowohl Einblicke in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.
Die Sache schien klar: Das Klima wandelt sich nur relativ gemächlich. Von dieser Konsensmeinung scherten nur wenige Freigeister aus, etwa der US-Ozeanograf Wally Broecker (mehr zu ihm in Kapitel 3). Er kritisierte, dass sich die Wissenschaftler »einlullen« ließen. Ihre Klimamodelle seien so konstruiert, dass sie nur graduelle Klimaveränderungen zuließen – das wiege die Forschung in trügerischer Sicherheit.
Wie trügerisch diese war, offenbarte sich im Sommer 1992 in Zentralgrönland.
In einem der tief ins Eis gefrästen Labore, sechs Meter unterhalb der Schneedecke, saß Richard Alley und starrte auf einen Eisbohrkern. Dieser wanderte von einem Wissenschaftler zum nächsten; jeder analysierte ihn mit einer anderen Methode. Der Geowissenschaftler mit dem Rotbart und der Hornbrille trug Thermojacke und Mütze, denn die Temperaturen in dem Eiskeller wurden auf unter minus zwanzig Grad Celsius gehalten, damit sich das Eis der Bohrkerne nicht veränderte. Jedes Mal, wenn beim Durchleuchten und Analysieren eine neue Sommer-Eisschicht an Alley vorbeizog, kennzeichnete er das mit einem Bleistift auf einem knapp einen Meter langen Diagrammblatt. Er markierte die Feinheit der Kristallkörner, die Größe der Luftblasen und Risse. Er markierte, wenn die Schichten tiefschwarz wurden (Vulkanausbrüche) oder grün (Waldbrände). Für ihn war es nicht bloß eine Eisstange, die an ihm vorbeizog, sondern eine »Zeitmaschine«.[19]
Irgendwann hörte er neben sich einen Aufschrei: »Wow!«
Dort saß Ken Taylor, der zwei Elektroden ins Eis gesteckt und an eine Spannungsquelle angeschlossen hatte, um die Leitfähigkeit zu überprüfen. Eigentlich ist Eis kein besonders guter elektrischer Leiter. Aber je mehr Säuren es enthält, desto besser fließt der Strom. Und da der Staubgehalt und damit auch der Säuregehalt von Jahreszeit zu Jahreszeit schwanken, konnte der Geophysiker vom Wüstenforschungsinstitut in Reno die Abfolge der Jahre im Eis anhand einer grünen Schlangenlinie am Computerbildschirm verfolgen. Irgendwann ging Taylor dazu über, die leitfähigen Schichten als hohen Ton über seine Computerlautsprecher abzuspielen und die weniger leitfähigen als niedrigen Ton. Dank dieser Spielerei konnte er die Füße hochlegen und der Melodie der jüngeren Klimageschichte lauschen.
Als der Strom in jenem Moment durchs Eis floss, passierte etwas Außergewöhnliches, etwas, das sich von jeder einzelnen Eisschicht, von jedem einzelnen der zurückliegenden rund 11.700 Jahre unterschied.[20]
Als Alley seinen Kollegen neben sich aufschreien hörte, war er noch mit seinem eigenen Eiskern beschäftigt, machte Notizen. Ob er nun den tiefen Ton aus den Lautsprechern gehört hat oder nicht, würde er später nicht mehr sagen können. Als er jedenfalls das Eis zur Seite packte und der Kern von Taylor auf seinen Lichttisch hinüberrollte, wusste er, was los war – und auch, warum sich immer mehr Kollegen hinter ihnen versammelten und über die Schultern blickten, darunter auch Paul Mayewski.
Bislang hatte Alley immer relativ dicke Jahresschichten im Eis vor sich gehabt. Es musste in jenen Zeiten also viel geschneit haben, das heißt, es musste viel Wasser vom Ozean nach Grönland transportiert worden sein, ergo musste es sich um ein relativ warmes und feuchtes Klima gehandelt haben – das Klima des Holozäns, in dem sich der Mensch schlussendlich vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern entwickelt hat.
Zwar wurden die Schichten mit zunehmender Tiefe immer dünner, weil immer mehr Eis auf sie drückte, aber das geschah relativ gleichmäßig. Als Alley aber Eis aus einer Tiefe von 1.678 Metern vor sich hatte, verringerte sich die Dicke der Jahresschichten auf einmal dramatisch: Einer etwas dünneren folgten eine kaum halb so dünne und schließlich eine noch dünnere Schicht. Und dabei sollte es für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte bleiben. »Lange Zeit passierte überhaupt nichts«, erinnert er sich. »Und dann ging alles die Klippe hinunter.«
Alley nahm seinen Stift und setzte ein Ausrufezeichen aufs Papier. Was er da vor Augen hatte, war genau das, was Nikolaj Hartz und Vilhelm Milthers fast hundert Jahre zuvor in einer dänischen Tongrube das erste Mal gesehen hatten: die Jüngere Dryas. Die bislang letzte große Kältephase auf der Erde. Also zumindest schon mal deren Ende. Im Gegensatz zu den beiden Dänen konnte Alley den Klimawechsel hinein ins derzeitige Holozän nun datieren – und zwar genau. Neben der Dicke der Schichten half ihm auch die Farbe des Eises: Es machte ziemlich abrupt einen trüben, milchigen Eindruck an seinem Lichttisch, was auf einen erhöhten Staubtransport infolge stärkerer Winde schließen ließ. Und das war typisch für das kältere, trockene Klima der Jüngeren Dryas. Die Erwärmung am Ende dieses Erdabschnitts, die uns aus der langen Eiszeit in unsere derzeit herrschende Warmzeit hineinkatapultierte, hatte sich demnach in nur drei Jahren vollzogen. Und die größte Veränderung davon fand in nur einem Jahr statt.
Aus dem Verhältnis der Sauerstoffisotope ließ sich auch ablesen, wie warm es zu einem bestimmten Moment war, als Schnee auf den Grönländischen Eisschild fiel. Demnach endete die jüngste Eiszeit mit einem Temperatursprung von rund zehn Grad Celsius in Grönland.
»Wow!«, rief nun auch Alley. Seine Stimme wurde immer höher, während Ken Taylor einstimmte und mit den Armen durch die Luft wirbelte: »Wir haben es! Wir haben es! Wir haben es!«
Nach Jahrzehnten der Suche hatten sie den Beleg nun vor sich: Das Klima war fähig, wirklich rapide umzuschlagen. Das, so waren beide in diesem Moment überzeugt, würde ihre Karriere verändern. »Es war so aufregend!«, erinnert sich Alley.
Dann wurden die beiden Eisforscher still. Sie sahen sich an. Was hieß das für die Welt? Das Klima, so waren sie nun überzeugt, konnte sich schnell und radikal verändern: Nicht in Generationen, sondern in Jahren. »Was bedeutet das für die Menschen?«, fragte sich Alley. »Meine Güte!«
Und wie ging es weiter? Was erzählte die weitere Reise zurück in die Vergangenheit? Ganz so schnell, wie die Jüngere Dryaszeit endete, hatte sie zwar nicht begonnen, stellten Alley und seine Kollegen fest, aber immerhin noch in wenigen Jahrzehnten.[21]
Diese Klimaausschläge blieben beileibe nicht die einzigen, die sich im Eisarchiv Grönlands fanden (mehr dazu in Kapitel 3). Auf Dutzende weitere stießen sowohl Amerikaner als auch Europäer – und die Ergebnisse ihrer getrennten Bohrungen passten erstaunlich gut zusammen. Das bedeutete: Das Klima verhielt sich während der jüngsten Eiszeit keineswegs so ausgeglichen wie bis dahin angenommen, sondern ziemlich launisch.
Um das in einen größeren Zeithorizont einzuordnen: Vor rund 2,7 Millionen Jahren ist die Welt in ihr aktuelles Eiszeitalter eingetreten – mit dem Begriff sind sehr lange Epochen in der Erdgeschichte gemeint, während derer es Eiskuppen an beiden Polen gibt. Innerhalb dieser Eiszeitalter wechseln sich Warm- und Kaltphasen ab. In den Kaltzeiten (umgangssprachlich und in diesem Buch auch »Eiszeit« genannt, der Fachbegriff lautet »Glazial«) dehnen sich die Gletscher aus, in den Warmzeiten (Fachbegriff: »Interglazial«) ziehen sie sich zurück. Aktuell, seit rund 11.700 Jahren, befindet sich die Welt in einer Warmzeit (innerhalb eines Eiszeitalters). Den Grundtakt für die Wechsel zwischen den Phasen geben die sogenannten Milanković-Zyklen vor: In periodischen Abständen verändert sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne, und damit verändert sich auch der Einfallswinkel der Sonnenstrahlung auf der Nord- und Südhalbkugel, was wiederum das Wachstum oder Abschmelzen großer Eisschilde einleitet.
Während die orbitale Ausrichtung der Erde für diese langfristigen Klimaveränderungen auf dem Planeten sorgten, also die Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten, musste etwas anderes die abrupten Temperatursprünge innerhalb dieser Perioden eingeleitet haben. Alley vergleicht diese beiden sich auf unterschiedlichen Zeitskalen abspielenden Klimaphänomene mit einem Menschen, der in einer Achterbahn fährt und derweil an einem Bungeeseil hoch- und runterschnellt.
Über Jahre wurden die Eisbohrkerne weltweit in Laboren analysiert. Weitere wurden aus anderen Teilen Grönlands und in separaten Expeditionen aus dem Eispanzer der Antarktis gezogen. Bessere Instrumente erlaubten, das uralte Eis immer genauer zu analysieren. Die Rechenkapazität der Computer erhöhte sich, was komplexere und höher aufgelöste Klimasimulationen erlaubte. All das festigte die Vorstellung der Forschung, dass abrupte Klimaänderungen in der Vergangenheit sogar eher die Norm waren als eine Ausnahme. Nur in zwei Zeitabschnitten erwies sich das Klima für einen längeren Zeitraum als stabil: während des Höhepunkts der letzten Eiszeit sowie in der jüngsten Warmzeit, dem Holozän.
Nun lag die Frage nahe: Was hat die abrupten Klimaveränderungen eigentlich verursacht? Was war der Mechanismus dahinter? Erst wer das herausgefunden hat, kann Antwort auf eine noch drängendere Frage geben: Ist womöglich der Mensch in der Lage, einen Sprung im Klima auszulösen?
Paul Mayewski fasziniert dieser Gedanke bis heute, aber er lässt ihn auch erschaudern. »Möglicherweise stehen wir an einer Art ökologischem Abgrund und sind kurz davor, ins Nichts zu treten, ohne es zu wissen«, schrieb der wissenschaftliche Leiter der US-Bohrkampagne zehn Jahre nach der epochalen Entdeckung. »Vielleicht ist es an der Zeit, das Klimasystem völlig neu zu betrachten.«[22]
Kapitel 3Unschöne Überraschungen im Treibhaus
»Das Klima ist ein wütendes Biest,
und wir pieksen es noch mit Stöcken an.«
Wallace Broecker, Ozeanograf
Als Wallace »Wally« Broecker von den Erkenntnissen aus Grönland erfuhr, war er elektrisiert. Begierig nahm der US-Ozeanograf mit dem zerzausten Haar und der breiten Nase alles auf, was ihm die Expeditionsteilnehmer schickten oder am Telefon berichteten. Er hatte maßgeblich dafür gesorgt, dass Amerikaner und Europäer auf dem Gipfel des Grönländischen Eisschilds bohrten, und zwar getrennt voneinander. Auch später zog er bei dem Projekt die Fäden im Hintergrund. Im Grunde hatte er selbst das größte Interesse an einem Erfolg: Kaum jemand hatte sich über die Jahre so viele Gedanken darüber gemacht, was hinter den abrupten Klimasprüngen der Jüngeren Dryas stecken mochte. Selbst aufs Eis brauchte er dafür gar nicht zu gehen, fand er, zumal bei minus zwanzig Grad am Ende der Welt zu frieren genauso wenig seine Sache war, wie sich durchs Dickicht zu schlagen und dabei Dreck abzubekommen.
Er sei wie ein Magnet gewesen, erzählt seine Kollegin Sidney Hemming vom Lamont-Doherty Earth Observatory in Palisades im US-Bundesstaat New York. »Er wollte immer der Erste sein, der neue Ergebnisse zu sehen bekam. Er war die zentrale Figur, um die Daten miteinander zu kombinieren und Schlussfolgerungen für die Welt zu ziehen.«
Mit den Bohrkernen aus dem grönländischen Eis war jedenfalls allen klar, dass sich das Klima so abrupt ändern konnte, wie es selbst ein Vordenker wie Broecker nicht für möglich gehalten hatte. Die Bohrkerne der Amerikaner und Europäer nannte er die »allerwichtigste und herausragendste paläoklimatische Aufzeichnung«. Aber warum es zu den Klimasprüngen gekommen war und was diese für uns heute bedeuten, blieb zunächst offen.
Broecker liebte diese Momente. »Das produktivste Denken«, sagte er einmal, »stellt sich ein, wenn man realisiert, dass etwas falsch ist, was man bis dahin für eine Wahrheit gehalten hat, und sich deshalb alles auflöst, was davon abhängt. Das verwirrt und bringt einen dazu, das Problem zu überdenken.« Nun tat er, was er immer in solchen Situationen tat: Er setzte sich an den Schreibtisch in seinem Büro im Erdgeschoss des Lamont-Doherty Earth Observatory, einer der wichtigsten US-Forschungsstätten zum Klima, sah aus dem großen Fenster hinaus und dachte nach.
Einen Computer besaß er nicht. Der behindere das eigene Denken und verleite zu Kurzschlüssen, sagte er einmal. Weil er Legastheniker war, korrigierten Mitarbeiter seine Manuskripte und E-Mails und tippten sie ein. Broecker arbeitete mit Bleistift und Papier und das sehr schnell. »Ich kam mir im Gegensatz zu ihm immer sehr langsam vor«, erzählt seine frühere Kollegin Dorothy Peteet, eine Biologin, die Ende der 1980er-Jahre in einem Sumpf nahe des Instituts Spuren der Jüngeren Dryas entdeckt und in der Folge nachgewiesen hatte, dass jene abrupte Klimaänderung ein globales Phänomen war. »Wally war immerzu damit beschäftigt, Karten oder Schaukästen zu malen oder Leute anzurufen.«
Broecker war ein Kauz und Witzbold, der andere mit seiner Energie ansteckte, aber auch unerbittlich war, wenn er träges oder umständliches Denken witterte. Manche beschreiben ihn als »Raubein«, der selbst angesehene Kollegen so zusammenstauchte, dass sie die Arbeitsstelle wechselten. Einmal, erinnert sich Richard Alley, habe er Broecker erzählt, wie er sich gerade mit der Schwierigkeit beschäftigte, einen möglichen Kollaps des Westantarktischen Eisschilds zu modellieren. Daraufhin entgegnete dieser: »Komm schon, Alley, hör auf mit dem Scheiß!«
»Wir kamen gut miteinander aus«, erzählt Alley heute. »Aber er konnte auch sehr ungeduldig mit Leuten werden, wenn die ihm nicht in aller Kürze erklärten, worum es ging.«
Broecker hatte in den 1950er-Jahren in einer Villa in Palisades als einer der Pioniere der Radiokarbondatierung seine Karriere begonnen.[23]