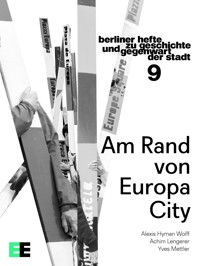
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EECLECTIC
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt
- Sprache: Deutsch
Nördlich des Berliner Hauptbahnhofs wächst seit 2012 ein neuer Stadtteil mit mehreren hunderttausend Quadratmetern Bürofläche und 3.000 Wohnungen: die Europacity. Das riesige städtebauliche Projekt auf ehemaligem Bahngelände wird von privaten Immobilienunternehmen in enger Partnerschaft mit dem Berliner Senat realisiert. Die Europacity steht für eine Neoliberalisierung der Stadt, die vorhandene nachbarschaftliche Strukturen zerstört sowie Ausschluss und Verdrängung produziert. Das Heft erzählt die Entstehungsgeschichte der Europacity, welche bis kurz vor ihrer Fertigstellung so gut wie keine öffentliche Auseinandersetzung hervorgerufen hat. Eine Stimmencollage dokumentiert die Sicht auf die Europacity aus der Perspektive der angrenzenden Stadtviertel. Im Textbeitrag der Politologin Teresa Pullano geht es um die Zusammenhänge zwischen einem historisch-kulturellen Europabild und Formen des ökonomischen und politischen Kapitals, so wie sie sich in der Europacity zeigen. Die Recherchen und Erfahrungsberichte wurden im Rahmen des künstlerischen Projekts „Am Rand von EuropaCity“ (2018/19) erarbeitet, welches durch Prozesse des ‚kollektiven Zuhörens‘ Anwohner*innen, Künstler*innen und Theoretiker*innen miteinander ins Gespräch brachte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt #9
Am Rand von EuropaCity
Yves Mettler, Alexis Hyman Wolff, Achim Lengerer (Hg.)
Nördlich des Berliner Hauptbahnhofs wächst seit 2012 ein neuer Stadtteil mit mehreren Hunderttausend Quadratmetern Bürofläche und 3.000 Wohnungen: die Europacity. Das riesige städtebauliche Projekt auf ehemaligem Bahngelände wird von privaten Immobilienunternehmen in enger Partnerschaft mit dem Berliner Senat realisiert. Die Europacity steht für eine Neoliberalisierung der Stadt, die vorhandene nachbarschaftliche Strukturen zerstört sowie Ausschluss und Verdrängung produziert.
Das Heft erzählt die Entstehungsgeschichte der Europacity, die bis kurz vor ihrer Fertigstellung so gut wie keine öffentliche Auseinandersetzung hervorgerufen hat. Eine Stimmencollage dokumentiert die Sicht auf die Europacity aus der Perspektive der angrenzenden Stadtviertel. Im Textbeitrag der Politologin Teresa Pullano geht es um die Zusammenhänge zwischen einem historisch-kulturellen Europabild und Formen des ökonomischen und politischen Kapitals, so wie sie sich in der Europacity zeigen.
Die Recherchen und Erfahrungsberichte wurden im Rahmen des künstlerischen Projekts Am Rand von EuropaCity (2018/19) erarbeitet, das durch Prozesse des ‚kollektiven Zuhörens‘ Anwohner*innen, Künstler* innen und Theoretiker*innen miteinander ins Gespräch brachte.
Zander, Weißfisch, Barsch, Hecht!
Trauer des Zugangs!
Durchlässigkeit definiert Grenzen
Was bin ich davor und danach?
Wer bin ich auf der einen und
der anderen Seite?
Es hat mit mir nichts zu tun
Ich nutze das einfach, ich hatte keine Zeit,
es war das Einzige, was ich gefunden habe
We can’t see what’s right in front of us
How can they make themselves invisible to us?
Mentale Grenzen
Unwütend, unkritisch
Die Stadt als Dekoration
Schönheit ist, wenn wenig Elend zu sehen ist
Mit der Zeit kann man sich daran gewöhnen
Etwas sehen können
Emotionale Bindung
Europa löst große Erwartung aus
Exploration ist Teil des Lebens
Das Entdecken wird wortwörtlich verbaut
Ein teures Europa
Mitten in Berlin und niemand beachtet es richtig
Who cares?
Irgendwann wird es dröhnen
Leer und voll gleichzeitig
Die Preissteigerung ist vorprogrammiert
Zander, Weißfisch, Barsch, Hecht!
Wer kann hier wohnen?
Wie versteht sich hier die Zeit?
Du wusstest halt genau, du wirst hier nie wieder zurückkommen können
Früher kam man rein, Hinterhof, entdecken
Fertig! Trauer des Zugangs!
Durchfahrtsraum
Baustelle
Umweltverlärmung
Verdrängung
Es geschieht einfach
Europacity!
Ich schwebe in Beton
Europacity!
Kulissenbau und Scheinmaterial
Europacity!
Investor friendly architecture
Europacity!
Namen tragen Erwartungen
Europacity!
Ausgrenzung tut am Bauch weh
Europacity!
Ein Stück Land, das werden sollte
Zander, Weißfisch, Barsch, Hecht!
Zander, Weißfisch, Barsch, Hecht!
Dieser Text wurde auf Grundlage der im Rahmen des Workshops zum kollektiven Zuhören am 1. Dezember 2018 entstandenen Textfragmente von Gilles Aubry verfasst und diente während der künstlerischen Intervention am 26. Mai 2019 als Skript für einen mehrstimmigen Chor.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Alexis Hyman Wolff, Achim Lengerer, Yves Mettler
Europacity: Namen tragen Erwartungen!
Yves Mettler
Unbequeme Grenzen
Alexis Hyman Wolff
Stimmencollage
Am Rand von EuropaCity oder die unmögliche Erfahrung
Teresa Pullano
Soundarchiv
Gilles Aubry
,Trauer des Zugangs‘, 25’01’’, Soundcollage von Gilles Aubry, zusammengestellt aus dem Audiomaterial, das während des Projekts Am Rand von EuropaCity entstanden ist.
Europaplatz, 2019
Einleitung
Alexis Hyman Wolff, Achim Lengerer, Yves Mettler
Seit den neunziger Jahren stehen Städte unter dem Druck der sich in Europa verbreitenden neoliberalen Standortpolitiken. Von der Finanzwelt vorangetrieben, den nationalen Regierungen und der EU getragen, schlug sich die neoliberale Agenda in den jeweiligen Ländern unterschiedlich nieder. In deutschen Städten wurden mit der Privatisierung der Deutschen Bahn viele defunktionalisierte Industrie- und Bahnflächen der Verwertung zugeführt. Die größtenteils privatwirtschaftlich bestimmte Stadtentwicklung verschärft heute die soziale Krise dieser innerstädtischen Bereiche. In diesem Kontext nimmt der über 40 Hektar große, neue Stadtteil namens Europacity, der nördlich des Berliner Hauptbahnhofes gebaut wird und bis 2024 fertiggestellt werden soll, die Rolle eines emblematischen Beispiels dieser Krise ein. In der Europacity spiegeln sich die ökonomischen und politisch widersprüchlichen Kräfte eines urbanen Investitionsmodells, dessen abstrakte Versprechen sowie konkrete, vielfältig ausufernde Konsequenzen für die Stadt Berlin.
Bemerkenswert an dieser mitten in der Stadt gelegenen Baustelle, deren Fläche fast doppelt so groß ist wie der Potsdamer Platz, scheint ihre ‚dröhnende öffentliche Lautlosigkeit‘ zu sein. Die Verhandlung des städtebaulichen Vertrags zwischen dem Berliner Senat, der Deutschen Bahn und später dem Immobilienunternehmen CA Immo fanden völlig vorbei an einer breiteren medialen Öffentlichkeit statt. Seither wird der im Jahr 2008 verabschiedete Masterplan für das Gebiet kontinuierlich umgesetzt. Auch konnte die Europacity nur durch die von der Immobilienwirtschaft und der Senatsverwaltung geförderte Erzählung einer mit der Stadt unverbundenen Brache durchgesetzt werden – einer abgeschnittenen, vermeintlich geschichtslosen Leerstelle, die es zu ‚füllen‘ galt.
Durch die Architektur, die Verkehrsplanung und die Abwesenheit von öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Schulen oder Theatern verstärkt das Bauvorhaben die durch die Geschichte und Topografie des Geländes bedingte städtische ‚Insellage‘.
Im Jahr 2017 umkreisten wir diese riesige Baustelle mit der Frage „Was ist die Europacity?“ und stellten im Gegensatz hierzu fest: Die Europacity wird gerade nicht auf einer leeren Brachfläche und in einem städtischen Vakuum gebaut, sondern grenzt inmitten der gewachsenen Stadt an die Stadtteile Mitte, Wedding und Moabit. Sie wächst zwischen dem Bayer-Areal und der Charité, zwischen dem Landesamt für Einwanderung und dem Sozialgericht. Am Rand der Europacity befindet sich die Scharnhorststraße, auch das ‚Ende der Welt‘ genannt, der Sprengelkiez und die Lehrter Straße.
Um die Europacity und ihre Nachbarschaften verstehen und verorten zu können, nahmen wir uns vor, den Menschen, der städtischen Umgebung und den hier neu entstehenden sozialen Grenzlinien ‚zuzuhören‘. In diesem Zusammenhang erschien uns die Namensgebung durch die im Jahr 2001 für die Veräußerung der Bahnimmobilien gegründete Vivico Real Estate und die arbiträre Weiterverwendung des Europabegriffs durch die aus der Vivico hervorgegangene CA Immo provokant. Denn die sozialen Ausschlussmechanismen, die sich an den hohe Mieten und der signifikanten Anzahl an Eigentumswohnungen in der Europaciy zeigen, verweisen indirekt auf die Politiken des Ausschlusses und der Ausgrenzung an den EU-Außengrenzen.
Diese doppelte Metapher der Ausgrenzung rund um ‚Europa‘ wurde zur titelgebenden Idee und Fragestellung unseres Projektes Am Rand von EuropaCity: Was befindet sich an den Grenzen der Europacity, wer wird ein- und wer wird ausgeschlossen durch dieses Großprojekt in der Mitte der Stadt? Zwischen März 2018 und dem 26. Mai 2019, dem Tag der Europawahl, organisierten wir eine Reihe von öffentlichen Spaziergängen, Workshops und künstlerischen Aktionen. Es ging uns darum, in Zusammenarbeit mit Nachbar*innen der Europacity und von uns eingeladenen Theoretiker*innen einen Raum für die kritische Thematisierung dieses neuen Stadtteils zu öffnen.
Am Rand von EuropaCity nimmt die Stadt, wie von Henri Lefebvre 1968 in Le droit à la ville formuliert, als ein sich immer veränderndes „gemeinschaftlich produziertes soziales Artefakt“1 wahr, deren Erzählungen nicht von vornherein festgelegt sind, sondern von jedem einzelnen gemeinsamen Spaziergang, in jeder Begegnung und jedem Gespräch erzeugt werden. Für uns ist die Stadt niemals eine abgeschlossene Entität. Deshalb muss man sie – auch gerade als aktive Nachbarschaft – ständig neu betrachten und interpretieren, um das Feld des Handelns nicht anderen zu überlassen. Denn eine Stadt ist von vielen und für viele gemacht; sie ist das Ergebnis unzähliger täglicher Mikrointeraktionen: Alle nehmen auf die ein oder andere Art an der Stadt teil und prägen hierdurch die städtische Gesellschaft. Sich die Zeit zu nehmen, dem, was die Stadt bietet, ihrer urbanen Kakofonie zuzuhören, und nicht einfach nur den vorgegebenen Pfaden zu folgen, erlaubte es, sich den Effekten und Konsequenzen einer Stadtplanung, die ein Investorenprojekt von der Größe der Europacity zugelassen und begrüßt hat, anzunähern.
Dieses Heft entstand aus dem Wunsch heraus, unserem Projekt des ,Zuhörens‘ an den Rändern der Europacity ein Fortwirken zu ermöglichen und gleichzeitig die Reflexion über alternative Räume und nachbarschaftliche Initiativen weiterzuführen. Die Zusammenarbeit mit den Berliner Heften zu Geschichte und Gegenwart der Stadt ermöglicht es uns, die Europacity in den Diskurs über Berlins aktuelle Entwicklungen einzubringen. Diese Ausgabe bietet deshalb eine Reihe von Beiträgen, die helfen sollen, die Europacity kritisch zu situieren.
Yves Mettlers Text Europacity: Namen tragen Erwartungen! beschreibt die Entstehungsgeschichte der Europacity – von der Geschichte des Geländes über die unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen bis hin zu den beteiligten Akteur*innen und deren Agenden, die Mettler sowohl ästhetisch als auch sozio-politisch einzuordnen versucht. Zusätzlich führt er in das künstlerische Projekt Am Rand von EuropaCity ein. Der Beitrag Stimmencollage beinhaltet Zitate von Anwohner*innen und Teilnehmenden, die während der Veranstaltungen, den Spaziergängen und in weiteren Interviews aufgenommen wurden. Der Text Unbequeme Grenzen von Alexis Hyman Wolff reflektiert die mit Am Rand von EuropaCity gemachten Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden. Im abschließenden Essay Am Rand von EuropaCity oder die unmögliche Erfahrung beschreibt die Politologin und Philosophin Teresa Pullano anhand von Jacques Derridas Text L’autre cap von 1991 die Zusammenhänge zwischen der Konzeption eines historisch-kulturellen Europabildes und den Formen ökonomischen und politischen ‚Kapitals‘, wie sie sich in der Europacity zeigen. Zwei Fotostrecken vermitteln einerseits einen bildlichen Eindruck der Europacity und ihrer Ränder in den Jahren 2008 bis 2021 und dokumentieren andererseits die im Rahmen von Am Rand von Europa-City entstandene Plakatserie sowie die künstlerische Intervention am Tag der Europawahl 2019.
Am Rand von EuropaCity konnte nur durch die Unterstützung der vielen Projektbeteiligten sowie an den Veranstaltungen Teilnehmenden realisiert werden, denen wir hier unseren herzlichsten Dank ausdrücken möchten. In erster Linie bei der sich früh herausgebildeten Kerngruppe unter Beteiligung des Künstlers Uwe Bressem, des Betreibers des Café Moab Martin Pohlmann, von Jürgen Schwenzel und Susanne Torka vom B-Laden, des Weddingers Norbert Oblotski und von Beate Wild, Wissenschaftlerin am Museum Europäischer Kulturen. Weiterhin gilt unser Dank für die gute Zusammenarbeit der Kulturfabrik, insbesondere Thomas Martin, Dr. Jutta Schramm und Robin Hirsinger, Silvia Raco vom Lehrter Café sowie Peter Kapsch vom Moabiter Ratschlag. Für ihre in den Interviews geteilten Einsichten bedanken wir uns bei Marion Pottmeier vom Kleinen Laden, bei Matthias Sauerbruch, Architekt an der Lehrter Straße, und Claudia Schwarz vom SprengelHaus Wedding. Für ihre Beiträge im Rahmen des Projektes danken wir Manuela Bojadžijev, Professorin am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM), Rainer Hehl, Professor für Entwerfen und Baukonstruktion am Institut für Architektur der Technischen Universität Berlin, Teresa Pullano, Professorin am Europainstitut der Universität Basel, und Claudia Weber, Professorin für Europäische Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder). Wir bedanken uns zudem bei Claudia Firth für die Vorbereitung und Durchführung des Workshops zum kollektiven Zuhören in der Kulturfabrik Moabit sowie bei Niina Lehtonen Braun, Stella Braun, Olivia Mettler und Alexander Wolff für die Mitgestaltung der Plakate beim Plakat-Workshop. Unser Dank gilt auch den Berliner Heften zu Geschichte und Gegenwart der Stadt und dem Verlag EECLECTIC. Für die Förderung des Projektes danken wir der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Schlussendlich geht unser Dank an den Soundkünstler Gilles Aubry, der alle Phasen von Am Rand von EuropaCity aufgenommen und archiviert hat.
1 Henri Lefebvre, Das Recht auf Stadt, Hamburg 2016, S. 82.
Tegeler Straße/Lynarstraße, 2018
Europacity: Namen tragen Erwartungen!
Yves Mettler
Der Fall der Berliner Mauer im November 1989 bedeutete das Ende des Kalten Krieges. Im Zuge dessen etablierte sich in Europa der Neoliberalismus, und die Städte entdeckten sich als touristische Attraktionen neu, wie etwa Barcelona mithilfe der Olympischen Spiele 1992. Die Städte befinden sich seither im Wettbewerb um Sichtbarkeit und Attraktivität. Politik und Wirtschaft sind darin eng verzahnt, indem die Regierungen diese Konkurrenz sowohl im eigenen Land wie auch im globalen Kontext anheizen – ein Phänomen, das man unter dem Begriff Standortpolitik1 zusammenfassen kann. 2006 verwandelte sich Berlin von einer historischen Hauptstadt, von einem Geheimtipp zu einer globalen Hauptstadt:2 ein Knotenpunkt der globalen Ökonomie, Kultur und Politik und damit auch der globalen Investoren.3 Es war das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Zu diesem Anlass erfand Berlin Public Viewing, welches das Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni zu einer gigantischen Sportbar werden ließ. Und es war das Jahr, in dem die Deutsche Bahn unter großem politischen Druck den Bau des neuen Hauptbahnhofs fertigstellte.4 Der südlich vor dem Bahnhof gelegene Platz, der auf das Kanzleramt und den Reichstag blickt, behielt den Namen Washingtonplatz, den er im Jahr 1932 zu Ehren des ersten US-amerikanischen Präsidenten verliehen bekommen hatte. Die von verschütteten Gleisen befreite Nordseite erhielt den Namen Europaplatz, laut eines Beschlusses der Bezirksverordnetenversammlung Tiergarten vom 15. Oktober 1998. Ausgehend vom Europaplatz und dem nördlich davon entwickelten Areal namens „Europacity“ möchte ich im Folgenden zeigen, wie in der aus dem wiedervereinigten Deutschland neu hervorgegangenen Hauptstadt Berlin das Kapital5 seinen Platz einnahm, oder eher, wie sie durch dieses eingenommen wurde, und was diese Geschichte Berlins von Europa erzählt.
Europaplatz, 2007
Woher kommt die Europacity?
Ein versiegeltes Experimentierfeld
Wie ist dieses Areal, das „geografisch im Zentrum des Bezirks Mitte liegt, aber bisher als weitläufige Bahnbrache die Stadtteile Moabit, Mitte und Wedding sehr stark trennt“,6 in das fast 90 Fußballfelder passen würden, entstanden? Warum bekam es in der Stadt so wenig Aufmerksamkeit? Als der Zweite Weltkrieg begann, befanden sich an dieser Stelle zwei der vielen Bahnhöfe in Berlin, der Hauptstadt, die damals mehr Einwohner*innen hatte als heute: der Hamburger Bahnhof, 1846 eröffnet, und gleich daneben der 22 Jahre später erbaute, deutlich größere Lehrter Bahnhof. Die beiden Bahnhöfe waren Kopfbahnhöfe, die Gleise verließen die Stadt Richtung Norden. Rund um die Gleise und in Verbindung mit dem 1859 fertiggestellten Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal entstanden dicht an dicht sowohl wichtige Industrieanlagen als auch Militäreinrichtungen wie Kasernen, ein Krankenhaus und ein Übungsgelände. Aus strategischen Gründen war das gesamte Areal während des Zweiten Weltkriegs Zielscheibe alliierter Bombenangriffe. Nach 1945 wurde der Lehrter Bahnhof vorübergehend wieder in Betrieb genommen, bevor er 1951 endgültig schloss. Seine Überreste wurden 1957 gesprengt und dienten als Material für den Wiederaufbau der Stadt. Ab 1961 folgte die Mauer an dieser Stelle dem Kanal. Die Bahnhöfe und Gleise lagen von nun an in West-Berlin, obwohl ein Teil der Fläche als Reichsbahngelände juristisch der DDR unterstand. So kam es, dass sich plötzlich am Rand von West-Berlin, gegen die Mauer gedrängt und doch im Herzen der geteilten Stadt, ein quasi brachliegendes Bahngelände befand. Die Deutsche Bahn führte Reparaturen an den Gleisen durch, um hier notbehelfsmäßig einen Güterbahnhof zwischen der Frontstadt und Westdeutschland zu betreiben. Nach dem Fall der Mauer folgte sehr bald die Stilllegung des Güterbahnhofs. Das Gelände wurde lediglich als Container-Umschlagstelle genutzt, es war ein Ort für Zirkusveranstaltungen und Rummelfeste, wie das Deutsch-Amerikanische Volksfest, welches bis 2015 jedes Jahr stattfand. Kinder (und Erwachsene) aus den angrenzenden Nachbarschaften spielten auf den Brachflächen, konnten hier den urbanen Raum erkunden und mit ihm experimentieren, während sich Besetzer*innen und andere Stadtnutzer*innen den vergessenen Kornversuchsspeicher aneigneten. Zwischen den Lagerhallen entstanden Autowerkstätten und verschiedene Kleingewerbe.7
Satellitenbild, Heidestraße, 2018
Mit der Entscheidung des Berliner Senats, ein Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof zu eröffnen, wurde 1996 ein neues Kapitel in der Geschichte des Areals aufgeschlagen. Parallel dazu begannen Künstler*innen und Kulturtreibende, die auf dem Gelände verbliebenen Mietshäuser und Fabrikgebäude zu nutzen. Seit 2002 ist Manfred Bartling Eigentümer und Betreiber des 700 qm großen Haus Kunst Mitte, einem der letzten Altbau-Wohnhäuser an der Heidestraße. Neben dem Atelier des Designers Werner Aisslinger und dem Architekturbüro GRAFT eröffnete René Block 2008 in der Heidestraße 50 ein grafisches Kabinett sowie Tanas, einen Projektraum für Gegenwartskunst aus der Türkei.8 Einige der großen flachen Hallen gegenüber an der Heidestraße waren vorher von der Clubszene übernommen worden, darunter das Heideglühen und der Tape Club, in dem die Electroclash-Sängerin Peaches des Öfteren auftrat.9 Daneben zog eine Generation von Künstler*innen ein, zu denen Tacita Dean, Thomas Demand und Olafur Eliasson zählten, die in den großzügigen Räumen den für ihre Werke nötigen Platz fanden und die später internationale Bedeutung erlangen sollten. Im Jahr 2004 rückten die Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs direkt neben dem Hamburger Bahnhof, die sogenannten Rieckhallen, in den Fokus der gesamten Stadt, als sie von den Architekten Kuehn Malvezzi für 8,25 Millionen € zu einer Erweiterung des Museums umgestaltet wurden, um dort die zeitgenössische Kunstsammlung des Industriellenerben Friedrich Christian Flick auszustellen.10 Seinen Höhepunkt erreichte der Kunstbetrieb an der Heidestraße zwischen 2007 und 2010, als auch die internationale Galerie Haunch of Venison eine Halle bezog und Ausstellungen von Künstler*innen wie Yoko Ono zeigte, während eine Reihe von Galerien, wie LOOCK oder Jarmuschek, in einem designmäßig umgestalteten Lagerhaus im Sand zwischen Kanal und Rieckhallen öffnete. So trug das Gelände zum Mythos der Kunststadt Berlin und deren internationaler Ausstrahlung bei. In den Entwicklungsprojekten der Europacity hingegen wurde die Geschichte des Ortes als Experimentierfeld im Herzen der Stadt, als realer Raum der Möglichkeiten und der Produktion von Kunst und Kultur ignoriert11 und stattdessen eine Erzählung von Kunst und Kreativität passend zu den eigenen Zwecken fabriziert. Der Diskurs der internationalen Investoren wie auch der Stadt selbst ließ das Areal als ein Brachland erscheinen, das nur darauf wartet, endlich sein vollständiges – und in diesem Fall sehr eindimensionales – Potenzial aufzuzeigen:
Am Hamburger Bahnhof, 2012
„Am Ende des Krieges wurde auch der Bereich Heidestraße schwer zerstört. Prägende Bauten, wie z.B. der Lehrter Bahnhof, wurden aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgerissen. Mit der Teilung Berlins rückte das Gebiet in eine unbedeutende Randlage. Die Flächen wurden zunächst als Güter-, später als Containerbahnhof genutzt. Nach der Wiedervereinigung intensivierte sich zunächst die Nutzung als Containerbahnhof, bis im Jahr 2003 die Einrichtung eines neuen Güterverkehrszentrums an anderer Stelle beschlossen wurde. Nach über 150 Jahren Bahnnutzung ist das Areal damit für neue Entwicklungen frei.“12
„On some wastelands north of Berlin’s central station, an area that had remained unused for decades, a completely new district will have grown by 2023.“13
Blick aus dem Hamburger Bahnhof, 2014
Hinter den Rieckhallen, 2020
Seit 2007 gehören die Rieckhallen, wie auch der Hamburger Bahnhof selbst,14





























