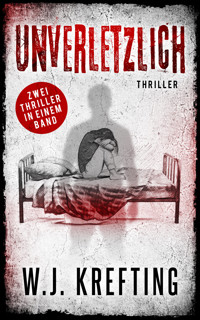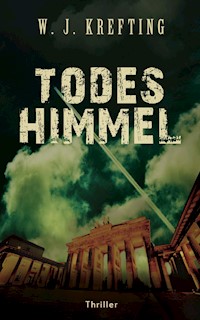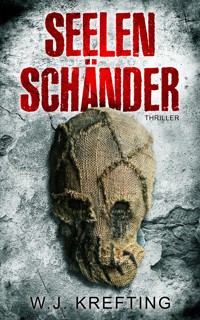2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Schiffscontainer mit unbekanntem Inhalt gelangt von Pakistan nach Berlin. Zur gleichen Zeit taucht in der Hauptstadt eine Leiche auf, die mit einem mysteriösen Schriftzeichen gebrandmarkt ist. Zusammen mit seinem Freund, Hauptkommissar Peter Relow von der Berliner Kriminalpolizei und dessen Partnerin, beginnt der Journalist Wolf Steeler mit den Ermittlungen. Als noch mehr Tote entdeckt werden, steht bald fest, dass es das Trio mit rücksichtslosen Salafisten zu tun hat, die einen durchdachten und cleveren Terroranschlag im Regierungsviertel planen. Als Datum haben sich die Terroristen den Tag der Bundestagswahlen ausgesucht. Eine mörderische Jagd durch Berlin beginnt – Und die Zeit wird knapp, denn bis zu den Wahlen verbleiben nur wenige Tage. Werden die drei es schaffen, die Katastrophe zu verhindern? Was hat es mit dem Container auf sich? Und wie hängt der Fall mit dem korrupten Bundestagsabgeordneten Sven Bäumer zusammen? Der Nachfolge-Roman "Todeshimmel" ist ab jetzt ebenfalls erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Impressum
Prolog
Die Berge um Chaman ragten majestätisch, wie braune Giganten, in den Himmel. Wolken umspielten ihre Gipfel, so, als würden diese stets versuchen, ein Geheimnis zu verbergen. Sie gaben es erst wieder frei, wenn ein Windstoß sie weitertrug. Schwerer zu entdecken waren jene Geheimnisse, die sich in den Bergen, inmitten des Schutz bietenden Steinlabyrinthes verbargen. Das kleine Dorf in der Nähe von Chaman schmiegte sich an das Felsmassiv und strahlte von oben aus betrachtet eine fast hypnotische Aura aus. Weiter unten im Dorf ging es dagegen hektisch zu: Inmitten der Siedlung liefen rund zwei Dutzend der Dorfbewohner aufgeregt zwischen den Hütten umher und wirbelten dabei Unmengen von Staub auf. Frauen, Kinder, alte Menschen. Sie alle eilten auf ein Ziel zu: den Platz in der Mitte des Dorfes, auf dem die Männer sich bereits eingefunden hatten und damit beschäftigt waren, ein stählernes Ungetüm zu zähmen.
Ein roter Schiffscontainer hing gefährlich instabil in der Luft und traf einen Mann in einer Pendelbewegung hart am Kopf. Er schrie laut auf und fiel zu Boden. Schnell eilte ein anderer zu Hilfe und versorgte die Platzwunde, aus der das Blut in den Sand auf den Boden tropfte. Der Container pendelte mit jedem Windstoß immer stärker an den zwei Seilen hin und her, mit denen er provisorisch an der Kippschaufel eines alten Traktors befestigt war. Die Winde waren zu dieser Jahreszeit schon sehr stark in der Region, besonders die Fallwinde in den Bergen durfte man nicht unterschätzen. Vier weitere Männer eilten herbei, sie hatten Mühe, die große Stahlkiste an den Ecken zu greifen und ihre heftigen Bewegungen zu stoppen. Sie mussten sich beeilen. Niemand wusste, was im nächsten Augenblick passieren würde. Die Überwachung und die Angriffe von den Drohnen der Amerikaner waren in letzter Zeit sehr häufig im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet vorgekommen, und man bemerkte die unbemannten Todesboten oft erst, wenn es schon zu spät war.
Faed lenkte den Traktor Meter für Meter mit seiner nun schwächer pendelnden Fracht auf einen wenige Meter entfernt geparkten Ural-Lastwagen zu, begleitet von den Männern, die langsam, Schritt für Schritt die Ladung begleiteten. Direkt über dem Laster senkte Faed die Schaufel, und die Stahlkiste setzte unsanft auf dem Chassis auf. Sie passte nicht richtig und drohte abzurutschen. Eine laute Diskussion brach aus. Die Männer hatten Mühe, die Kiste vor dem Abrutschen zu retten. Faed hob die Schaufel noch einmal kurz an, bis die Seile, an denen der Container hing, straff gespannt waren. Die Männer am Lkw konnten nun den Container in Ruhe platzieren, sodass Faed nach einigen Ruckbewegungen endgültig die Schaufel senken konnte. Schnell lösten die Männer die Tragseile und banden den Container mit Haltegurten auf dem Chassis des Lkw fest. Alles wirkte recht wackelig und war nicht im Entferntesten vergleichbar mit den peniblen Sicherheitsstandards, die in westeuropäischen Ländern bei Frachtgut angewandt wurden. Doch es funktionierte. Am Ende wartete der Ural-Laster abfahrbereit mit einem Container, der auf seinem Dach vier Schleifen hatte und unfreiwillig an ein Geschenkpaket erinnerte.
Faed verabschiedete sich von den anderen mit jeweils zwei Küssen auf die Wange und bestieg den Lkw. Er startete den Motor und fuhr los. Die Frauen und Kinder und die Alten aus dem Dorf winkten ihm von weitem zu. Er hupte und winkte zurück. Während Faed die unbefestigte Piste entlangfuhr, schaute er noch ein paar Mal in den Rückspiegel, um den immer kleiner werdenden, winkenden Tross im Auge zu behalten. Das Letzte, was er von der Gruppe sah, war, wie sie in einem großen Feuerball verschwand, der einige Minuten nach seiner Abfahrt das kleine Bergdorf verschluckte. Sekunden später flog eine amerikanische Predator-Drohne mit einem lauten Dröhnen über seinen Truck hinweg. Offenbar hatte sie bei dem Angriff alle Raketen abgefeuert, ansonsten hätte sie in einem zweiten Anflug den Laster höchstwahrscheinlich gleich mit gesprengt. Doch das tat sie nicht. Stattdessen drehte sie nach Westen ab und flog zurück über die Grenze in das afghanische Hoheitsgebiet.
Faed stoppte den Truck, stieg aus und beobachtete unter Tränen, wie sein Dorf abbrannte. Seine Familie, seine Freunde, seine Gefährten, die mit ihm zusammen in den vergangenen Monaten ihr Leben riskiert und mühsam gearbeitet hatten, um ihre Mission vorzubereiten – sie alle waren tot. Faed sank zu Boden und weinte vor Verzweiflung. Er betete zu Allah.
Nach Minuten sprang er mit einem Ruck auf. Er wollte nicht, dass alles umsonst gewesen war. Seinen Freunden gegenüber hatte er eine Verpflichtung. Die Verpflichtung, die Mission zu Ende zu führen. Und das würde er tun. Jetzt erst recht. Er bestieg wieder den Lkw und fuhr weiter gen Süden.
15 Stunden später legte das Containerschiff Liparus in der 900 Kilometer entfernten Hafenstadt Karatschi ab. An Bord hatte es einen roten Container. Sein Ziel: Hamburg.
Montag
Wolf Steelers Wohnung, Berlin-Prenzlauer Berg
Die ersten Sonnenstrahlen des klaren Herbstmorgens erhellten zaghaft den Himmel über Berlin. Die Umrisse der stählernen, wie Stecknadeln auf einer Landkarte über die Stadt verteilten Baukräne mit ihren Zickzackstreben nahmen stetig wieder ihre von der Nacht in einen Schleier gehüllten Konturen an. Als das Licht nacheinander die Kugel des Fernsehturms am Alexanderplatz, die gläserne Reichstagskuppel und schließlich die goldene Victoria auf der Siegessäule in ihrer ganzen Pracht erstrahlen ließ, war der neue Tag in der Hauptstadt angekommen, und es war nur noch eine Frage von Minuten, bis auch die letzten dunklen Überbleibsel der Nacht langsam aus den Häuserschluchten vertrieben und durch das Licht der nun täglich schwächer scheinenden Sonne erhellt waren.
Mit schrillem Ton klingelte der Wecker auf Wolfs Nachttisch. Es war nicht so, dass Wolf nicht länger hätte schlafen können. In der Redaktion erwartete man ihn erst um halb elf. Die Gewohnheit ließ ihn aber stets um fünf vor Sieben aufstehen. Das war Teil seiner Routine. Besonders zu Wochenbeginn bildete sie ein tragendes Gerüst. Einen Wecker brauchte Wolf dabei nur selten, denn es lastete ein Fluch auf ihm, der Wolf in Gestalt von ständig wiederkehrenden Alpträumen beinahe täglich aus dem Schlaf riss.
Als Erstes holte Wolf immer seine Zeitungen von unten, er wohnte im dritten Stock. Dann kochte er sich Kaffee und überflog in schneller Lektüre die wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Es folgte eine ausgiebige Dusche mit dem Deutschlandfunk im Hintergrund und darauf das richtige Frühstück mit ausführlicherem Lesen seiner drei Tageszeitungen.
Heute war es anders, heute brach Wolf seine starre Routine, holte die Zeitungen und las einen ganzen Artikel statt nur der Überschriften. Seinen Artikel im Berliner Morgen. Seiner Zeitung. „Bäumer in Korruptionsaffäre verwickelt - Bundestagsabgeordneter wurde jahrelang von Pharmakonzern Transmed bestochen“ las er. Danach saugte er die ganze Geschichte um den von ihm aufgedeckten Skandal um MdB Sven Bäumer zum ersten Mal abseits von Computerbildschirmen in gedruckter Form in sich auf.
Für Wolf hatte sein investigatives Wirken an der Geschichte von Beginn an alle Ideale seines Berufes verkörpert: die Medien als Wachhund, die in ihrer Funktion Missstände in der Gesellschaft aufdecken und zu einer besseren Welt beitragen. Und ganz nebenbei konnte dies für ihn den Durchbruch im Journalismus bedeuten. Das könnte sein Sprung nach oben sein, der Aufstieg von Wolf Steeler durch den Fall von Sven Bäumer. Wolf mochte diese Vorstellung auf geradezu absurde Art. Zumal er Bäumer damit nun ganz bestimmt den politischen Dolchstoß gegeben hatte und sich damit heute Morgen wie eine Art Racheengel fühlte. Eine Vendetta von ihm zu Ende gebracht im Auftrag des Volkes und der Gerechtigkeit – und auch seine ganz persönliche.
Die restlichen Überschriften der Aufmacherartikel im Politikteil des Berliner Morgen überflog Wolf wie gewohnt. „BKA sieht erhöhte Terrorgefahr in Deutschland“, „al-Qaida -Attentäter tötet acht deutsche Soldaten in Afghanistan“ und „Bundestag stimmt Weitergabe von Daten zu“. Bevor Wolf an der Bäumer-Geschichte gearbeitet hatte, war der Terror immer sein Spezialgebiet gewesen. Damit hatte er sich beim Berliner Morgen bereits einiges Renommee erarbeitet – und schon fast das Privileg auf ein eigenes Büro abseits der legebatterieähnlichen Großraum-Atmosphäre verdient. In den nächsten Tagen und Wochen würde er bestimmt noch die eine oder andere Folgegeschichte zu dem Thema Bäumer recherchieren und ins Blatt bringen. Danach wartete der Terror wieder auf ihn.
Wolf ging hinüber in seine kleine Küche und schaltete die Kaffeemaschine und das Radio ein. Bereits zum zweiten Mal brach er heute die Routine, indem er schon vor dem Duschen den Deutschlandfunk einschaltete, der in den Siebenuhrnachrichten schon den Berliner Morgen zitierte. Er drehte den Regler langsam von Sender zu Sender weiter, goss sich eine Tasse heißen Kaffees ein und hörte mit großer Genugtuung, dass alle Stationen das Thema Bäumer in den Nachrichten brachten. Mit dem Kaffeebecher in der Hand schritt Wolf hinüber zu seinem Bett und setzte sich langsam neben dem Nachttisch auf die Kante der Matratze. Wolf stellte den Keramikbecher auf der Holzfläche ab und griff nach dem silbernen Bilderrahmen neben dem Wecker. Minutenlang betrachtet er das Schwarzweißporträt der Frau im Rahmen. Zum Schluss hob er das Bild an seine Lippen und gab ihm einen Kuss. Wolf schaute, als wolle er sagen: „Das habe ich nur für Dich getan.“ Und genau das dachte Wolf, als er das Porträt zurück an seinen Platz stellte und wieder gegen den Becher austauschte. Wolf wanderte noch einige Minuten durch seine Wohnung, um seinen Triumph zu genießen und den Kaffee auszutrinken. Danach ging er unter die Dusche und rasierte sich unter der laufenden Brause. Wie jeden Morgen schabte er penibel jeden einzelnen Stoppel aus dem Gesicht. Beim Blick in den Spiegel wurde ihm zum ersten Mal richtig klar, dass es jetzt vorbei sein konnte.
Regierungsviertel, Berlin-Mitte
Wenige Kilometer Luftlinie weiter nordwestlich, am Platz der Republik, begannen die ersten Abgeordneten des Deutschen Bundestages und deren Mitarbeiter ihren Arbeitstag. Leben kehrte ins Regierungsviertel ein. Auch der Bürobote Selim Abu Kaleb startete wie gewohnt in seinen Tag. Sein Fußweg zur Arbeit führte ihn jeden Morgen am Holocaust-Mahnmal und dem Brandenburger Tor vorbei, bevor er die Dorotheenstraße überquerte und den Seiteneingang des Jakob-Kaiser Hauses benutzte. Damit war er an seinem Arbeitsplatz angekommen.
Den Sicherheitscheck am Eingang hatte Selim lediglich am allerersten Arbeitstag vor zwei Jahren über sich ergehen lassen müssen. Ab dem zweiten Arbeitstag reichte dem Sicherheitspersonal ein freundlicher Wink mit dem Hausausweis des Gebäudes, der ihm den Zugang zu den meisten Bereichen des Komplexes garantierte. Schon ein wenig fahrlässig, wie Selim oft dachte. Aber diesen Luxus gönnte sich der Bundestag auch in Zeiten extrem hoher Sicherheitsvorschriften. Der Plenarsaal beispielsweise war natürlich auch für Selim tabu und nur den Abgeordneten und Saaldienern vorbehalten. Aber auch ohne das Recht, den Saal betreten zu dürfen, war es eine große Ehre für Selim, im Bundestag arbeiten zu dürfen. Für ihn, der vor elf Jahren aus Palästina mit nichts nach Deutschland gekommen war. Das wusste Selim jedes Mal zu schätzen, wenn er über die langen Flure und durch die verzweigten Katakomben des Bundestages zur Poststelle wanderte. Hier kamen ihm Abgeordnete entgegen, die freundlich grüßten, dort ignorierten ihn Bundesminister samt ihrer Leibgarde, um besonders wichtig auszusehen. Sogar die Bundeskanzlerin hatte er schon einmal persönlich gesehen und sogar begrüßen dürfen. In der Poststelle waren hingegen nie prominente Politiker zu sehen.
Selim staunte stets, wie groß der Bundestag war. Er umfasst nicht, wie man vermuten könnte, nur das Reichstagsgebäude, sondern einen Gebäudekomplex bestehend aus drei Neubauten: dem Jakob-Kaiser-Haus, dem Paul-Löbe-Haus und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.
Als erstes durchquerte Selim morgens das Jakob-Kaiser-Haus, den Ort, an dem er auch die meiste Zeit seines Arbeitstages verbrachte, und welches das größte der drei Parlamentsneubauten war.
Auf seinem weiteren Weg ging es für Selim unter die Erde, in einen Versorgungstunnel, der alle Neubauten des Bundestages mit dem Reichstag verbindet. Von da aus führte ihn sein Weg weiter zum Paul-Löbe-Haus. Der moderne und für Selim fast schon futuristisch gestaltete Bau im Spreebogen ist Teil vom „Band des Bundes“, das die beiden früher durch die Mauer getrennten Teile der Hauptstadt über die Spree hinweg verbindet. Das „Band des Bundes“ besteht darüber hinaus noch aus dem neuen Kanzleramt und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf der Ostseite des Flusses. Dorthin war Selim unterwegs.
Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus wurde benannt nach einer der wichtigsten Vertreterinnen des Frauenrechtes in Deutschland. Mit der großen Bibliothek, dem Archiv, der Parlamentsdokumentation, der Pressedokumentation und den wissenschaftlichen Diensten ist das Gebäude das Informations- und Dienstleistungszentrum des Parlaments.
Die Poststelle im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus war riesig. Dort angekommen, bewegte Selim sich an den Rampen für die zig Postwagen vorbei, die Dutzenden von Mitarbeitern in geschäftigem Treiben be- und entluden. Die Poststelle wirkte wie ein kleines Unternehmen für sich, das selbst in Zeiten von E-Mails, Handys und so weiter den Schlüssel zur Kommunikation des legislativen Zentrums der Bundesrepublik mit der Außenwelt darstellte – zumindest redete Selim sich das gerne ein, um damit seiner Arbeit im Geiste eine zusätzliche Wichtigkeit zu verleihen. Selim war immer stolz, als Bürobote seinen Beitrag zur Meinungsbildung der Abgeordneten zu leisten, sie mit Informationen zu versorgen und damit auch einen winzigen Teil zur Steuerung seines neuen Heimatlandes beizutragen.
An der letzten Rampe bog Selim links in einen großen Raum ab, wo bereits sein Schiebewagen mit der Post für seine erste Runde durch den Bundestag auf ihn wartete. Selim hatte 50 Abgeordnete mit Post und Zeitungen zu beliefern und hatte dementsprechend viel zu transportieren. Manchmal fiel ihm dabei etwas vom Wagen herunter. Natürlich musste er seine Runde mehrmals täglich machen, da den Bundestag alle paar Stunden Postlieferungen erreichten.
Selim bedankte sich bei dem Kollegen, der seinen Wagen beladen hatte, und machte sich zügig auf den Weg. Viele Abgeordnete, besonders aber deren Büroangestellte, reagierten mitunter sehr ungehalten, wenn die Post nicht pünktlich auf dem Schreibtisch lag, und schließlich war es schon kurz vor acht.
Sven Bäumers Wohnung, Berlin-Kreuzberg
Sven Bäumer ging mit dröhnendem Kopf noch mal kurz ins Badezimmer, um sich, bevor er aus der Wohnung ging, die Haare mit einer Hand voll Gel nach hinten zu frisieren. Die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestages wartete unten auf der Straße bereits im Halteverbot auf ihn. Bisher hatte es keine Politesse gewagt, dagegen zu protestieren. Und vermutlich würde das auch so bleiben. Beim Blick in den Spiegel schob Bäumer seine Brille zurecht und versuchte genauso auszusehen wie auf den Wahlplakaten, die jetzt überall in seinem Wahlkreis sein falsches Grinsen auf die potentiellen Wähler richteten. In sechs Tagen war Bundestagswahl und Bäumer hatte die besten Chancen, mit überwältigender Mehrheit wieder ins Parlament gewählt zu werden. Das lag aber weniger an seiner Politik oder seiner Ausstrahlung als vielmehr daran, dass seine Partei, die Demokratische Union Deutschlands, abgekürzt DUD, in seinem Wahlkreis jeden x-beliebigen Kandidaten mit Aussicht auf Erfolg hätte aufstellen können. Bäumer hatte immer nur darüber grinsen können, und genau jenes Grinsen blickte ihn nun tatsächlich im Spiegel an.
Während der Sitzungswochen war immer viel zu tun, und da Bäumer vor seinen Parteikollegen zumindest den Eindruck erwecken wollte, motiviert und für den Bürger im Einsatz zu sein, war er immer schon vor neun in seinem Büro. Sonntagabends vor Beginn jeder Sitzungswoche trafen sich die Mitglieder seiner Partei normalerweise regelmäßig, um die neuesten „Schlachtpläne“ zu diskutieren. Da Bäumer jedoch das Mittelmaß zwischen anderweitiger Beschäftigung und zumindest nach außen hin sichtbar hoher Motivation finden wollte, war er gestern Abend unter einem Vorwand nicht erschienen. Stattdessen hatte er eine anstrengende Nacht in einem Club verbracht und war erst um zwei Uhr zu Hause in seinem Appartement gewesen – chauffiert von der Fahrbereitschaft. Öffentliche Verkehrsmittel inmitten von all den Pennern, Türken, Schwarzen und sonstigen seiner Meinung nach Asozialen waren nichts für ihn. Von denen hob er sich natürlich ab.
Wie bestellt stand der Chauffeur Günther Wellmann punkt acht Uhr mit seinem schwarzen A8 vor Bäumers Wohnung in Kreuzberg. Wellmann parkte mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig, um die vorbeifahrenden Autos auf der engen Straße nicht zu behindern. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte sich Wellmann am Kiosk noch schnell die „Bild“ und eine Ausgabe des „Berliner Morgen“ geholt. Jetzt wartete er auf einen seiner unangenehmsten Fahrgäste, der grundsätzlich unfreundlich und darüber hinaus immer ein paar Minuten zu spät kam. Deshalb dachte sich Wellmann, dass er noch kurz Zeit hätte, den Berliner Morgen zu überfliegen. So gut wie immer gab es dort und natürlich auch in der Bild interessante Neuigkeiten über seine „Kunden“ zu lesen. Das war das Spannendste an der Zeitung für Wellmann. Und heute sollte er wieder einmal nicht enttäuscht werden. Direkt auf der ersten Seite fiel ihm die Überschrift des Aufmachers auf: „Bäumer in Korruptionsaffäre verwickelt“. Die nächsten Minuten verbrachte Wellmann äußerst gespannt mit dem gründlichen Studium des Artikels. Plötzlich klopfte jemand gegen die Scheibe der Fahrertür. Er erschrak fast zu Tode und knüllte die Zeitung auf den Beifahrersitz. Wellmann drehte seinen Kopf nach links und sah in das Gesicht von Sven Bäumer. Sofort stieg er aus, begrüßte seinen Fahrgast überfreundlich, öffnete ihm die linke hintere Tür und wartete, bis Bäumer eingestiegen war. Wellmann nahm sich die Zeit, um einmal kurz durchzuatmen. Wusste Bäumer bereits von dem Artikel? Wellmann war kein Machtmensch, fühlte sich aber geehrt, dass er stets so hohe Politprominenzen von A nach B kutschieren durfte. Und selbst er wusste, dass solcherlei Enthüllungen den politischen Exitus bedeuten konnten. Bäumer war immer unfreundlich und herablassend, das hatte nichts zu bedeuten. Er war jedoch relativ gelassen, was man von einem Mann, der gerade im Begriff war, von der Karriereleiter zu fallen, nicht erwarten würde. So setzte sich Wellmann zurück ins Auto und sah in den Rückspiegel. Bäumers Gesicht sah aus wie immer, keine Spur von Aufregung oder Karrieredämmerung. Aber vielleicht ließ er sich ja nur nichts anmerken!? Menschen mit so einem dicken Fell wie Bäumer brauchten ja bekanntlich kein Rückgrat, um aufrecht stehen zu können. Wellmann beschloss, Bäumer nichts von dem Artikel zu sagen. Er schaltete das Autoradio an. Wellmanns Fahrgast hatte heute Morgen einen ziemlichen Kater, weshalb er Wellmann jedoch augenblicklich in bellendem Ton befahl, das Radio wieder auszuschalten und ihm damit überdies zu verstehen gab, nicht angesprochen werden zu wollen. So kam es, dass Sven Bäumer die Nachrichten verpasste, von denen nun schon fast all seine Parteifreunde und das gesamte politische Berlin wussten. Wellmann schaute noch einmal in den Rückspiegel und fragte sich, wie oft er diesen Gast wohl noch fahren müsse.
Der A8 brauste durch Berlin und hielt schließlich auf dem Platz hinter dem Reichstagsgebäude, inmitten von anderen Audi-Karossen, S-Klassen und Phaetons, deren Fahrer alle auf ihre Passagiere warteten. Wortlos stieg Bäumer aus dem Wagen und lief zum Hintereingang des Reichstagsgebäudes. Selbstverständlich kannten ihn alle Sicherheitsleute, seinen Ausweis brauchte er hier schon lange nicht mehr vorzuzeigen. So stolzierte er durch die Sicherheitsschleuse. Die zum Teil bereits informierten Sicherheitsleute schauten heute ein wenig genauer in Bäumers Gesicht, um eine Reaktion zu erhaschen. Unwissend, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch mehr wussten als der Bundestagsabgeordnete selbst.
Im Reichstagsgebäude nahm Bäumer die Treppe zu einem tiefergelegen Stockwerk und durchschritt den unterirdischen Durchgang zum Jakob-Kaiser-Haus. Auf dem Weg begegneten ihm bereits einige seiner Parteigenossen, die ihn mit einem fast mitleidvollen Blick begrüßten. Im Foyer des Jakob-Kaiser-Hauses nahm Bäumer den Aufzug in den zweiten Stock, schloss sein Büro auf und nahm gemütlich auf seinem Chefsessel Platz. Erst jetzt schaltete er sein Handy an, das er auf den Schreibtisch legte und dort liegen ließ, bis er vom Gang zum Kaffeeautomaten neben dem Kopierraum zurückkehrte. Zwanzig Anrufe in Abwesenheit sah er auf dem Display. Während Bäumer sich fragte, wer wohl so hektisch versuchte, ihn zu erreichen, klopfte es an der Tür. Nach einem unfreundlichen „Herein“ betrat der Araber den Raum, der jeden Morgen die Post auf den Tisch seiner Sekretärin legte und dann mit einem schüchternen „Tschüß“ verschwand. Anstatt sofort auf die Handyanrufe zu reagieren, beschloss Bäumer zunächst einmal gemütlich den Berliner Morgen bei einem Becher Cappuccino zu lesen.
Von dem Papierstapel, den der Araber auf den Schreibtisch gelegt hatte, nahm er sich den Berliner Morgen und schlug ihn geschickt mit einer Hand auf. Bäumer hob gerade den Cappuccino zum Mund, als ihm vor Entsetzen der Becher aus der Hand fiel und sich im Fall über seine Schuhe entleerte.
Selim, der gerade erst die Post zu Sven Bäumer gebracht hatte, hörte einen kurzen Aufschrei aus dessen Büro, dachte sich jedoch nichts weiter dabei. Dieser Bäumer war ihm schon immer ein wenig eigenartig vorgekommen, und es kam durchaus häufiger vor, dass er in seinem Büro lauter wurde. Selim setzte seine Runde fort, er hatte noch viel zu tun.
Hamburger Hafen, Freie und Hansestadt Hamburg
Majestätisch schraubte sich das Containerschiff „Liparus“ die Elbe hinauf. Schon etwas mehr als einhundert Kilometer hatte das 254 Meter lange Schiff seit der Mündung in Cuxhaven zurückgelegt und war nun nicht mehr weit von Hamburg entfernt. Schon war der Messeturm der Hansestadt zu erkennen und von der Brücke sahen der Kapitän, die Offiziere und der Lotse die riesigen Containerbrücken an den Quais. Soeben passierte die Liparus die Schiffsbegrüßungsanlage „Willkomm Höft“, an der bei jedem einlaufenden Schiff die jeweilige Nationalhymne zur Begrüßung abgespielt wurde. Zwar gehörte die Liparus einem deutschen Reeder, bei vielen Handelsflotten dieser Welt ist es jedoch üblich, aus finanziellen Gründen das Schiff in günstigeren Ländern anzumelden. So wurde für die Liparus heute die liberische Nationalhymne gespielt.
Das Schiff drehte nach Steuerbord, in den Waltershofer Hafen. Einen Teil seiner Ladung, 3000 Container, würde es in den nächsten Stunden hier löschen, 1200 neue Container wieder aufnehmen und dann so schnell wie möglich weiter nach Sankt Petersburg fahren. Ein Tag im Hamburger Hafen kostet einen Reeder pro Schiff mehrere zehntausend Euro.
Alles lief glatt. Der 40000 Tonnen-Stahlkoloss wurde von zwei Schleppern bis zu seinem Entladeplatz am Burchard-Kai gezogen und dann von denselben vorsichtig an die Kaimauer gedrückt. Dort vertäuten Hafenmitarbeiter das Schiff mit dicken Tauen. Eine Viertelstunde später hob eine der fünf Containerbrücken den ersten der Stahlboxen von Bord der Liparus.
Zehn Millionen Standardcontainer werden jährlich im Hamburger Hafen umgeschlagen. Die Liparus hatte rund 8.000 geladen und weitere zigtausend warteten allein am Containerterminal Burchhard-Kai darauf, entweder auf eines der nächsten Frachtschiffe oder auf einen LKW geladen zu werden. Tagein, tagaus. Eine ständige Routine, die Hafenarbeiter, Schiffsbesatzung, LKW-Fahrer und selbst die Mitarbeiter vom Zoll teilweise schon so engstirnig angingen, dass der Container als Einzelner schon bald gar nicht mehr existierte, sondern nur in größeren Stückzahlen.
Und so hob an diesem Montag eine der Containerbrücken am Burchard-Kai eine rote Stahlbox mit den exakten Maßen 6,058 mal 2,438 mal 2,591 Meter aus dem Bauch der „Liparus“. Niemand ahnte deren Inhalt. Der Kranfahrer stellte den Container auf die Betonplatte des Terminals, wo ein Reach-Stacker, eine Mischung aus Autokran und Gabelstapler, augenblicklich herangefahren kam, den Container in sein riesiges Stahlmaul einklinkte und an einen relativ abgelegenen Ort des Terminals brachte. Dort setzte der Fahrer des Reach-Stackers den Container auf einem Chassis ab. Der Reach-Stacker fuhr zurück zu den Containerbrücken, und ließ den Auflieger neben all den anderen Containern allein, die fein säuberlich in Hunderten von Stapeln auf den Weitertransport warteten und aus der Vogelperspektive aussahen, als hätte ein zwangsneurotisches Kind seine bunten Bauklötze fein säuberlich aufgestapelt.
Eine Mercedes-Actros-Zugmaschine mit Berliner Kennzeichen rollte heran. Am Steuer saß Thomas Freiberger. Freiberger hatte einen äußerst schlechten Tag und war froh, dass er heute nur noch die 300 Kilometer bis Berlin zurückfahren musste. Gute vier Stunden und er konnte den Rest des Tages zu Hause bei seiner Familie entspannen. Die heutige Lieferung, mit der Freiberger sich ohne das Wissen seines Chefs ein kleines Zubrot verdiente, war gut bezahlt worden. Eigentlich hätte er seinen freien Tag gehabt, doch irgendjemand Unbekanntes hatte ihn vor einer Woche angerufen und ihm 1000 Euro geboten, wenn er einen Container von Hamburg nach Berlin bringen würde - ohne Fragen und bar auf die Hand. Noch mal 500 würde es geben, wenn der Container verplombt sein Ziel erreicht. Freiberger, der als Brummi-Fahrer kein Vermögen verdiente, nutzte jede Gelegenheit, sich ein wenig Geld dazuzuverdienen. Auch wenn sein Chef, dem der Lastwagen schließlich gehörte, nichts davon wusste und ihn vermutlich direkt feuern würde, wenn die Geschichte irgendwann auffliegen würde. „Wenn Brömhoff mir nicht mehr Gehalt zahlt, dann darf ich dafür wenigstens seine Zugmaschine benutzen“, versuchte Freiberger sich selbst einzureden, um derartige Aktionen, die er dann und wann mal durchführte, zu rechtfertigen. Ganz ohne schlechtes Gewissen schaffte der Trucker es offenbar doch nicht. Um sich abzulenken, fing er lieber an, über den Inhalt des Containers und die Geheimniskrämerei darum nachzudenken. „Was könnte so Schlimmes da drin sein, dass ich eine Extraprämie bekomme, wenn die Kiste verplombt ankommt?“, fragte er sich. Auf seinen Frachtpapieren stand „Spielzeug“. 1.500 Euro für eine läppische Fuhre Spielzeug von Hamburg nach Berlin erschien Freiberger aber doch ein wenig happig. Ungefähr genauso viel verdiente er normalerweise in einem ganzen Monat. Und davon musste er seine Frau, sein Kind und die Wohnung mitfinanzieren. Auf jeden Fall war es aber besser, den Container von der Bundespolizei nicht öffnen zu lassen. In regelmäßigen Abständen führte diese nämlich Stichprobenkontrollen durch. Der Schmuggel boomte. Und selber würde Freiberger den Container bestimmt nicht öffnen.
Der geübte Lkw-Fahrer lenkte seine Zugmaschine rückwärts unter das zweiachsige Chassis und wartete auf das typische Klacken des Einrastens des Königszapfens in die Sattelplatte. Freiberger sprang aus dem Führerhaus, sah kurz nach, ob alles fest saß und kurbelte die Stützen nach oben. Dann klemmte er die Versorgungsleitungen für den Auflieger an. Elegant, sofern jemand bei Freibergers üppigem Körperumfang noch von „elegant“ reden konnte, schwang er sich zurück in sein Führerhaus und lenkte den Actros zum Kontrollhäuschen, das jeder Wagen, der das Terminal befuhr oder verließ, passieren musste. Er stoppte den Truck, marschierte in Richtung Häuschen und quittierte bei der Frau, die dort saß, den Erhalt des Containers. Ganz ohne Bundespolizei, ganz ohne Umstände. Dennoch war Freiberger leicht nervös. Erst als der Sattelzug auf der Köhlbrandbrücke in Richtung Autobahn unterwegs war, atmete er auf. Nun war es äußerst unwahrscheinlich, dass irgendjemand ihn bis Berlin noch kontrollieren würde. Aber man konnte es nie wissen. Freiberger lehnte sich zurück, regelte die Lautstärke seines Radios bis fast nach oben und fuhr Richtung Osten. Er ahnte dabei nichts von der Fracht, die er auf dem Containerchassis hinter sich her zog. Freiberger schaute auf das Foto von seiner Frau Sabine mit der kleinen Tochter Andrea auf dem Arm. „Bald bin ich wieder bei euch“, dachte er sich mit einer gehörigen Portion Vorfreude.
Verlagsgebäude „Berliner Morgen“, Berlin-Mitte
Im ersten Stock des Verlagsgebäudes des „Berliner Morgen“ glitten die beiden Edelstahltüren des Aufzuges fast geräuschlos auseinander. Heraus trat Wolf, eine Aktentasche unter dem linken Arm, einen Becher Kaffee in der rechten Hand. Mit zügigen Schritten, zwischendurch an seinem noch heißen Kaffee nippend, ging er einen langen Flur entlang, an dessen Ende er scharf rechts abbog. Das war so ziemlich die gefährlichste Stelle an Wolfs Arbeitsweg, denn man konnte nie wissen, wer von der anderen Seite gerade um die Ecke kam. Sogar noch gefährlicher als Wolfs allmorgendliche Fahrt mit der Berliner U-Bahn, wie er manchmal feststellte. Er schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau im selben Moment wie er von der anderen Seite kam, jedoch als sehr gering ein, weshalb er jedes Mal ungebremst weiterging. Heute hatte er Pech. Mit voller Wucht prallte er in der Kurve mit der Redaktionsassistentin Lina Penz zusammen. Lina ließ vor Schreck ihren Stapel Dokumente fallen. Wolf, ein wenig orientierungslos herumtaumelnd, fiel der Kaffee aus der Hand. Er ergoss sich über die Zettelwirtschaft von Lina Penz, die sich schon auf dem Fußboden verteilt hatte. Für eine Sekunde schauten sich die beiden erschrocken in die Augen.
„Oh, Herr Steeler, Entschuldigung, ich hab Sie nicht gesehen“ sagte Lina, der der Vorfall mehr als peinlich war. Das sah man an ihrer puterroten Gesichtsfarbe. Im Dunkeln hätte sie vermutlich geleuchtet. Wolf war der Letzte, der jemandem solche Missgeschicke übelnahm. „Schon gut, schon gut“ sagte er beschwichtigend, „war genauso gut meine Schuld.“
„Ich rechne nie damit, dass einer um diese Ecke kommt“ entschuldigte sich Lina nochmals. Sie verschwand schnell in der nahegelegenen Teeküche und tauchte innerhalb von wenigen Sekunden mit einer Küchenrolle wieder auf. Lina begann hektisch mit einem zusammengeknüllten Ball aus Küchenrollentüchern den Kaffee von den Blättern zu tupfen.
„Geht mir genauso“ erwiderte Wolf. Er nahm die Küchenrolle aus Linas Hand, riss sich ein paar Tücher ab und tupfte mit.
„Haben Sie denn was abbekommen?“ fragte Lina, und inspizierte dabei Wolfs Jackett.
„Nur ein wenig am Ärmel“ antwortete Wolf, der sich mit dem Küchentuch die rechte Hand und den Ärmel abtupfte.
„Das ist mir sehr peinlich, Herr Steeler, aber ich könnte Ihnen die Reinigung bezahlen.“
„Nein, schon gut, das ist ja fast nichts.“
„Dann lassen Sie mich Sie wenigstens auf einen Kaffee zur Wiedergutmachung einladen.“
„Nein, es ist wirklich gut, wahrscheinlich müsste ich Sie noch eher einladen. Wer weiß, worüber ich da gerade meinen Kaffee verschüttet habe“ sagte Wolf in einem halb fragenden Tonfall. Die ihm angeborene journalistische Neugier ließ sich auch in kleinen Dingen nicht verbergen.
„Oh, das, das ist nichts Besonderes. Das sind nur ein paar Agenturmeldungen von Reuters. Der Drucker in der Wirtschaft ist kaputt und deshalb muss ich die da heute ausgedruckt hinbringen“ antwortete Lina.
„Aber die haben die Meldungen doch alle auf dem Bildschirm?!“
„Ja, die Damen und Herren wollen die aber lieber in der Hand halten. Darum bringe ich Sie denen eben ins Ressort.“
Wolf wunderte sich manchmal über einige seiner Kollegen. Journalisten haben gemeinhin den Ruf, ein wenig eigenartig zu sein, doch einige waren noch eigenartiger als andere. Und die Kollegen aus dem Wirtschaftsressort gehörten für Wolf nun offiziell dazu. Offensichtlich hatte die Chefin des Ressorts, Anke Busch, einen schlechten Einfluss auf ihre Untergebenen. Ihre unfreundliche und abweisende Art machte es Menschen schwer, mit ihr klarzukommen. Sie hatte schon fast autistische Züge, wie Wolf fand. Doch wie es bei den meisten Inselbegabten so ist, sind sie in einem kleinen Bereich gut, und Anke Busch war nun mal eine gute Journalistin – aber eine Sklaventreiberin.
„Aha“ sagte Wolf, der sich nichts von seiner Meinung über die Kollegin anmerken lassen wollte.
„Gute Geschichte heute in der Zeitung“ stieß Lina nach einem kurzen Moment des Schweigens hervor.
„Vielen Dank!“ sagte Wolf. Er half Lina noch kurz, die Zettel wieder zusammenzulegen und schritt daraufhin durch eine Milchglastür mitten in das Großraumbüro, in dem auch sein Schreibtisch stand. Lina schaute ihm etwas enttäuscht hinterher und ging dann mit ihren Unterlagen weiter.
Hinten links in der Ecke stand Wolfs Schreibtisch. Wolf war eher ein Einzelgänger, und Großraumbüros hasste er mehr als die Pest. Zusammen mit den Kollegen konnte er sich nie so recht in seiner Kreativität entfalten und, was noch schlimmer war, bei der Telefonrecherche in Anwesenheit von anderen hatte er immer Angst, jemand könne Gesprächsfetzen mitbekommen und ihm eine seiner Geschichten abluchsen. So eigen war Wolf in Bezug auf seine Arbeit. Aber vielleicht bekam der Chefredakteur Faber ja heute, nach der Bäumer-Geschichte, ein Gehör für ihn und bot ihm ein eigenes kleines Büro an. Eine Höhle, in die er sich zurückziehen und in der er in Ruhe arbeiten könnte.
Während Wolf zu seinem Schreibtisch ging, grüßten ihn seine Kollegen wie gewohnt. Einige schauten mit stiller Bewunderung, andere mit einem Anflug von Neid und wieder andere so wie immer zu ihm herüber. Wolf mochte die meisten seiner Kollegen eigentlich sehr gern und grüßte alle mit einem freundlichen Lächeln und einem „Hallo“ oder „Morgen“ zurück. Er setzte sich an seinen Platz, fuhr den Computer hoch und schaute dabei schnell die Briefe durch, die Lina oder irgendeine andere der Sekretärinnen ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte. Lina. Was war das eben auf dem Flur überhaupt für eine eigenartige Begegnung gewesen? Er mochte Lina und Lina mochte ihn. Das hatten sie gemeinsam. Lina mochte ihn aber ein wenig zu viel, wie er sich schon seit längerem gedacht hatte, und das Angebot mit dem Kaffee oder Bier hatte bestimmt einen Hintergrund. Vor allem die Einladung zu einem Bier. Kaffee war eher unverbindlich, den konnte man auch unten in der Lobby des Verlagshauses während der Arbeitszeit trinken. Gut, das gleiche galt natürlich für das Bier, aber trinken während der Arbeitszeit konnte eventuell die Vorgesetzten stutzig machen. Wolf musste bei dem Gedanken innerlich schmunzeln. Die Zeiten, in denen während der Arbeitszeit in Redaktionen auch mal einer über den Durst getrunken wurde, waren vorbei. Also ging man im Allgemeinen davon aus, ein Bier nach Feierabend irgendwo in einer gemütlichen Kneipe zu trinken. Das war der Knackpunkt, denn bei einem Bier blieb es ja für gewöhnlich nie und dann, im Zustand alkoholischer Gelöstheit... . Nein, es war einfach noch zu früh. Verena war erst eineinhalb Jahre tot. Wolf wollte derartige Gedanken nicht zulassen. Selbst wenn er es gewollt hätte, so wäre es nicht gegangen, da in diesem Augenblick Stefanie Fortmann vor seinem Schreibtisch stand. Eine Mobbing-Kollegin erster Klasse, die sich nun mit ihrer vollen, von Absatzschuhen künstlich erhöhten Figur, ihren langen dunklen Haaren, die ihr Mopsgesicht umgaben, und ihren gelben Zähnen vor ihm aufbaute und ihn gewohnt finster anschaute.
„Morgen“ sagte Wolf.
Statt ihrerseits zu grüßen entgegnete sie nur: „Faber will dich sprechen“.
„Ich komme gleich“ sagte Wolf, der sich innerlich bereits auf eine Lobeshymne vom Chefredakteur einstellte.
„Sofort“ setzte Stefanie hinzu, was wiederum so gar nicht nach Lobeshymne klang. Stefanie drehte sich um und ging zurück an ihren Platz, der sich zum Glück weit genug weg von Wolfs befand. Es hatte einen Grund, warum ausgerechnet Stefanie ihm die Botschaft von Faber überbrachte. Sogar mehrere, wenn man es genau nahm. Erstens war Stefanie neidisch auf Wolf. Jeden Tag aufs Neue äußerte sie ihre Missgunst ihm gegenüber durch an fast schon tiefe Abneigung grenzende Feindseligkeit. Zweitens ging sie jeden Morgen, noch bevor sie sich an ihren Platz begab, zum Chefredakteur, um zu buckeln, was das Zeug hielt. Somit hatte Faber ihr vermutlich auch aufgetragen, die Botschaft zu überbringen. Frevelhaft bei der Beziehung zwischen Stefanie und Faber war die Tatsache, dass sie miteinander schliefen, obwohl Stefanie mit einem anderen Mann verheiratet war und drei Kinder hatte. Von der Affäre wusste niemand außer Stefanie, Faber und Wolf, der sich in der Vergangenheit immer wieder auch in privaten Belangen als exzellenter und hartnäckiger Rechercheur erwiesen hatte – in dem Fall aus reinem Privatinteresse.
Somit war Wolfs Einstellung Stefanie gegenüber als eher kritisch zu bewerten. Stefanie pflegte eine ähnliche Beziehung auch zu Wolfs und ihrem direkten Vorgesetzten, dem Politik-Ressortchef Markus Boettcher. Zumindest was das Schleimen angeht. Ob sie auch mit Boettcher schlief, wusste er nicht. Doch Boettcher, dem kleinen Mann mit dem Napoleon-Komplex, wie Wolf es nannte, der Faber seinerseits bei jeder Gelegenheit in den Hintern kroch, reichte vermutlich die heuchelnde Freundlichkeit. Boettcher war eher schlicht gestrickt und hatte den Ruf, der schlechteste Politikchef zu sein, den der Berliner Morgen jemals beschäftigt hatte.
Wolf erhob sich von seinem Drehstuhl und ging zurück durch die Milchglastür. Die Ecke, an der er den „Unfall“ mit Lina hatte, passierte er diesmal ein wenig vorsichtiger als einige Minuten zuvor. Am Ende des Gangs betrat er den Aufzug. Er fuhr in den zweiten Stock, der genauso geschnitten war wie der erste, stieg aus und bog diesmal rechts ab. Hier auf der Chefetage war der Teppich edler, die Wände waren weißer und jedes Büro (Großraumbüros gab es hier weit und breit nicht) hatte sein eigenes Vorzimmer.