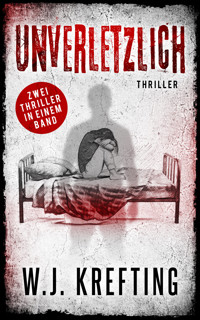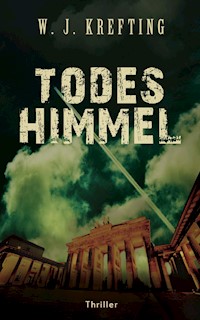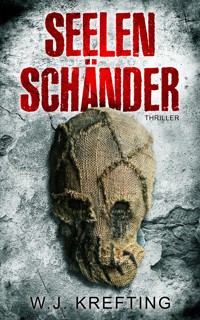3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Düsterer Neuseeland-Thriller vor der spektakulären Naturkulisse des Milford Sound. Ein Freizeitcamp wird für drei Jungen aus der Oberschicht zum Albtraum: Während die Gruppe ein paar unvergessliche Tage in den Bergen um den Milford Sound verbringt, schneidet ein Zyklon die entlegene Region vollends von der Außenwelt ab. Kurz zuvor ist ein psychisch kranker Mörder aus einer forensischen Klinik geflohen und in der Gegend gesichtet worden. Bald spült der Fjord die erste Leiche ans Ufer und eine Handvoll panischer Touristen verschanzt sich im nahen Besucherzentrum. Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten und so wird der australische Polizist Trevor Gordon zu ihrer einzigen Hoffnung. Gordon will in Neuseeland eigentlich einen Schicksalsschlag verarbeiten, dann taucht eine weitere Leiche auf und er muss handeln. Der Ermittler hegt den Verdacht, dass mehr hinter den Todesfällen steckt als ein bestialischer Serientäter und tatsächlich stößt er auf ein vergessenes Geheimnis aus der Vergangenheit. Gordon bleibt nicht viel Zeit, dem Mysterium auf den Grund zu gehen, denn niemand weiß, wie viele Menschen noch sterben müssen. Was verbirgt sich hinter den Toten am Fjord? W.J. Kreftings neuer Thriller nimmt Sie mit in den Sturm und wird Sie so schnell nicht wieder loslassen. Spannung garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Impressum
Prolog
Der Morgen überkam den Milford Sound ohne Dämmerung. Irgendwann war die Nacht von einem Moment auf den anderen einem unheimlichen Zwielicht gewichen. Dass plötzlich ein neuer Tag angebrochen war, registrierte man erst im Nachhinein. Regen und Hagel hatten nachgelassen, die Wetter-Wundertüte des Zyklons, der sich unaufhaltsam immer weiter auf das neuseeländische Festland schob, hielt zum Tagesanbruch „nur“ starken Wind bereit. Dennoch regnete es ins Tal, denn der Fjord war für die Wolken eingesprungen und produzierte seinen eigenen Niederschlag. Das abfließende Wasser aus den Unmengen an Regen und Hagel, die in der Nacht auf den Bergen rings um den Meeresarm niedergegangen waren, hatte sich zu kleinen Flüsschen zusammengeschlossen, die nun die steilen Hänge hinunterstürzten. Dutzende, Hunderte Wasserfälle in den unterschiedlichsten Größen säumten die hohen Ufer des Milford Sound und ergossen sich in die Tiefe, womit sie ein atemberaubendes Schauspiel boten. Das Wasser der meisten überwiegend kleineren Fälle erreichte die Fluten des Fjords nicht, denn der starke Wind zerstob es zu unendlich vielen kleinen Tröpfchen und blies diese gen Ufer.
An jenem Morgen nahm einer der aus dem Gebirge kommenden Wasserfälle plötzlich eine hellrote Färbung an. Es war Blut, das mit dem Wasser aus den Wäldern verdünnt den Abhang hinabstürzte, um vom Wind über die gesamte Landschaft verteilt zu werden. Es war fast so, als wollte der Geist eines Toten das Land um den Fjord in Besitz nehmen, indem er es überdeckte. Nachdem der Wasserfall ausgeblutet war, folgte ein lebloser, schlaffer Körper und trieb über die Kante des Abgrunds, von wo aus er seine Reise in die Tiefe antrat. Im freien Fall bewegte sich die Leiche schwerelos und schlug beim Drehen wild mit den Armen umher, während der Wind den Körper vom umgebenden Wasser befreite. Gestoppt wurde sein Fall von einem großen, aus dem Fjord ragenden Felsen, auf dem sich bei freundlicherem Wetter Seelöwen aufhielten. Der Körper rutschte langsam die schräge Oberfläche des Felsens in den Fjord hinab, während er eine blutige Spur auf dem harten Untergrund hinterließ, bis er am Ende platschend im Wasser landete. Die Wellen im Milford Sound hatten leichtes Spiel, ihn nach Belieben zu verformen, während sie ihn langsam in Richtung Ufer trieben, als wollte der Fjord den Menschen dort eine grausige Opfergabe darbieten.
Kapitel 1
Melbourne, Australien, eine Woche zuvor
Es gab Tage, an denen Trevor das Geräusch seines Weckers kurz vor dem Aufstehen halb schlafend in seine Träume einbaute. Heute war so ein Tag. Vor einer Minute hatte er sich noch in einem abstürzenden Flugzeug mit schrillem Alarm im Cockpit befunden. Jetzt torkelte er in Richtung Badezimmer, wobei ihn wieder dieser Schwindel überkam, der ihm seit einigen Wochen zu schaffen machte. Trevor hielt sich für einen Moment am Rahmen der Badezimmertür fest, atmete tief durch und machte sich bereit, schnell auf dem Boden Platz zu nehmen, falls er ohnmächtig werden wollte. Es wäre ratsam, kürzerzutreten, dachte er. Die langen Schichten und die viele Arbeit beim Murder Squad der Kriminalpolizei in Melbourne nahmen in der letzten Zeit überhand. Plötzlich wurde ihm übel. Er warf den Toilettendeckel nach oben und brach in die Schüssel, bis nichts mehr aus seinem Magen herauskam. Vielleicht hatte er sich einen Virus eingefangen? Das erklärte möglicherweise auch seine in letzter Zeit eingeschränkte Sehkraft, die heute zusätzlich von einem grauen Schleier getrübt war. Nach einer kalten Dusche war der Schwindel wie weggespült und auch seine Augen schienen wieder normal zu sein. Zum Glück, denn für einen Arztbesuch hatte er heute keine Zeit, es wartete zu viel Papierkram auf ihn. Wenn er ehrlich zu sich war, hatte er in den ganzen letzten Jahren nie Zeit für einen Check-up gefunden.
Die Sommersonne brannte um 8 Uhr morgens bereits so stark, dass sich auf Trevors Hemd schon auf dem kurzen Weg zur Tram-Haltestelle die ersten Schweißflecken abzeichneten. Allerdings war es nicht nur die Hitze, die ihn zum Schwitzen brachte, auch Trevors Kreislauf kam heute nicht richtig in Fahrt. In der Straßenbahn stand die Luft förmlich, und als er nach zwanzig Minuten vom Stadtteil Preston aus sein Ziel im Zentrum Melbournes erreichte, war er froh, wieder an der frischen Luft zu sein. Im Büro würde er als Erstes eines seiner beiden Reserve-Hemden anziehen, die immer dort in seinem Schrank hingen.
Das Victoria Police Center an der Flinders Street glich einem hässlichen Betonklotz, der so wirkte, als wäre er zur Abschreckung von Straftätern dort aufgestellt worden. Trevor und all seine Kollegen freuten sich auf das neue, schicke Hauptquartier in den Docklands, das der Bundesstaat Victoria sich für 230 Millionen Dollar Baukosten gönnte – und angesichts der hohen Baukosten für Unverständnis in der Bevölkerung Melbournes sorgte.
Mit einem Ping öffnete sich die Doppeltür des Lifts im vierten Stockwerk, dem Murder Squad. Kaum ausgestiegen, lief Trevor einer Kollegin in die Arme.
„Sorry, Trevor“, entschuldigte sich Rachel und huschte an ihm vorbei.
„Macht nichts“, rief er ihr hinterher, doch sie war schon hinter der nächsten Ecke verschwunden und konnte ihn nicht mehr hören.
Als erste Handlung für den heutigen Tag, der hoffentlich entspannter werden würde als die vorhergehenden, wechselte Trevor sein Hemd. Er stand gerade mit nacktem Oberkörper vor seinem Schrank, als sein Partner Harvey hereinkam.
„Hey, sexy! Ich glaube, ich hab dich noch nie früher an einem Tag dein Hemd wechseln sehen.“
Trevor mochte seinen immer gut gelaunten Partner. Er sorgte dafür, dass sein Alltag etwas erträglicher wurde, und schützte ihn an manchem Tag davor, angesichts der scheinbar immer krasser werdenden Gewaltverbrechen vollends in Zynismus und Verbitterung zu versinken.
„Pass auf, was du sagst. Wir haben Leute schon für weniger wegen sexueller Belästigung drangekriegt. Und das zu Recht“, entgegnete Trevor.
„Du solltest dich mal wieder trauen, eine Beziehung einzugehen. Das würde dir guttun.“
„Keine Zeit!“, raunzte Trevor. Jedes Mal, wenn Harvey zu tief in Trevors Privatleben einzudringen versuchte, würgte er das Thema ab, denn so nah wollte er ihn dann doch nicht an sich heranlassen. Harvey hatte das längst verstanden und akzeptiert, er wollte nach dem Vorbild des steten Tropfens, der den Stein höhlt, jedoch nichts unversucht lassen, seinen in letzter Zeit offensichtlich überforderten und unbelehrbaren Partner ab und zu auf andere Gedanken zu bringen.
„Wie auch immer, wir haben einen Tatort, drei Leichen. Der Chief hat uns gebeten, den Fall zu übernehmen. Wenn du mit deiner Strip-Show fertig bist, können wir los.“
Trevor war nicht begeistert, der sprichwörtliche Aktenstapel auf seinem Schreibtisch wuchs langsam bedrohlich in Richtung Decke, und er wollte nicht noch mehr Überstunden anhäufen, um den Papierkram endlich abzuarbeiten. „Wo geht’s hin?“, fragte er widerwillig.
„Braybrook.“
Während Harvey den dunkelblauen Ford mit aufgesetztem Blaulicht durch die Hochhäuser-Schluchten des Central Business District lenkte, überlegte Trevor, wie oft er in den vergangenen drei Jahren zu einem Einsatz im sozial schwachen Braybrook geschickt worden war. Zwei Hände reichten nicht aus, um die Fälle von Mord und Raubmord abzuzählen, in denen nur er und Harvey ermittelt hatten. Hinzu kamen die Einsätze der anderen Teams im Murder Squad. In den meisten Fällen handelte es sich um Dramen innerhalb der Familie oder Überfälle von kleineren Shops. Für Trevor waren das überwiegend die Folgen der hohen Arbeitslosigkeit dort. Die Supermärkte in der Gegend hatten alle aufgerüstet und teilweise bewaffnetes Sicherheitspersonal eingestellt. Trevor hasste es, tagtäglich Dinge mit ansehen zu müssen, die er nicht ändern konnte. Einer der Gründe, warum er sich als junger Mann für die Polizei entschieden hatte, war der Wunsch, Verbrecher wenigstens ihrer gerechten Strafe zuzuführen, wenn er sie schon nicht von ihren Taten abhalten konnte. Ein anderer Grund bestand darin, verstehen zu wollen. Was bewog einen Menschen dazu, einen Mord zu begehen? Was ging in ihm vor, wenn er die Entscheidung traf, ein Leben auszulöschen?
Als Harvey in die Arthur Street abbog, sahen Trevor und er schon von Weitem den Tatort. Zwei Streifen- und ein Rettungswagen standen mit blinkendem Blaulicht mitten auf der Straße. Davor hatte sich ein Pulk von Dutzenden Schaulustigen versammelt, die von blau-weiß kariertem Flatterband und ein paar uniformierten Polizisten zurückgehalten wurden. Einige der Neugierigen riefen unverständliche Sätze, die Trevor dumpf aus dem Wagen hörte.
„Verdammte Elendstouristen“, nuschelte Harvey und stellte den Wagen neben einem der Streifenfahrzeuge ab. Es war inzwischen unerträglich heiß geworden. Als Trevor aus dem klimatisierten Dienstwagen stieg, traf ihn die stickige Hitze wie ein Hammer vor den Kopf, und er musste sich am Dach des Ford festhalten, um nicht umzufallen.
„Ist alles in Ordnung? Du bist so bleich“, erkundigte sich Harvey.
Trevor wurde für einen Moment schwarz vor Augen, dann sah er kleine Sterne und er kniff die Augen zusammen. „Es geht schon“, sagte er, „das Wetter schlägt mir auf den Kreislauf.“
Als Trevor sich gefangen hatte, bahnten er und Harvey sich einen Weg durch den Menschenpulk, nicht ohne dabei von einzelnen Zuschauern angepöbelt zu werden. Einer der uniformierten Kollegen hob das Flatterband an und ließ sie passieren. „Der Vater ist durchgedreht, hat seine Familie und sich erschossen“, sagte er mit Gleichgültigkeit in seiner Stimme. Der Job als Polizist hatte ihn offensichtlich abgestumpft, doch Trevor brachte dem sogar teilweise Verständnis entgegen. Seit er seine Karriere begonnen hatte, begleitete ihn die Angst davor, eines Tages genauso abgebrüht zu enden. Heute hatte er jedoch andere Sorgen, sein Kreislauf meldete sich schon wieder. Diesmal verschwamm alles, was er sah, hörte und fühlte, zu einem einzigen Wahrnehmungsbrei. Der Menschenpulk und die Rufe daraus schallten an ihm vorbei, das Blaulicht blendete, der Streifenpolizist verkam zu einer Fratze und die Hitze auf seiner Haut schien ihn zu verbrühen. Schweißgebadet taumelte Trevor und kippte nur deswegen nicht um, weil der geistesgegenwärtige Harvey ihm zur Seite sprang und ihn abstützte. „Hey, hiergeblieben! Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?“
Diesmal benötigte Trevor etwas mehr Zeit, bis er sich gefangen hatte; nach ein paar Minuten waren seine Beschwerden unerklärlicherweise wie weggeblasen. Trevor versicherte seinem skeptisch dreinblickenden Partner, dass er sich keine Sorgen machen müsse.
„Na gut, wagen wir uns mal hinein.“ Harvey war zwar immer noch verunsichert, vertraute Trevor aber.
Das Haus an der Arthur Street war bestimmt 40 Jahre alt und von ein paar mächtigen Platanen umgeben. Eine dünne Moosschicht bewuchs die weißen Holzplanken an den Wänden, von denen an vielen Stellen die Farbe absplitterte. Die Fliegengitter vor den Fenstern und der Haustür verliehen dem Gebäude das Aussehen einer Haftanstalt. Ein Gefängnis, das vom Zerfall gezeichnet war. Trevor und Harvey betraten den Flur. Nur zu gut kannten sie den Geruch, der unmittelbar an ihre Nasen drang. Es roch nach Blut, nach Eisen, und je weiter sie ins Haus gingen, desto intensiver wurde es.
„Wir sind hier!“, ertönte eine Stimme aus dem Wohnzimmer. Ein Mann im blauen Schutzanzug, ein Kollege von der Spurensicherung, hatte Trevor und Harvey im Flur gehört und trat heraus, um den beiden den Weg zu weisen. Im Wohnzimmer erwartete sie ein fürchterlicher Anblick. Eine riesige Blutlache hatte sich über fast den gesamten Linoleum-Fußboden ausgebreitet und tränkte einen Teppich im hinteren Teil des Raums. Es war das Blut von drei Menschen, das Blut einer kleinen Familie, die in der Mitte des Raums lag: Vater, Mutter und die vielleicht fünfjährige Tochter. Trevor bewegte sich vorsichtig durch den Raum und trat auf Zehenspitzen nur auf die Stellen des Bodens, an die das Blut nicht gelangt war. Sie waren wie kleine Inseln im Raum verteilt, über die sein Partner ihm folgte. Trevor musste hart arbeiten, um die aufkommende Übelkeit zu unterdrücken, als er nah genug bei den reglosen Körpern stand. Gerade hatten sie noch so friedlich ausgesehen, jetzt vermittelten sie den Eindruck puren Entsetzens. Die beiden Mitarbeiter der Spurensicherung spekulierten gerade laut darüber, ob der Vater wohl hatte nachladen müssen, während Trevor sich sein eigenes Urteil bildete.
Die Frau lag mit von sich gestreckten Beinen auf dem Boden, ihre kleine Tochter hielt sie fest an sich auf den Bauch gedrückt. Im Rücken des Mädchens klaffte ein Einschussloch, das etwa den Durchmesser von zwei Zentimetern maß – die Austrittswunde war vermutlich noch einmal ein ganzes Stück größer. Neben den beiden lag der Mann, augenscheinlich der Vater des Mädchens. Auf seinem Bauch lag eine doppelläufige Schrotflinte, das Loch in seinem Kopf war so groß, dass man hindurchschauen konnte. Die Schrotladung hatte einen Großteil seiner Gehirnmasse herausgetrieben, sodass sie sich weiträumig im Raum verteilt hatte und auch noch an der hinteren Wand klebte. Trevor tat es in der Seele weh, sich vorzustellen, was hier passiert war. Der Mann hatte seine Frau und seine Tochter vermutlich gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Das kleine Mädchen hatte Angst und sich fest an ihre Mutter geklammert. Wahrscheinlich hat sie geweint und schluchzend ihre Mutter gefragt, was Papa da macht. Der Mann hat dann den Lauf der Schrotflinte fest auf den Rücken des Mädchens gepresst und abgedrückt. Hoffentlich war sie sofort tot und musste nicht leiden. Die Schrotladung muss durch den zarten Körper des Mädchens gegangen sein wie durch Watte und war dann noch in den Körper der Mutter eingedrungen. Eine Patrone hatte beide getötet, spekulierte Trevor. Dann hatte sich der Vater zu seiner toten Familie gesellt. So, als würde er sich abends zu ihnen ins Bett legen. Wer weiß, was in seinem Kopf zu diesem Zeitpunkt vorging. Dann hatte er sich die Mündung in den Mund gesteckt und abgedrückt, woraufhin die Flinte durch den Rückstoß ein Stück nach hinten katapultiert wurde und auf dem Bauch des Mannes liegen blieb. Für Trevor war klar: Der Vater hatte nicht nachladen müssen, sondern seine ganze Familie mit zwei Ladungen hingerichtet. Obwohl Trevor schon einiges gesehen hatte, nahm ihn der Anblick sehr mit. Sobald Kinder zu Schaden kamen, diese unschuldigen, zerbrechlichen Wesen, hatte er Schwierigkeiten, die nötige Distanz zu seiner Arbeit zu wahren. Auch Harvey kam nicht besonders gut mit der Situation klar, für seine Verhältnisse sagte er recht wenig.
„Wir werden das Mädchen jetzt vorsichtig umdrehen, bitte machen Sie Platz“, kündigte einer der Männer von der Spurensicherung an.
Harvey und Trevor traten ein paar Schritte zurück und suchten sich jeweils eine Insel, die das Blut umflossen hatte, auf der sie stehen konnten, ohne ihre Schuhe zu versauen. Obwohl ihm vor dem Anblick graute, der sich gleich eröffnen würde, schaffte Trevor es nicht, seinen Blick von der toten Familie abzuwenden. Die Hand im Latexhandschuh auf der Schulter des Mädchens wirkte deplatziert. Behutsam drehte der Mann von der Spurensicherung den zarten Körper um. Trevor sollte recht behalten, die Austrittswunde in ihrem Brustbereich war ungefähr viermal so groß wie das Einschussloch am Rücken. Jetzt konnte Trevor auch die Verletzung der Mutter sehen. Die Schrotladung hatte auf dem Weg durch den Körper des Mädchens gestreut, sodass sich auf der Brust der Frau kein einzelnes Einschussloch befand, sondern die Haut an mehreren, kleineren Stellen perforiert worden war, wenn man die Löcher in ihrer blutdurchtränkten Bluse richtig deutete. Am Rücken der Mutter befanden sich keine Austrittslöcher, die Schrotkugeln steckten noch immer in ihrem Körper.
Trevor schaute sich den Tatort noch einmal in Ruhe an. Wut kam in ihm auf. Wut auf den Vater, der seine Familie ausgelöscht hatte, vor allem jedoch das Leben seiner kleinen Tochter. Er selbst hatte keine Familie, doch er wusste, wie es sich anfühlte, einen geliebten Menschen zu verlieren. Wieso bloß hatte niemand diese schreckliche Tat verhindert? Hatte es keine Warnzeichen im Vorfeld gegeben? Hatten die Nachbarn nichts bemerkt?
„Wer hat eigentlich die Polizei verständigt?“, fragte Trevor.
Es waren wohl Passanten, die im Haus eine laute Auseinandersetzung gehört hatten, berichtete Harvey. Die Antwort nahm Trevor nicht mehr wahr. Er verlor in diesem Moment sein Bewusstsein und war auf dem Weg zum Fußboden. Diesmal war sein Partner nicht schnell genug, ihn aufzufangen, sodass Trevor hart aufkam und mitten in der großen Blutlache liegen blieb.
Kapitel 2
Dunedin, Südinsel von Neuseeland
Das Hupen und die quietschenden Reifen des schweren 59er-Cadillac bildeten zusammen einen schrillen Akkord, der Rick trotz der lauten Musik auf seinen Kopfhörern zusammenzucken ließ.
„Pass gefälligst auf, wenn du über die Straße gehst“, brüllte der Fahrer des amerikanischen Oldtimers, während er hektisch und mit einiger Mühe die Scheibe der Tür herunterkurbelte.
Leicht zitternd nahm Rick die Kopfhörer ab und schaute zum Fahrer hinüber. Es war Laurie, ein protziger Kollege von Ricks Arbeitsstelle, dem Wakari Hospital im Norden der Stadt.
„Ach, du bist es, Rick. Du solltest dich das nächste Mal umschauen, sonst wird dich irgendwann noch mal jemand von seinem Kühlergrill wischen müssen.“
Der V8-Motor des Cadillacs blubberte laut auf, als der Wagen den leicht unter Schock stehenden Rick umrundete und davonfuhr. Nach einer kurzen Atempause setzte Rick seinen Weg zur Bushaltestelle an der gegenüberliegenden Straßenseite fort und versuchte sich mit lauter Musik wieder zu beruhigen. Auch wenn Rick Laurie nicht wirklich gern mochte, so hatte er doch recht: Rick täte gut daran, ein bisschen aufmerksamer durchs Leben zu gehen, ansonsten würde ihm eines Tages tatsächlich noch mal etwas Schlimmes zustoßen.
Rick war nicht immer so gewesen. Erst seitdem seine privaten Probleme in den letzten Monaten zusehends an ihm nagten, versank er häufiger in Gedanken. Die finanzielle Situation von ihm und seiner Frau und die Sorge um die Zukunft ihres gemeinsamen behinderten Kindes prägten derzeit ihren Alltag. Am schlimmsten daran war der Gedanke, dass kein Ausweg aus diesem Schicksal führte. Ein behindertes Kind zu versorgen und die damit verbundenen Aufwendungen zu stemmen, bedeutete eine Bürde fürs Leben. Ähnlich verhielt es sich mit dem kümmerlichen Gehalt, das er als Pfleger in einer psychiatrischen Einrichtung bekam, das Geld reichte bei Familie Hayes nur selten bis zum Ende des Monats und das Haus war bereits mit einer Hypothek belastet. Es brach Rick das Herz, wenn er daran dachte, dass sie das Haus eines Tages wegen zu hoher Schulden verlassen könnten. Ihr Heim war eine Oase, die nicht weit entfernt von der Küste lag und einen herrlichen Ausblick auf das Meer bot. Wie lange hatten sie nach so einem Haus, das darüber hinaus noch bezahlbar war, gesucht?
Von der Hillside Road, seiner Haltestelle im Zentrum Dunedins, bis zum Halfway Bush im nördlichen Stadtteil Wakari benötigte die Linie 44 eine gute halbe Stunde. Der Bus war fast voll, beim Einsteigen entdeckte Rick vor der allerletzten Reihe noch einen freien Doppelsitz, auf den er sich dankbar fallen ließ. Hinter ihm saß eine Frau, die ihrem Sitznachbarn – offensichtlich einem Touristen – mit lauter, penetranter Stimme die Geschichte Dunedins erklärte. Sie erzählte, wie 1848 die ersten schottischen Siedler hierherkamen, um Neu Edinburgh zu gründen. Rick regelte die Lautstärke seiner Kopfhörer hoch. Dann bekam er noch mit, dass Dunedin ja auf Gälisch Edinburgh bedeute. Rick regelte die Kopfhörer ein bisschen höher, endlich hörte er die Frau nicht mehr. Nur die unverkennbaren Gitarrenriffs von Angus Young schallten an sein Ohr, während am Busfenster die viktorianischen Gebäude der sauberen Altstadt vorbeizogen.
An der Haltestelle Taieri Road stieg ein Mann mit einem marineblauen Anzug, einem Baseballcap und einer verspiegelten Sonnenbrille in den Bus. Ungewöhnlich fand Rick ihn nicht wegen seiner Kleidung, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass er ihn noch nie zuvor in diesem Bus gesehen hatte, der Mann aber nicht wie ein Tourist aussah. Touristen erkannte man sofort an ihrer lockeren Kleidung, Einheimische trugen in der Regel eher formellere Sachen. Und da Dunedin mit knapp 130.000 Einwohnern nicht übermäßig groß war und Rick die Linie 44 zudem täglich um dieselbe Zeit nutzte, kannte er mindestens 95 Prozent der Fahrgäste vom Sehen. Der Mann im Anzug schaute sich einmal im Bus um, verharrte mit seinem Blick für einen kurzen Moment in Ricks Richtung und stellte sich schließlich an eine Haltestange in der Mitte des Buses.
Mit jeder Haltestelle, die sich der Bus vom Stadtzentrum entfernte, leerte sich der Bus weiter, bis an der Endstation Halfway Bush nur noch ein halbes Dutzend Passagiere übrig waren.
Das Wakari Hospital lag gut drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Als die Einrichtung 1915 gebaut wurde, herrschte offensichtlich noch die Überzeugung, dass die Geisteskranken, die Verrückten möglichst weit weg von den „Normalen“ untergebracht werden sollten. Auch das trug dazu bei, dass die Anstalt bis heute eine gespenstische Aura umgab. Doch wenigstens bot der erhabene Standort eine bildschöne Aussicht auf die Stadt. Dunedin lag im Lavabett eines erloschenen Vulkans und war umgeben von einer hügeligen Gesteinsformation. Diese war jetzt im Sommer mit saftigem Grün bewachsen und sorgte im Übrigen dafür, dass es selbst in dieser Jahreszeit nicht wärmer als 20 Grad wurde.
Rick und die verbliebenen Fahrgäste stiegen aus dem Bus. Der Fußweg von der Haltestelle bis zum Hospital ließ Zeit für genau eine Zigarette. Rick kramte eine Schachtel Winfield aus der Tasche und zündete sich einen Glimmstängel daraus an. Für einen kurzen Moment blieb er stehen, um die Aussicht dabei zu genießen. Als sein Blick über die Landschaft schweifte, sah er durch die Baumwipfel bereits die helle Fassade des Wakari Hospital durchschimmern. Es half nichts, er musste weiter, in wenigen Minuten begann die Spätschicht.
Selbst wenn man es nicht wusste, so hätte man doch ahnen können, dass es sich bei dem klobigen Betonbau des Hospitals um eine psychiatrische Anstalt handeln könnte. Steril, rechteckig und mit teilweise vergitterten Fenstern stand das Gebäude mitten in einem Vorort und bildete einen krassen Kontrast zur wunderschönen neuseeländischen Kulisse im Hintergrund, die im Licht der untergehenden Sonne überaus malerisch anmutete. In der Einrichtung waren Patienten sowohl in einer geschlossenen, als auch in einer offenen Abteilung untergebracht. Im Park vor der Klinik gingen einige von letzteren mit ihren Betreuern vor dem Abendessen noch eine Runde spazieren.
Rick drückte seine Kippe im Aschenbecher neben dem Haupteingang aus. Er setzte seine Kopfhörer ab und zuckte zusammen, als plötzlich jemand die Hand auf seine rechte Schulter legte. Einer der Patienten?, schoss es ihm unwillkürlich durch den Kopf. Nach einem Schockmoment neigte Rick vorsichtig seinen Kopf nach rechts. Sofort fiel ihm ein Skorpion-Tattoo auf dem fremden Handrücken ins Auge. Langsam drehte Rick sich um. Der unbekannte Anzugträger aus dem Bus stand hinter ihm.
„Ich wollte Sie nicht erschrecken. Haben Sie vielleicht ein paar Minuten?“
Rick zögerte, die Situation erschien ihm sehr suspekt, jedoch war er gleichzeitig neugierig. „Na gut, aber nur, wenn es wirklich nicht lange dauert. Schießen Sie los.“
„Bitte nicht hier, lassen Sie uns ein Stück in den Park gehen.“
Der Fremde erwähnte seinen Namen während des darauffolgenden Gesprächs nicht. Auch nahm er seine Mütze oder die Sonnenbrille nicht ab, sodass Rick nicht erkannte, mit wem er es zu tun hatte. Was er zu sagen hatte, dauerte dafür aber tatsächlich nur wenige Minuten, wie er versprochen hatte. Als er wieder ging, ließ er einen verunsicherten Rick mit dem Rat zurück, über sein Angebot zu schlafen, am nächsten Tag könne man noch einmal in aller Ruhe über alles reden.
Die Nachricht des Anzugträgers arbeitete in Rick und fesselte ihn während seiner gesamten Schicht. Er versorgte die psychisch kranken Patienten in der geschlossenen Abteilung, half ihnen, sich bettfertig zu machen, schaute mit einigen von ihnen noch Fernsehen und übernahm mit einem zweiten Kollegen einen Teil der Nachtwache, doch er befand sich gedanklich permanent beim Angebot des Fremden. Auch auf dem Rückweg im Bus durch das dunkle Dunedin ließ ihn das Thema nicht los. Zu Hause wurde Rick von seiner Frau Betty erwartet.
„Du bist noch wach?“, fragte er und küsste sie auf die Stirn.
„Ich habe kurz Charly ein Schmerzmittel gegeben, er hat die ganze Zeit geschrien. Es tut ihm weh.“
Rick drückte Betty fest an sich. „Ich hab von einem neuen Spezialisten in Christchurch gelesen, für Kinder, die mit offenem Rücken geboren wurden. Da sollten wir mal hin.“
„Ja, das sollten wir“, bemerkte Betty nach einer kurzen Pause. „Als du bei der Arbeit warst, hat die Bank noch mal angerufen. Ob du morgen Vormittag vorbeikommen könntest, es geht schon wieder um die Hypothek …“
Rick schob Betty von sich weg und seufzte. „Na ja, ich kann das ja wohl nicht ewig vor mir herschieben.“
Den Großteil der Nacht verbrachte Rick damit, sich von einer Seite auf die andere zu wälzen und über unproduktiven Gedanken zu brüten. Er wusste nicht, was ihn mehr beschäftigte: das Angebot des Fremden oder der Termin bei der Bank. Zwischendurch schaute er nach Charly, der dank der Schmerzmittel, die Betty ihm gegeben hatte, friedlich schlummerte.
Völlig gerädert und mit verquollenen Augen trat Rick am nächsten Morgen seiner Bankberaterin gegenüber.
„Es ist eine Qual, wenn sie noch nicht durchschlafen, nicht wahr? Aber das geht vorbei, ich spreche aus Erfahrung“, begrüßte sie ihn mit ihrer aufgeschlossenen, typisch neuseeländischen Art und lächelte dabei.
Wenn Sie wüssten, dachte Rick. „Sie wollten mit mir wegen der Hypothek sprechen?“, kam Rick direkt zur Sache. Die Bankberaterin bat ihn in ihr Büro und bot ihm an, sich zu setzen.
„Erst mal danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Rick. Es stimmt, ich möchte mit Ihnen über die Hypothek auf Ihr Haus sprechen und Sie daran erinnern, dass die erste Rate im Februar fällig ist.“
Rick stutzte. „Februar? Das ist diesen Monat. Über wie viel Geld sprechen wir denn?“
„5.000 Dollar. Das steht auch alles so im Darlehensvertrag.“
„Tut mir leid, ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren, da habe ich das wohl verschwitzt“, entschuldigte sich Rick.
„Wir können noch mal über eine Stundung reden …“
„Nein, nein, schon gut“, sagte Rick, „Sie bekommen die Rate, ich treibe das Geld auf.“
„Okay. Und dann wäre da noch etwas: Einige Überweisungen von offenen Rechnungen konnten wir in der vergangenen Woche nicht ausführen, da Ihr Konto nicht gedeckt ist.“
„Verstehe“, sagte Rick, „ich kümmere mich.“
Rick versuchte, sich Betty gegenüber nichts von seinen Sorgen um die angespannte finanzielle Situation anmerken zu lassen. Sie hatte mit der Betreuung des kleinen Charly schon genug Last zu tragen.
„Und, was gab es bei der Bank?“, erkundigte sich Betty.
„Ach, nur ein paar Unterschriften.“
Rick hasste es, seine Frau anzulügen. Um der Situation zu entkommen, brach er frühzeitig zur Arbeit auf. Während der Busfahrt nahm Rick sich Zeit zum Nachdenken und machte sich seine Gesamtsituation bewusst. So konnte es nicht weitergehen. Musste es auch nicht, eine Lösung für sein Problem lag in Reichweite. Er musste nur noch zulangen. Aber handelte er damit auch richtig? Streng genommen musste er nicht handeln, sondern einfach im passenden Augenblick gar nichts tun. Außerdem konnte er sich in seiner Situation nicht den Luxus leisten, das Richtige zu tun. Rick traf eine Entscheidung.
„Ich freue mich, dass wir ins Geschäft kommen“, sagte der Anzugträger, der bereits im Park auf Rick gewartet hatte.
„Schon gut. Wann bekomme ich die 10.000 Dollar?“
„Wenn die Sache erledigt ist.“
Rick fühlte sich nicht gut damit.
„5.000 jetzt und den Rest danach?“
Der Fremde willigte ein. Er schaute sich um, zog unauffällig ein großes Geldbündel aus der Innentasche seines Sakkos, zählte das Geld ab und überreichte es Rick. Der nahm es mit zittrigen Händen entgegen und steckte es in die Hosentasche. Er konnte sich nicht daran erinnern, überhaupt irgendwann in seinem Leben mit so viel Bargeld auf einmal herumgelaufen zu sein.
„Nach Ihrer Schicht werde ich Sie an einem sicheren Ort aufsuchen und Ihnen die zweite Hälfte übergeben. Sofern alles glattgelaufen ist“, verabschiedete sich der Fremde.
Jetzt hatte er keine Wahl mehr, er musste es durchziehen. Mit einem mulmigen Gefühl betrat Rick die geschlossene psychiatrische Station, deren vergitterte Glastür er mit einem vierstelligen Sicherheitscode öffnete. Fünfzehn Patienten waren hier untergebracht, die meisten von ihnen litten unter den verschiedensten Psychosen, waren teilweise bereits straffällig geworden und befanden sich in Sicherungsverwahrung.
Rick zog sich in der Umkleide seinen grünen Kasack an und half seinen Kollegen im Aufenthaltsraum, einigen sedierten oder katatonischen Patienten, die regungslos auf ihren Stühlen saßen und die Wand anstarrten, das Abendessen anzureichen. Danach war Schlafenszeit und die Pfleger brachten die Patienten in ihre Zimmer.
Die meisten Bewohner würden eine sehr lange Zeit hier verbringen, immer demselben Tagesablauf folgen und nicht viel Abwechslung erleben. Rick rechtfertigte das damit, dass psychisch kranke Menschen ohnehin einen geregelten Rhythmus benötigten. Außerdem war es bei manchen von ihnen mehr als geboten, sie für immer wegzusperren. Immerhin waren die Zimmer auf der geschlossenen Abteilung recht gemütlich eingerichtet. Nur die massiven Türen, die jede Nacht abgeschlossen wurden, erinnerten ein wenig an eine Gefängniszelle. Nachdem alle Bewohner im Bett waren, verabschiedeten sich drei der Pfleger, sodass für die Nachtwache nur noch Rick und sein Kollege Jeremy auf der Station blieben. Mehr Leute brauchte es auch nicht, da die meisten Patienten die Nacht über mit Schlafmitteln ruhiggestellt waren und Rick und Jeremy nur aktiv werden mussten, wenn jemand die Notschelle betätigte.
„Ich hau mich vor den Fernseher. Wenn du mich suchst, weißt du Bescheid“, sagte Jeremy.
„Ist gut, ich muss noch kurz was nachschauen“, antwortete Rick.
Das war die Chance, seinen Plan auszuführen. Rick wollte jedoch nicht tätig werden, ohne vorher ein paar Informationen einzuholen. Er suchte an seinem großen, klimpernden Bund den richtigen Schlüssel und öffnete den gut gesicherten Verwaltungsraum der Station, in dem sich alle Akten der Patienten befanden. Im Regal musste er nicht lange suchen, bis er im untersten Fach den Ordner von Patient Woodrow fand. Rick versicherte sich im Flur, dass Jeremy ihn nicht überraschen würde, und setzte sich an den Schreibtisch. Wer war also dieser Clive Woodrow? In der Akte befanden sich eine Menge Berichte, Gutachten und Fotos von ihm. Er war ein Mann um die 30, der aufgrund seiner hageren Statur und der eingefallenen Wangen deutlich älter aussah. Rick nahm eines der Gutachten aus dem Ordner und las es durch. Dass Woodrow unter einer ausgeprägten bipolaren Störung litt und in der Vergangenheit bereits straffällig geworden war, wusste Rick. Einzelheiten hatte er bisher jedoch nicht erfahren, da in der Regel nur der Stationsleiter und die Klinikleitung Bescheid wussten. Das war das erste Mal, dass Rick sich überhaupt eingängig mit einer Patientenakte beschäftigte. Natürlich kannte er Woodrow schon lange, aber Rick verfolgte stets den Grundsatz, nicht zu viel über die Patienten zu wissen, um ein ganz unvoreingenommenes Verhältnis zu pflegen.
Woodrows Biografie fiel dadurch auf, dass die ersten Anzeichen einer psychischen Störung erst relativ spät auftraten, im Alter von 14 Jahren. Er kam aus guten, wenn nicht besten Verhältnissen, doch das hatte offenbar nicht seinen darauffolgenden, steilen Abstieg verhindern können. Er schloss sich einer Jugendclique an und wurde zum ersten Mal durch einen Diebstahl in einem Supermarkt aktenkundig. Ein Jahr später wurde er wegen Raubes zu zwei Jahren Jugendhaft verurteilt. Als er nach der Hälfte der Zeit entlassen und der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, fing er an, Drogen zu nehmen. Bei einem weiteren Raub, diesmal traf es einen Kiosk, starb ein alter Mann an einem Herzinfarkt. Nur durch den glücklichen Umstand, dass der Richter ihm wohlgesonnen war, wurde er damals nicht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, sondern erhielt eine letzte Chance in Form einer Bewährungsstrafe für den Raub. Darauf folgten mehrere Aufenthalte in der Psychiatrie, bis Woodrow eines Tages wegen eines Raubmords zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. An dem Tag stand er vor einem Richter, der absolut keinen Spaß verstand, der junge Mann hatte seinen Kredit verspielt. So war er schließlich hier im Wakari Hospital gelandet.
Nirgendwo in der Akte fand Rick einen Hinweis auf den Auslöser der psychischen Störung, nur darauf, dass sein Vater früh verstorben und die Mutter deswegen zur Alkoholikerin geworden war.
Mit den neuen Informationen über Clive Woodrows kriminelle Vergangenheit entwickelte Rick Zweifel daran, ob er seinen Plan tatsächlich weiterverfolgen wollte. Er würde einen Mörder freilassen, eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft. Und warum eigentlich? Darüber hatte ihm der fremde Anzugträger nichts gesagt. Es gelang Rick schnell wieder, seine Zweifel beiseitezuschieben, denn vorerst würde er mit Sicherheit nicht wieder die Möglichkeit bekommen, sich so einfach seiner finanziellen Probleme zu entledigen. Rick verschloss den Verwaltungsraum und sah nach seinem Kollegen Jeremy.
„Setz dich und nimm dir ne Cola, Dr. House fängt gleich an“, sagte er.
„Ich komm gleich, muss vorher noch mal ins Bad.“
Rick verschwand um die Ecke und schlich zügig über den Gang zu Zimmer 15, auf dessen Tür in grünen Druckbuchstaben Clive Woodrows Name stand. Mit zittrigen Händen fummelte er den passenden Schlüssel aus seinem Bund heraus, ängstlich, dass Jeremy das klirrende Geräusch hören und misstrauisch werden könnte. Plötzlich fiel ihm der Bund aus der Hand und landete scheppernd auf dem beigen Linoleumboden.
„Ist alles in Ordnung?“, rief Jeremy herüber.
„Ja, alles in Ordnung, ich komme gleich.“
Rick hob den Bund auf und öffnete die Tür. Im Zimmer war es dunkel, doch im schwachen Lichtkegel, der durch den Flur hereinfiel, konnte er Woodrow erkennen. Er saß auf dem Bett und bewegte sich nicht.
„Gib mir noch eine Minute Zeit, dann kannst du verschwinden. Der Sicherheitsdienst geht gerade eine Runde ums Gebäude, du kannst also unbemerkt durchs Foyer nach draußen“, flüsterte Rick.
Er ließ die Zimmertür offen, versicherte sich, dass Jeremy noch immer vorm TV saß, und schlich weiter zur schweren Stationstür. Nach Eingabe seines Codes brummte die Tür kurz und ließ sich aufdrücken. Rick klemmte den Plastikdeckel von einer Flasche mit Desinfektionsmittel zwischen Tür und Rahmen, sodass sie nicht wieder ins Schloss fallen konnte. Damit war sein Job getan.
„Hab ich was verpasst?“, fragte Rick und setzte sich in den Sessel, der neben Jeremys stand.
„Nein, nicht wirklich, läuft erst seit ein paar Minuten.“
Rick gab vor, interessiert die Serie zu verfolgen, innerlich konnte er es vor Aufregung jedoch kaum aushalten. Einige Male stand er nervös auf, um sich direkt wieder hinzusetzen und einen fragenden Blick von seinem Kollegen zu ernten.
Clive Woodrow hockte auf dem Bett in seinem dunklen Zimmer und versuchte sich abzulenken. In den vergangenen Wochen hatte er wieder mit Gedankenrasen zu kämpfen gehabt. Und wenn in seinem Kopf gerade einmal nicht die unproduktive Gedankenspirale lief, gab es Gewitter, wie er es nannte. Ein unbeschreibliches Druckgefühl wanderte dann in seinem Schädel willkürlich hin und her. Wie ein springender Flummi in einem Raum, nur viel langsamer und herumwabernd wie das weiche Wachs in einer Lavalampe. Der enttäuschte Clive hatte eigentlich gedacht, dass er diese Probleme nach der Anwendung der Techniken, die ihm während seiner Therapien beigebracht worden waren, im Griff hatte. Doch er wurde eines Besseren belehrt. Seine Probleme waren auch erst wieder so schlimm, seitdem der Fremde ihn besucht und ihm einen Brief gebracht hatte. Er wusste nicht genau, wann das war. Hier drin ging ein Tag in den anderen über, zeitliche und räumliche Grenzen verschwammen ineinander, was durch die Beruhigungsmittel, die er jeden Tag nahm, noch verschlimmert wurde. Es war fast ein bisschen so, als existiere er nicht. So, als hätte er sich in ein nicht greifbares Etwas verwandelt. Er verglich sich mit einer Qualmwolke, die man versuchte einzufangen. Nichts, was er tat, war folglich von Bedeutung. Wofür lebte er eigentlich noch? Er kam sich vor wie Dreck, und auch die meisten Pfleger behandelten ihn so. Manchmal wurde er sogar geschlagen. Dieser Jeremy war der Schlimmste von allen.
Clives Gedanken rasten schneller und schneller, er musste sich irgendwie ablenken und stieß seinen Hinterkopf immer wieder gegen die harte Betonwand hinter ihm. Solange, bis er endlich nur noch den Schmerz spürte und etwas hatte, worauf er sich konzentrieren konnte.
Plötzlich hörte Clive das Schloss seiner Zimmertür klappern. War es schon Zeit zum Aufstehen? Hatte er wirklich die ganze Nacht in seinem Gedankenkarussell verbracht? Er war doch gerade erst von Jeremy ins Zimmer gebracht worden, oder täuschte er sich? Die Tür öffnete sich und das Licht, das aus dem Flur hereinfiel, blendete ihn. Im Türrahmen stand eine Gestalt. Sie sah aus wie ein Engel, der Engel des Todes? War es an der Zeit für ihn, mit dem Wesen zu gehen und dieses Leben endlich hinter sich zu lassen?
„Gib mir noch eine Minute Zeit, dann kannst du verschwinden. Der Sicherheitsdienst geht gerade eine Runde ums Gebäude, du kannst also unbemerkt durchs Foyer nach draußen.“
Clive erkannte die Stimme von Rick, dem zweiten Pfleger auf der Station. Heute Abend ging es also los. Clive dachte an den Brief des Fremden. Er versuchte sich zusammenzureißen und zog rasch ein paar Sachen über, die er aus dem Kleiderschrank rupfte. Als er den Flur betrat, brauchte er wieder einen Moment, sich an das helle Licht zu gewöhnen. Durch die zusammengekniffenen Augen sah er die Stationstür, die einen Spaltbreit offen stand. Er schaute sich um, auf dem Flur war niemand zu sehen. Von der anderen Seite hörte er den Fernseher und schlich über den Flur in Richtung Gemeinschaftsraum. Um die Ecke lugend sah er Rick und Jeremy von hinten, wie sie auf den Bildschirm starrten. Seine Hand begann zu zittern. Eine Vorstellung überkam ihn. Wie befriedigend es doch wäre, wenn er einem der Männer, vorzugsweise Jeremy, von hinten eine Schlinge um den Hals legen könnte. Langsam und kräftig würde er sie immer fester zuziehen und dabei beobachten, wie Jeremys Füße zucken und seine Hände vergeblich versuchen würden, die Schlinge zu lösen. Dann würde er nur fester ziehen, Jeremys Kopf würde langsam blau werden und nach ein paar letzten, verzweifelten Tritten mit dem Fuß auf dem rutschigen Boden würde sein Körper schließlich schlaff in den Sessel zurückfallen und regungslos liegen bleiben. Verdient hätte er es allemal, und jetzt hatte er endlich die Gelegenheit dazu, es ihm heimzuzahlen.
In Clives Geist trug sich ein Kampf zu, sollte er seine Vorstellung in die Wirklichkeit umsetzen? Etwas Unerklärliches trieb ihn dazu, ein Drang, den er in der Therapie gelernt hatte zu unterdrücken. Doch er war wieder kurz davor, die Oberhand zu gewinnen.
Plötzlich erhob Rick sich von seinem Sessel und holte Clive schlagartig zurück in die Wirklichkeit. Er wich zurück und hielt sich hinter der Wand versteckt. Zum Glück setzte sich Rick wieder hin. Gerade war Clive dabei, sich umzudrehen und zur Stationstür zu gehen, als ihn das Gefühl überkam, ein Blitz würde durch seinen Kopf zucken. Clive steuerte schnurstracks eine Pinnwand im Flur an und riss den Plastikkugelschreiber ab, der neben ihr an einer dünnen Kordel hing. Zielgerichtet marschierte er festen Schrittes auf den Sessel zu, in dem der nichtsahnende Jeremy gerade in seine Serie vertieft saß. Clive hielt den Kugelschreiber fest in der Faust umschlossen, sodass das spitze Ende unten herausragte. Als er direkt hinter Jeremy stand, holte Clive aus und rammte ihm den Kugelschreiber so fest er konnte in den Hals. Er musste die Schlagader getroffen haben, denn als er seine Waffe umgehend wieder herauszog, pulsierte das Blut im Schwall aus dem Loch. Der völlig überraschte Jeremy stieß einen gurgelnden Schrei aus und fasste sich mit weit aufgerissenen Augen reflexartig an den Hals, um die Wunde zuzudrücken. Vergeblich. Clive stach noch einmal zu. Und noch einmal und noch einmal. Laut schreiend fiel Jeremy aus dem Sessel und wand sich mit schmerzverzerrtem Gesicht vor Clives Zufriedenheit ausstrahlendem Angesicht auf dem Boden. Rick war mit seinem Sessel ein paar Meter zurückgewichen und in Schockstarre verfallen. War er als Nächstes an der Reihe? Erleichtert sah er, wie Clive den Kugelschreiber fallen ließ und um die Ecke verschwand. Nach einigen Augenblicken kniete Rick sich neben seinen Kollegen.
„Jeremy, Jeremy!“, rief er immer wieder, bis ihm schließlich, viel zu spät, der Gedanke kam, einen Krankenwagen zu rufen.
Ohne Zeit zu verlieren, rannte Clive zur Stationstür, stieß sie auf, rannte die Treppe hinunter und eilte durch das unbesetzte Foyer nach draußen. Die erste Etappe war geschafft. Clive blieb einen Augenblick stehen und sog die herrliche nächtliche Sommerluft tief in seine Lungen. Der Duft löste Erinnerungen an bessere Zeiten in ihm aus, die die dunklen Gewitterwolken in seinem Kopf vertrieben. Leider konnte er das Gefühl der Freiheit nicht lang genießen, denn er musste weg von hier, bevor irgendjemand sein Verschwinden bemerkte und die Suche nach ihm begann. Clive rannte durch den Park, immer weiter Richtung Norden. Die Berge lagen nur ein paar Kilometer weit entfernt, dort würde er Schutz finden. Und Nahrung für ein paar Tage, wie der Fremde ihm während seines Besuchs versprochen hatte. Clive besaß keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Immerhin hatte er auch angekündigt, seine Flucht zu organisieren, und jetzt war er hier auf den grünen Hügeln Neuseelands unterwegs. Nach zwanzig Minuten im Laufschritt setzte Clive sich für eine Verschnaufpause auf das Gras. Er hatte bereits eine gute Strecke zurückgelegt, in der Ferne konnte er das charakteristische, helle Wakari Hospital trotz Dunkelheit gut erkennen. Es gab noch keine Anzeichen, dass die Suche nach ihm begonnen hätte, er sah weder Scheinwerfer noch hörte er eine Sirene. Eigentlich herrschte gar keine Eile. Andererseits war aber auch noch niemand von hier geflohen, oder er hatte es nicht mitbekommen, weshalb er gar nicht wusste, wie so eine Situation aussah. Clive robbte zu einem Gebüsch ein paar Meter neben ihm und kroch darunter. Er stellte sicher, dass das Geäst ihn gut bedeckte. Selbst wenn er jetzt hier einschlafen sollte, würden sie ihn nicht finden. Es war vermutlich sowieso besser, sich in aller Ruhe erst morgen früh im Tageslicht zu dem Versteck aufzumachen, in dem etwas zu essen wartete.
Der Notarzt erreichte das Wakari Hospital ungefähr zehn Minuten nach Ricks Anruf und konnte Jeremy nicht mehr helfen. Außer der Ambulanz waren inzwischen auch zwei Police Officer und Klinikleiter Professor Johnston eingetroffen.
„Wie ist das passiert?“, fragte der Professor sichtlich ungehalten, aber auch betroffen.
„Ich … ich weiß es nicht, auf einmal preschte Woodrow um die Ecke und stach zu, danach haute er ab“, stotterte Rick und errötete.
„Ein Patient entkommt nicht einfach so aus seinem Zimmer, bringt jemanden um und verschwindet dann auch noch von einer geschlossenen Station“, sagte Johnston. „Außer Sie haben vergessen, die Türen abzuschließen.“
„Auf keinen Fall“, sagte Rick.
„Wie lange ist der Patient, dieser Mr Woodrow, denn schon weg?“, fragte einer der beiden Police Officer, der offensichtlich Maori-Wurzeln hatte, wie sein äußeres Erscheinungsbild erkennen ließ: Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, kurze Haare und eine kleine spiralförmige Tätowierung am Hals.
„Zwanzig Minuten“, antwortete Rick.
Der Officer notierte sich den Zeitraum. „Wie gefährlich ist dieser Mister Woodrow?“ Er richtete die Frage an Professor Johnston.
„Nun ja, er ist ein verurteilter Mörder und hier in Sicherungsverwahrung. Bisher war er gut eingestellt und wir hatten ihn dank seiner Medikamente unter Kontrolle. Sobald er sie nicht mehr einnimmt, wird sich das innerhalb von Tagen ändern.“
„Dann dürfen wir keine Zeit verlieren, wir leiten sofort die Fahndung ein.“
Wegen des Aufruhrs und des Polizeieinsatzes dauerte Ricks Schicht heute ungewohnt lange. Rick wollte aber noch unbedingt abwarten, bis die Spurensicherung ihre Arbeit abgeschlossen hatte und Jeremys Leiche abtransportiert war. Als er endlich erschüttert im Bus nach Hause saß, stieg die Sonne bereits über den grünen Bergen empor. Rick war zu müde, um wegen seiner Tat ein schlechtes Gewissen zu haben. Kaum hatte er sich in den harten Schalensitz fallen lassen, konnte er die Augen nicht mehr offen halten. So bekam Rick nichts davon mit, wie an der Haltestelle Taieri Road der fremde Anzugträger zustieg und im Sitz direkt hinter ihm Platz nahm. Die beiden Männer waren die einzigen Fahrgäste. Als der Fremde Rick mit seinen Fingern ins Ohr schnippte, wachte der auf. Benommen schaute er sich um und erschrak, als der Anzugträger hinter ihm plötzlich zu reden begann. „Das scheint ja gut funktioniert zu haben. Zumindest wenn man nach dem Polizeiaufgebot vor dem Wakari Hospital urteilt. Gute Arbeit! Und nicht vergessen, wir haben uns nie gesehen!“
Der Fremde zog ein Bündel Geldscheine aus der Tasche und reichte es Rick, der es, noch immer benommen, einsteckte. Prompt erhob sich der Mann wieder von seinem Sitz, er wollte offensichtlich an der nächsten Haltestelle schon wieder aussteigen. Rick war sich zunächst nicht sicher, ob er das Geld, diese mit Blut befleckten Scheine, tatsächlich noch wollte. Er ergriff schließlich jedoch seine Chance, bevor es zu spät war.
„Kennen Sie Woodrow? Warum sollte ich ihn freilassen?“
Bevor der Fremde aus dem Bus stieg, drehte er sich noch einmal zu Rick um.
„Das könnte ich Ihnen sagen, aber dann müsste ich Sie umbringen. Ich bezweifle, dass Sie das wollen, oder?“
Der Fremde stieg aus und verschwand. Da die aufgehende Sonne ihn blendete, konnte Rick nicht sehen, in welche Richtung er ging. Stattdessen ärgerte er sich über seine dumme Frage. Dass der Fremde ihm keine Details verraten würde, hätte er sich denken können. Wenigstens hatte er die zweite Hälfte des Geldes vollständig erhalten. Was jetzt geschah, lag nicht mehr in seiner Hand.
Kapitel 3
Milford Sound, Südinsel von Neuseeland
Ehrfurchtgebietend dehnte sich der Milford Sound von der Nordküste Neuseelands bis weit ins Landesinnere aus. Von hier aus betrachtet wirkte das ruhige, fast hypnotisch aussehende Wasser des Fjords so, als hätte jemand ein Tuch aus glänzender Seide, in dem sich der blaue Himmel und ein paar Wolken spiegelten, zwischen den majestätischen Gipfeln der Berge im Fjordland Nationalpark aufgespannt. Gar nichts ließ erahnen, dass sich unter der so ruhigen Wasseroberfläche ein Abgrund auftat, der Hunderte Meter in die Tiefe führte. Ein Schwarm Kormorane durchquerte das Wasser in der Mitte des Fjords, um immer wieder für einen Augenblick abzutauchen, nach einem Fisch zu schnappen und manchmal sogar mit Beute wieder aufzutauchen.
Der Gipfel des am westlichen Ufer des Fjords gelegenen Mitre Peak, einem der höchsten Berge in der Gegend, umspielten dicke, weiße Haufenwolken, als hätte sie jemand dort platziert, um den Himmel davor zu schützen, von der felsigen Spitze aufgespießt zu werden.
Rings um den Fjord stürzten Wasserfälle von den mit sattem Grün bewachsenen Hängen in die Tiefe. Auf halbem Weg nach unten zerstoben die kleineren von ihnen zu weißer Gischt, die prachtvoll schimmernde Regenbogen reflektierte. Die vorbeiziehenden Wolken sorgten für ein beeindruckendes Schattenspiel auf der Bühne der gigantischen Bergrücken links und rechts des Meeresarms. In unregelmäßigen Abständen ragten entlang der scharfen Wasserlinie Felsen aus dem Wasser, Seelöwen sonnten sich auf ihrem von der Sonne gewärmten Gestein. Das Grölen der Tiere durchstieß immer wieder das monotone Tosen der größeren, bis in den Fjord hinabstürzenden Fälle.
Heute zeigte sich der Milford Sound von seiner freundlichen Seite. Es herrschte eine einladende Atmosphäre, in der Wasser, Wetter, Gebirge und alle Lebewesen am Fjord in Eintracht miteinander zu harmonieren schienen.
Die Idylle wurde schroff durch den röhrenden Motor eines in die Jahre gekommenen Nissan Pick-up unterbrochen. Der Wagen pflügte durch das hohe Gras, heulte laut auf und wurde immer langsamer, bis er schließlich nicht mehr weiterkam.
„Verflucht noch mal!“, rief Noah. Er drückte aufs Gas, kurbelte die Scheibe herunter und starrte auf die rotierenden Räder, während sie sich immer weiter in das Erdreich frästen. Die Pritsche des Wagens war vollgepackt mit Lebensmitteln und Wasserkanistern, das hatte er nicht bedacht, als er die befestigte Straße für eine Abkürzung querfeldein zu seinem Ziel, einer Blockhütte nicht weit entfernt vom Ufer des Arthur River, verlassen hatte. Noah verkrampfte hinterm Steuer immer weiter, als ihn plötzlich ein lautes Hämmern an der Scheibe der Beifahrertür fast zu Tode erschreckte. Er riss seinen Kopf zur Seite und stellte erleichtert fest, dass es Koraka war, der neben dem Wagen stand und ihn durch die Scheibe anschaute.
„Jesus Christus, müsst ihr Maori euch immer so anschleichen? Das ist eine regelrechte Seuche. Du bist doch nicht auf der Jagd“, rief Noah. Er beugte sich über den Beifahrersitz und langte nach dem Türgriff.
Koraka zog die Tür auf. „Woher willst du wissen, dass ich nicht auf der Jagd bin?“, fragte Koraka. „Vielleicht bin ich auf der Jagd nach Menschen, die die Ruhe der Natur stören.“
Noah wusste nicht, wie die Bemerkung gemeint war, als der Maori ihn grimmig anschaute.
„Ist schon wieder ein Jahr vorbei? Gibt’s doch nicht“, bemerkte Koraka.
„Es ist Februar und wie jedes Jahr um den 6. sind wir hier. Sehr scharfsinnig bemerkt“, spottete Noah.
„… und wie jedes Jahr hast du für euer Camp zu viel Zeug eingekauft.“ Koraka wies mit dem Kopf auf die Ladefläche. „Wo ist Heather denn?“
„Noch in Te Anau, ein paar Notfall-Medikamente besorgen. Die Vorschriften für Sommercamps sind in den letzten Jahren strenger geworden. Auch dann, wenn nur eine Handvoll Jungs dabei ist. Und jetzt frag nicht und hilf mir lieber, du könntest mich anschieben“, schlug Noah vor.
„Das brauche ich nicht, du könntest einfach das Allradgetriebe zuschalten, Gas geben und sehen, was passiert“, sagte Koraka nicht ohne ein gewisses Maß an Genugtuung, stützte sich lässig mit den Unterarmen auf der Beifahrertür ab und schaute Noah an. Leicht peinlich berührt realisierte dieser, dass der Vierradantrieb tatsächlich noch nicht zugeschaltet war. In der Regel fuhr der geizige Noah immer nur mit einer angetriebenen Achse, um Sprit zu sparen, dabei hatte er ganz vergessen, dass sein Truck noch viel mehr konnte. Noah haute den zweiten, etwas kleineren Schaltknüppel des Getriebes auf die Stellung 4 H. Das Getriebe surrte und knackte laut, ohne dass der Gang einrastete.
„Ich würde auch beim Allradgetriebe kuppeln“, sagte Koraka.
Mit einem aufgesetzten Grinsen schaute Noah zu Koraka herüber, kuppelte durch und haute den Knüppel ein zweites Mal bis zum vorderen Anschlag. Noah ließ die Kupplung fliegen, der Wagen machte einen Satz und riss Koraka um ein Haar von den Füßen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten arbeitete der Nissan sich weiter durch das Gelände und ließ den kopfschüttelnden Maori zurück.
„Verdammter Idiot“, fluchte Noah in den Rückspiegel blickend und fuhr immer weiter auf den Lake Ada zu. Der See war lang, schmal und lag in der Mitte des Arthur River, der sich durch die grüne, zum großen Teil bewaldete Landschaft bis zum südlichen Ende des Milford Sound schlängelte. Genauer gesagt mündete der Fluss ins Deepwater Basin, einen bauchigen Fortsatz des Fjords, an dessen nördliches Ende die kleine Halbinsel mit dem Flugplatz grenzte.
Noah folgte dem Arthur River mit einigem Abstand, um sich nicht ein weiteres Mal mit dem Pick-up in der sumpfigen Uferregion festzufahren. Vor einer kleinen Brücke – einige hundert Meter vor dessen Mündung – stoppte er, ab hier ging es nur noch zu Fuß weiter. Noah stellte den Motor ab, stieg aus und schnappte sich zwei Zehn-Liter-Wasserkanister von der Ladefläche.
Obwohl er im nächsten Jahr bereits seinen 60. Geburtstag feierte, war sein Körper noch immer drahtig und fit genug, das Gewicht ohne große Anstrengung anzuheben. Noah erklärte das immer mit seiner „unerschütterlichen“ irischen Abstammung – die leider auch dafür verantwortlich war, dass er rote Haare und helle Haut hatte und deshalb empfindlich auf zu starkes Sonnenlicht reagierte. Noah setzte kurz die Wasserkanister ab, zog den Schirm seiner Baseballkappe tiefer ins Gesicht und überquerte mit seiner Last die Brücke, die ihn direkt auf den Milford Track am anderen Ufer führte.