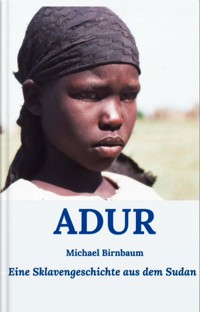Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein toter Aktivist. Ein vergiftetes Land. Ein Konzern, der tötet, um sein Geheimnis zu wahren. Für Journalist Michael Baumann wird die Recherche in der nigrischen Wüste zum Kampf ums Überleben. An der Seite einer mutigen Geologin und eines Tuareg-Kriegers, der seine eigene Zukunft opfert, zieht Baumann in einen hinterhältigen Konflikt um Uran und Macht. Hier ist jeder ein Spieler, und die Wahrheit ist die tödlichste Waffe von allen. Bis zur letzten Seite atemlos. Der neue Afrika-Thriller von Michael Birnbaum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AMASTAN
Der letzte Ritt des Schleierkriegers
von Michael Birnbaum
Über das Buch
Ein Mann. Ein Versprechen. Eine letzte Grenze. Michael Baumann wird vom Journalisten zum Gejagten: Als seine Geliebte, die mutige Geologin Angélique Kramer, im Niger verschleppt wird, ist die offizielle Lesart schnell gefunden: Dschihadisten. Doch Baumanns Instinkt warnt ihn. Die Spur führt nicht in die Wüste des Terrors, sondern in die Abgründe globaler Machtpolitik.
An seiner Seite nur zwei ungleiche Verbündete: Capitaine Laurent, ein desillusionierter französischer Geheimdienstler, der seine eigenen Regeln bricht. Und Amastan, ein Tuareg-Krieger, der seine Hochzeit und seinen Brautpreis riskiert, um einen Freund zu retten.
Gemeinsam decken sie auf, was niemand wissen soll: wie Uran-Konzerne ganze Landstriche vergiften. Wie Russlands Söldner im Schatten agieren. Und wie der »Krieg gegen den Terror« zum Deckmantel für uralte Gier wird. Ein Thriller, der beginnt, wo die Nachrichten aufhören.
Über den Autor
Michael Birnbaum war jahrelang Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Seine Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zeit inspirierten ihn zu seinen Afrika-Romanen der Baumann-Reihe – von denen er immer behaupten wird, sie seien ganz und gar erfunden. In München geboren, studierte er Geschichte, Volkswirtschaft und Politik an der LMU in München und an der Johns Hopkins University in Baltimore.
»Der Weiße ist sehr klug. Er kam still und friedlich mit seiner Religion. Wir waren amüsiert über seine Dummheit und erlaubten ihm zu bleiben. Jetzt hat er unsere Brüder gewonnen, und unser Klan kann nicht mehr als einer handeln. Er hat ein Messer an die Dinge gelegt, die uns zusammenhielten, und wir sind auseinandergefallen.«
― Chinua Achebe, Things Fall Apart
Impressum
Texte: © 2026 Copyright by Michael Birnbaum
Umschlag:© 2026 Copyright by Michael Birnbaum
Verantwortlichfür den Inhalt:
Michael Birnbaum
Höslstr. 10
81927 München
MichaelBirnbaum
AMASTAN
Der letzte Ritt des Schattenkriegers. Ein Afrika-Roman
Die blauen Schatten der Sahel
Hyänen in der Dämmerung
Angriff in der Nacht
Die Hitze wich so abrupt, dass es Amastan ag Litni selbst nach all den Jahren in der Sahel noch überraschte. Er spürte, wie die Temperatur um ihn herum fiel, als würde eine unsichtbare Hand einen Vorhang zur Seite ziehen. Der Sand unter seinen Knien strahlte die gespeicherte Wärme des Tages aus, ein letztes Aufbäumen gegen die Nacht, die bereits über die Dünen kroch wie Tinte in Wasser.
Mit jener zeremoniellen Sorgfalt, die ihm seine Mutter in Kindertagen beigebracht hatte, löste er den Tagelmust. Die ersten Windungen fielen schwer in seine Handfläche, steif vom getrockneten Schweiß, doch das Indigo leuchtete noch immer intensiv genug, um blaue Schatten auf seiner Haut zu hinterlassen. Die Male seiner Herkunft.
Im schwindenden Licht wirkte sein Gesicht, das tagsüber nie die direkte Sonne sah, überraschend jung. Sechsundzwanzig Jahre, doch um seine Augen zeigten sich noch nicht jene tiefen Furchen, die bei anderen Männern seines Volkes bereits mit zwanzig aufbrachen wie Risse in ausgedörrter Erde.
Er faltete das Tuch und legte es neben sich auf den Sand, wo es wie ein dunkler Schatten lag.
Die Kamele hatten sich bereits niedergelassen, ihre langen Hälse gesenkt, die Kiefer mahlten gemächlich an der trockenen Akazienwurzel. Der Schimmel stand abseits, eine weiße Silhouette gegen den violettfarbenen Horizont, den Kopf erhoben, die Ohren nach vorn gerichtet. Pferde witterten Gefahren, bevor Menschen sie hörten. Diese Eigenschaft hatte Amastan dem Tier nie aberzogen.
In der versteckten Tasche seines Gewands spürte er den festen Zylinder des Brautpreises. Fünfzehn Kamele in CFA-Francs, zusammengerollt und in dreifaches Plastik eingeschweißt gegen Schweiß, Sand und neugierige Soldatenfinger. Drei Jahre hatte er für dieses Geld gearbeitet – auf Baustellen in Ouagadougou, in Goldminen nahe Essakane, als Führer für europäische Touristen, die die Sahara als Instagram-Kulisse suchten und nicht begriffen, dass man hier nicht posierte, sondern überlebte.
Seine Hand griff zur Feldflasche. Das Metall fühlte sich angenehm kühl an. Er schraubte den Verschluss ab – und erstarrte.
Kein Geräusch hatte ihn gewarnt. Die Stille schlich sich heran wie ein Dieb. Erst jetzt bemerkte er das Verschwinden der Grillen, deren Zirpen die Dämmerung begleitet hatte.
Die Stille drückte mit physischem Gewicht gegen seine Trommelfelle.
Der Schimmel schnaubte. Warnend, panisch.
Dann sah er sie.
Zuerst zwei. Dann vier. Schließlich sechs Paare gelb-grün leuchtender Punkte, die ihn umkreisten. Hyänen.
Ihr Atem dampfte in der plötzlich kühlen Luft. Der Geruch erreichte ihn verzögert: Aas, feuchte Erde und etwas Süßliches, Fauliges, das ihm den Speichel in den Mund trieb.
»Also doch«, dachte er, ohne Panik zu spüren. »Die Trockenheit treibt sie her. Sie riechen nicht mich – sie riechen das Wasser.«
Seine Hand blieb ruhig, als er die Feldflasche absetzte. Keine schnellen Bewegungen. Nichts, das als Schwäche gedeutet werden konnte.
Hyänen waren keine Jäger wie Löwen. Sie waren Opportunisten, die Risiko gegen Ertrag abwogen.
Das Messer hing an seinem Gürtel. Er konnte es in einer Bewegung ziehen, aber was dann? Sechs Hyänen. Eine konnte er töten, vielleicht zwei. Die anderen würden ihn zerfleischen.
Die Kamele erhoben sich, widerwillig. Das größere, ein Weibchen mit vernarbtem Hals, stieß einen grollenden Laut aus – halb Warnung, halb Drohung.
Hyänen mieden Kamele. Normalerweise. Doch die Trockenheit hatte drei Monate gedauert.
Der Schimmel tänzelte nervös. Amastan pfiff, kurz, scharf. Die Ohren zuckten, aber das Pferd gehorchte. Jahre des Trainings überwanden den Instinkt.
Eine der Hyänen – die größte, vermutlich das leitende Weibchen – trat näher. Seitlich, tastend. Die anderen folgten, verengten den Kreis kaum merklich. Professionelle Arbeit. Diese Tiere hatten schon Menschen gejagt.
Amastan griff nach dem Lederbeutel an seiner Schulter. Seine Finger fanden das staubdichte Etui, zogen das Smartphone heraus. Der Bildschirm leuchtete grell auf. Kein Netz. Natürlich kein Netz.
Aber das Licht.
Er aktivierte die Taschenlampe, richtete den Strahl auf die Augen der Leiterin. Die gelb-grünen Punkte verschwanden, dann drehte sich der Kopf weg. Ein frustriertes Knurren.
Die anderen Hyänen blieben.
»Brennholz«, flüsterte er. »Ich brauche Feuer.«
Ein Fehler, geboren aus Übermut. Jeder Meter bis zum nächsten verdorrten Strauch schien eine Meile zu sein.
Die Leiterin bewegte sich entschlossener. Ihre Schultern rollten unter dem gefleckten Fell. Amastan richtete das Licht auf sie, schwenkte es zu den anderen. Sie wichen zurück, aber nur um Zentimeter. Die Taktik verlor ihre Wirkung.
Er stand auf. Kontrolliert, ohne Hektik. Seine Knie knackten leise. Das Messer glitt flüsternd aus der Scheide, warf silberne Reflexe.
Das größere Kamel trat neben ihn, stellte sich zwischen Amastan und die Leiterin. Das Tier senkte den Kopf, zog die Lippen zurück, enthüllte gelbe Zähne. Der säuerliche Geruch seines Atems vermischte sich mit dem Gestank der Hyänen. Kameradschaft, geboren nicht aus Zuneigung, sondern aus dem gemeinsamen Willen zu überleben.
»Gut«, murmelte Amastan. »Bleib genau da.«
Die Hyäne links machte einen Satz nach vorn. Nur ein Test.
Amastan wirbelte herum, Messer hoch, Smartphone in der anderen Hand. Der Lichtstrahl traf das Tier im Sprung, blendete es. Die Hyäne landete unkoordiniert.
Die anderen lachten – jenes groteske, menschenähnliche Lachen, das keine Belustigung war, sondern Kommunikation.
Sie bereiteten den Angriff vor.
Amastan drehte sich langsam um die eigene Achse. Das Kamel neben ihm tat dasselbe. Der Schimmel war näher herangekommen, schnaubte nervös. Das zweite Kamel trabte unruhig am Rand des Kreises.
Die Kälte kroch durch das dünne Gewand. Sein Atem kondensierte im Licht des Smartphones.
»Komm schon«, sagte er zur Leiterin. Seine Stimme trug eine Härte, die er nicht gespielt hatte. »Wenn du es willst, dann hol es dir. Aber du wirst bezahlen.«
Die Worte galten nicht dem Tier. Hyänen verstanden keine Sprache, aber Tonfall und Haltung.
Die Leiterin senkte den Kopf, Schultern vorgeschoben, Schwanz zwischen den Beinen – Angriffsposition. Amastan sah die Muskeln sich spannen.
Er hob das Messer höher, richtete die Spitze auf die Hyäne – und in diesem Moment erlosch das Smartphone.
Die Dunkelheit schlug zu wie eine Faust.
Amastans Augen suchten verzweifelt Orientierung. Die gelb-grünen Augenpaare leuchteten intensiver, näher.
Seine Hand fummelte nach der Powerbank. Das Kamel brüllte. Er hörte Fleisch auf Fleisch klatschen. Eine Hyäne hatte angegriffen.
Er steckte das Kabel ins Smartphone. Seine Finger zitterten vom Adrenalin.
Licht flammte auf.
Der Schimmel schrie. Zwei Hyänen näherten sich dem halb flüchtenden Pferd. Wenn es floh, würden sie es in hundert Metern niederreißen.
Amastan pfiff laut, schrill. Der Schimmel hielt inne. Amastan lief auf das Pferd zu, Messer erhoben. Die Hyänen wichen zurück.
»Zurück!«, brüllte er. Seine Stimme hallte über den Sand.
Das Messer sauste durch die Luft. Er zielte auf den Raum zwischen ihnen und dem Pferd. Eine Hyäne jaulte auf.
Amastan erreichte den Schimmel, griff nach den Zügeln. Das Pferd scheute, aber er hielt fest.
»Ruhig«, murmelte er. »Wir gehen nirgendwohin.«
Die Leiterin nutzte die Ablenkung. Sie stand bei den Kamelen, keine drei Meter entfernt, Zähne gebleckt. Das Kamel fauchte, spuckte. Die anderen Hyänen schlossen auf.
Amastan zog den Schimmel zu den Kamelen zurück. Das Smartphone hielt er zwischen den Zähnen, das Licht nach vorn, das Messer in der freien Hand.
»Feuer«, knirschte er durch zusammengebissene Zähne. »Ich brauche verdammtes Feuer.«
Doch es gab kein Feuer. Nur ihn, drei Tiere und sechs Räuber.
Die Nacht war noch jung. Der Mond würde erst in drei Stunden aufgehen. Und Amastan ag Litni verstand mit der Klarheit eines Mannes, der die Wüste kannte: Dies würde die längste Nacht seines Lebens werden.
Falls er sie überlebte.
Der Preis des Überlebens
Das Mondlicht goss sich über die Wüste und ließ sie in Silber erstrahlen. Amastan ag Litni spürte, wie der Schweiß unter seinem Tagelmust kühl wurde, während die Hyänen ihren Kreis enger zogen.
Der Schimmel schnaubte, ein feuchter Laut, der vor Panik übersprang. Die beiden Kamele pressten sich eng an ihn, ihre langen Hälse gesenkt, die Augen weiß umrandet.
Er ging in die Hocke. Langsam, ohne Eile, als besäße er alle Zeit der Welt. Seine linke Hand glitt zum Lederbeutel an seinem Gürtel, während die rechte das Messer hielt – nicht drohend erhoben, nur gegenwärtig. Die Bewegung war so alt wie die Tuareg selbst, eine Geste, die ihm seine Großmutter beigebracht hatte: »Zeige einem Raubtier nie deine Angst, aber auch nie deine Absicht. Lass es rätseln.«
Der getrocknete Kameldung fühlte sich kühl zwischen seinen Fingern an. Drei Stücke besaß er, nicht mehr. Der Feuerstein kratzte über den Stahl, einmal, zweimal. Beim dritten Mal fing der Dung Feuer, ein zartes Glühen, das sich in seine Hand fraß wie etwas Lebendiges.
Die vorderste Hyäne – ein Weibchen, erkannte er an den gedrungenen Schultern – hielt inne. Ihr Kopf neigte sich, die Ohren zuckten. Die Flamme warf ihr Gesicht in groteskes Relief: die breite Schnauze, die kleinen, intelligenten Augen, den mächtigen Unterkiefer. Amastan hatte in diesen Tieren nie Hässlichkeit gesehen, nur eine andere Art von Schönheit. Die Schönheit dessen, was überlebte, weil ihm keine andere Wahl blieb.
Der Geruch des brennenden Dungs stieg ihm in die Nase, herb und vertraut. Er roch nach den Lagerfeuern seiner Kindheit, nach jenen Nächten, in denen sein Vater Geschichten erzählte von Männern, die gegen Löwen kämpften. Geschichten, die stets mit denselben Worten endeten: »Und er überlebte, weil er nicht vergaß, wer er war.«
Wer bin ich?, dachte Amastan, während die Flamme zwischen seinen Fingern flackerte. Ein Mann mit vierzigtausend CFA-Franc im Geldgürtel, dem Ertrag dreier Jahre Arbeit. Ein Mann, der in achtzehn Tagen hätte heiraten sollen. Ein Mann, dessen Verlobte jetzt in ihrem Zelt in Agadez saß und sich fragte, ob er sie vergessen habe.
Die Hyäne sprang.
Nicht auf ihn – das wäre zu direkt gewesen, zu ehrlich.
Sie zielte auf den Schimmel, auf die weiche Flanke, wo die Haut dünn war. Amastans Hand fuhr in den Sand zu seinen Füßen, schloss sich um eine Handvoll glühender Körner. Er schleuderte sie der Hyäne ins Gesicht.
Das Tier heulte auf, ein Laut, der weder menschlich noch tierisch klang. Es schüttelte den Kopf, kratzte mit den Vorderpfoten über die eigene Schnauze. Die anderen wichen zurück, nicht weit, nur ein paar Schritte. Genug, um zu zeigen, dass sie verstanden: Dieser Mensch war nicht wehrlos.
Amastan erhob sich. Das Messer in seiner Rechten fing das Mondlicht ein und warf es als kaltes, blaues Funkeln zurück. Die Klinge war so alt, dass niemand mehr wusste, wer sie geschmiedet hatte. Sein Großvater hatte sie getragen, und dessen Großvater vor ihm. Der Griff lag perfekt in seiner Hand, abgeschliffen von Generationen, getränkt mit Schweiß und Blut und dem Öl unzähliger Schärfungen.
»Du willst mein Wasser, ich will mein Leben«, flüsterte er auf Tamasheq.
Die Worte galten nicht den Hyänen, sondern ihm selbst, eine Beschwörung. »Das ist ein fairer Handel. Nimm den Sand und geh.«
Doch die Hyänen dachten nicht an Fairness. Sie kreisten weiter, ihre Körper tief am Boden. Die zweite Hyäne – ein junges Männchen – bewegte sich nach links. Ein Schritt, nicht mehr. Doch er veränderte alles. Sie teilten sich auf, bereiteten einen koordinierten Angriff vor. Eines würde von vorn kommen, als Ablenkung, während die anderen von der Seite her einbrechen würden.
Amastan ließ den brennenden Dung fallen, trat ihn aus. Die Dunkelheit schloss sich um ihn wie Wasser. Nur das Mondlicht blieb, kalt und distanziert. Er hörte, wie die Hyänen sich bewegten, das Scharren ihrer Krallen im Sand, ihr raues Hecheln. Sein eigener Atem klang zu laut in seinen Ohren. Er zwang sich, langsamer zu atmen, die Luft tief in die Lungen zu ziehen.
Das Weibchen sprang erneut. Dieses Mal auf ihn.
Er sah die Bewegung im Mondlicht, einen Schatten, der sich verdichtete. Seine Muskeln reagierten, bevor sein Verstand den Befehl geben konnte. Er wich nach rechts aus, nicht weit genug, um die Deckung der Tiere zu verlieren, aber genug, um der Hyäne die Flanke statt der Brust zu bieten. Ihre Zähne schnappten zu, verfehlten ihn um Zentimeter. Er roch ihren Atem, faulig und warm, und dann stach er zu.
Das Messer fuhr in ihre Schulter, tief genug. Das Tier schrie, ein hoher, gellender Laut. Es riss sich los, und Amastan spürte, wie die Klinge aus dem Fleisch glitt, wie warmes Blut über seine Knöchel lief.
Die anderen Hyänen wichen zurück. Nicht weit, doch die Botschaft war klar: Dieser Preis war zu hoch. Das verwundete Weibchen trabte davon, hinkend, den Kopf gesenkt. Die anderen folgten, einer nach dem anderen, bis nur noch ihre Schatten über die Dünen huschten wie böse Gedanken.
Amastan stand reglos, das blutige Messer in der Hand, und lauschte dem Puls in seinen Schläfen.
Seine Beine zitterten, doch er gestattete sich nicht, sich zu setzen. Nicht bevor er sicher sein konnte, dass sie wirklich fort waren.
Der Schimmel schnaubte, jetzt ein sanfterer Laut. Amastan streckte die Hand aus, berührte den schweißnassen Hals des Pferdes. Das Tier zitterte unter seiner Handfläche, beruhigte sich aber allmählich.
Er wischte das Messer am Saum seines Gewands ab, langsam, methodisch. Das Blut hinterließ dunkle Flecken auf dem indigogefärbten Stoff. Blut ließ sich auswaschen. Angst nicht.
Vierzig Kilometer bis zum nächsten Brunnen. Achtzehn Tage bis zur Hochzeit. Tainat würde in ihrem Zelt sitzen, das Henna-Tattoo auf ihren Händen bereits verblassend, und sich fragen, ob er kommen würde. Ob er sie vergessen hatte. Ob er tot war.
Er hatte ihr pünktliches Erscheinen versprochen. Doch Versprechen waren wie Wasser in der Wüste – kostbar, aber stets in Gefahr, zu versickern.
Amastan steckte das Messer in die Scheide zurück, zog den Tagelmust fester um sein Gesicht. Der Wind frischte auf, trug Sand mit sich, der gegen seine Wangen peitschte. Ein Sandsturm kündigte sich an. Eine weitere Verzögerung. Eine weitere Prüfung.
Er legte die Hand auf den Geldgürtel unter seinem Gewand, spürte die harten Kanten der zusammengerollten Scheine. Vierzigtausend CFA-Franc. Der Preis für eine Braut, für ein Leben, für die Möglichkeit, etwas aufzubauen, das mehr war als bloßes Überleben.
»Inschallah«, murmelte er und wandte sich nach Norden, wo der Polarstern durch die Wolken brach, ein kalter Lichtpunkt in der Dunkelheit.
Die Hyänen waren fort, doch die Wüste blieb. Und die Wüste vergaß nie, was man ihr schuldete.
Die Sterne von Tainat
Der Felsen hatte seine Wärme längst an den Nachthimmel verloren. Amastan spürte, wie die Kälte durch den Stoff seines Gewandes kroch, während seine Hand noch immer das Messer umklammerte. Getrocknetes Blut – nicht seins – klebte an der Klinge. Er würde sie später reinigen. Jetzt zählten nur der allmählich ruhiger werdende Herzschlag und das ferne Jaulen der Hyänen, die sich dorthin zurückzogen, wo sie hingehörten: in die Dunkelheit.
Das Pferd schnaubte leise. Blut rann aus der Risswunde an seiner Flanke, doch seine Bewegungen verrieten keine Panik mehr. Amastan betrachtete das Tier mit der nüchternen Wertschätzung eines Mannes, der seinen Reichtum in Atemzügen maß: Solange das Pferd atmete, lebte sein Vermögen. Er schob das Messer in die Scheide und wischte sich die Hand am Sand ab. Staub knirschte zwischen den Zähnen, wenn man zu schnell atmete – eine Lektion, die man nur einmal lernen musste.
Statt der Zigarette, die er sich in einem anderen Leben gegönnt hätte, holte er das Aluminiumetui aus seiner versteckten Tasche. Es fühlte sich kühl und fremd an wie ein Meteor. Kein Empfang. Natürlich nicht. Doch er öffnete die App nicht für Verbindung, sondern für Erinnerung.
Der Bildschirm leuchtete grell auf, eine kleine künstliche Sonne in der endlosen Nacht. Drei Balken. Er drückte Play.
Ihre Stimme materialisierte sich zwischen den Felsen, komprimiert und leicht verzerrt, doch unverkennbar Tainat: »Ich habe das Muster für den Teppich beendet. Blau und Weiß, wie du es magst.«
Eine Pause, in der er ihre Finger auf dem Webrahmen sehen konnte, geschickt und geduldig wie Spinnen. »Deine Mutter sagt, der Brautpreis sei zu hoch. Ich sage, du bist es wert.«
Amastan schloss die Augen. Die Milchstraße spannte sich über ihm aus wie ein riesiges Zelt aus Licht, so dicht, dass man meinte, die Sterne greifen zu können. Tamashek hatte ein Wort dafür – essuf –, diese unstillbare Sehnsucht, die Melancholie der endlosen Ebenen. Er kannte Männer, die daran zerbrachen. Männer, die in Ouagadougou oder Niamey in staubigen Cafés mit Satellitenfernsehen hockten und vergaßen, wer sie gewesen waren, bevor die Welt zu klein geworden war.
»Bin ich das?«, dachte er, während seine Finger das Smartphone umschlossen, als könne er ihre Hand darin finden. »Wert für eine Frau, die einen Teppich webt und auf einen Mann wartet, der zwischen Hyänen und Handymasten pendelt?«
Er spielte die Nachricht erneut ab. Dann noch einmal. Die Stimme veränderte sich nicht, aber seine Wahrnehmung schon. Beim dritten Mal hörte er die Müdigkeit hinter ihrem Scherz über den Brautpreis. Beim vierten Mal den unausgesprochenen Zweifel: Wirst du kommen? Oder bist du wie die anderen, die ihre Versprechen der Wüste überlassen?
Das Pferd bewegte sich. Amastan öffnete die Augen, die Hand bereits am Messer, doch da war nichts – nur Wind, der den Sand vor sich hertrieb wie eine unsichtbare Herde. Der Sturm kündigte sich an, nicht laut, sondern durch den Geschmack der Luft. Metallisch. Elektrisiert. Er hatte vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei.
Er schaltete das Telefon aus und betrachtete seinen Schatten im Mondlicht. Ein langer, dünner Strich auf dem Sand, nicht mehr. In Agadez würden Straßenlaternen flackern, Generatoren husten und Händler ihre Waren sichern. Dort gab es Elektrizität und die Illusion von Kontrolle. Hier galt nur das alte Gesetz: Du zahlst für jeden Fehler mit Blut oder Zeit, und manchmal mit beidem.
Der Geldgürtel unter seinem Gewand drückte gegen die Rippen. Genug für einen anständigen Brautpreis. Genug, um Tainats Familie zu zeigen, dass er mehr war als ein Tuareg ohne festen Wohnsitz, mehr als ein Name im Wind.
Doch war er das wirklich?
Amastan stand auf. Seine Knie knackten – mit sechsundzwanzig Jahren klang er schon wie ein alter Mann.
Das Pferd hob den Kopf, als er sich näherte. Er untersuchte die Wunde mit den Fingern, fühlte die zerrissenen Ränder, den warmen Puls darunter. Nicht tief genug für den Tod, aber tief genug für Schmerz. Er würde langsamer reiten müssen. Langsamer bedeutete später. Später bedeutete... …was? Tainats Enttäuschung? Die spöttischen Blicke ihrer Brüder? Die leise Genugtuung seiner Mutter, die immer gewusst hatte, dass ihr Sohn zu viel wanderte, um jemals anzukommen?
Er riss einen Streifen von seinem Ersatzgewand ab und band ihn fest um die Flanke des Pferdes. Das Tier zuckte, duldete aber seine Hände. Takarakit, dachte er. Solidarität. Man hilft, weil die Wüste eines Tages dich um Hilfe bitten wird, und dann ist es zu spät, Freunde zu suchen.
Der Wind verstärkte sich. Sandkörner tanzten über den Boden wie winzige, irrsinnige Derwische. Amastan wickelte den Tagelmust enger, bis nur noch seine Augen frei blieben. Indigo färbte immer ab – seine Haut trug die Spuren wie Tätowierungen, blau wie die Verheißung eines Brunnens oder der Fluch eines leeren Himmels.
Er stieg auf. Das Pferd trug ihn ohne Protest, obwohl jeder Schritt eine Klage war. Im Osten zeichnete sich kaum sichtbar die Ahnung der Sichel ab, die Morgendämmerung in ihrer grausamsten Form: ein neuer Tag, der nicht wartete, egal ob man bereit war oder nicht.
Wert, hatte Tainat gesagt. Das Wort drehte sich in seinem Kopf wie ein Gebet oder ein Vorwurf. In der Wüste maß man Wert nicht in Worten, sondern in Taten. In der Fähigkeit, Hunger zu ertragen. Durst. Zweifel. Und am Ende – wenn die Sterne sich verbeugten und die Nacht sich zurückzog – in der simplen, unbestechlichen Frage: Bist du angekommen?
Er trieb das Pferd an. Nicht schnell. Aber beständig. Denn das Einzige, das schlimmer war, als zu spät zu kommen, war, überhaupt nicht zu kommen.
Hinter ihm erlosch die Glut des Kameldungs. Vor ihm erstreckte sich die Ebene, endlos wie die Zeit selbst.
Und über ihm, gleichgültig und ewig, leuchteten die Sterne Tainas.
Gerüchte am Brunnen
Am Brunnen von Tin Zaouaten hing der Geruch von nassem Stein und Ziegenmist in der heißen Luft. Amastan führte sein Pferd am improvisierten Trog vorbei zum gemauerten Becken, wo klareres Wasser floss. Das Tier trank gierig, wurde dann langsamer, während die frische Wunde an seiner Flanke in der Sonne glänzte und geschwollen wirkte. Drei Tage bis Agadez unter günstigen Umständen. Fünf, wenn die Götter es anders bestimmten.
Er füllte seine Feldflasche, trank in kleinen Schlucken und ließ das Wasser auf der Zunge zergehen, bevor er hinunterschluckte. Nicht weil das Wasser knapp war - der Brunnen spendete reichlich -, sondern weil Maßhalten sich stets als klüger erwies, egal ob beim Wassertrinken oder bei der Wahrheitssuche.
Männer standen in kleinen Gruppen umher, ihre Stimmen so gedämpft wie bei einer Trauerfeier. Die meisten kannte er vom Sehen: Händler aus Kidal, Nomaden aus dem Adrar des Ifoghas, einige junge Burschen mit zu ruhelosen Augen für ehrliche Arbeit. Niemand rief laute Begrüßungen. Man nickte sich zu, registrierte Gesichter und teilte die Welt wortlos in Bekannte und Fremde.
Zwei ältere Männer lehnten am Brunnenrand, ihre Turbane so weiß, dass sie in der gleißenden Sonne schmerzten in den Augen. Der Größere trug eine Narbe, die sich von der Schläfe bis zum Kiefer zog - alt genug für Respekt, frisch genug zum Erinnern. Seine Stimme trug weiter, als ihm lieb sein mochte.
»Sie kam in einem weißen Geländewagen«, sagte er auf Tamasheq und setzte jedes Wort bedacht wie Steine auf einen Pfad. »Toyota Land Cruiser, neues Modell. Soll für die Minengesellschaft in Arlit arbeiten.«
»Oder für den Geheimdienst.« Der Kleinere, dessen Hände beim Sprechen nie zur Ruhe kamen. »Wer weiß das schon bei diesen Leuten? Heute sind sie Geologen, morgen kartieren sie unsere Brunnen für ihre Drohnen.«
Amastan schraubte die Feldflasche zu, langsam, ohne hinzusehen. Seine Finger führten die vertraute Bewegung aus. Seine Ohren arbeiteten.
»Eine Französin?«, fragte der Größere, obwohl er die Antwort kannte. Manche Fragen stellte man, um Zeit zu schinden.
»Natürlich eine Französin. Wer sonst fährt allein durch Tchibarakaten?« Der Kleinere spuckte in den Sand, ein altes Ritual der Verachtung. »Jetzt wimmelt es auf den Straßen von Soldaten. Malische Armee, nigrische Grenzpolizei, sogar die Franzosen mit ihren Hubschraubern. Sie halten jeden an, der ein Motorrad besitzt. Als wären wir alle Dschihadisten, nur weil wir den Tagelmust tragen.«
»Vor drei Tagen, sagst du?«
»Vielleicht vier. Die Zeit ist schwierig geworden.« Der Kleine lachte humorlos. »Früher konnte man wenigstens sagen: Der Überfall war gestern, der Markt ist morgen. Jetzt? Jetzt weiß man nicht einmal, ob der Morgen noch kommt.«
Amastan band das Pferd an einen der Holzpfähle, die wie Rippen eines vergessenen Tieres aus dem Sand ragten. Das Tier schnaubte und senkte den Kopf. Müde, aber nicht gebrochen. Er legte eine Hand auf den Pferdehals, spürte den Puls unter dem Fell. Stark. Gleichmäßig. Man konnte mit einem Tier arbeiten, das noch kämpfen wollte.
»Sie haben Ousmanes Söhne mitgenommen«, fuhr der Kleinere fort, leiser jetzt, als fürchte er, die Worte könnten sich gegen ihn wenden. »Beide. Sechzehn und neunzehn. Weil sie Motorräder besitzen. Weil sie zweimal nach Libyen fuhren, um Benzin zu schmuggeln.«
»Benzin«, wiederholte der Größere, und das Wort klang wie Anklage und Gebet zugleich.
Amastan trat näher. Nicht zu nahe - das wäre unhöflich gewesen -, aber nahe genug, um teilzuhaben, ohne sich aufzudrängen. Die beiden Männer musterten ihn kurz, nahmen die Jugend in seinem Gang wahr, die Vorsicht in seiner Haltung. Einer, der zuhörte, bevor er sprach. Selten genug in diesen Zeiten.
»Die Minengesellschaft«, sagte Amastan auf Französisch, dann wechselte er ins Tamasheq, »zahlt sie gut?«
Der Größere lächelte nicht, doch seine Augen zeigten Anerkennung. Eine kluge Frage. Eine, die nach Ökonomie klang, nicht nach Politik.
»Gut genug, um Ärger anzuziehen«, antwortete er. »Die Franzosen schürfen Uran, als gäbe es kein Morgen. Und vielleicht haben sie recht.« Er zupfte an seinem Bart, ein nervöses Zucken, das nicht zu seinem ruhigen Gesicht passte. »Aber wo Uran ist, da gesellen sich andere. AQMI, Ansar Dine, wie sie sich nennen. Sie wollen Lösegeld. Oder Aufmerksamkeit. Oder beides.«
»Und wir«, sagte der Kleinere, »stehen dazwischen. Wie immer.«
Amastan nickte. Schwieg. Es gab nichts zu sagen, was nicht schon tausendmal gesagt worden war. Die Tuareg standen stets dazwischen - zwischen Regierungen, die sie nicht anerkannten, und Dschihadisten, die sie rekrutieren wollten. Zwischen Frankreich, das Uran begehrte, und China, das Einfluss suchte. Zwischen einer Vergangenheit, die nie zurückkehrte, und einer Zukunft, die niemand verstand.
»Die Frau«, fragte Amastan, »lebt sie noch?«
Die beiden Männer wechselten Blicke. Der Größere zuckte mit den Schultern, eine Geste, die Bände sprach.
»Wer kann das wissen? Wenn sie Glück hat, verhandeln sie. Wenn nicht...« Den Satz beendete er nicht. Brauchte er nicht.
Ein junger Mann, kaum zwanzig, schlenderte heran. Sein Gang verriet ihn sofort - zu selbstsicher für jemanden ohne Geheimnisse. Die Augen huschten von Gesicht zu Gesicht, auf der Suche nach Schwächen oder Gelegenheiten. Amastan erkannte den Typ: Einer, der zwischen allen Stühlen saß und dies für Freiheit hielt.
»Redet ihr über die Französin?« Der Junge grinste, als wäre eine Entführung ein Sportereignis. »Man sagt, sie sei hübsch. Vielleicht heiratet sie einen von ihnen, wenn die Regierung nicht zahlt.«
Der Größere starrte ihn an, bis das Grinsen erlosch.
»Man sagt vieles«, erwiderte er langsam. »Aber ein kluger Mann plappert nicht alles nach, was er hört.«
Der Junge zuckte zusammen, murmelte eine unglaubwürdige Entschuldigung und zog sich zurück. Amastan beobachtete, wie er zu einer Gruppe junger Männer am Brunnenrand schlenderte, alle mit neuen Handys und alten Ressentiments. Die gefährlichste Kombination.
»Zu viele junge Männer ohne Arbeit«, sagte der Kleinere leise. »Zu viele mit Smartphones und zu wenig Verstand. Die Dschihadisten rekrutieren über WhatsApp. Versprechen ihnen Sinn. Ein Gehalt. Eine Kalaschnikow. Und sie fallen darauf herein, weil wir ihnen nichts Besseres bieten können.«
Amastan füllte die Pferdeflasche, obwohl sie noch halb voll war. Seine Hände brauchten Beschäftigung, während sein Kopf arbeitete. Tchibarakaten lag auf seiner Route. Oder nahe genug, dass ein Umweg nur einen halben Tag kosten würde. Doch ein halber Tag bedeutete weitere Verspätung für Tainat. Bedeutete mehr Zeit für ihre Zweifel, mehr Munition für ihre Brüder, die ohnehin meinten, sie verdiene mehr als einen wandernden Vermittler ohne festen Wohnsitz.
Doch da war auch das andere Gesetz, das ältere. Takarakit. Die Verpflichtung zu helfen. Nicht aus Nächstenliebe - die Wüste kannte keine Sentimentalität -, sondern aus eiserner Logik: Heute hilfst du, morgen brauchst du selbst Hilfe. Das Netz hielt nur, wenn alle Fäden hielten.
»Soldaten auf den Straßen«, wiederholte Amastan, als dächte er laut. »Malische? Oder französische?«
»Beide«, sagte der Größere. »Die Operation Barkhane patrouilliert zwischen Gao und Tessalit. Die Malier kontrollieren die Zufahrten nach Kidal. Niemand bewegt sich, ohne Fragen beantworten zu müssen.« Er musterte Amastan mit unverhohlenem Interesse. »Du kommst aus Burkina Faso?«
»Ouagadougou.« Eine Halbwahrheit. Amastan kam von überall und nirgends.
»Und wohin?«
»Agadez.« Die volle Wahrheit. Mehr musste nicht gesagt werden.
Der Größere nickte, als verstünde er das Ungesagte. »Dann musst du durch Tchibarakaten. Oder einen weiten Umweg nehmen.«
»Wie weit?«
»Drei Tage. Vielleicht vier. Aber sicherer.« Er zögerte. »Obwohl 'sicher' ein merkwürdiges Wort geworden ist. Vor einem Monat galt die Route nach Arlit als sicher. Vor einer Woche Tchibarakaten. Jetzt?« Wieder dieses Schulterzucken. »Jetzt ändert sich die Landkarte schneller, als man sie zeichnen kann.«
Amastan dankte mit einem Nicken, führte das Pferd in den schmalen Schatten einer verfallenen Mauer. Die Sonne brannte erbarmungslos und verwandelte den Sand in flüssiges Licht. In zwei Stunden würde die Hitze unerträglich werden. Dann würde er weiterreiten, wenn die anderen ruhten. Nachts reiste man langsamer, aber ungesehen.
Er lehnte sich gegen die Mauer, spürte die rissige Oberfläche durch den Stoff seines Gewands. Der Geldgürtel drückte wie stets, eine beständige Erinnerung an alles, was auf dem Spiel stand. Ein ehrliches Leben. Oder - bei der falschen Entscheidung - nur Papier, das im Wind verwehte.
Eine französische Frau, entführt in Tchibarakaten. Soldaten auf den Straßen. Junge Männer mit Smartphones und Waffen. Und er, Amastan, mit einem verwundeten Pferd und einer wartenden Braut.
Die Frage stellte sich von selbst: Was war Pflicht wert, wenn sie einen alles kostete? Und was war ein Mann wert, der die Pflicht wählte und dabei die Liebe verlor?
Er schloss die Augen, lauschte dem fernen Gemurmel am Brunnen, dem Schnauben des Pferdes, dem leisen Knirschen von Sand unter Sohlen. Irgendwo in dieser Wüste wartete eine Frau auf Rettung. Irgendwo anders wartete eine andere Frau auf ein Versprechen.
Die Wüste, dachte Amastan, stellte stets die falschen Fragen. Oder vielleicht die einzig wahren.
Er öffnete die Augen. Die Entscheidung war noch nicht gefallen. Aber die Zeit, sie zu treffen, verrann wie Wasser durch rissige Finger.
Am Brunnen sprachen die Männer weiter, ihre Stimmen ein beständiges Rauschen aus Gerüchten, Ängsten und jener alten, unzerstörbaren Hoffnung, dass der morgige Tag vielleicht besser würde als der heutige.
Amastan glaubte ihnen nicht. Aber er verstand sie.
Der Name des Journalisten
Mustaphas Laden roch nach Zimt, abgenutztem Leder und dem süßlichen Rauch von chinesischem Grüntee, der zu lange gekocht hatte. Die Wellblechwände strahlten eine Ofenhitze aus, doch unter dem improvisierten Dach aus Palmwedeln und verblassten Werbeplanen herrschte zumindest die Illusion von Kühle.
In chaotischen Stapeln türmten sich Blechdosen mit arabischen Schriftzeichen neben Kartons chinesischer Taschenlampen, Säcke mit Hirse neben Plastikkanistern voll Motoröl. Ein uraltes Transistorradio knisterte leise und spielte Koranverse, durchsetzt von statischem Rauschen.
Amastan trat ein und ließ seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnen. Sein Pferd wartete draußen im Schatten einer halbtoten Akazie. Beide brauchten Ruhe, doch die Wüste zeigte kein Mitgefühl für menschliche Bedürfnisse.
»Amastan.« Mustapha erhob sich hinter einem wackeligen Tisch, auf dem eine Messingwaage thronte, die noch aus osmanischer Zeit stammen konnte. Sein Gesicht war eine Landkarte aus Lachfalten und Sorgenlinien, und seine kleinen, dunklen Augen verfehlten nichts. »Die Wüste hat dich wieder ausgespuckt. Gut. Sie hätte dich auch behalten können.«
»Noch nicht.« Amastan zog den Tagelmust herunter und atmete die stickige Luft ein. »Ich brauche Proviant. Datteln, Trockenfleisch. Wasser in Flaschen, nicht vom Brunnen.«
Mustapha nickte und bewegte sich geschmeidig zwischen den Warenstapeln. Seine überraschend geschickten Hände griffen einen Jutesack, öffneten ihn und füllten eine Schale mit dunklen, klebrigen Datteln. Der Geruch von Zucker und Sonne breitete sich aus. »Aus Marokko. Nicht wie der Müll aus Libyen, der nach Diesel schmeckt.« Sein Lächeln erreichte nicht die wachsamen Augen. »Du reitest nach Agadez?«
»Ja.«
»Allein?«
»Allein.«
Mustapha seufzte theatralisch. »Die jungen Männer heute. Immer allein. Immer in Eile.«
Amastan schwieg und beobachtete, wie Mustapha Trockenfleisch aus einem Sack holte – Ziege, gewürzt mit Pfeffer und Salz. Der Händler wischte sich die öligen Finger an einem schmutzigen Lappen ab und reichte sechs versiegelte Wasserflaschen herüber.
»Fünftausend Francs«, sagte Mustapha mit abwesender Stimme.
Amastan zählte die Scheine auf den Tisch. Mustapha ignorierte das Geld und schenkte stattdessen Tee aus einer emaillierten Kanne in zerkratzte Gläser. Der dampfende Aufguss roch bitter und herb. Sie tranken schweigend, während das Radio zu Nachrichten wechselte. Eine hastige Stimme warf Worte wie »attaque« und »enlèvement« in den Raum.
»Die Straßen sind unruhig«, brach Mustapha das Schweigen und stellte sein ungeleertes Glas ab. »Vor ein paar Tagen entführten sie eine Französin bei Tchibarakaten. Eine Geologin.«
Amastan trank weiter, sein Gesicht eine Maske.
»Sie kommen mit ihren Maschinen, bohren Löcher und nehmen unser Uran für ihre Kraftwerke. Und wir? Wir bekommen verseuchtes Wasser und Soldaten, die uns wie Verbrecher behandeln.«
»Wer hat sie entführt?«
Mustapha zuckte mit den Schultern. »Die üblichen Verdächtigen.« Er beugte sich vor, seine Stimme sank zum Flüstern. »Aber ich hörte von einer neuen Gruppe. Jünger. Radikaler. Al-Murabitun. Arbeiten angeblich mit den Libyern zusammen.«
Mustaphas Stimme wurde vorsichtiger. »Die Französin war nicht allein. Sie hatte einen deutschen Journalisten dabei.«
Amastans Hand erstarrte kurz über der Dattelschale.
»Baumann. Ein seltsamer Name. Klingt wie ein Werkzeug.« Mustaphas Lachen klang trocken. »Aber er war anständig. Sprach sogar ein wenig Tamasheq. Fragte nach den Menschen, nicht nach Schlagzeilen.«
»Was wollte er?«
»Was alle Journalisten wollen. Geschichten. Wahrheiten.« Mustapha schenkte nach, obwohl Amastans Glas noch halb voll war. »Jetzt sitzt er irgendwo und fragt sich, ob seine Fragen das Lösegeld wert waren. Fünf Millionen Euro fordern sie.«
Amastan stand abrupt auf.
»Du gehst schon? Ohne den Tee zu Ende zu trinken?«
Amastan packte mechanisch die Vorräte in seine Satteltaschen.
»Das Geld«, erinnerte Mustapha leise. »Du hast es dagelassen.«
Amastans Blick glitt über die unberührten Scheine. »Nimm es.«
»Ich habe nicht gezählt.«
»Du musst nicht.«
Mustapha lächelte wissend. »Takarakit. Die alte Pflicht.«
»Es geht mich etwas an«, brach es aus Amastan heraus.
»Weil er anständig war? Und deine Braut? Wird sie warten?«
»Sie muss.«
»Muss sie?« Mustapha trat näher, sein Atem roch nach Tee und Schweiß. »Oder redest du dir das nur ein?«
»Was ist die Wahrheit?«
»Dass du keine Wahl hast. Takarakit lässt keine Wahl.« Mustaphas Stimme wurde sachlich. »Tchibarakaten liegt zwei Tagesritte entfernt. Der Weg ist voller Soldaten.«
»Dann halte ich an.«
»Und was sagst du ihnen?«
»Dass ich nach Agadez reite. Der kürzeste Weg.«
»Du lügst schlecht, Amastan. Dein Gesicht verrät dich.«
»Dann lerne ich es.«
Mustapha schüttelte den Kopf. »Du bist ein Narr. Ein ehrenhafter Narr.« Er hob das Geld auf. »Nimm es. Bestechungsgelder öffnen Türen.«
»Behalte es. Für den Nächsten, der Hilfe braucht.«
»Verdammt sollst du sein.« Mustaphas Augen glänzten. »Deine Prinzipien werden dich umbringen.«
»Vielleicht.«
Draußen schlug die Sonne wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Das Pferd schnaubte zur Begrüßung. Amastan prüfte die Wunde an seiner Flanke – geschwollen, aber nicht entzündet. Das Tier würde durchhalten. Es musste.
»Amastan!« Mustaphas Stimme ließ ihn umdrehen. Der Händler stand silhouettenhaft in der Tür. »Wenn du Baumann findest… sag ihm, Mustapha hält ihn für einen Narren. Einen ehrenhaften Narren. Die Welt braucht mehr davon.«
Amastan nickte schweigend.
Der Sattel fühlte sich heiß an unter ihm, als er aufstieg. Das Pferd setzte sich langsam in Bewegung, sein Gang verriet den Schmerz der Wunde. Tin Zaouaten verschwamm in der Hitze hinter ihm, eine Fata Morgana aus Wellblech und Staub. Vor ihm lag die Wüste, gleichgültig wie immer. Irgendwo da draußen wartete ein deutscher Journalist. Oder auch nicht.
Amastan dachte an Tainats Worte: Du bist es wert. Jetzt handelte er wie ein Mann, der nichts wert war – er ließ seine Braut warten, um einem Fremden zu helfen. Doch Takarakit fragte nicht nach Bequemlichkeit. Es fragte nur: Kannst du helfen? Dann musst du helfen.
Das Pferd stolperte, fing sich wieder. Amastan strich über seinen Hals und murmelte beruhigende Laute. Zwei Tage bis Tchibarakaten.
Die Sonne sank tiefer, lange Schatten krochen über den Sand. Amastan ritt weiter in die Ungewissheit, die ihm alles kosten konnte. Doch er ritt. Weil nichts zu tun keine Alternative war.
Baumann. Der Name klang fremd. Wie ein Werkzeug. Doch Werkzeuge konnten Brücken bauen.
Die Wüste schwieg. Der Wind trug Sand und Echos vergessener Stimmen mit sich.
Amastan ritt weiter, ein störrischer Punkt in der Unendlichkeit.
Der Chronist der gebrochenen Träume
Der Riss in der Heimatfront
Das leise Surren der Ventilatoren in seinem Bürohaus unter dem Pfefferbaum vermochte nicht, die drückende Nachmittagshitze zu besiegen. Michael Baumann studierte noch immer die Satellitenaufnahmen von Mogadischu, als er Motorengeräusche hörte. Nicht das gewohnte Summen des Elektrotors – es war Jojos altersmüder Range Rover, dessen Auspuff röchelte wie ein Sterbenden. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm: 16:32 Uhr. Viel zu früh für die Rückkehr von der Geburtstagsfeier in der Deutschen Schule in Runda.
Seine Finger, die eben noch sicher die Lupe über die Aufnahmen geführt hatten, begannen unvermittelt zu zittern. Er ließ die Fotos liegen, erhob sich und trat ans Fenster. Durch das dichte Blätterdach des Pfefferbaums beobachtete er, wie die Töchter schweigend ausstiegen und zum Haupthaus gingen. Ihre festlichen Kleider wirkten plötzlich wie Requisiten nach einer abgesetzten Vorstellung.
Die Tür zum Bürohaus aus Holz öffnete sich unangekündigt. Jojo stand in der Tür, das gleißende Nachmittagslicht im Rücken, sodass ihr Gesicht im Schatten lag. Sie trug noch immer das hellblaue Seidenkleid, das er ihr zum letzten Hochzeitstag geschenkt hatte. Ihre Stimme klang seltsam entleert, als hätte man alle Emotionen daraus gesogen.
»Du hast vergessen, dass gestern Annas Geburtstag war.« Sie trat ins Zimmer, und der Geruch von heißem Asphalt und verblassendem Eau de Toilette folgte ihr. »Sie hat gewartet. Ich habe gesagt, du rufst an, wenn du Zeit hast.«
Baumann schloss die Augen, presste Daumen und Zeigefinger gegen seine schmerzenden Schläfen. Der Geschmack von kaltem Kaffee und Reue lag auf seiner Zunge. »Es gab Vorfälle in Mogadischu. Die Story war dringend.«
»Immer ist etwas dringend«, stellte sie vorwurfsvoll fest. Ihre Worte klangen abgenutzt, wie eine zu oft gespielte Schallplatte. Ihr Blick glitt über seinen Schreibtisch, über die Karten und Berichte zu guineischem Bauxit, als sähe sie die Geister, mit denen er lebte.
Er wollte etwas erwidern, eine Erklärung finden, die nicht nach Ausrede klang. »Jojo, ich...«
Sie hob eine Hand, eine müde Geste, die jedes weitere Wort erstickte.
»Vergiss es, Michael. Wir reden, wenn du auch geistig wieder für uns da bist.«
Sie drehte sich um und verließ das Holzhaus in Nairobis Stadtteil Lavington. Die Tür fiel ins Schloss, mit einem präzisen, endgültigen Klicken, das laut sprach wie ein Vorwurf.
Baumann blieb zurück, allein mit dem Summen der Technik und der Last seiner Abwesenheit. Er griff nach seiner Zigarettenschachtel, rieb mehrmals erfolglos das Feuerzeug, bevor die Flamme endlich aufflackerte.
Der erste Zug brannte in seiner Lunge. Draußen, hinter den Scheiben und dem mit Stacheldraht bewehrten Zaun, lag Nairobi und wartete auf seine Geschichten. Doch hier, in seinem eigenen Garten, hatte sich soeben ein Riss aufgetan, tiefer und bedrohlicher als alle Konfliktlinien, über die er je berichtet hatte.
Der neue Herr im Redaktionsturm
Baumann stand vor dem Laptop, auf dessen Bildschirm Markus Wegeners Gesicht erschien. Das Bild wirkte künstlich, als wäre es eingescannt. Hinter Wegener erstreckte sich eine sterile, weiße Wand, nur unterbrochen von einem gerahmten Poster mit dem Wort »Truth« in verschiedenen Graustufen.
»Michael, die Sahel-Story – großartiges Thema, aber zu komplex für unsere Leser.« Wegeners Lächeln erreichte seine Augen nicht. »Können wir es auf Flüchtlingsdramen runterbrechen? Mehr Emotion, weniger Politik.«
Durch die offenen Fenster drang der Geruch von Hibiskus herein, vermischt mit dem beißenden Rauch der Kohlefeuer aus den Hütten hinter der Grundstücksmauer. Baumann hörte das ferne Gemurmel der Straßenhändler in Karanguare. Er biss sich auf die Lippe und schmeckte Kaffee und eine Bitterkeit, die er nicht hinunterschlucken wollte.
»Es geht um Uran, Markus. Um neokoloniale Ausbeutung durch Frankreich. Russlands Schattenkrieg.«
»Uran ist abstrakt.« Wegener lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Die Geste wirkte einstudiert. »Ein ertrinkendes Kind im Mittelmeer ist konkret. Verstehen Sie?«
Du willst Geschichten über die Symptome, dachte Baumann, aber ich will über die Krankheit schreiben. Stattdessen griff er nach der Wasserflasche auf dem Schreibtisch und trank. Das Plastik fühlte sich warm an, das Wasser schmeckte nach nichts.
»Ich verstehe«, sagte er. Die Worte klangen flach. »Aber wenn wir nicht erklären, warum die Boote ablegen, zählen wir nur Leichen. Immer wieder.«
»Das ist nicht unser Auftrag.« Wegener beugte sich vor, und die Kamera fing das Leuchten seines Bildschirms ein, das sein Gesicht von unten beleuchtete wie eine Theatermaske. »Unser Auftrag ist es, Geschichten zu erzählen, die gelesen werden. Die geteilt werden. Die relevant sind.«
Das Wort »relevant« hing zwischen ihnen wie ein Schleier. Baumann kannte diese Sprache der neuen Journalismus-Grammatik, in der »Engagement« wichtiger war als Wahrheit.
»Relevant«, wiederholte Baumann. Sein Finger klopfte ein nervöses Stakkato gegen den Tischrand. »Für wen?«
»Für unsere Leser. Die wollen wissen, wie es sich anfühlt. Nicht warum es passiert.« Wegeners Stimme nahm einen geduldigen Ton an. »Wir brauchen Protagonisten. Menschen mit Namen. Schicksale.«
Ein Gecko huschte über die Wand hinter dem Laptop, seine Füße kratzten leise auf dem Putz. Baumann folgte ihm mit den Augen.
»Ich habe Namen«, sagte Baumann leise. »Douzambe Moussa. Vierunddreißig Jahre, drei Kinder. Arbeitete in der Mine bei Arlit, bis er herausfand, dass das Uran, das er abbaute, in französischen Atomreaktoren landete, während sein Dorf im Dunkeln saß. Er organisierte Streiks. Jetzt ist er verschwunden.«
»Das ist ein Anfang.« Wegener nickte, aber seine Finger tippten außerhalb des Bildausschnitts. »Aber wir brauchen die emotionale Reise. Die Verzweiflung. Den Moment, wo er beschließt, nach Europa aufzubrechen.«
»Er ist nicht nach Europa aufgebrochen. Er ist in einem Gefängnis verschwunden. Wahrscheinlich tot.«
»Dann ist er nicht unsere Geschichte.« Wegeners Stimme blieb freundlich, aber etwas Hartes schimmerte durch. »Verstehen Sie, Michael, ich schätze Ihre Arbeit. Wirklich. Aber wir müssen an unsere Leserschaft denken. An unsere Abonnenten. Die zahlen Ihr Gehalt.«
Und du bezahlst mich dafür, die Wahrheit zu sagen, dachte Baumann, nicht das, was sich gut klickt. Er schwieg. Die Stille füllte sich mit dem Summen der defekten Klimaanlage und dem fernen Ruf eines Hadada-Ibis.
»Wie lange haben Sie jetzt aus Nairobi berichtet?« Wegeners Frage klang fast persönlich.
»Zwölf Jahre.«
»Lange Zeit. Fehlt Ihnen Deutschland nicht manchmal?«
Baumann wischte sich über die Stirn. Der Schweiß klebte salzig unter seinen Fingern. »Ich bin dort, wo die Geschichten sind.«
»Die Geschichten sind überall.« Wegener lächelte, aber diesmal wirkte es beinahe traurig. »Die Frage ist, welche wir erzählen können. Welche wir uns leisten können zu erzählen.«
Das Wort »leisten« blieb hängen. Baumann verstand die Implikation.
»Ich brauche drei Wochen«, sagte Baumann. Seine Stimme klang ruhiger, als er sich fühlte. »Drei Wochen in Niger. Ich kann nachweisen, dass russische Scheinfirmen die Uranminen übernehmen wollen, wie die Gewinne verschwinden, wie lokale Aktivisten sich in Luft auflösen.«
»Drei Wochen.« Wegener schüttelte den Kopf. »Das ist nicht mehr drin, Michael. Wir haben Budgetkürzungen.«
»Das ist keine Reise. Das ist Journalismus.«
»Das ist das Budget-Formular AF-37b.« Ein kurzes Auflachen, ohne Humor. »Willkommen in der Realität der Medienbranche 2.0.«
Baumann schloss die Augen. Hinter den Lidern sah er die rote Erde von Arlit, die Männer mit Geigerzählern, die wie Geister um die Mine schlichen.
»Was, wenn ich teilweise auf eigene Kosten gehe?«
Die Pause dauerte zu lang. Wegeners Gesicht wurde zur Maske.
»Dann«, sagte er schließlich, »wäre das Ihre Entscheidung. Aber die Zeitung übernimmt keine Haftung. Und wir garantieren nicht, dass wir die Story drucken.«
»Verstehe.«
»Michael.« Wegeners Ton wurde weicher. »Ich war auch mal wie Sie. Ich wollte die Welt verändern. Aber die Welt interessiert sich nicht für unsere Geschichten. Die Leute scrollen weiter. Sie klicken auf Katzenvideos. Wir können entweder dagegen ankämpfen und untergehen, oder wir passen uns an.«
»Oder wir machen unseren Job«, sagte Baumann leise.
»Unser Job«, antwortete Wegener, »ist es, relevant zu bleiben. Das ist die einzige Wahrheit, die zählt.«
Die Verbindung brach ab. Baumann klickte das Fenster weg. Draußen rief ein Ibis, heiser und klagend.
Er zog eine Zigarette aus der Packung und zündete sie an. Der Rauch brannte würzig in der Lunge. An der Wand hing eine Landkarte von Afrika, übersät mit Stecknadeln – jede eine Story, jeder ein Ort, wo Menschen verschwanden.
Relevant, dachte er und lachte bitter.
Er würde fahren. Nach Niger, nach Arlit. Er würde die Geschichte schreiben, auch wenn sie niemand druckte. Weil Moussa verschwunden war. Weil die Brunnen verseucht waren. Weil die Wahrheit nicht relevant sein musste, um wahr zu sein.
Die Asche fiel auf den Schreibtisch. Er wischte sie nicht weg. Draußen sank die Sonne hinter die Akazien. In wenigen Stunden würde es dunkel sein. Aber jetzt brannte das Licht noch hell genug, um zu sehen und zu erkennen.
Aufbruch als Flucht
Die Tasche lag aufgeklappt auf dem Bett wie ein offener Mund. Baumann packte geistesabwesend, während durch das offene Fenster der Geruch von nassem Gras und Eukalyptus hereinzog. Vom Wohnzimmer her erklang Esthers Klavierübung, die gleiche Tonleiter immer wieder.
»Du fährst also wirklich«, stellte Jojo fest, ihre Stimme flach und müde. Baumann drehte sich nicht um, glättete das Moskitonetz in der Tasche.
»Jemand muss diese Geschichte erzählen.«
»Jemand.« Ihr Lachen klang bitter. »Nicht du. Jemand.«
Er tastete nach den Malaria-Tabletten. Die Blisterpackung knisterte. Der metallische Nachgeschmack der Pillen lag ihm bereits auf der Zunge.
»Wegener hat Nein gesagt«, sagte Jojo. Barfuß näherte sie sich über die Holzdielen. »Ohne Genehmigung. Ohne Budget. Ohne Druck-Garantie.«
»Sie werden es drucken.«
»Weil die Story so gut ist? Oder weil du so gut bist?« Die Frage sollte verletzend klingen.
Baumann griff nach seinem abgegriffenen Notizbuch. Moussa, Seite vierzehn.
»Es geht nicht um die Story«, wurde Jojos Stimme leiser, gefährlicher. »Es ging noch nie nur um die Story.«
Er wandte sich um. In ihrem Gesicht las er Resignation.
»Annas Geburtstag hast du vergessen. Rachels Schulaufführung. Esthers Elterngespräch.« Jedes Wort fiel wie ein Stein. »Und jetzt fährst du wegen eines Mannes, den du nie getroffen hast.«
»Ich habe mit ihm telefoniert. Zweimal.«
»Zweimal.« Sie nickte langsam. »Und mit mir? Wann hast du das letzte Mal wirklich mit mir gesprochen?«
Die Klaviertonleiter brach ab. Stille legte sich über das Haus.
»Moussa hat drei Kinder«, sagte Baumann leise. »Sein Dorf hat kein Trinkwasser mehr. Die Brunnen sind verseucht.«
»Und unsere Kinder?« Jojo trat näher, blieb aber außer Reichweite. »Die haben einen Vater, der immer woanders ist. Auch wenn er hier ist.«
Das Telefon im Büro klingelte. Der spezielle Ton für internationale Anrufe. Baumann zuckte zusammen. Jojo sah es, und ihr Gesicht verhärtete sich.
»Geh ruhig«, sagte sie. »Könnte wichtig sein.«
»Jojo …«
»Geh.«
Er ging. Die Holzdielen knarrten. Hinter sich hörte er, wie sie die Schlafzimmertür schloss. Sanft. Endgültig.
Das Büro roch nach kaltem Zigarettenrauch. Das Display zeigte +227. Niger.
»Baumann.«
»Monsieur Michael? Ici Amadou. De Niamey.«
»Was haben Sie?«
»Moussa.« Rauschen auf der Leitung. »Sie haben ihn gefunden.«
Baumanns Hand erstarrte. »Wo?«
»In der Wüste. Nördlich von Arlit. Zwei Kugeln. Rücken.«
Die Worte hingen in der Luft. Baumann schloss die Augen.
»Wer weiß davon?«
»Noch niemand. Die Polizei vertuscht es. Selbstmord, sagen sie.« Amadou spuckte aus. »Mit zwei Kugeln im Rücken.«
»Können Sie Fotos besorgen?«
»Schwierig. Gefährlich. Aber möglich. Für den richtigen Preis.«
Baumann nannte eine Summe. Sie einigten sich.
»Ich komme morgen«, sagte Baumann. »Addis, dann nach Niamey.«
»Ich hole Sie ab. Flughafen.« Amadou senkte die Stimme. »Aber seien Sie vorsichtig. Die, die Moussa umgebracht haben – die haben Augen überall.«
Die Verbindung brach ab.
Baumann legte das Telefon hin. Draußen begann es zu regnen. Tropfen trommelten auf das Wellblechdach. Der Geruch von nassem Staub stieg auf, erdig und bitter.
Er kehrte ins Schlafzimmer zurück. Jojo saß auf dem Bett, neben der gepackten Tasche.
»Moussa ist tot«, sagte er. »Zwei Schüsse. In der Wüste. Die Polizei vertuscht es.«
»Natürlich ist er tot.« Ihre Stimme klang emotionslos. »Sie sind immer tot, Michael. Die Männer, denen du hinterherläufst. Die Geschichten enden immer mit Tod.«
Er setzte sich neben sie, ohne Berührung. Der Regen verstärkte sich.
»Ich muss fahren. Jetzt erst recht.«
»Ich weiß.« Sie stand auf, langsam. »Das ist das Problem. Ich weiß es. Du weißt es. Und wir tun beide so, als hätten wir eine Wahl.«
Sie verließ das Zimmer. Ihre Schritte verschwanden im Rauschen des Regens.
Baumann saß allein da. Die gepackte Tasche. Das Familienfoto auf dem Nachttisch. Ein anderes Leben.
An der Decke breitete sich ein Wasserfleck aus wie ein Hautausschlag.
Draußen regnete es weiter. Morgen würde er fliegen. In die Wüste. Zu einem toten Mann. Für eine ungedruckte Geschichte.
Weil jemand es tun musste.
Weil Flucht wie Pflicht aussah und Pflicht wie Flucht – und am Ende beides dasselbe war: ein Ticket weg von hier.
Die Hitze der Ankunft
Die Hitze schlug zu wie eine Faust.