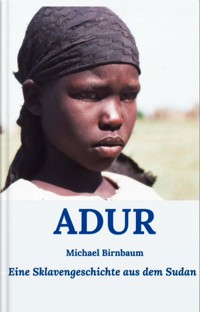Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuesten Fall reist der deutsche Afrika-Korrespondent Michael Baumann nach Nigeria. Er will zwei Geschichten recherchieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Lagos taucht er ein in die Welt derjenigen, die wie Ken Saro-Wiwas legendärer Held Mr. B versuchen, in der pulsierenden Metropole reich zu werden – und zu überleben. Doch schnell wird Baumann in eine zweite, düstere Geschichte hineingezogen: die eines aus Deutschland abgeschobenen Ogoni-Aktivisten, der in Nigeria spurlos verschwindet. Bei seinen Nachforschungen stößt Baumann auf einen deutschen Konsularbeamten, der ihm hilft, selbst unter falschem Namen Asyl in Deutschland zu beantragen – mit Erfolg. Doch als er erfährt, dass der Aktivist in Nigeria hingerichtet wurde, wird Baumann mit den brutalen Konsequenzen von Bürokratie und Macht konfrontiert. Ein fesselnder Roman über Gerechtigkeit und moralische Grenzen beim Thema Asyl.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MichaelBirnbaum
Mr. E kehrt wieder zurück
Ein Afrika-Roman
Baumann-Reihe, Band Nr. 4
Über das Buch
In seinem neuesten Fall reist der deutsche Afrika-Korrespondent Michael Baumann nach Nigeria. Er will zwei Geschichten recherchieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Lagos taucht er ein in die Welt derjenigen, die wie Ken Saro-Wiwas legendärer Held Mr. B versuchen, in der pulsierenden Metropole reich zu werden – und zu überleben. Doch schnell wird Baumann in eine zweite, düstere Geschichte hineingezogen: die eines abgeschobenen Ogoni-Aktivisten, der in Nigeria spurlos verschwindet.
Bei seinen Nachforschungen stößt Baumann auf einen deutschen Konsularbeamten, der ihm hilft, selbst unter falschem Namen Asyl in Deutschland zu beantragen – mit Erfolg. Doch als er erfährt, dass der Aktivist in Nigeria hingerichtet wurde, wird Baumann mit den brutalen Konsequenzen von Bürokratie und Macht konfrontiert. Ein fesselnder Roman über Gerechtigkeit und moralische Grenzen beim Thema Asyl.
Über den Autor
Michael Birnbaum war jahrelang Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Seine Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zeit inspirierten ihn zu seinen Afrika-Romanen der Baumann-Reihe – von denen er immer behaupten wird, sie seien ganz und gar erfunden. Heute lebt er in München.
MichaelBirnbaum
Mr. E
kehrt wieder zurück
Ein Afrika-Roman über Macht, Asyl und den Kampf ums Überleben
»Keiner wird als Flüchtling geboren – ein Flüchtling wird man durch die Umstände. Und jeder von uns könnteeines Tages einer sein.«
(UNO-Flüchtlingshilfe)
Impressum
Texte: © 2025 Copyright by Michael Birnbaum
Umschlag:© 2025 Copyright by Michael Birnbaum
Verantwortlich
für den Inhalt:
Michael Birnbaum
Höslstr. 10
81927 München
DIE GESCHICHTEN FINDEN DICH
Der Aktivist im Nigerdelta
Der Raum atmete nicht mehr. Schwüle und der beißende Geruch von Öl und abgestandenem Flusswasser drangen in jede Ritze der schäbigen Kneipe. Die Wände, von der Zeit und dem Elend in Port Harcourt ausgehöhlt, keuchten – schwer und faulig.
Emeka ließ seinen Blick über seine Anhänger am Tisch schweifen. Gesichter wie zerknittertes Papier, jede Falte eine Geschichte von Verlust und zähem Überleben. Das trübe Licht der Glühbirne spiegelte sich in ihren Augen, als wären sie aus Glas.
Ich bin der Einzige, der noch den Mund aufmacht, dachte er. Der Geschmack von Ölstaub lag auf seiner Zunge, scharf und metallisch, als hätte er Blut geleckt.
Dann, ohne Vorwarnung, durchfuhr ihn die Erinnerung wie ein Messer: der Sicherheitsbeamte, seine Faust, das Knacken der eigenen Rippen unter dem Schlag. Vor der Schule. Vor den Kindern. Sein Atem stockte, als spürte er die Hand noch immer an seiner Kehle.
Draußen dröhnten die Pumpen, ein dumpfer, unerbittlicher Herzschlag. Wenn ich jetzt schweige, wer spricht dann? Wer steht auf, wenn sie die Kinder mit ölverschmierten Fingern in ihre Schulhefte schreiben lassen?
Seine Hände umklammerten die Tischkante, die Narben an seinen Knöcheln brannten. Die Schlagstöcke. Die Handschellen. Das Lachen der Männer in Uniform. Ein fernes Hupen schrillte durch die Dämmerung – zu grell für diese stickige Stille.
Sind wir schon Gespenster? Doch dann spürte er das Papier unter seinen Fingern, die frisch gedruckten Flugblätter, noch feucht von der Presse. Die Wahrheit, die niemand hören wollte.
Der Ventilator stöhnte über ihm.
Wie viele bleiben mir noch? Der Fischer neben ihm hatte Hände wie ausgetrocknete Erde, rissig und hart.
Emeka wusste: Jedes Wort könnte sein Letztes sein.
Er trug das Delta in sich, in den Narben, im Gestank seiner Kleidung, im Summen der Pipelines, das ihn auch im Schlaf verfolgte. Nachts flüsterte seine Tochter:
»Papa, wann kommt das saubere Wasser?«
Er hatte ihr über den Kopf gestrichen, ohne Antwort.
Die Entscheidung war längst gefallen. Jedes Flugblatt, jede Rede waren Verrat – an seiner Familie oder an seinem Volk. Und der Benzingeruch in der Luft erinnerte ihn daran, dass beides langsam vergiftet wurde.
Emeka Okoro war Lehrer, Ehemann, Vater, Protestierender. Die kleine Wohnung nahe Port Harcourt barg sein größtes Glück. Jeden Morgen spürte er die Verantwortung, wenn er die Schulbücher sortierte. Nicht nur für seine eigenen Kinder, sondern für alle, die in diesem vergifteten Paradies aufwuchsen.
Seine Frau legte ihm dann manchmal stumm die Hand auf die Schulter. Sie kannte die Geschichten, die er nachts im Bett erzählte – von verschmutzten Flüssen, von Fischern ohne Fang. »Du kannst nicht alle retten«, flüsterte Adana dann.
Er nickte. Aber seine Augen blieben an den Ölflecken auf dem Schulhof hängen, die wie blutige Fußabdrücke aussahen.
Die Kinder in seiner Klasse schrieben Aufsätze über ihre Träume. Emeka korrigierte die Grammatik, während in ihm die Wut brodelte. Denn er wusste, dass diese Träume immer kleiner wurden, solange die Pumpstationen liefen.
Nneka, eine junge Frau, rückte näher am Tisch, das schlafende Kind an ihrer Brust. Ihr Flüstern schnitt durch das gedämpfte Kneipengeräusch: »Sie beobachten dich schon.« Ihre Finger hielten das Baby fest, als suchten sie selbst Halt. »Wir brauchen einen Ausweg.«
In ihren Augen konnte man ihre trotzige Furcht sehen, die Emeka nur zu gut kannte. Ihr Atem roch nach ängstlicher Muttermilch.
Draußen quietschten Bremsen. Alle am Tisch erstarrten für einen Moment. Nneka zog das Kind fester an sich, ihr Blick sagte mehr als Worte. Die Zeit wurde knapp.
»Ich werde nicht aufgeben«, antwortete Emeka entschlossen. »Die Menschen hier verdienen es, gehört zu werden. Auch wenn ich dafür bezahlen muss.«
Die Lehrbücher der Soziologie lagen noch immer auf seinem Schreibtisch – voller Randnotizen, die wutig waren und Erkenntnis verrieten. Das Studium hatte ihm die Sprache gegeben, das Unrecht zu entlarven. Er sezierte die Ausbeutung mit präzisen Worten und verfasste Flugblätter, die wie Brandsätze wirken.
Doch morgens um sieben stand er trotzdem vor der Tafel in der Schule. Die Kreide staubte seine Finger ein, während draußen die Öltanker vorbeifuhren. Das Gehalt war karg, aber es hielt seine Kinder satt.
»Papa, warum schreibst du so viel?«, fragte der Älteste neulich.
Emeka strich ihm über den Kopf. »Weil Wörter manchmal lauter sind als Schreie, Sohn.«
In der Schultasche trug er immer beides: Klassenarbeiten zum Korrigieren und neue Pamphlete zum Verteilen.
Emeka Okoro war schlank und kräftig, er verkörperte die Stärke, die die Menschen um ihn herum suchten. Seine Haare, pechschwarz, bildeten einen krassen Kontrast zu den vernarbten Armen und Händen, die von früheren Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften zeugten.
Chijioke, der Journalist mit den nervösen Fingern, rieb sich über die Stirn. Sein Notizbuch war voller Zahlen – Tote, Vergiftete, Verschwundene. »Vielleicht sollten wir die nächste Rede verschieben?«
Er strich über den abgewetzten Rand seines Notizbuches. »Denn, wenn du festgenommen wirst?«, fragte er, und sein Lächeln blieb so dünn wie die Seiten, auf denen er seine gefährlichen Wahrheiten schrieb. »Was passiert dann mit uns?«
Emeka richtete sich auf, spürte die Verantwortung. Sein Vater hatte noch Netze geworfen, war Fischer gewesen, bevor das Öl kam und das Wasser langsam tötete.
Als auch die Fische starben, ging sein Vater zu den Ölleuten arbeiten, baute Pipelines, arbeitete auf Plattformen. Sein Vater verdiente so viel Geld, dass er Emeka als seinen einzigen Sohn nach Lagos zum Studieren schicken konnte. »Weil du so klug warst in der Schule«, hatte sein Vater ihm mitgegeben.
Jetzt warf Emeka Worte wie Netze aus – manchmal war das genauso hoffnungslos.
Emekas Blick blieb ernst, nur selten entkam ihm ein Lächeln. Doch aus seinen Augen sprach die Leidenschaft für die Sache, für die er kämpfte.
»Wir sind mehr als nur ich«, sagte er. »Das Feuer wird immer weiterbrennen.«
Doch tief in seinem Herzen nagte die Angst. »Was, wenn das Feuer aber erlischt?«
»Sieh mal«, sagte er einmal zu seinem jüngsten Sohn, während er dessen Schulheft zuklappte, »manche Männer kämpfen mit Waffen. Wir tun das mit Wahrheiten.«
Die Flugblätter in seiner Aktentasche raschelten leise, als würde die Wahrheit selbst ungeduldig werden. Je mehr sie ihn mundtot machen wollten, desto häufiger wurden die nächtlichen Treffen in Hinterhöfen, desto schärfer waren seine Analysen.
Seine Frau fand ihn oft schreibend beim Licht einer Taschenlampe. »Sie können meine Stimme nicht erschießen«, murmelte er dann in die Dunkelheit hinein. Und wirklich – jedes verbrannte Pamphlet schien zehn neue Leser zu finden.
Vor der Kneipe brüllten die Motorräder der Zwei-Rad-Taxen durch die Straßen auf der Suche nach Fahrgästen.
Da hörte er plötzlich ein Knacken hinter sich. Die Tür wurde aufgerissen. Ein Holzsplitter krachte zu Boden. Die Tür schlug gegen die Wand. Zwei Schatten füllten den Rahmen, mit Sonnenbrillen trotz der dämmrigen Kneipe, die untere Hälfte ihrer Gesichter reglos wie Masken.
Zwei Männer in Zivilkleidung betraten die Kneipe.
Emeka spürte, wie die Luft im Raum herunterfiel.
Er stand langsam auf, sein Stuhl quietschte wie ein letzter Protest. Die Flugblätter in seiner Tasche raschelten leise, als würde die Wahrheit selbst flüstern: »Lauf.«
Aber er blieb stehen.
»Passt auf euch auf«, sagte er zu den anderen, seine Stimme fest, aber mit einem Hauch von etwas, das fast wie ein Abschied klang.
Nneka presste die Lippen aufeinander. Ihr Baby schlief noch immer, ahnungslos. Die Lampe über ihnen flackerte, warf gespenstige Schatten an die rußige Wand.
Emeka stand auf. Sein Stuhl quietschte. In diesem Moment wussten sie alle: Wer heute Nacht durch diese Tür ging, kam vielleicht nicht zurück. Die Zeit war um.
Er drehte sich um und schaute in Richtung der Tür. Das grelle Licht der Dämmerung blendete ihn kurz. Die Geräusche der Stadt klangen jetzt wie eine Alarmsirene.
»Wirst du zurückkommen?«, flüsterte jemand.
Er kannte die Antwort nicht.
Dann machte er den ersten Schritt und ging auf die Männer zu.
Anruf aus der Redaktion
Der Kaffeedampf kräuselte sich über den Nigeria-Fotos auf Michael Baumanns Schreibtisch. Staubige Straßen, erstickende Menschenmassen – die Bilder strahlten eine Hitze aus, die selbst in Nairobis Abendluft noch brannte. Unter einem Porträt der Journalisten der oppositionellen Zeitschrift The Punch hatte sich Kaffeerand zu einer Lache wie aus Blut ausgebreitet.
Michael Baumanns Gedanken drifteten ab zu einer literarischen Reportage, die er der Zentralredaktion in München anbieten wollte. Lagos war eine kochende Welt-Metropole voller Gegensätze und Ungleichzeitigem, ein Moloch von 20 Millionen Menschen, die dort, jeder auf seine Weise, ums Überleben kämpften; und Ken Saro-Wiwa hatte es in »Mr. B« brillant eingefangen.
»Straße des Lebens«, murmelte Baumann vor sich hin. »Wie treffend.«
Er schob ein Foto zur Seite und griff nach einem weiteren. Die Farben waren ausgebleicht, aber das Lächeln auf den Gesichtern der Redakteure der Zeitschrift The Punch strahlte immer noch. Baumann erinnerte sich an die Hoffnung in ihren Augen, an deren unerschütterlichen Glauben an Gerechtigkeit.
»Jojo, hast du das Buch 'Mr. B' von Ken Saro-Wiwa gesehen?«, rief Baumann in Richtung Haus. »Findest du es nicht ironisch«, setzte er nach, »dass Saro-Wiwas Buch bei uns überlebt hat – während sie den Autor an den nigerianischen Ölquellen aufgehängt haben?«
Jojo trat aus der Küche heraus, ein Geschirrtuch über der Schulter.
»Es müsste im Regal im Wohnzimmer sein«, antwortete sie.
Baumann stand auf und ging ins Wohnzimmer. Er zog das Buch aus dem Regal und blätterte durch die Seiten. Es war schon lange her, dass er es gelesen hatte, aber die Worte hatten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
»Er wurde hingerichtet«, murmelte Baumann vor sich hin und spürte einen Stich in seiner Brust. Die Parallelen zum Schicksal vieler namenloser Oppositioneller in Nigeria waren unübersehbar.
Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und tippte eine E-Mail an die Redaktion:
Die Mail trug den lakonischen Betreff:
»Reportage-Vorschlag Lagos, Sterbebett der Demokratie.
Liebe Kollegen,
ich möchte eine literarische Reportage über die Straße in Lagos schreiben, die Ken Saro-Wiwa in seinem erfolgreichen Roman 'Mr. B' beschrieben hat. Die Geschichte dieser Straße und ihrer Menschen ist eng mit der politischen Geschichte Nigerias verbunden und bietet einen tiefen und zugleich bunten Einblick in das Leben dort. Ihre Bewohner atmen Politik und ersticken zum Teil daran.
Viele Grüße
Michael«
Er klickte auf »Senden« und lehnte sich zurück. Baumann schaute auf seinen Pass mit dem Visum für Nigeria. Es lief nächsten Monat ab, und es wäre schade, diese Gelegenheit verstreichen zu lassen.
»Ich muss bald nach Nigeria«, sagte er laut zu sich selbst.
Jojo trat in sein kleines hölzernes Bürohaus, das im Garten unter einem Pfefferbaum ganz nah am Haus stand.
»Schon wieder? Das letzte Mal war es doch nicht ungefährlich?«
»Ja, das war damals in Port Harcourt, als Ken Saro-Wiwa hingerichtet wurde. Aber seitdem hat sich dort viel gebessert«, antwortete er knapp.
»Dieses Mal will ich nur nach Lagos, über die Menschen von Mr. B schreiben, die in dem Roman vorkommen. Die gibt es alle wirklich«, versuchte er zu argumentieren. »Immer über Rebellen und Hunger zu schreiben, habe ich satt. Lagos ist eine mögliche Zukunftsvision für unsere Welt, der Horror, ein Moloch wie ein Ameisenhaufen aus Menschen, mit unwahrscheinlich viel Geld, extremer Armut, unmöglichem Verkehr, tollem Jazz und riesiger Korruption«, fing er an, sich in seine Geschichte hineinzudenken. »Und ich habe noch ein Visum.«
Sie seufzte und nickte dann verständnisvoll.
Während Baumann einen Schluck Kaffee nahm, dachte er über die logistischen Herausforderungen nach. Er wusste, dass es keine andere Möglichkeit gab, als mit einem Visum nach Nigeria einzureisen. Und in seinem Pass war noch ein Visum. Das würde aber bald ablaufen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
Die Sonne begann unterzugehen und warf lange Schatten über seinen Schreibtisch. Baumann schaute aus dem Fenster auf den Pfefferbaum, er liebte den Garten und fühlte eine seltsame Melancholie.
Plötzlich riss ihn das klingende Telefon aus seinen Tagträumen. Baumann nahm den Hörer ab.
»Baumann«, meldete er sich.
»Michael Baumann, hier ist dein Chefredakteur«, kam die vertraute Stimme durch die Leitung. Der Mann hatte ihn vor Jahren eingestellt und dann später auch nach Afrika geschickt. Seiner Stimme haftete am Telefon diese besondere Art von Zynismus an – jener Tonfall, mit dem man Kriegsberichte über Kaffee und Kipferl bespricht. Aber dennoch konnte Baumann mit ihm besser als mit dem Auslandschef oder dem neuen Mann auf der Reportagenseite.
»Ich habe deinen Vorschlag gelesen. Liest sich interessant, macht mich neugierig.«
»Danke. Ich denke, die Menschen in der Adetola Street können viel über das Leben in Lagos erzählen«, stellte er fest und spürte, wie sein Herz über den Erfolg schneller schlug.
»Das glaube ich auch«, sagte der Chefredakteur. »Aber ich habe noch eine zweite Geschichte für dich. Die Innenpolitik winselt nach einem verfolgten Ogoni … du weißt, die wollen alle bedrohten Menschen hier nach Deutschland bringen. Es geht um einen abgeschobenen Ogoni-Aktivisten. Er hatte in Deutschland Asyl beantragt und ist jetzt in Nigeria angeblich verschwunden.«
Baumann zog die Augenbrauen hoch. »Ein Ogoni-Aktivist?«
»Ja, er war in Deutschland und versuchte, auf die Situation im Nigerdelta aufmerksam zu machen. Aber sein Asylantrag wurde abgelehnt, und jetzt weiß angeblich niemand, was mit ihm passiert ist.«
Baumann lehnte sich zurück und starrte an die Decke seines Büros. Der weiße Ventilator drehte unbeeindruckt seine Kreise. Die Erinnerungen an Nigeria fluteten ihn plötzlich. Die Hitze, die korrupte Polizei, die verzweifelten Menschen.
»Und du willst, dass ich das in Nigeria recherchiere?«
»Genau. Du bist unser Mann an Ort und Stelle und kennst das Land besser als jeder andere. Es wäre eine wichtige Geschichte auch und gerade hier in Deutschland mit seiner ganzen Asyldiskussion.«
Baumann schwieg kurzzeitig. Nigeria war für ihn ein Land voller Erinnerungen – nicht alle waren gut. Aber ihm war klar, dass er den Auftrag schlecht ablehnen konnte. Deshalb hatten sie wahrscheinlich auch den Chefredakteur selbst anrufen lassen.
»In Ordnung«, sagte er schließlich. »Ich werde es machen. Lass die Innenpolitik mir alles per E-Mail schicken, was sie zu dem Fall wissen. Versprechen kann ich nichts.«
»Danke, Michael. Pass auf dich auf.«
Er legte den Hörer auf.
Die Entscheidung war gefallen; er würde nach Nigeria fliegen. Zwei Geschichten – zwei verschiedene Welten, eine aus der Megacity und eine aus Port Harcourt. Das gefiel ihm weniger. Von dort war er mal regelrecht geflohen, als die Geheimpolizei … Aber auch Nigeria hatte sich geändert, sprach er sich Mut zu.
Jojo trat wieder ins knarzende Bürohäuschen ein …
»Was hat der Chef in München gesagt? Mit dem hast du doch gerade telefoniert?«
»Ich soll nach Lagos reisen«, antwortete Baumann langsam. »Zwei Geschichten recherchieren. Die eine über die Menschen in der Adetola Street – wie ich vorgeschlagen habe.«
Jojo nickte und wartete auf den Rest.
»Und die andere über einen abgeschobenen Ogoni-Aktivisten, der jetzt verschwunden ist. Die Innenpolitik in München scheint deswegen in großer Aufregung.«
Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung.
»Das wird nicht leicht werden«, fügte Baumann hinzu.
Jojo setzte sich neben ihn und streichelte seine Schulter. »Du schaffst das.«
Der Pfefferbaum warf Schatten über seinen Pass. Zwei Geschichten. Ein Visum. Kein Ausweg.
Flucht in eine andere Welt
Es war Nacht. Das bescheidene Haus von Emeka Okoro lag im Dunkeln, nur ein schwacher Lichtschein zwischen den zerschlissenen Vorhängen. Die Luft war schwül, die Hitze des Tages hatte sich bislang nicht verflüchtigt. Der Geruch von verbrannter Holzkohle und frittierter Plantain hing noch in der Luft, vermischt mit dem beißenden Gestank der offenen Abwasserkanäle.
In der Ferne brüllten Polizeisirenen, die immer näher kamen. Es klang wie eine Warnung, die keine Zeit mehr ließ, zu zögern. Emeka kannte das Geräusch.
Er stand am Hintereingang. Sein Gesicht war angespannt, seine Augen, sonst warm und lebendig, waren jetzt wachsam, fast wild.
Er atmete flach, als würde jeder Atemzug ihn verraten.
In der Hand hielt er einen kleinen Rucksack, in dem die wichtigsten Dokumente, einige Kleidungsstücke und ein altes Foto seiner Familie steckten. Zwischen den Dokumenten verbarg sich ein zerfetzter Zeitungsausschnitt – das letzte Foto von Saro-Wiwa, seinem Vorbild, vor seiner Hinrichtung, vergilbt von schweißnassen Händen. Es war alles, was er mitnehmen konnte.
»Sie kommen«, flüsterte er. »Wenn sie mich finden, bin ich tot.«
Er dachte an das letzte Mal, als er in der Kneipe in Port Harcourt war. Die brutale Festnahme, die Schläge auf der Wache, die Demütigung. Sie hatten ihn wie ein Tier behandelt, und doch war er damals noch davongekommen. Aber der eine Beamte mit dem abgewetzten Knüppel hatte gelacht: »Nächstes Mal holen wir deine Frau dazu.«
Emeka Onkoros Herz schlug gegen seine Brust. Er warf einen letzten Blick zurück ins Haus, wo seine Frau und die beiden Kinder schliefen. Er wollte nicht gehen, aber er hatte keine Wahl. Wenn er blieb, würde er sie alle in Gefahr bringen. Sie würden ihn benutzen, um an seine Familie heranzukommen. Und das konnte er nicht zulassen.
»Ihnen wird schon nichts geschehen«, murmelte er, als wolle er sich selbst überzeugen. Doch die Zweifel nagten an ihm. Was, wenn sie trotzdem kamen? Was, wenn sie Fragen stellten, die seine Frau nicht beantworten konnte? Er biss die Zähne zusammen und verdrängte den Gedanken.
Es gab keinen anderen Weg.
Langsam öffnete er die Hintertür. Die Tür quietschte wie das Gitter seiner Gefängniszelle vor drei Monaten. Emeka erstarrte – hatte sie das gehört?
Er trat ins Freie. Draußen warteten nur die Ratten. Die Nacht umhüllte ihn wie ein schützender Mantel, aber er wusste, dass sie trügerisch war. Jeder Schatten konnte ein Versteck sein, jeder Schritt konnte falsch sein. Er bewegte sich vorsichtig, bereit, bei der geringsten Bewegung zu fliehen.
Jetzt konnte er die Motoren hören. Er warf einen Blick über die Schulter und sah die Scheinwerfer der Polizeiautos, die sich wie feindliche Augen durch die Straßen tasteten. Sein Mund war trocken, seine Hände zitterten, aber er konnte nicht stehen bleiben. Nicht jetzt.
Irgendwo knallte eine Tür. Emekas Nackenhaare stellten sich auf – war das schon der erste Streifenwagen oder nur Nachbars streunender Köter?
Emeka drückte den Rucksack fester an seine Brust und verschwand im Dunkel der Nacht. Ein Mann auf der Flucht, getrieben von der Hoffnung, dass seine Opfer nicht umsonst sein würden. Doch tief in seinem Herzen wusste er, dass er nicht nur vor der Polizei floh, sondern auch vor der Verantwortung.
Emeka rannte durch enge, dunkle Gassen, vorbei an schlafenden Hunden und Mülltonnen. Die Sirenen kamen immer näher, ihr schriller Ton schnitt durch die nächtliche Stille und trieb ihn weiter.
Er warf einen Blick über die Schulter, sein Herz schlug bis zum Hals. Er trat in Pfützen, das Wasser spritzte hoch und klatschte gegen seine Hosenbeine. Sein Hemd klebte am Körper, durchtränkt von Schweiß und der feuchten Kühle der Nacht. Sein Ellbogen streifte einen Blecheimer. Der scheppernde Widerhall jagte eine Schar Ratten in die Flucht, ihre schwarzen Silhouetten huschten wie lebendige Schatten über die Mauern.
Kurz blieb er stehen, um Luft zu holen, die Lunge brannte, als würde sie Feuer fangen. Doch er durfte nicht lange verweilen. Mit einem tiefen Atemzug sprintete er weiter, die Beine schwer, nur der Wille, zu überleben, trieb ihn noch an. »Jeder Schatten könnte ein Verräter sein«, dachte er, während er um eine Ecke bog.
Schließlich erreichte er das Haus eines Freundes. Es war ein unscheinbares Gebäude, die Fenster dunkel, die Vorhänge zugezogen. Emeka klopfte leise an die Tür. Sein Atem kam stoßweise, seine Hände zitterten. Es dauerte nur Sekunden, dann öffnete sich die Tür. Ein Mann in seinen Dreißigern stand dort mit einem ernsten und sorgenvollen Gesicht. Er sagte kein Wort, nickte nur und warf Emeka einen Helm zu. Dann deutete er auf das Moped, das im Schatten der Hauswand stand.
Emeka stieg hinten auf, sein Griff um die Schultern des Freundes war fest, fast verzweifelt. Der Motor sprang an, ein leises Knurren, das in der Nacht wie ein befreiendes Signal klang. Sie beschleunigten, die Räder fraßen sich in den Sand, und die Straße tauchte vor ihnen auf, ein endloser Fluchtweg in die Dunkelheit.
»Freunde sind das Einzige, was in dieser Stadt noch zählt«, dachte Emeka, während der Fahrtwind sein Gesicht kühlte.
Die Lichter der Straßenlaternen verschwammen zu gelben Streifen, und die Sirenen wurden leiser, bis sie schließlich ganz in der Ferne verhallten. Doch Emeka wusste, dass die Gefahr nicht vorbei war. Sie war nur einen Schritt hinter ihm – und sie würde nicht aufgeben.
Das Moped raste über holprige Straßen, vorbei an schlafenden Dörfern und dunklen Feldern, die sich wie ein endloses, schwarzes Meer in der Nacht ausbreiteten. Der Wind peitschte Emeka ins Gesicht, aber er spürte die Kälte nicht.
Seine Augen waren starr auf die Straße gerichtet. »Die Grenze ist nah«, dachte er, während sein Herz klopfte.
Die Landschaft flog an ihnen vorbei, ein verschwommener Mix aus Schatten und Licht. Emekas Hände umklammerten die Schultern seines Freundes so fest, als hinge sein Leben davon ab – und das tat es auch.
Plötzlich musste er daran denken, warum er fliehen musste. Als sein erster Artikel über die Vertuschungen der Ölkonzerne gedruckt wurde, steckte ihn die Polizei für drei Tage in eine Zelle ohne Licht. Seine Frau Adanna, damals schwanger mit Chidi, wusch ihm danach die Wunden aus und flüsterte: »Du musst wählen – klug sein oder laut.«
Bei diesen Gedanken musste er jetzt auf dem Rücksitz des Mopeds unwillkürlich lächeln. Er wurde beides, klug und laut. Seine Reden auf den Straßen schnalzten wie Peitschenhiebe; die Leute strömten zu ihm, weil er nicht nur Wut, sondern auch Plan hatte. Doch mit jedem Protest wuchs die Angst – anonyme Anrufe, sein Vater, der ihn warnte: »Die Erde ist durstig, mein Sohn, und sie trinkt Blut.«
So rasten sie durch die Nacht. Der Freund lenkte das Moped mit ruhiger Hand, als wäre er mit jeder Kurve, als kenne er jedes Schlagloch.
Schließlich erreichten sie den Rand eines Waldes, nahe der Grenze zu Kamerun. Der Motor wurde leiser, dann abgestellt. Die Stille, die folgte, war fast unerträglich. Zwei Männer in dunkler Kleidung traten aus dem Schatten der Bäume. Sie tauschten kurze Worte mit Emekas Freund, ihre Stimmen waren kaum mehr als ein Flüstern.
Dann nahmen sie Emeka in Empfang.
Emeka stieg vom Moped und schüttelte die Hand seines Freundes. Es war ein kurzer, aber intensiver Händedruck, begleitet von einem Blick, der mehr als Worte sagte. Keine Abschiedssätze – nur ein Nicken.
Die beiden Männer führten ihn tiefer in den Wald, während sein Freund auf dem Moped zurückblieb. Emeka warf einen letzten Blick über die Schulter, aber sein Freund war bereits im Dunkel der Nacht verschwunden.
Die Grenze war nah.
Emeka atmete tief durch und folgte den Männern, bereit für den nächsten Schritt – was auch immer das bedeutete.
Die Schatten der Kontaktleute bewegten sich lautlos zwischen den Baumstämmen. Ihre Füße sanken in den feuchten Waldboden, kein Zweig knackte unter ihrem Tritt. Das Mondlicht sickerte durch das Blätterdach.
Emeka folgte, die Hände zu Fäusten geballt. Es roch nach verfaulten Blättern und nasser Erde.
Irgendwo, weit entfernt, heulten Hunde. Das Echo klang wie eine Warnung, die der Nachtwind durch den Wald trug.
»Kein Zurück mehr«, flüsterte einer der Männer vor ihm. Die Worte gingen im Rascheln der Blätter unter.
Emekas Stirn glänzte feucht im Mondlicht, obwohl die Nachtluft kühl über seine Haut strich. Seine Pupillen bohrten sich in den schmalen Trampelpfad.
»Eine Grenze«, dachte er, während sein Atem in kurzen Stößen ging, »nur ein Strich im Dreck. Aber dahinter atmet die Hoffnung.«
Irgendwo knickte ein Ast. Emekas Narben an den Handgelenken brannten plötzlich, als erinnerte ihn der Schmerz an all die anderen Linien, die er bereits überschritten hatte – zwischen Vater und Aktivist, zwischen Schweigen und Aufschrei.
Das Hundegeheul kam näher. Der Pfad vor ihm zitterte im fahlen Licht wie eine unsichere Lebenslinie.
Die Männer blieben stumm, bewegten sich geübt und routiniert. Sie wichen den Ästen aus, überquerten Bachläufe und führten Emeka durch das Labyrinth des Waldes, als wären sie selbst ein Teil der Nacht.
Emeka folgte ihnen, sein Atem ging gleichmäßig, aber in seinem Inneren brodelte es. Jeder Schritt brachte ihn näher zur Grenze, näher zur Ungewissheit.
Schließlich erreichten sie das andere Ende des Waldes. Die Bäume lichteten sich, und vor ihnen lag kamerunischer Boden.
Zwei Schatten lösten sich von den Baumstämmen. Ihre Gesichter blieben im Dunkel, nur das Glimmen ihrer Zigaretten verriet ihre Position. Ein kurzes, abgehacktes Flüstern, Codeworte, die im Nachtwind starben.
Der Größere trat vor. Seine Hand, von Ölflecken und Narben gezeichnet, streckte sich aus. Ein Umschlag, dick genug für ein neues Leben. Darunter ein zerknüllter Zettel, die Adresse, nur schemenhaft im Mondlicht zu erkennen.
»Merken. Dann verbrennen«, knurrte die Stimme. Der Geruch von billigem Tabak hing um ihn.
Emeka nickte. Das Papier in seiner Hand fühlte sich wie eine letzte Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft an.
Emeka öffnete den Umschlag, zählte das Geld nicht. Er steckte es ein. Die Adresse auf dem Zettel war mit derselben blassen Tinte geschrieben wie die Telefonnummer seines Shell-Kontakts damals in Port Harcourt. Zufall? Sein Gesicht zeigte Erleichterung und doch zugleich auch Unsicherheit. »Ein neuer Ort. Ein neuer Anfang«, dachte er.
Die Kontaktleute verschwanden im Dunkeln, so leise wie sie gekommen waren.
Emeka stand allein am Waldrand, mit der Adresse in der Hand. In der Ferne sah er die Lichter eines kleinen Dorfes, winzige Punkte in der Dunkelheit, die wie Sterne auf der Erde wirkten.
Er holte tief Luft. Das nasse Laub und die feuchte Erde rochen intensiv.
Langsam bewegte er sich auf die Lichter zu. Jeder Schritt schien beschwert, als würde er nicht nur den Untergrund unter seinen Füßen, sondern auch die Bürde seiner Vergangenheit zurücklassen.
Das Rascheln der Blätter war das einzige Geräusch, das zu hören war.
Doch trotz der Stille spürte Emeka, wie die Angst in ihm lauerte, wie ein Schatten, der ihn nie ganz loslassen würde. Er wusste, dass die Freiheit, die er suchte, kein Ende, sondern ein Anfang war.
Als er näher an das Dorf herankam, hörte er Stimmen, das Lachen von Kindern, das Klappern von Geschirr. Das Leben hier ging weiter, unbeeindruckt von seiner Flucht, von seiner Angst.
Emeka blieb stehen und blickte auf die Lichter vor ihm.
Dann gab er sich einen Ruck und ging weiter …
Ankunft in Yaoundé
Emeka trat auf den staubigen Bordstein von Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Die Busstufen ächzten unter seinem Gewicht.
Die Stadt schlug ihm entgegen wie eine Faust – ein Chaos aus kreischenden Bremsen, schrillen Händlerrufen und dem blechernen Klirren von Wellblechdächern.
Über ihm flatterten grellbunte Stoffbahnen im Wind wie verwaschene Protestbanner. Der Duft von scharf gewürztem Suya-Fleisch vermengte sich mit dem beißenden Gestank von Diesel und Fäulnis.
Ein schmächtiger Junge presste sich plötzlich an ihn, er trug einen Turm aus Broten auf dem Kopf. »Pardon, Patron.« Seine Finger waren flink wie eine Schlange. Emeka griff instinktiv an die Tasche – das Geld war noch da, aber jetzt wusste jemand, wo er es verstaute. Irgendwo schrie eine Frau, ein Radio plärrte Highlife-Musik.
Emeka atmete tief ein. In dieser lärmenden Anonymität war er endlich unsichtbar. Die Adresse in seiner Tasche brannte wie ein heimliches Versprechen.
Er trug einfache Kleidung, ein graues Hemd und eine abgetragene Hose, um nicht aufzufallen. Der Suya-Geruch weckte plötzlich Erinnerungen an Straßenstände in Port Harcourt – an den Abend vor seiner Verhaftung. Er spuckte bitter in den Rinnstein. Der kleine Rucksack auf seinem Rücken hüpfte kurz.
Seine Augen scannten die Umgebung, blieben an Gesichtern hängen, an Uniformen, an jedem, der zu lange in seine Richtung sah.
Er hielt das Stück Papier mit der Adresse fest in der Hand, die Ecken schon verschlissen vom ständigen Öffnen und Schließen. Seine Schritte waren nicht hektisch, aber schnell, als er sich durch die Menschenmenge schob. Die Adresse führte ihn in ein ruhigeres Viertel, wo die Straßen enger wurden und die Häuser niedriger.
Ein kleines Café tauchte auf, halb versteckt zwischen einem Friseurladen und einem Gemüsestand. Die Fenster waren getönt, die Vorhänge zugezogen.
Emeka blieb einen Moment stehen, atmete tief durch und trat dann ein.
Drinnen war die Luft kühl, erfüllt vom Duft frisch gebrühten Kaffees. An einem Tisch in der Ecke saß ein Mann in seinen Vierzigern, er sah europäisch aus, mit einer schmalen Brille und einem Gesicht, das nichts verriet. Neben ihm eine Frau, ebenfalls eine Weiße, die Emeka sofort erkannte. Sie nickte ihm diskret zu, ein kaum merkliches Zeichen.
Emeka setzte sich an den Tisch, seine Hände zitterten leicht. Er legte das Papier mit der Adresse vor sich ab, die Schrift nach unten.
Der Mann schob ihm etwas unter der Tischplatte zu, ohne den Blick zu heben. Ein Pass, neu, mit einem Foto, das Emeka kaum wiedererkannte.
»Ein neuer Name, ein neues Leben. Aber kann ich jemals wirklich ich selbst sein?« Sein Daumen strich über das Passfoto – ein Fremder mit seinen Augen. Die Plastikfolie klebte an seinem schweißnassen Finger wie eine zweite Haut.
Der Mann lehnte sich zurück, die Hände gefaltet. »So wirst du erst einmal weiterleben.«
Die Frau nahm einen Schluck Kaffee, ihre Augen blieben auf Emeka gerichtet. »Du bleibst hier, bis wir dir sagen, wohin es weitergeht. Vergiss die Kinderstimmen nachts. Vergiss deinen Namen im Traum. Das ist jetzt die einzige Regel.«
Emeka nickte, seine Finger umklammerten den Pass. Er spürte das Gewicht des neuen Namens, der neuen Identität.
Der Mann stand auf, warf ein paar Scheine auf den Tisch. »Wir sehen uns, wenn es so weit ist.«
Die Frau folgte ihm, ohne ein weiteres Wort. Emeka blieb zurück, mit dem Pass, einer Hostie in Plastik, in der Hand, die Adresse auf dem Tisch.
Draußen hupte ein Auto, und irgendwo lachte jemand. Das Leben ging weiter. Ein Möwenpaar kreischte im Sturzflug um Brotreste. Emeka biss in sein Suya – das Fleisch schmeckte fahl.
Es war kein neues Leben. Nur eine andere Art zu sterben.
Erinnerungen an die Abacha-Zeit
Baumann saß in seinem Arbeitszimmer. Das Licht der Schreibtischlampe warf einen warmen Schein auf die alten Notizbücher und Fotos, die vor ihm ausgebreitet lagen. Die Seiten waren vergilbt, die Ränder eingerissen, und auf einigen klebten noch Reste von Tesafilm.
Er blätterte langsam durch die Aufzeichnungen, seine Finger blieben an einem Foto hängen – ein Schwarz-Weiß-Bild von Ken Saro-Wiwa, wie er vor dem Tribunal stand, die Hände gefesselt, aber der Blick ungebrochen.
Seine Frau Jojo kam ins Zimmer, eine Tasse Tee in der Hand. Sie setzte sich auf die Armlehne des Sessels, ihr Blick fiel auf das Foto.
»Das war in Port Harcourt, oder?«
Baumann nickte, ohne den Blick von dem Bild zu heben. »Ja. 1995. Saro-Wiwa war schon verurteilt, bevor das Tribunal überhaupt begann. Die ganze Welt hat zugesehen, aber niemand hat etwas getan.«
Jojo stellte die Tasse auf den Tisch, ihre Hand strich über seine Schulter. »Du hast damals alles riskiert, um darüber zu berichten.«
»Ich war der einzige Weiße dort. Die anderen Korrespondenten hatten Angst, oder sie wurden abgeschreckt. Aber ich konnte nicht wegschauen.«
Er schloss das Notizbuch. Die Erinnerungen kamen zurück, wie ein Film, der in seinem Kopf abspulte. Die Hitze in Port Harcourt, der Gestank von Öl und verbranntem Gummi. Die Gesichter der Menschen, die vor dem Gerichtsgebäude warteten, ihre Hoffnung, die langsam in Verzweiflung umschlug.
»Die Geheimpolizei hat mich verfolgt. Ich konnte kein Hotelzimmer bekommen, weil ein Anwalt von Amnesty International denselben Namen hatte wie ich. Sie dachten, ich sei er.«
Jojo lächelte schwach. »Und dann bist du über die grüne Grenze nach Kamerun.«
»Ja. Die Situation wurde immer schlimmer. Jeden Tag gab es neue Verhaftungen, neue Drohungen. Ich wusste, wenn ich bleibe, werde ich nicht mehr herauskommen.«
Er stand auf, ging zum Fenster. Draußen war es still, die Kinder waren schon im Bett und die drei Labradore dösten im Garten vor sich hin. Was für eine Idylle und damit ein Kontrast zu den Erinnerungen, die in seinem Kopf tobten.
»Saro-Wiwa hat gewusst, dass er sterben wird. Aber er hat nicht aufgegeben. Bis zum letzten Moment hat er gekämpft.«
Jojo kam zu ihm, legte ihre Hand auf seinen Arm. »Und du hast seine Geschichte niedergeschrieben. Das zählt.«
Baumann schüttelte den Kopf. »Manchmal frage ich mich, ob es gereicht hat. Ob jemand wirklich hingehört hat.«
»Du hast getan, was du konntest.«
Er blickte auf die Fotos auf dem Tisch.
»Die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft hat mich am meisten getroffen. Sie haben zugesehen, wie ein ganzes Volk unterdrückt wurde, und nichts getan.«
Jojo nahm seine Hand, ihre Finger verschränkten sich mit seinen. »Aber du warst da. Du hast nicht weggeschaut.«
Baumann atmete tief durch, spürte die Erinnerungen, die ihn immer noch begleiteten. »Manchmal frage ich mich, ob ich noch einmal so viel Mut hätte. Ob ich noch einmal alles riskieren würde.«
»Du würdest. Weil du nicht anders kannst.«
Er lächelte zum ersten Mal, ein müdes, aber ehrliches Lächeln. »Vielleicht hast du Recht.«
Er ging zum Schreibtisch zurück und setzte sich. Die Fotos lagen noch da. Baumann strich über das Schwarz-Weiß-Bild.
»Wahrscheinlich. Gewohnheit ist die letzte Form von Mut.«
Die Vorbereitung
Das kleine Hotelzimmer schrumpfte mit jedem Schritt. Die Tapete blätterte ab, darunter ein gelblicher Pilz, der ihm stumm entgegen wucherte. Er murmelte seinen neuen Namen vor sich hin, wiederholte die Geschichte, die man ihm eingeprägt hatte. »Jean-Luc Mbarga.« Die Worte schmeckten nach falschem Geld. Sein Spiegelbild im Schrank zuckte zurück – selbst das Glas wollte den Lügner nicht halten.
Die Frau aus dem Café kam am frühen Abend. Sie brachte eine Tasche mit neuer Kleidung – ein gestärktes Hemd, eine dunkle Jacke, die Bedeutung vortäuschte. Sie legte die Sachen aufs Bett und musterte ihn.
»Zieh das an. Und dann geh zum Friseur um die Ecke.« Die Frau rückte seine Krawatte zurecht, ihre Fingernägel kratzten bewusst über seine Halsschlagader. Ein Test. Er hielt den Atem an, wie damals im Verhör. »Noch siehst du aus wie ein Mann, der etwas zu verlieren hat.«
Emeka gehorchte. Der Friseur schnitt ihm die letzten Locken. Die Haare fielen zu Boden. Der Spiegel zeigte einen Fremden – glattrasiert, makellos, aber mit Emekas müden Augen.
Am nächsten Tag betrat er den Flughafen von Yaoundé. Er hatte seinen neuen Pass sicher in seiner Jacke und hielt sein Ticket in der Hand. Er ging langsam, aber mit gezielten Schritten. Die Sonnenbrille rutschte auf seinem schweißnassen Nasenrücken. Hinter ihm lachte ein Kind – der Klang war wie die Stimme seiner Tochter. Seine Hände umklammerten den Griff des Koffers so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Er atmete tief durch, als er sich der Sicherheitskontrolle näherte. Die Schlange bewegte sich kaum, und jeder Zentimeter fühlte sich wie eine Ewigkeit an.
Schließlich war er an der Reihe. Er legte den Pass und das Ticket auf den Tresen, die Hände entspannt und das Gesicht neutral.
Der Beamte rieb Daumen und Zeigefinger an den Passseiten – prüfte er das Wasserzeichen oder Emekas Schicksal? Die Sekunden dehnten sich. Ein Stempel krachte. Emekas Herz fing wieder zu schlagen an.
»Alles in Ordnung. Sie können durch.«
Die Worte trafen ihn wie eine Beichte ohne Absolution. Emeka nahm den Pass, steckte ihn ein. Er nahm den Koffer und ging weiter.
Die Helligkeit im Flughafen blendete ihn, die Stimmen der Reisenden verschmolzen zu einem dumpfen Rauschen. Er bemerkte, dass die Anspannung in seinen Schultern nachließ, aber die Angst blieb, ein leises Zittern in seinen Händen.
Er suchte sein Gate. Die Anzeigetafel blinkte. Freiheit. Ein fremdes Wort.
»Jean-Luc Mbarga«, flüsterte er leise. Der Name passte wie ein schlecht sitzender Anzug. Aber er gehörte jetzt ihm.
Er ging weiter, hielt seine Schultern dabei gerade. Sein Schatten fiel lang vor ihm – ein dünner Strich ohne Gewicht auf dem polierten Boden.
Jean-Luc würde geradeaus gehen. Emeka blieb für immer dieser dunkle Fleck hinter ihm.
Gemeinsame Vergangenheiten
Baumanns Finger zögerte eine Sekunde über der Telefontastatur, als hätte das Gerät die Macht, Vergangenes wieder zu beschwören. Dann die vertraute Stimme:
»Donald. Lange nichts gehört.«
»Baumann.« Die Wärme in Donalds Tonfall war echt, die Überraschung auch. »Was führt dich zurück in unsere sündige Welt?«
Baumann starrte auf die Lagos-Karte vor sich. Die Adetola Street war mit Rot umkreist – wie ein blutiger Fingerabdruck auf dem Papier. »Ich denke über eine Rückkehr nach. Mr. B. in der Adetola Street. Die Ogoni im Delta. Die üblichen Geschichten.«
Das Schweigen am anderen Ende war dick wie Smog einer schmutzigen Großstadt. Dann ein Ausatmen – Raucherlunge oder Resignation? Donald, der nigerianische Politologe, der jetzt für die UN in Nairobi saß, als wäre Afrika ein einziges Land.
»Lagos ist immer noch … Lagos.« Donalds Lachen klang müde. »Die Adetola Street –