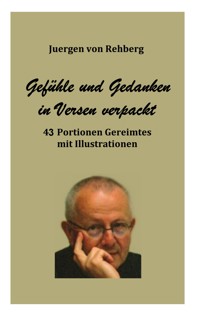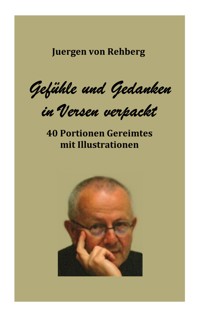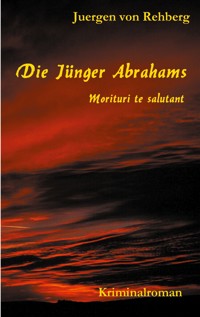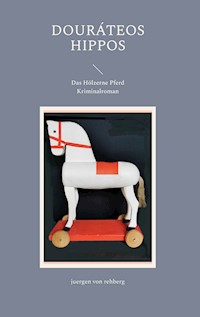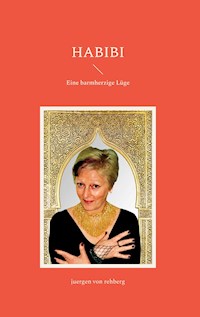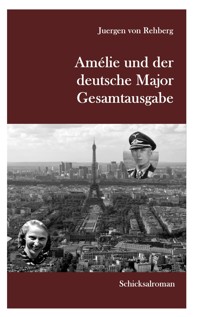
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Major Hermann vorm Walde verliebt sich im besetzen Paris in die französische Widerstandskämpferin Amélie und muss mit ihr fliehen, nachdem er sie aus den Hände der Gestapo befreit hat. Eine abenteuerliche Reise führt sie über die Schweiz, Spanien, Lissabon, Afrika bis Haiti, wo sie sich eine Existenz aufbauen und einen Sohn bekommen. Jaques vorm Walde, Honorarkonsul auf Haiti, heiratet eine deutschen Hotelangestellte und stellt mit ihr die Flucht seiner Eltern nach. Ein schwerer Schicksalsschlag verändert alles. Eine spannende, unterhaltsame Geschichte mit viel Liebe, Leid und Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Meinen Wagen, bitte!“
Der junge Mann in Livree nahm den Schlüssel, den ihm der Hotelgast entgegenhielt, und er antwortete mit einer leichten Verbeugung:
„Sofort, Herr Konsul.“
Es war ein trüber Herbsttag und der Wind trieb den Regen beinahe waagerecht vor sich her. Er war so heftig, dass an den Gebrauch eines Regenschirms erst gar nicht zu denken war.
Eine junge, hübsche Frau hatte sich in unmittelbarer Nähe zu dem Konsul gestellt und blickte erwartungsvoll auf die Straße.
Jaques vorm Walde, Honorarkonsul von Haiti, schaute die junge Frau an und, er erkannte in ihr die Hausdame des Hotels, Frau Heller, die man neudeutsch als „Housekeeper“ zu bezeichnen pflegt.
„Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen, Frau Heller?“, fragte er in einem väterlichen Ton, begleitet von einem feinen Lächeln.
„Danke nein, Herr Konsul“, antwortete Franziska Heller und fügte hinzu:
„Es ist sehr nett, dass Sie mir das anbieten; aber ich warte auf ein Taxi.“
„Das kann heute dauern“, setzte der Konsul nach, „bei diesem Mistwetter wollen alle ein Taxi.“
Inzwischen hatte der Mann in seiner schmucken Livree den Wagen des Konsuls vorgefahren und sich einen Schirm gegriffen, von denen einige im Eingangsbereich des Hotels aufbewahrt wurden.
Er hielt ihn aufgespannt über das Haupt des Gastes, um diesen damit - mit einem „Bitte sehr“ – zu seinem Wagen zu geleiten.
Der Konsul nahm dem beflissenen, jungen Mann den Schirm aus der Hand, hielt ihn über die Hausdame Franziska Heller und sagte:
„Kommen Sie, ich fahre Sie.“
Es lag so viel Charme und Herzlichkeit in seiner Aufforderung, dass Franziska Heller nicht widerstehen konnte.
Sie hakte ihren Arm unter den Arm des Konsuls, und dann eilten sie raschen Schrittes zu dem vorgefahrenen Wagen.
Das Auto, auf welches sie zugingen, war ein Traum in aubergine. Es war das Schmuckstück der französischen Automobilfirma Citroën, „La Déesse“, „Die Göttin“.
Bevor der Konsul die Tür öffnete, fragte er seinen Fahrgast, wo er einsteigen möchte; hinten oder vorne.
„Vorne, wenn ich darf“, antwortete Franziska mit leicht geröteten Wangen.
„Aber ja doch“, antwortete der Konsul, „mit dem größten Vergnügen.
Franziska Heller ließ sich in den Sitz gleiten, und der Konsul schloss die Tür. Während er um das Auto herumging, um einzusteigen, betrachtete sie das Innenleben des Traumgefährts.
Und als der Konsul eingestiegen war, sagte Franziska:
„Mit einem so wunderschönen Auto bin ich noch nie gefahren.“
Jaques lächelte.
„Und wohin darf ich Sie nun fahren, junge Dame?“, fragte er.
„Bis zur nächsten U-Bahn-Station“, antwortete Franziska, die bei der Bezeichnung „junge Dame“ leicht errötet war.
Mit ihren zweiundvierzig Jahren empfand sie sich nicht mehr als junge Dame, vielmehr als eine Frau, an der das Leben bisher achtlos vorübergegangen war.
Jaques hatte bemerkt, dass seine Mitfahrerin etwas verwirrt schien, und er fragte weiter:
„Ich nehme an, dass eine beliebige U-Bahn-Station nicht das gewünschte Endziel ist. Oder irre ich mich da?“
„Natürlich nicht, Herr Konsul“, antwortete Franziska in einem etwas trotzigen Ton.
„Dann verraten Sie mir doch bitte, wohin Sie wollen“, sagte Jaques, „ich werde Sie gerne dorthin fahren. Oder ist das ein Geheimnis? Wenn ja, dann ist es bei mir gut aufgehoben; ich kann schweigen wie ein Grab.“
Er unterlegte seine Worte mit einem Lächeln, und er schaute Franziska damit ins Gesicht.
Franziska konnte sich nicht dagegen wehren. Obwohl sie es gar nicht wollte, erwiderte sie das Lächeln des Konsuls.
„Das ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie das anbieten, aber Sie haben sicher etwas Besseres zu tun, als mich durch die Gegend zu kutschieren.“
„Also, dass Sie meine Göttin als Kutsche bezeichnen, das ist schon ein starkes Stück“, sagte Jaques, und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu:
„Dann sagen Sie aber jetzt dem Kutscher sofort, wohin er seine Rosse lenken soll.“
Franziska musste herzlich lachen. Ein warmes Gefühl erfasste sie. Dieser Mann hatte einen Zugang zu ihrer Seele gefunden, die sich schon vor langer Zeit zurückgezogen hatte.
Die Worte, die dann folgten, drangen von ganz allein aus ihrem Mund:
„Dann bringen Sie mich zum Pflegeheim Aurora in die Bergheimer Straße.“
„Darf ich fragen, wen Sie dort besuchen wollen?“, fragte Jaques.
„Meine Mutter“, antwortete Franziska leise.
Jaques fiel der Tonfall in Franziskas Antwort auf, und er verzichtete darauf, weiter nachzufragen.
„Meine Mutter ist schon seit ein paar Jahren dort“, fuhr Franziska nach einer längeren Pause fort, „sie ist dement.“
Als sie das sagte, rannen ihr die Tränen über das Gesicht.
„Das tut mir sehr leid“, sagte Jaques und reichte Franziska ein Taschentuch, welches er der Innentasche seines Sakkos entnommen hatte.
Jaques war noch ein Kavalier alter Schule. Old school eben, wie man das heutzutage nennt. Sakko, Hemd, Krawatte, Einstecktuch, und immer ein sauberes Stofftaschentuch in der Innentasche des Sakkos.
„Entschuldigen Sie bitte, Herr Konsul“, sagte Franziska, während sie ihre Tränen abwischte.
„Da gibt es nichts zu entschuldigen“, antwortete Jaques, „und bitte lassen Sie den Konsul weg; ich heiße Jaques.“
„Das geht doch nicht“, antwortete Franziska, „Sie sind ein Gast des Hotels und ich bin nur eine Angestellte.“
„Aber jetzt bin ich kein Gast, sondern einfach nur ein Mann in den besten Jahren“, sagte Jaques, „und Sie sind keine Hausdame, sondern eine junge, traurige und sehr hübsche Frau, die zu chauffieren ich das große Vergnügen habe.“
Franziska lächelte. Wieder umfing sie das warme Gefühl der Geborgenheit, und wieder kamen die Worte wie von selbst:
„Dann nennen Sie mich bitte Franziska!“
„Mit dem größten Vergnügen, liebe Franziska.“
*****
Jaques vorm Walde, 64 Jahre alt, Sohn des Hermann vorm Walde und der Amélie vorm Walde, geborene Dubois, war das Kind einer Ehe, die ihren Ursprung kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs genommen hatte.
Major Hermann vorm Walde diente damals unter dem Stadtkommandanten von Groß-Paris, General Dietrich von Choltitz.
Der Major hatte schon vor einigen Monaten die hübsche Pariserin Amélie kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt.
Das war damals nicht ungefährlich, denn das Fraternisieren mit dem Feind war strengstens verboten. Es hielt sich nur nicht jeder daran. Man durfte sich halt nicht erwischen lassen.
Es war in einem Café auf dem Montmartre. Major Hermann vorm Walde liebte dieses Café. Er kam stets in Zivil, um nicht aufzufallen.
Sein akzentfreies Französisch ließ ihn nicht sofort als Deutschen erkennen. So mischte er sich – selbst ein Künstler – unter die anderen Künstler und lauschte ihren aufgeregten Diskussionen.
Major vorm Walde hatte, bevor er Soldat wurde, Kunst studiert und mit der Malerei begonnen. Irgendwann holte ihn aber die Familientradition ein.
Er stammte aus einer Offiziersfamilie, deren Ursprung bis in die napoleonische Zeit zurückführte. Sein Vater war General, ebenso sein Großvater.
Nachdem er mit seiner Leidenschaft nicht den erhofften Durchbruch schaffte, gab er schließlich dem Drängen seines Vaters und auch seines Großvaters nach und wurde Berufsoffizier.
Seinen großen Wunsch sich als Maler zu etablieren gab er jedoch nicht auf; er vergrub ihn in seinem Herzen.
Es war einer der Abende, an denen er für ein paar Stunden vom Soldaten wieder zum Künstler wurde. Er saß mit ein paar jungen Leuten zusammen und beteiligte sich an deren lebhaften Diskussionen.
Als er einmal von einem der Diskutanten darauf angesprochen wurde, woher er eigentlich komme, stutzte er für einen kleinen Moment. Doch dann sagte er im Brustton der Überzeugung, dass er Schweizer sei.
Und als Untermauerung seiner Antwort sagte er ein paar Worte in einem angedeuteten Schwyzerdütsch, und er lachte dazu, als ob es sich um eine lustige Redewendung handeln würde.
Es dauerte einen kleinen Moment; aber dann lachten alle mit. Die Initialzündung wurde von einer Frau ausgelöst, die mit am Tisch gesessen war.
Diese Frau war Amélie, die sofort erkannte, dass Hermann ebenso wenig Schweizer war, wie sie eine Künstlerin.
Amélie war Mitglied bei der Résistance, immer auf der Suche nach einem Opfer. Sie wusste, dass es immer wieder Deutsche gab, die sich auf Montmartre herumtrieben.
Es waren vornehmlich Offiziere, welche die Nähe zu den Künstlern suchten. Gewöhnliche Soldaten hatten keinen Zutritt. Vermutlich wollten sie sich mit dem Flair der Künstler parfümieren.
Vielleicht war es aber auch nur der Hauch der Verderbtheit, welcher dem Montmartre anhing.
Hermann hatte Amélies Interesse erweckt. Sie setzte geschickt die Waffen einer Frau ein, über welche sie in reichem Maße verfügte.
Schwarze Haare, dunkle Augen und eine Figur, die keine Wünsche offenließ.
„Ich mag die Schweiz.“
Mit diesen Worten begann Amélie ein Gespräch, um ganz sicher zu sein, dass ihre Vermutung auch zutraf.
„Ich war als Kind mit meinen Eltern am Lac Léman, das war eine schöne Zeit.“
Major vorm Walde schluckte. Damit hatte er nicht gerechnet.
„Da war das Hotel <Wilhelm Tell>, vis-à-vis vom Bahnhof. In diesem haben wir immer logiert. Das kennen Sie doch bestimmt.“
„Ja, sicher“, antwortete Major vorm Walde, „das ist ja sehr berühmt.“
„Genau“, antwortete Amélie, „ein Haus mit Klasse. Ich muss nach dem Krieg unbedingt wieder einmal hin. Aber zuerst müssen wir einmal die< Boches> besiegen.“
Major vorm Walde zuckte zusammen, als er den Schimpfnamen für seine deutschen Kameraden hörte.
Amélie lachte lauthals dabei und die versammelte Runde fiel mit ein. Einer der Anwesenden hob sein Glas und brüllte:
„Tod allen Boches, Tod den deutschen Teufeln!“
Amélie hielt ihr Glas dem Major entgegen, stieß mit ihm an und sagte:
„Darauf, dass alle Boches verrecken und der Krieg bald vorüber ist!“
Es schnürte Hermann vorm Walde die Kehle zu, als er sein Glas zum Mund führte, um auf den Tod seiner Kameraden zu trinken.
Er hatte für einen kurzen Moment erwogen aufzustehen und sich zu deklarieren; aber zwei Dinge hielten ihn davon ab.
Erstens die prekäre Lage; denn er wäre wohl nicht mehr lebendig in sein Quartier zurückgekommen.
Und zweitens die Augen von Amélie, die wie eine Gefängnistür waren, durch die er gegangen war, ohne es zu bemerken. Er war dieser Frau von Anbeginn verfallen.
*****
„Wir sind gleich da“, sagte Franziska zu dem Konsul. Es hatte inzwischen zu regnen aufgehört. Der Himmel tat sich auf und die Sonne zwängte sich mit ihren ersten Strahlen hindurch.
„Die nächste links, und dann sieht man schon das Pflegeheim.“
Die Einrichtung namens <Aurora> lag auf einer kleinen Anhöhe, inmitten eines Parks.
„Wie kann man eine solche Einrichtung nur <Aurora> nennen?“, murmelte Jaques leise vor sich hin.
„Was meinen Sie damit?“, fragte Franziska, welche die Bemerkung von Jaques gehört hatte.
„In der Mythologie bezeichnet man mit <Aurora> die Göttin der Morgenröte, und die Morgenröte ist wiederum das Synonym für die rötliche Färbung des Osthimmels vor dem Sonnenaufgang.“
Und nach einer kurzen Pause fügte Jaques hinzu:
„Eine solche Einrichtung steht aber mehr für Sonnenuntergang, als für Sonnenaufgang; meinen Sie nicht auch?“
Franziska nickte und bekam feuchte Augen.
„Verzeihen Sie, liebe Franziska“, sagte Jaques, „das war wohl gerade nicht sehr sensibel von mir; es tut mir leid.“
Franziska schüttelte ihren Kopf und antwortete:
„Sie müssen sich nicht entschuldigen; Sie haben ja recht. Wenn man in die Gesichter dieser Menschen schaut, dann ist da kein Leben mehr zu erkennen. Es scheint, als wären sie nur noch leere Hüllen…“
„Erkennt Sie Ihre Mutter, wenn Sie sie besuchen?“, fragte Jaques.
„Manchmal schon und dann wieder gar nicht. Es wird in letzter Zeit immer weniger“, antwortete Franziska. Dann sah sie Jaques an und fragte:
„Würden Sie mich zu meiner Mutter begleiten?“
Jaques war überrascht ob dieser Frage, und er überlegte krampfhaft, was er darauf antworten sollte.
Franziska half ihm bei der Entscheidungsfindung, indem sie ihre Frage mit den Worten ergänzte:
„Es würde mir sehr helfen.“
„Aber ja, ich komme natürlich gern mit, wenn Sie das wünschen“, antwortete Jaques.
Kurz darauf betraten sie das Zimmer von Martha Heller, Franziskas Mutter.
Ein Raum von ca. 20 Quadratmeter mit einem kleinen anschließenden Badezimmer, einem Bett, einem kleinen Tisch und zwei Stühlen, einem Sessel und zwei Fenstern zum Park.
Zwischen den Fenstern stand eine kleine Kommode, auf welcher mehrere gerahmte Bilder platziert waren.
Martha Heller saß in ihrem Sessel und schaute in den Park. Es war, als hätte sie die Eintretenden gar nicht bemerkt.
„Hallo Mutter!“
Franziska war zu ihrer Mutter hingetreten und hatte ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben.
„Ich habe dir Besuch mitgebracht“, sagte Franziska, „das ist der Herr Konsul, ein lieber Gast unseres Hotels.“
Martha Heller zeigte keinerlei Regung. Sie hatte weder auf die Liebkosung ihrer Tochter reagiert, noch auf das von ihr Gesagte.
Während Franziska ein paar Dinge auspackte, die sie für die Mutter mitgebracht hatte, ein wenig Obst und ein paar Zeitschriften, sagte sie zu Jaques:
„Meine Mutter empfängt heute nicht. Sie hat sich in ihre Welt zurückgezogen, zu der ich keinen Zugang habe.“
Die Wehmut, die schon leicht an Ironie grenzte, war nicht zu überhören. Jaques hätte Franziska in diesem Augenblick am liebsten in den Arm genommen. Aber stattdessen zeigte er auf die Fotografien, welche auf der Kommode standen.
„Wer ist das?“, fragte er und Franziska nahm jedes der Bilder in die Hand und gab die dazugehörenden Erklärungen ab.
„Das sind Bilder aus einer anderen Zeit, einer besseren Zeit. Alles liebe Menschen; aber inzwischen Fremde für meine Mutter.“
Ein Bild hielt sie besonders lange in ihren Händen. Und wieder stiegen Tränen in ihre Augen. Sie musste kämpfen, bevor sie sagen konnte, wer die Personen sind.
„Das sind mein Vater, meine Mutter, meine beiden Brüder Wolfgang und Martin und ich.“
„Die Brüder sehen sich sehr ähnlich“, sagte Jaques.
„Ja, es waren Zwillinge“, antwortete Franziska.
„Wieso waren?“, fragte Jaques.
„Sie sind tot“, antwortete Franziska, und bevor Jaques weiterfragen konnte, ging sie zum Bett der Mutter und schüttelte das Kopfpolster auf.
Danach ging sie zu ihrer Mutter, gab ihr erneut einen Kuss auf die Stirn und beim Hinausgehen sagte sie:
„Bis nächste Woche, Mutter!“
Jaques folgte ihr mit einem unruhigen Gefühl.
„Können Sie mich bitte zur U-Bahn-Station bringen?“, sagte Franziska, als sie das Gebäude verlassen hatten.
„Das wird nicht nötig sein“, antwortete Jaques, „Kutsche und Kutscher stehen nach wie vor zu Ihrer Verfügung, mein Fräulein.“
Während er das sagte, setzte Jaques das bezauberndste Lächeln auf, das er gerade zur Verfügung hatte.
„Es tut so weh; es bringt mich schier um…“
Mit diesem Aufschrei der Seele schlang Franziska ihre Arme um Jaques und ließ ihrem Schmerz freien Lauf.
*****
Seit jenem Vorfall im Café auf dem Montmartre, der dem Major Hermann vorm Walde arg zugesetzt hatte, waren einige Wochen vergangen.
Hin- und hergerissen, ob er je wieder dorthin gehen sollte, siegte schlussendlich der Wunsch, Amélie wiederzusehen.
„Hallo Suisse! Wo warst du so lange?“, fragte Pierre, einer aus der Runde.
„Ich war krank“, antwortete Hermann vorm Walde, der gegenüber dem Fragenden eine starke Aversion verspürte.
Er war es, der ihm den Namen <Suisse> gegeben hatte, nachdem Hermann auf die Frage nach seinem Namen in höchster Bedrängnis geantwortet hatte:
„Ich heiße Wilhelm Rütli.“
Bei der dringlichen Namensfindung waren dem Major Wilhelm Tell und der Rütlischwur als typische schweizerische Attribute in den Sinn gekommen.
„Wilhelm, das klingt mir zu Deutsch“, hatte Pierre damals gesagt, „ich nenne dich <Suisse>, mein schweizerischer Freund.“
Und so wurde aus dem deutschen Hermann und dem assimilierten schweizerischen Wilhelm ein französischer Suisse.
„Wo ist Amélie?“, fragte Hermann in die Runde.
„Die hat noch etwas zu tun“, antwortete Pierre mit einem feisten Grinsen im Gesicht. „Aber vielleicht kommt sie ja noch. Hast du vielleicht Sehnsucht nach ihr, Suisse?“
Hermann hasste diesen arroganten Menschen, der sich ständig in den Vordergrund drängte.
„Vielleicht“, antwortete Hermann etwas gereizt, „und selbst wenn, würde es dich stören?“
„Aber nein, mein Freund“, antwortete Pierre lachend, „das zeugt nur von deinem guten Geschmack, was Frauen betrifft“.
In sein Lachen fielen auch die restlichen Anwesenden mit ein, und damit war die Situation entschärft.
Es war schon kurz vor Mitternacht, und Hermann hatte schon erwogen, zu gehen, als die Tür aufging und Amélie das Café betrat.
Sie hatte einen fliehenden Blick in ihren Augen, und sie wirkte leicht verstört. Als sie Hermann erblickte, erschrak sie im ersten Moment, fing sich aber schnell wieder.
Amélie ging zum Tisch ihrer Freunde, ergriff den ersten Cognac, der ihr in die Finger kam, und kippte ihn in einem Zug hinunter.
„Was ist passiert?“, fragte Manon, das einzige weibliche Wesen in der Gruppe.
Der Zustand Amélies berechtigte diese Frage durchaus. Ihre Haare waren zerzaust und ihre Kleidung war leicht derangiert.
„Ein verrückter Autofahrer hätte mich beinahe überfahren. Ich konnte gerade noch zur Seite springen und bin dabei gestürzt“, antwortete Amélie.
„Das ist ja schrecklich“, sagte Manon, „hast du die Polizei gerufen?“
„Nein“, antwortete Amélie, „das hätte keinen Sinn gehabt.“
„Aber wieso nicht?“, fragte Manon weiter.
„Weil es ein deutsches Militärfahrzeug war“, antwortete Amélie und sah Hermann dabei an.
Hermann wusste in diesem Augenblick nicht, was das zu bedeuten hatte, und wie er sich verhalten sollte.
Pierre erlöste ihn mit den Worten:
„Merde; diese verdammten Boches.“
„Hallo Suisse! Sieht man dich auch einmal wieder?“
Herrmann war nicht gerade glücklich darüber, dass Amélie ihn auch <Suisse> nannte wie die anderen.
„Hallo Amélie; schön dich zu sehen!“, antwortete Hermann, und er fühlte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte.
Es ließ sich nicht leugnen, er hatte sich in diese Frau verliebt. Er war sich jedoch nicht sicher, ob seine Liebe von Amélie erwidert würde.
Aber noch in dieser Nacht erhielt er Gewissheit.
„Bring mich nach Hause, Suisse!“
Es waren diese magischen Worte, welche die letzten Zweifel des Liebenden ausräumten.
Amélie hatte dem Alkohol reichlich zugesprochen und ihr Stehvermögen war schon leicht beeinträchtigt, als sie Hermann aufforderte, sie zu begleiten.
„Rue Racine zwanzig“, sagte sie dem Taxifahrer, als sie eingestiegen waren, und dann legte sie ihren Kopf an die Schulter ihres Begleiters und schlief ein.
„Wir sind da“, sagte Hermann und rüttelte Amélie dabei sanft an ihrer Schulter.
Amélie holte aus ihrer Manteltasche einen Schlüssel und gab ihn Hermann mit den Worten:
„Erster Stock, Tür drei, und du musst mich tragen.“
Hermann lächelte. Er nahm Amélie in die Arme und trug sie die Treppe hinauf. Sie war leicht wie eine Feder; aber selbst dann, wenn sie ein paar Kilo schwerer gewesen wäre, hätte er sie getragen.
Der deutsche Major trug eine französische Widerstandskämpferin auf seinen Armen, und er fühlte sich wie im siebenten Himmel. Ein Ort, wo es keine Nationalitäten und keine Kriege gibt und wo der Mensch einfach nur Mensch sein kann.
*****
Die Fahrt zurück verlief schweigend. Jaques schaute ab und zu aus seinen Augenwinkeln zu Franziska hin, die regungslos neben ihm saß.
„Wie wäre es mit einem Kaffee?“, unterbrach Jaques das Schweigen. „Sie könnten mich einladen, quasi als Entlohnung für den Kutscher.“
Franziska musste lächeln. Dieser Mann, der ihr im Grunde genommen völlig fremd war, verstand es immer wieder, ihre verängstigte Seele aus ihrem Versteck zu locken.
„Kennen Sie das Café Reimprecht am Stürmersee, etwas außerhalb der Stadt?“, fragte Franziska.
„Nein, bisher nicht“, antwortete Jaques, „aber mit Ihrer Hilfe wird sich das bald ändern, nehme ich an. Sie müssen mir nur den Weg zeigen.“
Die Sonne hatte inzwischen die letzten Wolken verjagt und den Tag mit einer wohligen Wärme umhüllt.
Franziska und Jaques hatten auf der Terrasse des Cafés Platz genommen und Kaffee und Kuchen bestellt.
„Erzählen Sie mir ein bisschen von sich, liebe Franziska“, begann Jaques ein Gespräch. „Hatten Sie als Kind einen Kosenamen?“
„Wie kommen Sie darauf?“, fragte Franziska ganz erstaunt. Es wurde ihr fast schon ein wenig unheimlich, wie dieser Mann in ihr Leben eindrang.
„Ich weiß nicht“, antwortete Jaques mit demselben Lächeln, welches bei Franziska immer wieder jeden Argwohn zerstreute.
„Mein Vater nannte mich Franzi“, antwortete Franziska, „das mochte ich sehr…“
„Und Ihre Mutter?“, fragte Jaques.
„Die mochte das überhaupt nicht“, antwortete Franziska.
„Warum nicht?“, fragte Jaques überrascht.
„Weil sie mich hasste. Sie hasst mich schon fast mein ganzes Leben lang.“
Jaques hielt inne. Ihm wurde bewusst, dass er einen wunden Punkt berührt hatte. Er war sich nicht sicher, ob er weiter fragen sollte, und er beschloss daher zu schweigen.
„Sie macht mich für den Tod der Zwillinge verantwortlich“, sagte Franziska in die Stille hinein.
Dieser Satz war wie ein Messer, welches die Stille mit scharfer Klinge durchtrennte.
Als Franziska das sagte, schaute sie Jaques mit einem stechenden Blick an, dem er nur schwer standzuhalten vermochte.
„Ich war zehn Jahre alt und meine beiden Brüder waren fünf. Wir wohnten damals in einem Haus in einem Dorf, direkt neben der Landstraße.
Meine Mutter war in der Küche und kochte das Mittagessen. Und ich spielte mit den Zwillingen im Hof Fangen.
Wolfgang rannte auf die Straße, gefolgt von Martin. Ein junger Mann aus dem Nachbarort hatte ein neues Auto bekommen und machte eine Spritztour damit.
Als er um die Kurve vor dem Haus mit viel zu hoher Geschwindigkeit schoss, kam er ins Schleudern und erwischte meine beiden Brüder. Sie waren sofort tot.
Meine Mutter, die den Aufprall gehört hatte, kam aus der Küche gestürzt und schrie wie wild. Es waren immer wieder dieselben Worte:
<Warum hast du nicht aufgepasst? Du bist schuld am Tod meiner Lieblinge.>
Ich war nie ihr Liebling. Aber von diesem Tag an hasste mich meine Mutter…“
Jaques zog es das Herz zusammen. Wie sehr musste diese Frau wohl leiden.
„Aber du warst doch selbst noch ein Kind“, sagte Jaques, und er hatte gar nicht bemerkt, dass er Franziska geduzt hatte.
„Hat dich dein Vater denn nicht in Schutz genommen?“, fragte er.
„Das hätte nichts genützt“, antwortete Franziska, „meine Eltern hatten sich entzweit, weil Vater ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte.“
„Das spricht aber nicht sehr für deinen Vater“, bemerkte Jaques.
„Ganz so ist es nicht“, sagte Franziska, „du musst wissen, dass die Heirat meiner Eltern eine arrangierte Angelegenheit war.“
„Wie das denn?“, fragte Jaques erstaunt.
„Mein Vater stammte aus einem reichen Bauernhof, und meine Mutter kam aus eher ärmlichen Verhältnissen.
Sie hat sich meinen Vater geangelt und sich von ihm schwängern lassen. Somit war eine Hochzeit unvermeidlich. Und als ich geboren wurde, und leider nur ein Mädchen war, wurde der Ruf nach einem Stammhalter laut.
Der wurde dann auch vier Jahre später geboren, und sogar in zweifacher Ausfertigung. Der Haken dabei war jedoch die Ähnlichkeit der Buben mit einem anderen Dorfbewohner.
Mein Vater gab sich dennoch als Erzeuger aus, der er aber nicht war. So lebten sich meine Eltern auseinander, und mein Vater nahm sich eine Geliebte.“
„Das klingt ja wie ein schlechter Roman“, sagte Jaques, „das Schicksal winkt aus allen Winkeln.“
„Und doch war es so“, sagte Franziska und fügte hinzu:
„Ich möchte mich für das DU entschuldigen; es ist mir einfach so passiert. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, Herr Konsul.“
„Stopp, stopp, liebe Franziska“, sagte Jaques, „erstens habe ich damit angefangen und zweitens möchte ich dich von Herzen bitte, dass wir dabeibleiben. Ich würde mich sehr drüber freuen.“
Franziska zögerte einen kurzen Moment lang, dann nickte sie.
„Ich habe mein Leben vor dir ausgebreitet, und du hast so tief in meine Seele geblickt, wie noch kein Mensch zuvor. Es hat mir wohlgetan und ich fühle mich so frei wie schon lange nicht mehr.“
Mit diesen Worten beugte sie sich vor und gab Jaques einen Kuss auf die Wange.
Jaques war sich in diesem Augenblick bewusst, dass ein zartes Pflänzlein in sein Leben getreten war, welches einer besonderen Pflege bedurfte.
Zuwenig Zuwendung würde es verdorren lassen und zu viel würde es ersticken. Es bedurfte eines behutsamen Vorgehens, um das Pflänzlein <Franzi> so zu hegen und zu pflegen, dass es wohl gedeihen und irgendwann voll erblühen würde.
*****
Hermann brachte Amélie in ihr Schlafzimmer und legte sie sanft auf das Bett. Er wollte sich gerade umdrehen, um zu gehen, als Amélie sagte:
„Zieh mich aus, chérie; ich schaffe das nicht allein.“
Während sie das sagte, hatte sie ihre Augen geschlossen und hielt ihre Hände dem Major entgegen wie ein kleines Kind, das seine Arme der Mutter entgegenstreckt.
Hermann zog Amélie Schuhe und Rock aus. Als er ihre Bluse öffnete, sah er ihre nackten Brüste. Amélie trug keinen BH. Hermann fühlte eine aufsteigende Erregung. Er erschrak und zog die Decke schnell über ihren Körper.
Amélie ließ alles willig geschehen. Sie war kurz davor einzuschlafen.
„Leg dich zu mir, chérie; ich möchte heute Nacht nicht allein sein.“
Wenig später war Amélie eingeschlafen. Hermann betrachtete sie noch eine Weile. Dann nahm er einen Zettel und schieb eine Nachricht darauf.
„Wunderbare Amélie, es tut mir leid; aber ich kann heute Nacht nicht bei dir bleiben. Ich möchte dich aber für morgen Abend zum Essen einladen. Ich werde dich um 19:00 Uhr abholen. Ich küsse dich mit all meiner Liebe…“
Hermann legte den Zettel auf den Nachtisch neben dem Bett, gab Amélie einen Kuss auf die Wange und schlich leise hinaus.
Zurück blieb eine Frau, die gerade ihre Augen geöffnet hatte, um nach dem Zettel zu greifen. Sie las die Nachricht und lächelte. Es war das Lächeln der Sphinx.
Hermann fuhr mit dem Taxi in seine Wohnung in der Rue d‘Artagnan. Sie lag in der Nähe der Kommandantur und bestand aus einem großen Zimmer mit Bett und einem kleinen Bad.
Auf einem kleinen Tischchen stand ein Grammophon, und daneben lag ein Stapel Schellackplatten. Es waren – mit wenigen Ausnahmen – Platten mit klassischer Musik.
Er legte die Platte „Arien und Lieder“ von Joseph Schmidt auf, und gleich der erste Titel spiegelte seine Gemütsverfassung wider. Es war die Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ aus dem 1. Akt der Zauberflöte.
Vor seinen Augen erschien noch einmal der Anblick von Amélie, wie sie ausgezogen auf ihrem Bett lag. Hermann seufzte vor Liebesschmerz.
Wie gern hätte er - noch vor wenigen Augenblicken - Amélie in den Arm genommen, um sie zu lieben. Aber das wäre wider seine Natur gewesen.
Wenn sich diese Frau ihm hingeben sollte, dann nicht unter dem Einfluss von zu viel Alkohol, sondern aus Liebe und im Rausch der Leidenschaft.
Hermann hatte das Grammophon abgestellt und war zu Bett gegangen. Seine letzten Gedanken führten ihn noch einmal zu seiner Angebeteten.
An diesem Tag waren zwei Dinge geschehen, welche eines deutschen Offiziers unwürdig waren:
Das Abspielen und Anhören der Musik eines Juden, denn ein solcher war Joseph Schmidt, und das sich Einlassen mit dem Feind.
Hermann vorm Walde, Major der deutschen Wehrmacht, Offizier wider Willen und ganz bestimmt nicht aus Überzeugung, hatte schon seit geraumer Zeit heftige Zweifel an seinem Tun.
Allein seine Abstammung, gleichwohl seine Erziehung, hinderten ihn daran, sich gegen seinen Dienstherrn zu stellen, obwohl er um den Widerstand aus den eigenen Reihen wusste und auch damit liebäugelte.
Seine große Hoffnung lag darin, dass der Krieg bald zu Ende gehen möge, dass er ihn unbeschadet überstehen würde, und dass er und Amélie ganz offiziell ein Paar sein könnte.
Mit diesen Gedanken schlief Hermann vorm Walde ein, nicht ahnend, dass sich dunkle Wolken gebildet hatten, welche den Himmel der Liebe mit tiefer Dunkelheit umhüllten.
*****
„Guten Morgen, Herr Konsul, ich habe eine Nachricht für Sie.“
Mit diesen Worten und einem verbindlichen Lächeln reichte der Concierge Jaques einen Brief und fügte hinzu:
„Ich wünsche dem Herrn Konsul noch einen schönen Tag!“
Jaques bedankte sich und öffnete den Brief. Er war von Franziska.
„Lieber Herr Konsul, ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für den gestrigen Tag bedanken. Er hat mir sehr gefallen und das Gespräch mit Ihnen hat mir sehr viel gegeben.
Bitte, missverstehen Sie mich nicht und halten Sie mich nicht für undankbar; aber wir leben in zu verschiedenen Welten.
Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, und ich werde Sie stets in dankbarer Erinnerung behalten. Herzlichst Franziska Heller.“
Jaques las den Brief wieder und wieder. Aber so oft er das auch tat, verstehen konnte er ihn nicht. Was war geschehen, das diese plötzliche Sinnesänderung hervorgerufen hatte?
„Ich brauche dringend Feder und Papier“, sagte Jaques aufgeregt zu dem Concierge.
„Darf ich Sie in das Schreibzimmer verweisen“, antwortete der Concierge und winkte einen der Pagen herbei. „Stefan wird Sie dorthin begleiten.“
Jaques ließ sich von dem Pagen hinführen und hieß ihn zu warten. Dann setzte er sich an einen der Schreibtische und begann mit dem Verfassen einer Antwort.
„Liebste Franziska, ich bin in hohem Maße über Deine Zeilen erstaunt. Was immer Dich dazu bewogen haben mag, mir unsere Freundschaft vor die Füße zu werfen, es war falsch. Unsere wunderbare Begegnung am gestrigen Tag hat in uns beiden etwas bewirkt, das man nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Das Schicksal war, ist und wird immer stärker sein als der Mensch, und er tut gut daran sich nicht gegen es zu stemmen. Ich möchte Dich inständig bitten, mit mir zu reden. Ich erwarte Dich noch heute Abend vis-á-vis vom Hotel im Restaurant <Adler>. Ich werde einen Tisch bestellen und dort ab 20:00 Uhr auf Dich warten.
Bitte, enttäusche mich nicht und nimm meine Einladung an. Ein NEIN akzeptiere ich nicht. Herzlichst Dein Jaques“
Jaques steckte den Brief in ein Kuvert, verschloss es und gab ihn dem wartenden Pagen mit einem Trinkgeld und den Worten:
„Den bringst du jetzt sofort zu Frau Heller, der Hausdame, und übergibst ihn ihr persönlich. Hast du das verstanden?“
Der Page Stefan nahm das Kuvert entgegen, und mit einem zackigen „Jawohl, Herr Konsul!“ und einer Verbeugung entfernte er sich raschen Schrittes.
Jaques ging zurück zum Concierge und bat denselben, eine Reservierung für zwei Personen im Restaurant <Adler> für den Abend vorzunehmen.
Dann verließ er das Hotel und nützte die Zeit bis zum Abend für diverse Erledigungen und Besorgungen. Eine davon führte ihn zum besten Juwelier in der Stadt.
*****
Als der Major pünktlich um 19:00 Uhr bei der Wohnung von Amélie anläutete, war er sich nicht sicher, ob ihn die Angebetete überhaupt empfangen würde.
Vielleicht war das Erlebnis der vergangenen Nacht nur dem übermäßigen Alkoholgenuss geschuldet, und seine Amélie wäre im nüchternen Zustand nicht mehr dieselbe.
Umso überraschter war Hermann, als sich die Tür öffnete und Amélie ihm in einem leuchtend roten Kleid empfing.
„Guten Abend, mein Held; ich freue mich sehr, dich zu sehen.“
Und bevor sich Hermann von Worten und Erscheinung erholen konnte, bekam er einen Kuss auf den Mund.
„Was ist, chérie; freust du dich denn gar nicht?“
„Doch, doch“, stammelte Hermann, der sein Glück noch nicht so recht fassen konnte. Was da gerade geschah, war weit mehr, als er erwartet hatte.
„Komm herein“, sagte Amélie, „ich habe uns einen kleinen Aperitif gemacht. Den trinken wir und dabei erzählst du mir, wo wir heute Abend hingehen werden.“
Hermann folgte der Aufforderung Amélies und betrat die Wohnung.
„Mach es dir bequem, chérie“, sagte Amélie und blitzte Hermann mit ihren dunklen Augen an. „Ich hole nur schnell den Aperitif“.
Hermann setzte sich. Er versuchte Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Träumte er oder war das alles Wirklichkeit, was da gerade mit ihm geschah.
„Sie liebt mich auch“, sagte Hermann zu sich, „ich bin der glücklichste Mann auf Erden.“
„Santé, chérie!“, sagte Amélie und stieß mit Hermann an. „Und jetzt erzählst du mir, was wir heute Abend machen werden.“
Hermann nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas und antwortete:
„Ich habe mir gedacht, wir gehen irgendwo hin fein essen.“
„Und wohin gehen wir?“, fragte Amélie lächelnd.
„Nun, ich weiß nicht so recht“, antwortete Hermann leicht verlegen, „ich hatte gehofft, du hättest vielleicht eine gute Idee.“
„Habe ich, chérie“, antwortete Amélie, „aber da müssen wir ein Stück aus der Stadt hinausfahren.“
„Ich habe aber kein Auto“, sagte Hermann.
„Das macht nichts“, antwortete Amélie, „ich habe ein Auto.“
„Du hast ein eigenes Auto?“, fragte Hermann erstaunt.
„Nicht wirklich, es gehört einem Freund“, antwortete Amélie, „es gehört Pierre, den du ja kennst.“
„Ausgerechnet Pierre“, dachte Hermann bei sich, und seine Mine verfinsterte sich ein wenig dabei.
„Du magst Pierre nicht, chérie“, sagte Amélie, „habe ich recht? Aber warum nicht?“
„Er ist mir zu laut, zu aufdringlich“, antwortete Hermann, „ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich so über ihn denke.“
„Tut es nicht“, antwortete Amélie, „aber du solltest das nicht so ernst nehmen; Pierre ist ein Künstler und ein wenig verrückt.“
„Du hast sicher recht, Amélie“, sagte Hermann und trank sein Glas aus. „Dann lass uns gehen.“
Als sie im Auto saßen und sich aus der Stadt hinausbewegten, fragte Hermann nach dem Ziel der Fahrt.
„Château Trois Bougies“, antwortete Amélie.
„Schloss Drei Kerzen“, sagte Hermann, „das klingt sehr romantisch.“
„Magst du das nicht?“, fragte Amélie.
„Sehr sogar; ich freue mich schon darauf“, antwortete Hermann.
„Dann ist es ja gut, chérie“,