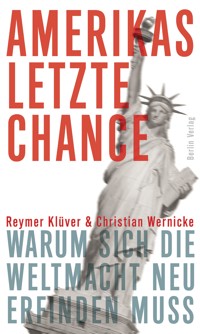
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach drei Jahren unter Barack Obama sind die Vereinigten Staaten zerrissener denn je. Neben der anhaltenden schweren Wirtschaftskrise kämpft das Land mit den Altlasten der Vergangenheit: Armut, Rassismus, Kriege ohne Ende. Obendrein stehen sich die politischen Lager so unversöhnlich gegenüber wie seit langem nicht. Fort ist der Wunderglaube, der den wortgewaltigen Demokraten Ende 2008 ins Weiße Haus katapultierte. Die letzte verbliebene Supermacht scheint die Hoffnung auf einen Aufbruch aus eigener Kraft verloren zu haben. Die SZ-Korrespondenten Reymer Klüver und Christian Wernicke erleben und schildern die politische wie soziale Krise Amerikas aus nächster Nähe. Sie ziehen eine schonungslose Bilanz der Präsidentschaft Obamas und benennen die herkulischen Aufgaben, vor denen er und eine Weltmacht im Niedergang stehen. Sie zeigen aber zugleich, warum Obama mit vielen seiner Reformvorhaben scheitern musste - und warum doch allein seine Wiederwahl Amerika eine letzte Chance zur eigenen Erneuerung als westlicher Führungsmacht eröffnen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Reymer Klüver & Christian Wernicke
AMERIKAS
LETZTE
CHANCE
Warum sich die Weltmacht
neu erfinden muss
BERLIN VERLAG
INHALT
Einleitung
Warum sich die Weltmacht neu erfinden muss
ÜBERBLICK
Rettet die United States!
Ein Luxusliner zeugte einst von Amerikas Größe, nun droht die Verschrottung – eine Parabel
DIE ALTLASTEN
Volkskrankheit Armut
Amerikas Überfluss nimmt zu. Aber immer weniger haben Anteil daran
Vom Eigenheim erschlagen
Wie die Immobilienkrise Millionen amerikanischer Familien ruiniert – und das Land gleich mit
Die Macht der alten Farbenlehre
Viel hat die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten verändert, im Alltag aber noch längst nicht genug
Die Zerrüttung der Mitte
Warum der Außendruck der Globalisierung und Brüche im Inneren die Gesellschaft zerreiße
Last der Kriege
Die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten der Militäreinsätze zehren das Land au
Die Bürde der Einmaligkeit
Die USA gründen auf der Idee eigener Größe – doch was die ausmacht, bleibt umstritten
DIE ZERFALLENDE ZUKUNFT
Mediale Schizophrenie
Wer wissen will, warum Amerika in Selbstblockade verfällt, muss sich nur vor den Fernseher setzen
In den Schluchten von Amerikas Balkan
Gleichgesinnte bleiben immer mehr nur unter sich – eine neue Segregation teilt das Wahlvolk
Im Modernisierungsstau
Erziehung, Infrastruktur, Klimaschutz – wie ein Land seinem eigenen Fortschritt im Wege steht
Weltmacht auf Abruf
Amerika muss seinen alten globalen Führungsanspruch einer neuen Wirklichkeit anpassen
AUSBLICK
Verfeindete Staaten von Amerika
Ein Lagerwahlkampf vertieft die Gräben. Die Aussöhnung beginnt 2013. Vielleicht
Dank
EINLEITUNG
Warum sich die Weltmacht neu erfinden muss
»Amerikas letzte Chance«? Das klingt anmaßend. Und es ist, in den Augen mancher unserer amerikanischen Freunde, mal wieder typisch für Europäer, die gern auf dieses Land jenseits des Ozeans herabschauen – gerade in diesen Jahren, da die Weltmacht erkennbar angeschlagen ist. »Letzte Chance« – als stünden die Vereinigten Staaten vor dem Untergang? Das wäre natürlich Unsinn. Noch immer ist New York eine der vibrierendsten Städte auf dem Erdball, im kalifornischen Silicon Valley sind nach wie vor die cleversten Computerfreaks der Welt zu Hause und in Harvard die schärfsten Denker. In Washingtons Think-Tanks sind brillante Kenner der internationalen Politik zu finden, und Hollywood produziert noch immer Filme, die die Welt bewegen. Amerika ist auf so vielen, so verschiedenen Gebieten nach wie vor führend – politisch, wirtschaftlich, militärisch, kulturell, technologisch –, dass der Titel dieses Buches reichlich kühn anmuten mag.
Und doch, auch in den Vereinigten Staaten sind immer mehr Stimmen zu vernehmen, die Amerika auf einer abschüssigen Bahn sehen, vor einer gewaltigen Wegscheide, an der sich herausstellt, ob die erste Demokratie der modernen Welt auch in diesem, nun nicht mehr ganz jungen Jahrhundert unbestrittene Führungsmacht bleibt. Oder ob Amerika, wie viele fürchten und manche hoffen, nach dem Ende des American Century in die Zweitrangigkeit absteigt oder gar, im schlimmsten Fall, sich selbst verliert. Das Land scheint nicht zu wissen, in welche Richtung es gehen will.
Thomas Friedman, der scharfzüngige linke Kolumnist der New York Times, und sein Koautor, der kluge Politikwissenschaftler Michael Mandelbaum, konstatieren kurz und knapp in ihrem jüngsten Buch That Used to Be Us (»Das waren einmal wir«): Wenn die Amerikaner die Herausforderungen, vor denen das Land steht, nicht meistern, dann riskieren sie »ein mieses 21. Jahrhundert«. Und Peggy Noonan, eine nachdenkliche konservative Kommentatorin, schreibt im Wall Street Journal: »Die Menschen fürchten zunehmend die Verwerfungen im Inneren, sie fürchten sogar, dass unser Land auseinanderbrechen könnte. Reich/arm, schwarz/weiß, jung/alt, rot/blau (also: republikanisch/demokratisch): Die Dinge, die uns trennen, sind nicht neu; und doch gibt es jetzt ein Gefühl, dass der Klebstoff, der uns für mehr als zwei Jahrhunderte zusammengehalten hat, sich abgenutzt hat und mit den Jahren rissig geworden ist.« Das Land hat seine alte, uramerikanische Zuversicht verloren, es bröckelt die Hoffnung auf einen Aufbruch aus eigener Kraft. New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg warnte vor der Gefahr sozialer Unruhen in den Straßen amerikanischer Städte, noch ehe die Occupy-Wall-Street-Bewegung in Erscheinung trat.
Wie anders war es fast vier Jahre zuvor. Eine neue Ära schien anzubrechen nach acht langen Jahren erbitterten politischen Streits unter Präsident George W. Bush. »Change has come to America!«, verkündete Barack Obama vor Hunderttausenden in Chicagos Grant Park in einer Novembernacht, die Geschichte machte: Gerade hatten ihn die Amerikaner an diesem 4. November 2008 zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt: der erste Schwarze im Weißen Haus. Die Nation glaubte tatsächlich, sich neu erfinden zu können. Das Land bebte vor Zuversicht.
Die Demokraten sahen in ihm einen großen Präsidenten, noch ehe Obama sein Amt überhaupt angetreten hatte. Sie verglichen ihn mit ihren politischen Ikonen des 20. Jahrhunderts, dem noch immer verehrten John F. Kennedy oder dem großen Reformer und Weltkriegspräsidenten Franklin D. Roosevelt. Die Wechselwähler, die sich in ihrer Mehrzahl für ihn entschieden hatten, erblickten in dem schlanken, hochgewachsenen Senator einen Mann, der das Land mit sich selbst versöhnen und endlich wieder Zivilität in den politischen Diskurs bringen würde. Sogar Republikaner entdeckten in ihm eine Persönlichkeit von historischem Rang. Auch sie hatte Obama (zumindest vorübergehend) mit Stolz auf ihr Land erfüllt: Allein durch die Wahl eines Afroamerikaners hatte die Nation bewiesen, dass sie zu innerer Reform in der Lage war. So schien es jedenfalls. Und Obama versprach allen Großes: die Modernisierung des Landes und die Versöhnung der zersplitterten Gesellschaft. Da keimte der Traum eines neuen amerikanischen Zeitalters in Frieden und Wohlstand.
Wahre Herkulesaufgaben erwarteten den jungen Präsidenten. Die gewaltigste Wirtschaftsmisere seit der Großen Depression: Bankenkrise, Autokrise, Immobilienkrise, Jobkrise. Zwei blutige Endloskriege. Angesichts dieser Erblast ist Obama Wichtiges gelungen: Er verhinderte den Wirtschaftskollaps, setzte eine seit Jahrzehnten verschleppte Gesundheitsreform durch und verschrieb der mächtigen Wall Street eine neue Finanzmarktordnung. Er holte die Truppen heim aus dem Irak und begann den Abzug aus Afghanistan, dezimierte al-Qaida und stellte Amerikas ramponiertes Ansehen in der Welt wieder her.
Und doch reicht das alles irgendwie nicht. Wirklich zufriedengestellt hat Barack Obama niemanden. Die Linken im Lande nicht, für die er nicht genug Reformeifer bewies. Die Rechten nicht, denen die ganze Richtung nicht passte. Und die in der Mitte (ver-)zweifeln, weil die politische Selbstblockade in Washington seit Obamas Wahl nicht wie versprochen ab-, sondern nur noch zugenommen hat. Obama ist nicht der Halbgott, zu dem ihn seine Anhänger unter seiner tatkräftigen Mitwirkung stilisiert hatten. Der Nation ist der Wunderglaube an ihren Präsidenten abhandengekommen. Im vierten Jahr der Präsidentschaft Obamas sind die Vereinigten Staaten innerlich zerrissener denn je.
Wir spüren diesen Verwerfungen nach und haben bei unseren Reisen und Recherchen als Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung ein gestresstes Land kennengelernt. Ein Land, das von Altlasten der Vergangenheit niedergezogen wird und dessen Zukunft in der Gegenwart zu zerfallen droht. Im Hafen von Philadelphia haben wir einen ausgeschlachteten, alten Ozeanriesen entdeckt, der einst Stolz der Nation war, nicht zuletzt weil er ihren Namen trug: United States. Eine Gruppe engagierter Bürger versucht das rostige Staatsschiff zu retten, doch die Aufgabe droht sie zu überwältigen. Es ist eine Parabel auf den Zustand dieses Landes – und den fast verzweifelten Wunsch, einen Ausweg aus der Misere zu finden.
In Nahaufnahmenschildern wir Amerika so zwiespältig, wie es heute ist, und berichten von Menschen, denen wir auf Reportagereisen quer durchs ganze Land begegnet sind. Wir durchwachen die Nacht vor einer Schulturnhalle in den Appalachen mit Menschen, die für einen Besuch in einer mobilen Gesundheitsklinik anstehen, weil sie so arm sind, dass sie sich einen Doktor nicht leisten können. Wir besuchen eine Familie, die ihr Haus in einem der vielen konturlosen Vororte der Hauptstadt Washington verliert, weil sie die Hypothekenraten nicht mehr zahlen kann – so wie es Millionen Amerikanern inzwischen ergangen ist. Wir reisen den Ol’ Man River hinab, den Mississippi, und erleben, wie drückend das Erbe des Rassismus auch in der Ära Obama noch ist. Sind unterwegs im Rostgürtel von Ohio, wo die Männer von einem anderen Land träumen, in dem es noch Jobs und eine Zukunft für sie gab – ehe die Globalisierung über die USA kam. Hoch oben im Norden, am Flughafen von Bangor in Maine, treffen wir eine Rentnertruppe, die als »Troop Greeters« und gute Patrioten Amerikas Soldaten bei der letzten Zwischenlandung vor dem Krieg alles Glück dieser Welt wünschen, obwohl sie selbst längst nicht mehr an den Sinn der Waffengänge glauben. Und wir erzählen von einem jungen Kriegsheimkehrer aus dem Irak, der, zurückgezogen in einem Kleinstädtchen an der kanadischen Grenze, nun aus Uniformen Papier macht und doch die Last der Kriege nicht loswird – so wie das ganze Land.
Wir beobachten, wie wenig sich Amerika für die Zukunft fit macht, wie es heute auf Kosten von morgen spart. Wie die Straßen und Brücken bröckeln, die Schulen verkommen und das Land die Energiewende verpasst, die es noch vor vier Jahren anzugehen schien. Wie wenig die Menschen, befördert durch polarisierende Medien, noch bereit sind, Andersdenkenden zuzuhören. Wir haben Tea-Party-Freunde im Vorortidyll von Nashville aufgesucht und linke Aktivisten in San Francisco interviewt und festgestellt, dass sich das Land immer mehr nach der Gesinnung organisiert: Konservative und Linke bleiben jeweils unter sich. Überall entdecken wir dasselbe Phänomen – eine tiefe Spaltung des Landes. Amerika driftet auseinander: wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, politisch. Und nichts scheint diese Polarisierung aufhalten zu können – auch nicht jener Präsident, von dem sich so viele eine innere Versöhnung erhofft hatten.
Dies ist kein Insiderbuch aus Washington, recherchiert auf den Korridoren des Kongresses oder in den Hinterzimmern von Ministerien. Es ist ein Buch über Obamas Land – nicht über Obama und seine Gegenspieler. Wir wollen Anschauung liefern aus einem zerfasernden Land. Es sind Beobachtungen aus mehr als einem halben Jahrzehnt, in dem wir als Korrespondenten in den USA unterwegs waren. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit – wie auch, in diesem so riesigen, so vielfältigen Land? Wohl aber glauben wir, dass wir ein neues amerikanisches Lebensgefühl eingefangen haben: das Gefühl kollektiver Verunsicherung und Bedrückung.
Amerika hat sich gewaltig verändert, seitdem wir es jeweils das erste Mal besuchten. Wir waren Studenten, fasziniert, begeistert, bereit zu bewundern. Und wir hatten Grund dazu. 1984 hatte Reymer Klüver die gewaltigen Dimensionen des Kontinents erlebt. Wie in einem Roadmovie zog Amerika an ihm vorbei, als er mit dem Auto ein Vierteljahr unterwegs war von den Wolkenkratzern in New York bis zu den palmenbestandenen Hügeln von Hollywood. Und es brannte sich bei ihm die Einsicht ein, dass sich die ungeheure Weite des Landes in den Köpfen der Menschen widerspiegelte, in einem Sinn für Großzügigkeit und einem schier grenzenlosen Optimismus: Irgendwie, so schien jeder sagen zu wollen, geht es immer voran. Das entsprach damals, um es gelinde auszudrücken, nicht dem Lebensgefühl der Deutschen. Zwei Jahre später besuchte Christian Wernicke sieben Monate lang als Austauschstudent Penn State, die Universität »in der Mitte von Nirgendwo«, und die Hauptstadt Washington. Es war die Hoch-Zeit Ronald Reagans, des Heros der Konservativen, der in Deutschland so verteufelt wurde. In Pennsylvania lernte er einen selbstverständlichen Patriotismus kennen, der völlig unabhängig davon war, wer im Weißen Haus regierte. Es war ein Gefühl für Zusammenhalt jenseits der Parteien. Auch diesen Patriotismus gab es in der Bundesrepublik nicht: Demokraten wie Republikaner teilten den Stolz auf eine Nation, deren Bürger keine gemeinsame Herkunft einte, sondern das kollektive Versprechen, die Freiheit des anderen zu wahren.
Dieses Amerika, das wir damals kennenlernten, existiert so nicht mehr. Zusammenhalt und Zuversicht sind nicht die herausragenden Merkmale, mit denen sich die US-Gesellschaft im Wahljahr 2012 beschreiben lässt.
Die Ursachen für Amerikas Krise sind vielfältig. Natürlich ist die Rezession ein entscheidender Faktor, obwohl die US-Wirtschaft – gerade im Vergleich zum ebenfalls kriselnden Europa – noch immer ein deutliches Wachstum verzeichnet. Tief wurzelnde Spannungen wie der Rassenkonflikt zwischen Schwarz und Weiß belasten weiterhin die Gesellschaft; und Auseinandersetzungen um neue Minderheiten – die Hispanics, die Asiaten, die Muslime – machen das Zusammenleben nicht einfacher. Aber es hat enorme Fortschritte gegeben, das zeigt sich im gewöhnlichen Alltag ebenso wie in dem so außergewöhnlichen Aufstieg Obamas ins Weiße Haus. Auch sind die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 und des darauffolgenden Jahrzehnts des Kriegs gegen den Terror längst nicht ausgestanden. All diese Faktoren tragen ganz offenkundig zu der kollektiven Depression in Amerika bei.
Die eigentlichen Triebkräfte, die das Land zerreißen, liegen jedoch tiefer. Eine wirtschaftliche Polarisierung treibt die Schere zwischen Arm und Reich seit drei Jahrzehnten so weit auseinander, dass ein gesellschaftlicher Ausgleich kaum mehr möglich zu sein scheint. Die Reichen in Amerika sind so reich wie noch nie, die Armen so viele wie lange nicht mehr. Und die Subkulturen der Gesellschaft entfernen sich – gedanklich wie sogar räumlich – immer weiter voneinander. Das linke wie das rechte Lager mutieren zu politischen Stämmen, die unter sich bleiben und einander weder mehr kennen noch kennen wollen. Diese zentrifugalen Kräfte überfordern ein politisches System, das wie kaum ein zweites auf Konsens angelegt ist. Washington versagt.
Die Weltbank misst bei gleich einer Reihe ihrer Indikatoren einen steten Verfall amerikanischer Regierungsqualität; im internationalen Vergleich stufen Manager die politische Stabilität der Vereinigten Staaten mittlerweile auf ähnlich miserablem Niveau ein wie die Italiens. Die Parteien lösen keine Probleme mehr, sie verschärfen sie. Politiker, deren Beruf die Suche nach Kompromissen ist, geben sich dem Kulturkampf hin. Die Kluft zwischen dem Ernst der Lage der Nation und der schieren Einfältigkeit der politischen Rituale und Reflexe in der Hauptstadt wird – da Wahlen nahen – mit jedem Tag größer. »American Idiocracy« titelte der Economist – Herrschaft der Irren.
Das war im August 2011, kurz nachdem die Selbstblockade der Washingtoner Politik im epischen Ringen um die Erhöhung der US-Verschuldungsgrenze das Land an den Rand der Staatspleite getrieben hatte. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hatte deswegen die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten herabgestuft. S & P formulierte damals nur, was allgemeine Erkenntnis war: »Effektivität, Stabilität und Berechenbarkeit der amerikanischen Politik und ihrer Institutionen haben nachgelassen.« Wobei das noch milde ausgedrückt ist: Die politischen Parteien Amerikas haben in ihrem Glaubenskrieg darüber, welche Rolle der Staat in der amerikanischen Gesellschaft spielen soll und darf, die Fähigkeit zum pragmatischen Kompromiss verloren. Der Streit selbst ist so alt wie die Republik. Doch nie zuvor wurde er so verbissen ausgetragen. Ideologie triumphiert über Common Sense. Die Amerikaner selbst sind angewidert von dem Schauspiel, welches ihnen ihre Politiker in Washington bieten. Das Ansehen des Kongresses ist auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Und doch spiegelt die Kompromisslosigkeit in Washington nur die Spaltung des Landes wider: Aus den Vereinigten Staaten sind mittlerweile die Verfeindeten Staaten von Amerika geworden, gespalten nicht entlang geografischer, sondern entlang ideologischer Grenzen. Und ein Ende der Selbstlähmung ist nicht in Sicht.
Mehr als ein Jahrzehnt währt sie jetzt bereits. Sie ist mittlerweile Gegenstand zahlloser Diskussionsforen und vieler gescheiter Bücher in den USA geworden, die schonungs-, ja erbarmungslos die Misere analysieren. Dennoch sind die meisten der klugen Köpfe Amerikas, die sich Gedanken über den Zustand der Nation machen, davon überzeugt, dass ihr Land die Misere überwinden wird. Thomas Friedman und Michael Mandelbaum zum Beispiel, der Kolumnist und der Professor, führen zwar ausführlich die Defizite auf, schreiben dann aber trotz alledem: »Wir sind Optimisten, weil die Amerikaner ziemlich viel Erfahrung darin haben, große, schwere Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Und wir sind Optimisten, weil die Erfolgsbilanz unserer nationalen Leistungen uns mit gutem Grund annehmen lässt, dass wir unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden können.« Charles Kupchan, ein Washingtoner Professor und ausgewiesener Kenner der internationalen Politik, der gnadenlos den langsamen Abschied Amerikas von seiner Rolle als Weltmacht Nr. 1 analysiert, ist sich gleichwohl sicher, dass sein Land die gegenwärtige Krise meistern wird. »Die USA sind ein anpassungs- und widerstandsfähiges Land, ausgestattet mit der Gabe zur Selbstkorrektur. Uns wird es gut gehen« – auch wenn Amerika nicht mehr die globale Führungsmacht bleiben werde. Vielleicht muss man Amerikaner sein, um diese Zuversicht zu teilen. Wir sind es nicht – aber falls diese unverbesserlichen Optimisten recht behalten, umso besser.
»Amerikas letzte Chance« ist ein Buchtitel, wie ihn kaum ein Amerikaner wählen würde. Zu tief wurzelt der Glaube an die eigene Besserungsfähigkeit, die Zuversicht, wie wir sie als Studenten in diesem Land bewundernd kennenlernten. Der Gedanke, dass sich Amerika von der Krise, die das Land unstreitig durchlebt, nicht wieder voll und ganz erholen könnte, liegt den meisten Amerikanern selbst im Zustand kollektiver Depression fern. Aber nicht allen. Auch in den USA gibt es ernstzunehmende Mahnungen, das uramerikanische Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Landes könnte am Ende nicht genug sein und nur den Blick auf die unschöne Realität verstellen. »Die Genialität unseres Systems besteht nicht darin, Fehler zu vermeiden, sondern darin, dass wir aus ihnen lernen und wieder erstarken«, sagt der Washingtoner Politikwissenschaftler Kenneth Lieberthal. Die eigentliche Frage sei nun aber, so fügt er nachdenklich hinzu: »Verlieren wir unsere Fähigkeit zum Comeback?« Peter Thiel, der Erfinder von PayPal und ein konservativer Freidenker, warnt vor einem geradezu »verzweifelten Optimismus«, der allein Amerika nicht retten werde. Und Peter Beinart, ein demokratischer Intellektueller, beschwört seine Partei, endgültig alle kühnen Träume vom Anbruch einer neuen progressiven Epoche, in denen sie zu Beginn von Obamas Präsidentschaft geschwelgt hatte, fahren zu lassen. »Präsident Obama wird daran gemessen werden, wie er die Politik des Niedergangs managt.« Abstieg. Niedergang. Depression. Das sind die Kennwörter der Ära Obama.
Tatsächlich hat sich ausgerechnet während der Präsidentschaft dieses einstigen Hoffnungsmannes der Eindruck verstärkt, dass es nur einen Weg gibt: bergab. Die pragmatischen Kompromisse, die das Land bisher immer wieder in die Lage versetzten, auf Herausforderungen von innen und außen zu reagieren, scheinen heute unmöglich zu sein. Die Bedrohung durch den Sowjetkommunismus Ende der fünfziger Jahre etwa sorgte für einen beispiellosen Innovationsschub und katapultierte die Vereinigten Staaten in die Zukunft. Und zur selben Zeit zwang die Bürgerrechtsbewegung die Nation, sich ihrer demokratischen wie moralischen Defizite bewusst zu werden und endlich das amerikanische Versprechen vom Anrecht auf Freiheit und Streben nach persönlichem Glück für jeden US-Bürger gelten zu lassen. Die gegenwärtige Krise hat bisher keinen solchen Aufbruch ausgelöst, sondern nur Lähmungserscheinungen hervorgebracht.
Schon jetzt ist das Ansehen der Vereinigten Staaten als globales Leitbild arg angeschlagen. Die anhaltende Unfähigkeit der Politik, auf die wirtschaftliche und soziale Krise angemessen zu reagieren, stellt die Leistungsfähigkeit des demokratischen Modells überhaupt in Frage. In den USA wie in Europa, wo über Jahrzehnte versäumte Reformen des Sozialstaats nun – per Verschuldungskrise – den Euro und die kontinentale Integration an sich zu sprengen drohen, regiert Politikversagen. »Der Westen« ruiniert seinen Leumund, zur hämischen Freude der Autokraten in Teheran oder Caracas, in Peking oder Moskau. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama warnt, die Welt bewundere China längst nicht mehr nur ob seiner ökonomischen Erfolge, sondern auch »weil es große, komplexe Entscheidungen schnell fällen kann – verglichen mit der quälenden politischen Lähmung, die die Vereinigten Staaten wie Europa in den vergangenen Jahren befallen hat.«
Die Zeit drängt also. In Amerika fällt 2012 die Entscheidung, ob das Land den vorsichtigen Reformkurs, den Obama eingeschlagen hat, fortsetzt und der Modernisierung eine Chance gibt. Oder aber ob die Wähler das Steuer noch einmal herumreißen und nach dem vierjährigen Zwischenspiel eines demokratischen Präsidenten erneut den Rückzug des Staates verlangen, wie ihn die Republikaner seit Ronald Reagans Zeiten propagieren. Das würde der weiteren Zerfaserung der Gesellschaft freien Lauf lassen.
Amerika hat 2012 eine Chance, wieder zu sich zu finden. Es könnte für lange Zeit die letzte sein.
ÜBERBLICK
RETTET DIE UNITED STATES!
Ein Luxusliner zeugte einst von Amerikas Größe, nun droht die Verschrottung – eine Parabel
Susan Gibbs hat die United States gerettet. Einfach so, an einem trüben Wintermorgen 2011, und ausgerechnet in Philadelphia: dort also, wo die Vereinigten Staaten 235 Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit vom verhassten Kolonialregime der damaligen Weltmacht Großbritannien verkündet hatten.
Es ist kein sonderlich feierlicher Moment, da die zierliche Frau mit den feinen, braunen Haaren die Bestätigung für ihre Heldentat erhält. Ein eisig kalter Wind weht, und unter ihren Schuhen knirschen die Glassplitter eines zerborstenen Fensters, als Susan Gibbs das Handy aus der Tasche ihres Wintermantels fingert und die ersehnte E-Mail ihres Rechtsanwalts entdeckt. Da steht es, schwarz auf weiß: gekauft für drei Millionen Dollar, in voller Länge, in ganzer Breite. Die United States – vor dem Untergang bewahrt.
Susan Gibbs kommt es noch »irgendwie unwirklich« vor: »Mir ist, als stünde ich neben mir selbst.« Alles um sie herum soll nun plötzlich ihr gehören: das staubige Promenadendeck, die rostigen Stahlwände, von denen die Farbe in Flatschen herabhängt, das Kino ohne Klappstühle, der leere Tanzsaal und all die endlosen Kabinengänge, in denen schon vor Jahren jedes Licht erlosch. Sogar das Skelett jener Taube, die sich vor langer Zeit als letzter Passagier drüben in den Katakomben des Hauptdecks verirrte, ist im Preis inbegriffen.
Instinktiv zieht Gibbs den Kopf zwischen die Schultern, wenn sie von der jähen Verantwortung spricht. So als wolle sie sich wegducken. Dann wiederum lacht sie. Es laste ja »dem Himmel und Barack Obama sei Dank!« nicht das Schicksal des ganzen Landes auf ihr. Nur dieses Schiff ist es. Nun gut, kein ganz kleines: ein 300 Meter langer Leib aus doppelwandigem Stahl, an dessen Bug seit sechzig Jahren der Name der Nation prangt die .
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























