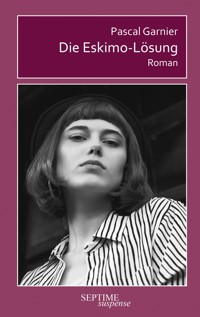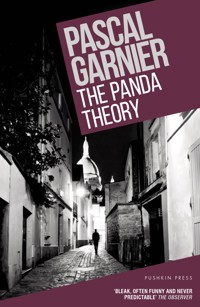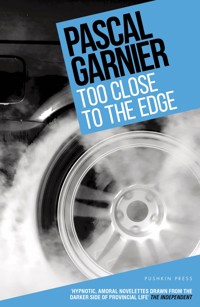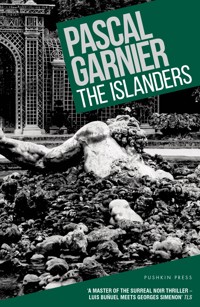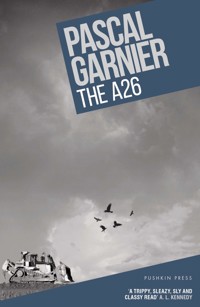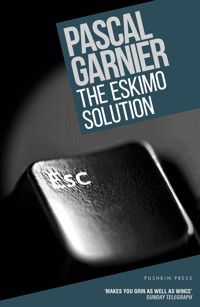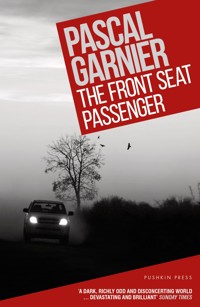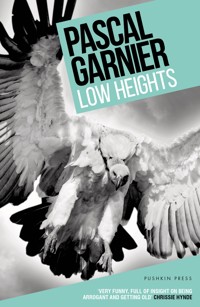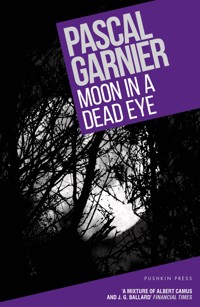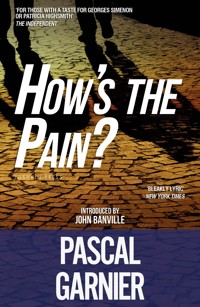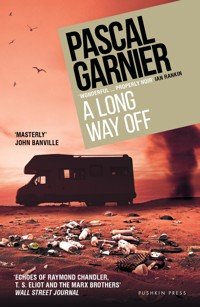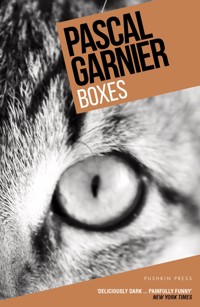13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Yolande hat seit fünfzig Jahren das Haus nicht mehr verlassen – seitdem man ihr den Kopf kahlgeschoren hat, weil sie sich während des Zweiten Weltkriegs mit deutschen Soldaten eingelassen hatte. Was draußen passiert, beobachtet sie durch ein Loch im Fensterladen. Ihr Bruder Bernard, ein ehemaliger Eisenbahner, opfert sich für sie auf, während er selbst gegen den unausweichlichen Krebstod kämpft. Gemeinsam und jeder für sich klammern sie sich verzweifelt an den Rest Leben, der ihnen noch geblieben ist. In der Nähe entsteht die neue Autobahn A26. Gelegen inmitten endloser brauner Felder, wird die Baustelle mit ihren Betongruben zum Grab für leichtsinnige oder vom Pech verfolgte Frauen. Vor dem Hintergrund der trostlosen Landschaft des nordfranzösischen Pas-de-Calais mit ihrem niedrigen Himmel entspinnen sich Dramen des Alltags, die die Figuren auf ihre Vergangenheit zurückwerfen und deren Fatalität sie nicht entkommen. »Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie. Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.« A. L. KENNEDY
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Aus dem Französischen von Felix Mayer
Originaltitel: L’A26 © Éditions Zulma, 1999
© 2024, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Christie Jagenteufel
Cover: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © i-stock
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-99120-042-0
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag
ISBN: 978-3-99120-036-9
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Pascal Garnier
1949–2010) war Romancier, Verfasser von Kurzgeschichten, Kinderbuchautor und Maler. In den Bergen der Ardèche, wo er zu Hause war, schrieb er seine in noir-gefärbten Bücher, zu deren Protagonisten er sich durch die einfachen Menschen der Provinz inspirieren ließ. Obwohl seine Prosa zumeist sehr dunkel im Tonfall ist, glitzert sie aufgrund seines trockenen Humors und der schrullig schönen Bilder. Immer wieder mit Georges Sime- non verglichen, ist Pascal Garnier der König des französi- schen Roman noir.
Felix Mayer, geb. 1970, studierte in München, Paris und Pisa Komparatistik und Philosophie sowie in Düsseldorf Literaturübersetzen. Er übersetzt Belletristik und Sachbü- cher aus dem Französischen, Englischen, Italienischen und Slowenischen.
Klappentext:
Yolande hat seit fünfzig Jahren das Haus nicht mehr verlassen – seitdem man ihr den Kopf kahlgeschoren hat, weil sie sich während des Zweiten Weltkriegs mit deutschen Soldaten eingelassen hatte. Was draußen passiert, beobachtet sie durch ein Loch im Fensterladen. Ihr Bruder Bernard, ein ehemaliger Eisenbahner, opfert sich für sie auf, während er selbst gegen den unausweichlichen Krebstod kämpft. Gemeinsam und jeder für sich klammern sie sich verzweifelt an den Rest Leben, der ihnen noch geblieben ist.
In der Nähe entsteht die neue Autobahn A26. Gelegen inmitten endloser brauner Felder, wird die Baustelle mit ihren Betongruben zum Grab für leichtsinnige oder vom Pech verfolgte Frauen. Vor dem Hintergrund der trostlosen Landschaft des nordfranzösischen Pas-de-Calais mit ihrem niedrigen Himmel entspinnen sich Dramen des Alltags, die die Figuren auf ihre Vergangenheit zurückwerfen und deren Fatalität sie nicht entkommen.
Frau aus der Oberschicht, zum ersten Mal begegnet, werden die beiden zueinander
Pascal Garnier
An der A26
Roman | Septime Verlag
Aus dem Französischen von Felix Mayer
Für Isa und Chantal
Die drittletzte Laterne am Ende der Straße geht plötzlich aus. Yolande schließt das Auge, das sie gegen den Fensterladen drückt. Der Nachhall des weißen Lichts pulsiert noch ein paar Sekunden lang auf ihrer Netzhaut. Als sie das Auge wieder öffnet, ist am Himmel über der erloschenen Laterne nur noch ein schwarzes Loch zu sehen.
»Ich hab sie zu lange angestarrt, jetzt ist die Birne durchgebrannt.«
Yolande wendet sich vom Fenster ab. Sie zittert leicht. Sie hat nicht durch einen Spalt in den Fensterläden auf die Straße geblickt, sondern durch ein eigens dafür gebohrtes Loch, eine Art Schießscharte. Es ist im ganzen Haus die einzige Öffnung nach außen. Yolande nennt es, je nach Stimmung, den »Bauchnabel« oder das »Loch im Arsch der Welt«.
Yolande könnte jedes Alter zwischen zwanzig und siebzig haben. Sie hat die Körnung und die unscharfen Konturen einer alten Fotografie. Eine dünne Staubschicht scheint sie zu bedecken. In dieser Karkasse einer alten Frau steckt ein junges Mädchen. Manchmal ist dieses Mädchen zu erahnen, in der Art, wie sie sich setzt und dabei den Rocksaum über die Knie zieht, wie sie sich mit der Hand durch das Haar streicht, eine anmutige Geste, die man von diesem Handschuh aus faltiger Haut nicht erwarten würde.
Sie hat sich an einen Tisch gesetzt, vor einen leeren Teller. Ihr gegenüber steht ein weiteres Gedeck. Die Deckenlampe hängt tief herab und ihr Licht ist zu schwach, um den Rest des Esszimmers zu erhellen, der im Dunkeln bleibt. Dennoch ist zu spüren, dass der Raum mit einer Menge Dinge und Möbel vollgestopft ist. Die gesamte Luft des Raumes scheint über dem Tisch zusammengedrückt, in dem Lichtkegel, der aus dem Lampenschirm fällt. Yolande sitzt steif da und wartet.
›Heute Morgen hab ich den Schulbus gesehen. Die Kinder hatten Kleidung in allen möglichen Farben an. Als sie aus dem Bus gestiegen sind, sah das aus, als würde man eine Bonbonschachtel ausschütten. Nein, das war nicht heute Morgen, das war gestern, oder vielleicht auch vorgestern … Die sahen wirklich aus wie Bonbons. Genau in dem Moment hat sich der Himmel kurz aufgehellt, ein blauer Streifen zwischen den Wolken. Früher hat man die Kinder nicht so angezogen. Diese ganzen grellen Farben, das gab es damals nicht, niemand hatte das. Was hab ich sonst noch gesehen? … Autos? … Nur ein paar. Ach ja, doch! Der Metzger war heute Morgen da. Das war heute, ganz sicher, er kommt immer sonntagmorgens. Ich hab gesehen, wie er seinen Wagen abgestellt hat, dieser Blödmann. Er will immer kucken. Das geht schon seit Jahren so. Aber er kriegt nie was zu sehen, und das weiß er auch. Er hat Rindfleisch gebracht, sehnig und faserig, dazu einen Markknochen, den man in den Eintopf geben kann. Der ist jetzt fertig, hat den ganzen Tag geköchelt, Blubb! Blubb! Blubb! … Der Deckel des Schmortopfs hat getänzelt und einen grauen Schaum ausgespuckt, dazu einen starken Geruch, so intensiv, wie wenn man schwitzt … Was hab ich sonst noch gesehen? …‹
Yolande ist nicht zusammengezuckt, als es an der Tür dreimal schnell und leise geklopft hat und ein Schlüssel im Schloss zu hören war. Ihr Bruder klopft immer dreimal, um sich anzukündigen, bevor er hereinkommt. Das ist überflüssig, weil außer ihm nie irgendjemand kommt. Aber er macht es trotzdem.
Yolande sitzt noch immer vor ihrem leeren Teller. Es ist kalt im Raum, der Herd ist aus. Bernard hängt seinen feuchten Mantel auf. Darunter trägt er eine Eisenbahneruniform. Er ist etwa fünfzig Jahre alt. Er hat das Gesicht eines Mannes, den man auf der Straße nach der Uhrzeit fragen oder um einen Franc oder eine Auskunft bitten würde. Er geht hinter seiner Schwester vorbei, küsst sie auf den Nacken, sagt »Guten Abend« und setzt sich ihr gegenüber. Er verschränkt die Finger, lässt die Gelenke knacken und faltet seine Serviette auseinander. Seine Gesichtshaut ist gelblich, unter den Augen hat er blaurote Tränensäcke. In den seitlich am Kopf anliegenden Haaren zeichnet sich eine kreisrunde Aureole ab, die seine Schiebermütze dort hineingedrückt hat.
»Hast du noch nicht gegessen? Du hättest schon anfangen sollen, es ist schon spät.«
»Nein, ich habe auf dich gewartet. Ich habe überlegt, wann der Schulbus zum letzten Mal vorbeigekommen ist.«
»Wahrscheinlich am Samstag.«
»Du bist ganz dreckig. Regnet es?«
»Ja.«
»Aha.«
Sie sitzen beide gleich reglos da, steif auf ihren Stühlen. Sie blicken sich an, ohne sich zu sehen, stellen Fragen, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten.
»Auf dem Rückweg vom Bahnhof habe ich mir einen Platten geholt, in der Nähe der Baustelle. Die graben da alles um. Da sieht’s aus, als hätte die Erde Matsch ausgekotzt. Überall Maschinen, Bagger, Dampfwalzen, das ganze Zeug. Sie kommen schnell voran, aber dabei geht auch viel kaputt.«
»Hast du noch Fieber?«
»Manchmal. Aber nie lange. Ich nehme die Tabletten, die der Arzt mir gegeben hat. Ich bin ein bisschen kraftlos, aber das ist alles.«
»Möchtest du einen Teller Eintopf?«
»Ja, gerne.«
Yolande nimmt den Teller, den er ihr hinhält, und verschwindet im Dunkel. Das Geräusch des Schöpflöffels, der gegen den Schmortopf schlägt, klingt wie ein Gong, begleitet vom Tröpfeln der Brühe. Yolande kommt zurück und hält Bernard den Teller hin. Er ergreift ihn, Yolande hält ihn fest.
»Hast du Angst gehabt?«
Bernard wendet den Blick ab und zieht sanft am Teller.
»Ja, aber nur kurz. Gib her, es geht mir schon besser.«
Yolande verschwindet wieder, um ihren eigenen Teller zu füllen. Aus dem Dunkel heraus sagt sie, ohne zu wissen, ob es eine Frage oder eine Feststellung ist:
»Du wirst in Zukunft immer mehr Angst haben.«
Bernard fängt an, mechanisch zu essen.
»Keine Ahnung, vielleicht. Machon hat mir neue Medikamente gegeben.«
Yolande isst auf dieselbe Weise wie er, so wie man einen Kahn ausschöpft.
»Heute Morgen hab ich den Metzger gesehen. Er hat wieder versucht zu kucken.«
Bernard zuckt mit den Schultern.
»Er kann doch nichts sehen.«
»Nein, er kann nichts sehen.«
Dann schweigen sie und essen ihren lauwarmen Eintopf auf.
Die Lichtstrahlen, die von der Straße durch die geschlossenen Fensterläden fallen, erhellen hier und da Ausschnitte aus dem Chaos, in dem das Esszimmer versinkt. Ein Netz aus schmalen Gräben, das die bunt zusammengewürfelte Anhäufung aus Möbeln, Büchern, Kleidungsstücken und allen möglichen anderen Sachen durchzieht, ermöglicht es, von Zimmer zu Zimmer zu gelangen, vorausgesetzt, man verleiht seinem Körper ein ägyptisches Profil. Gestützt wird diese Müllkippe, die jeden Augenblick in sich zusammenzustürzen droht, mehr schlecht als recht von Stapeln aus Zeitungen und Magazinen.
Yolande hat das gebrauchte Geschirr, die Servietten und die Gläser vom Vorabend in eine Ecke des Tisches geschoben. Jetzt schneidet sie Fotos aus einer Zeitschrift aus und klebt sie anschließend, wie Teile eines Puzzles, auf Pappkarton. Aus der Deckenlampe sickert noch immer dasselbe stumpfe Licht, tagein, tagaus.
›Bernard war heute nicht in der Arbeit, er war zu schwach. Er ist zunehmend erschöpfter und wird immer dünner. Sein Körper ist wie das Haus, ausgehöhlt und von Gängen durchzogen. Wo tue ich ihn hin, wenn er tot ist? Hier ist nirgendwo mehr Platz … Wir werden es schon hinkriegen, wir haben es noch immer hingekriegt, das haben wir im Lauf der Zeit gelernt. Nichts hat dieses Haus je verlassen, selbst das Klo ist jetzt verstopft. Wir behalten alles. Eines Tages werden wir nichts mehr brauchen, weil alles da ist, für immer.‹
Yolande summt leise vor sich hin, begleitet vom Nagen der Mäuse und dem schweren Atmen Bernards im Nebenzimmer.
Er schläft oder stellt sich schlafend. Seine Fingerspitzen spielen mit einer hell schimmernden Plakette, die an einer goldenen Kette hängt. Mehr als gestern und viel weniger als morgen. Er wird nicht mehr zum Arzt gehen. Noch bevor er die Praxis betreten hatte, hatte er gewusst, dass das sein letzter Besuch sein würde und dass er ihn fast nur noch aus Höflichkeit machte. Wie immer hatte Machon diese joviale Art zur Schau gestellt, die Bernard so auf die Nerven geht. Aber gestern Abend hatte er sich noch mehr verstellt als sonst, er verhaspelte sich und sah sich vergebens nach dem Souffleurkasten um. Kurz, er hatte Bernard abgefertigt, während sein Blick verneinte, was seine Lippen bekräftigten.
»Das ist eine Frage der Moral, Monsieur Bonnet, und des Willens. Sie müssen kämpfen, kämpfen! Aber Sie werden sehen, in zwei oder drei Tagen wird es Ihnen schon deutlich besser gehen. Und nicht vergessen: drei morgens, drei mittags, drei abends.«
Zwar hatte Bernard sich erleichtert gefühlt, als er hinausging, aber das lag nicht an den Medikamenten. Die regelmäßigen Besuche beim Arzt, die nun schon seit Monaten andauerten, zehrten genauso an ihm wie seine Krankheit, diese nicht enden wollende Qual. Er war in seinem Leben nie krank gewesen und hatte es als schwere Demütigung empfunden, sich Doktor Machon, den er doch gut kannte, mit Leib und Seele auszuliefern. Seit Jahren fuhr Machon jeden Mittwoch mit dem Zug nach Lille, um seine Mutter zu besuchen. Eines Tages hatten sie angefangen, sich zu grüßen und ein paar Worte zu wechseln, und irgendwann war zwischen ihnen zwar keine Freundschaft, aber ein angenehmes Verhältnis entstanden. Als seine Beschwerden begonnen hatten, hatte Bernard sich ganz selbstverständlich an Machon gewandt. Er war sein Patient geworden, was er schon bald bereut hatte. Wenn er vor dem großen Schreibtisch im Empire-Stil saß, kam er sich immer wie ein Verdächtiger vor, der sich für ein Verhör hat ausziehen müssen, ein des Lebens Schuldiger. Wenn er Machon heute am Bahnhof traf, fühlte er sich nackt und hilflos.
Bernard hatte das Rezept zusammengeknüllt und war in sein Auto gestiegen. Diesmal hatte er sich in der Nähe der Baustelle keinen Platten geholt.
Wie die Schnurrhaare einer Katze spritzten Garben aus Wasser zu beiden Seiten unter den Reifen des R5 hervor. Bernard entdeckte das Leben in seinen winzigsten Erscheinungsformen. Es füllte jeden Tropfen, der die Windschutzscheibe sprenkelte, mit gelbem Licht, Milliarden kleiner Glühbirnen, die die lange Nacht erhellten. Es war auch im Vibrieren des Lenkrads in seinen Händen zu spüren, und im Ballett der Scheibenwischer, das ihn an die Schlussszene eines Musicals denken ließ. Auf die Angst, die die Ungewissheit mit sich brachte, folgte das seltsame Nirwana der Gewissheit. Es war also nur noch eine Frage von Wochen, von Tagen … Er wusste natürlich schon lange, dass er sterben würde, aber an diesem Abend spürte er, dass er eine Grenze überschritten hatte. Im Grunde war es in den letzten Monaten die Hoffnung gewesen, die ihm die meisten Schmerzen bereitet hatte. ›Bernard Bonnet, Ihr Ansuchen um Gnade wurde abgewiesen.‹ Er fühlte sich frei, hatte nichts mehr zu verlieren.
Und dann hatte er im Licht der Scheinwerfer diese rothaarige junge Frau gesehen, die den Daumen rausgehalten hatte, verstrickt in ein Netz aus Nacht und Regen.
»Was für ein Wetter!«
Er hatte gedacht: ›Drei Monate, höchstens.‹ Sie roch nach nassem Hund. Sie war noch keine zwanzig.
»Ich hab den Bus nach Brissy verpasst. Fahren Sie in die Richtung?«
»Ich fahre dran vorbei, ich kann Sie dort absetzen.«
Sie hatte eine dicke Nase, dicke Brüste und dicke Schenkel und roch nach offenem Fenster, nach der Jugend, die sich unerschrocken ins Leben stürzt. Vermutlich hatte Bernards Uniform sie beruhigt, denn sie machte es sich bequem, öffnete ihren Parka und schüttelte ihre moosigen roten Haare.
»Der nächste fährt erst in einer halben Stunde. Ich warte nicht gern. In einem Monat werd ich achtzehn, dann mach ich meinen Führerschein. Ich spar schon darauf, auch auf ein Auto. Mein Schwager verkauft mir seins, einen R5, wie Ihrer.«
»Sehr gut.«
»Ich kenn Sie doch irgendwoher … Arbeiten Sie am Bahnhof?«
»Ja.«
Die Streifen auf ihrer Hose sahen aus wie Kratzer. Sie hatte feste Schenkel und roch so, wie Yolande gerochen hatte, wenn sie mit Verspätung aus der Fabrik gekommen war. Ihr Vater hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen.
»Weißt du, wie spät es ist?«
»Ja, aber wie soll ich denn nach Hause kommen? Busse fahren keine mehr, wir sind im Krieg, hast du das nicht mitbekommen? … Was gibt’s denn zu essen?«
Zu essen gab es immer dasselbe, und Yolande hatte immer irgendwo einen Liebhaber.
»Warum lächeln Sie denn?«