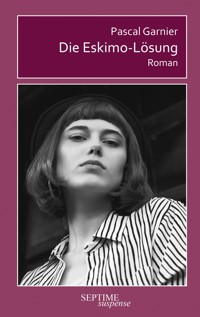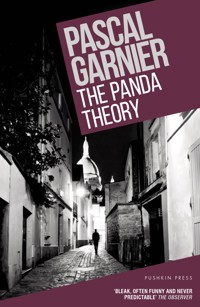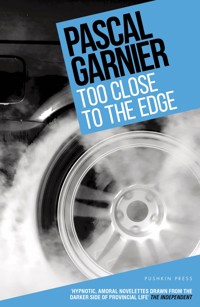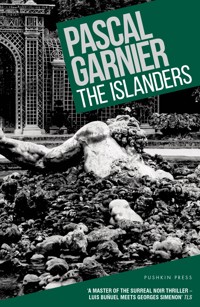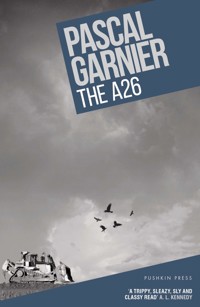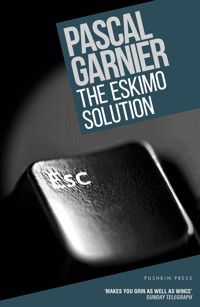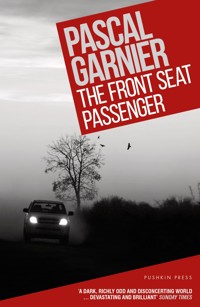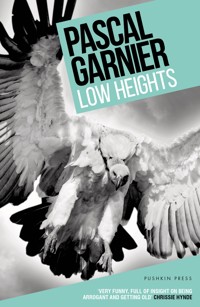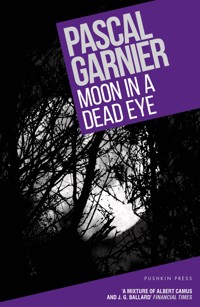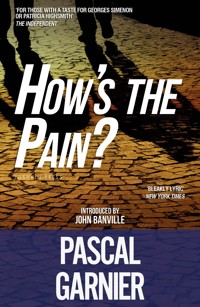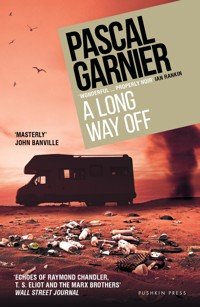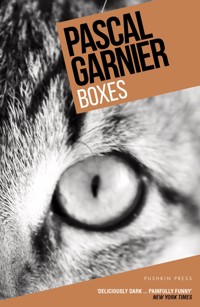13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Éliette genießt ihre Rente, allerdings nicht ohne Bitterkeit. Ihr Ehemann ist tot, die Kinder leben weit entfernt. Keine Freunde weit und breit. Und noch dazu kein Sex. Eines Tages, als über dem Dorf ein Gewitter niedergeht, gewährt sie einem attraktiven Vierzigjährigen, der sich auf dem Land verfahren hat, bei sich Unterschlupf. Doch kaum hat der Kleinganove Éliettes Haus betreten, explodiert ihre Welt geradezu: Der Sohn der Nachbarn kommt bei einem Autounfall ums Leben, eine durchgedrehte junge Frau nistet sich bei ihr ein und auf einmal tauchen zwei Kilo Kokain auf. Achtung vor dem Alter, das nur scheinbar schläft ... … in diesem Alter schreit man nicht mehr, man stöhnt nicht mehr, man vögelt ganz leise, damit einen der Tod nicht hört. »Garnier stürzt dich in eine bizarre, überhitzte Welt und vermengt dabei Tod, Fiktion und Philosophie. Eine berauschende, schmuddelige, klasse Lektüre.« A. L. KENNEDY
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Originaltitel: Trop près du bord © Éditions Zulma, 2010
© 2024, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Christie Jagenteufel
Cover: Jürgen Schütz
Coverbild: © i-stock
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-99120-066-6
Printversion: Hardcover
ISBN: 978-3-99120-048-2
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Pascal Garnier
(1949–2010) war Romancier, Verfasser von Kurzgeschichten, Kinderbuchautor und Maler. In den Bergen der Ardèche, wo er zu Hause war, schrieb er seine in noir-gefärbten Bücher, zu deren Protagonisten er sich durch die einfachen Menschen der Provinz inspirieren ließ. Obwohl seine Prosa zumeist sehr dunkel im Tonfall ist, glitzert sie aufgrund seines trockenen Humors und der schrullig schönen Bilder. Immer wieder mit Georges Simenon verglichen, ist Pascal Garnier der König des französischen Roman noir.
Klappentext:
Éliette genießt ihre Rente, allerdings nicht ohne Bitterkeit. Ihr Ehemann ist tot, die Kinder leben weit entfernt. Keine Freunde weit und breit. Und noch dazu kein Sex. Eines Tages, als über dem Dorf ein Gewitter niedergeht, gewährt sie einem attraktiven Vierzigjährigen, der sich auf dem Land verfahren hat, bei sich Unterschlupf. Doch kaum hat der Kleinganove Éliettes Haus betreten, explodiert ihre Welt geradezu: Der Sohn der Nachbarn kommt bei einem Autounfall ums Leben, eine durchgedrehte junge Frau nistet sich bei ihr ein und auf einmal tauchen zwei Kilo Kokain auf.Achtung vor dem Alter, das nur scheinbar schläft ... … in diesem Alter schreit man nicht mehr, man stöhnt nicht mehr, man vögelt ganz leise, damit einen der Tod nicht hört.
Pascal Garnier
Zu nah am Abgrund
Roman | Septime Verlag
Aus dem Französischen von Felix Mayer
Für Nathalie
Papa, papa …
Serge Gainsbourg
Als die geschälte Kartoffel in die mit Wasser gefüllte Kasserolle fiel, war ein volltönendes Pflupp zu hören, dessen Widerhall wie ein Tennisball von den Wänden der Küche zurückgeworfen wurde. Den Gemüseschäler in der ausgestreckten Hand, hielt Éliette inne, erfüllt von der tiefen Gewissheit, einen Augenblick des vollkommenen Glücks zu erleben.
Ihr Herz, das ein Jahr lang unter mehr oder weniger beherrschtem Schluchzen gezittert und geflattert hatte, war zur Ruhe gekommen, wie die grüne Luftblase einer Wasserwaage. Dafür gab es keinen bestimmten Grund, oder auch Tausende: weil es elf Uhr vormittags war, weil Mai war, weil der Regen gegen die Fensterscheiben schlug, weil auf France Musique Barockmusik lief, weil sie gerade den ersten Gemüsesalat des Sommers zubereitete (frische Erbsen, Salatherz, Karotten, Kartoffeln, Rüben, Frühlingszwiebeln – und dazu Speck!), weil die Biografie von Colette, die sie tags zuvor in der Bücherei von Meysse aufgestöbert hatte, aufgeschlagen auf Seite 48 im Wohnzimmer auf dem Tisch lag, weil sie auf niemanden wartete und niemand auf sie wartete.
All das und unendlich viele weitere Kleinigkeiten führten dazu, dass Éliette sich zum ersten Mal seit Charles’ Tod in ihrem Haus nicht mehr allein fühlte, sondern ganz und unteilbar.
Die Stimme des Moderators von France Musique, die klang wie die eines leberkranken Pfarrers, kündigte die nächste Sendung an. Éliette öffnete die Augen, ergriff die letzte Kartoffel und setzte ihre Ehre daran, die Schale in einer einzigen Spirale zu lösen. Dann schnitt sie Karotten und Rüben in exakt gleich große Stückchen, zerpflückte das Salatherz und tauchte genüsslich die Hände in die Erbsen, die das Abtropfsieb bis zum Rand füllten. Die kleinen grünen Kugeln rollten zwischen ihren Fingern hin und her, und Éliette empfand dabei dieselbe Freude wie als Kind, wenn sie mit ihrer Oma Alice Erbsen ausgeschotet hatte. Dieses wohlige Gefühl war dann die Belohnung gewesen.
In der Küche von Oma Alice hatte eine Atmosphäre geherrscht wie in einem Hammam: Nur Frauen durften sie betreten. Wohlriechende Dünste ließen die Fenster beschlagen. Mit ihren von der Arthritis verformten Fingern, die lebenden Wurzeln glichen, schnitt Oma Alice Gemüse, dressierte Geflügel und knetete Teig, der so weich und weiß wie ihre Arme war. In dieser Küche wurde nicht gesprochen, sondern gesungen. Ihre von dichtem grauem Flaum gesäumte Oberlippe zitterte, wenn sie Chansons aus den Zwanzigerjahren vor sich hin summte: »Les Roses blanches«, »La Butte rouge«, »Mon vieux Paul«.
Eingeschnürt in ihre große schwarze Schürze mit der Tasche auf der Vorderseite, ähnelte sie in jeder Hinsicht ihrem gusseisernen Herd, der ständig glühte. Zwischen ihr und dem Herd bestand eine geradezu osmotische Beziehung, sodass man sich fragen konnte, in welchem der beiden Bäuche die Gerichte gesimmert und gebraten hatten, die sie, schnaufend wie eine alte Dampflokomotive, auftrug.
Obwohl Éliette drei Enkel hatte, würde sie niemals so sein wie Oma Alice. Wahrscheinlich, weil sie nicht alt genug war, nicht dick genug und weil sie ihre kurzen Haare nicht zu einem Dutt à la Großtante hochstecken konnte. Das Alter war heutzutage ein Affront gegen die Jugend, ein spätes obszönes Entwicklungsstadium, das Kinder nicht zu Gesicht bekommen durften. Alter klang nach absinkenden inneren Organen, Krampfadern und einer Menge anderer widerwärtiger Dinge. Wie dem Tod. Éliette war vierundsechzig.
Sie war einer jener Menschen, die zeit ihres Lebens schön gewesen waren und immer schön bleiben würden, von einer gesunden, wie selbstverständlichen Schönheit. Niemals hatte sie auch nur im Mindesten nachgeholfen, um diese Schönheit zu betonen. Nur hin und wieder ein wenig Lippenstift, wenn sie abends mit Charles ausging, und auch das nur, damit die Küsse nach Himbeere schmeckten. Selbst die wenigen Falten, die jetzt ihre Augen umrandeten, verliehen ihrem Gesicht zusätzlichen Charme. Die Zeit schien sich über sie zu legen wie Wachs über Honig. Nur Charles’ Tod hatte das Leuchten in ihren Augen kaum merklich verdunkelt und ihr Lächeln auf immer in Klammern gesetzt.
Fast vierzig Jahre lang hatte eine ungetrübte Liebe sie verbunden, bis eine plötzliche schwere Krebserkrankung Charles zwei Monate vor der Rente dahingerafft hatte, gerade als sie sich daran gemacht hatten, aus dem Großraum Paris wegzuziehen und in dem Haus in der Ardèche ihre immerwährenden Ferien zu genießen.
Dreißig Jahre zuvor hatten sie das alte Anwesen, das einmal eine Seidenraupenzucht beherbergt hatte, gekauft. Jahr für Jahr hatten sie es während des Urlaubs eigenhändig renoviert, um daraus diese friedliche Oase zu machen, die Éliette jetzt, so traurig es war, nur allein genießen konnte. Nach Charles’ Tod hatten Sylvie und Marc ihr dringend davon abgeraten, hierherzuziehen.
»Das ist doch verrückt, Maman. Was willst du denn da ganz allein, mitten im Nichts? … Für die Ferien ist es ja okay, aber das ganze Jahr …«
»Aber ich werde nicht allein sein, die Jauberts sind auch noch da!«
»Die Jauberts … Das sind ja nette Leute, aber außer ihren Problemen mit dem Traktor, dem Frost und den Zwiebeln, die mal wieder verkümmert sind, gibt es doch nichts, worüber man mit ihnen reden kann. Und das nächste Dorf ist acht Kilometer entfernt und du hast keinen Führerschein, wie willst du denn da zum Einkaufen fahren – mit dem Fahrrad?«
»Warum nicht?«
»Und wenn du krank bist?«
»Ich hab ein Telefon.«
»Das ist bescheuert, vollkommen bescheuert!«
Mehrere Monate lang hatte Éliette gezögert, war in ihrer Wohnung in Boulogne auf und ab gegangen, ihr Horizont eingeschränkt auf das Fernsehprogramm und die theoretische Möglichkeit, dass am Sonntag ihre Kinder und die Enkel kamen. Und dann, eines Tages …
»Ich verkaufe die Wohnung in Boulogne und ziehe nach Saint-Vincent.«
Marc hatte die Augen verdreht und Sylvie war wie immer in Tränen ausgebrochen. Natürlich war das verrückt, aber genau das hatte Éliette gebraucht, ein Körnchen Verrücktheit, um nicht in der Vernunft zu versinken.
Ende des Frühjahrs war sie umgezogen. Während der ersten Monate lenkte sie sich ab, indem sie lauter mehr oder weniger sinnvolle Dinge tat, strich Türen und Fenster neu, obwohl sie es nicht nötig hatten, pflanzte im Garten Gemüse und Blumen, von denen die meisten aus Langeweile eingingen, noch bevor sie geknospt hatten, versuchte mithilfe eines Kassettenrekorders, mit dem sie nicht umgehen konnte, Italienisch zu lernen, gab eine Menge Geld aus für Zeitschriften mit Titeln wie Auf eigene Faust: Gartenpflege, Auf eigene Faust: Vorhänge nähen, Auf eigene Faust: Selbstliebe etc. und fing an, Tagebuch zu schreiben, kam jedoch über die dritte Seite nicht hinaus. Dann wurde es Herbst.
Bis dahin hatten Marc und Sylvie sie bei ihren zahlreichen ausgefallenen Unternehmungen abwechselnd unterstützt, aber beide hatten ihr eigenes Leben, eine Familie, einen Beruf, und im September waren sie nach Paris zurückgekehrt und hatten Éliette der Obhut der Jauberts überlassen, deren Hof zwei Kilometer entfernt lag.
Rose und Paul Jaubert waren ein wenig jünger als Éliette, sahen aber aus, als wären sie zehn Jahre älter. Im Grunde hatte sie mit ihnen nicht viel gemeinsam, aber in dreißig Jahren guter Nachbarschaft war eine aufrichtige Freundschaft entstanden, aus der nach Charles’ Tod und Éliettes Umzug nach Saint-Vincent eine Art liebevolle, aber auch lästige Pflegschaft wurde.
Bis Ende November war Éliette gezwungen, fast jeden Abend an dem Resopaltisch in der Küche der Jauberts zu Abend zu essen und statt eines Digestivs das erste Fernsehprogramm zu sich zu nehmen. Es fiel ihr äußerst schwer, sich dieser täglich erneuerten Einladung zu entziehen, ohne die beiden zu kränken. Sie schob ein Bedürfnis nach Alleinsein und innerer Einkehr vor, das sie akzeptierten, ohne es zu verstehen, das sie aber vermutlich ebenso beruhigte wie Éliette.
So erkämpfte sie sich für die Abende eine Freiheit, die darin bestand, nicht das erste Fernsehprogramm zu schauen, sondern Radio zu hören, zu lesen oder – was meistens der Fall war – stocksteif wie eine Tote im Bett zu liegen und darauf zu warten, dass der Schlaf seinen guten Willen zeigte, was jedoch nicht immer so schnell geschah, wie sie es sich gewünscht hätte. Dann hatte das Mogadan das letzte Wort. Aber sie beklagte sich nicht; keine Einsamkeit ist schlimmer als die, die man mit anderen teilen muss. Dennoch sah sie die Jauberts, vor allem Rose, beinahe täglich.
»Schau, ich hab dir etwas Suppe mitgebracht, einen Salatkopf, Zwiebeln, Zucchini. Ich geh jetzt einkaufen, brauchst du was?«
Éliettes Kühlschrank quoll ständig von Gemüse über, das regelmäßig auf dem Kompost landete. Nein, sie brauchte nichts, und wenn sie doch einmal etwas brauchte, ließ Rose sich nicht blicken. Zu dieser Zeit kam ihr die Idee mit dem Kleinfahrzeug. Auf den kurvigen Straßen in der Gegend hatte sie immer wieder solche Autos gesehen, und jedes Mal hatte sie die siebzigjährigen Paare beneidet, die im Schneckentempo dahinkrochen, unerschütterlich und ungerührt vom Hupen und den Lichtzeichen der mürrischen Autofahrer, die sie am liebsten in den Straßengraben bugsiert hätten, um die Fahrbahn wieder in Besitz zu nehmen.
»Herrgott noch mal! Diese Dinger gehören echt verboten. He! Du bist ja schlimmer als mein Traktor!«
Éliette ließ solche Äußerungen Pauls wohlweislich unkommentiert, wenn sie auf der Rückfahrt vom Markt ein solches Fahrzeug überholten, aber sich selbst konnte sie sich sehr gut am Steuer eines solchen schicken motorisierten Einkaufswagens vorstellen. Tagsüber malte sie es sich aus und nachts träumte sie davon, wie ein Kind von einem heiß ersehnten Weihnachtsgeschenk. Es erforderte nicht wenig Geschick, Paul dazu zu bringen, sie zu einem Händler zu begleiten.
»Warum machen Sie denn nicht den Führerschein, Éliette? Dann könnten Sie sich ein richtiges Auto kaufen. Mein Cousin verkauft seinen R5, der ist in tadellosem Zustand.«
»Ich würde die Prüfung niemals bestehen, da bin ich mir sicher.«
»Als Rose ihn gemacht hat, war sie auch schon fünfundvierzig.«
»Ich bin vierundsechzig. Und außerdem will ich so eines.«
»Aber das ist doch kein Auto, Éliette, das ist ein Spielzeug. Und ein teures noch dazu!«
»Genau. Ich will ein Spielzeug.«
Mithilfe von Charles’ Rente und dem Erlös aus dem Verkauf der Wohnung konnte sie sich diesen Traum problemlos erfüllen. Widerwillig fuhr Paul sie nach Montélimar, wo sie sich einen herrlichen, cremefarbenen Aixam kaufte, das neueste Modell. Um sich an den Umgang mit dem Wägelchen zu gewöhnen, musste sie eine Zeit lang auf dem unbefestigten Weg üben, der zu ihrem Haus führte, doch nach ein paar Tagen konnte sie vor und zurück rangieren, nach links und nach rechts, ohne die Stoßstangen zu sehr zu beschädigen. Während ihrer ersten Ausfahrt (zwanzig Kilometer hin und zurück) war sie so berauscht, als würde sie ein Flugzeug steuern. Sie hatte das Fenster geöffnet, ließ die Haare im Wind flattern und sang aus voller Kehle: »Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson …«
Das hatte ihr Leben verändert. Anfangs gab sich Rose beleidigt, als hätte Éliette sich einen Liebhaber zugelegt. Aber dann gewöhnten sich beide daran und schließlich scherzten sie darüber.
»Na, wer kommt denn da? Éliette in ihrem Joghurtbecher!«
›Madame de Bize war alles andere als eine Frühlingsblume. Die bittere Falte in der vom ständigen gekünstelten Lächeln ausgehöhlten Wange verriet ihre vierzig Lebensjahre; ihr ausladendes Gesäß, dessen hochnäsige Wölbung Freunde beiderlei Geschlechts einst gepriesen hatten, wurde zu ihrem Ärger plump und schwer …‹
Das Schrillen des Telefons riss Éliette aus der Lektüre der Biografie Colettes. Es war mittags, also konnte es nur Sylvie sein. Sie rief immer um diese Zeit an, einmal die Woche, aus dem Büro, kurz bevor sie zum Mittagessen ging.
»Maman? Ich bin’s, Sylvie.«
»Hallo, meine Liebe. Wie geht’s dir?«
»Geht schon, aber ich bin ziemlich kaputt. Justine hat die Masern.«
»Die Ärmste!«
»Und sie wird garantiert auch Antoine anstecken.«
»Das war bei dir und deinem Bruder genauso. Aber ihr kommt doch trotzdem an Pfingsten, oder?«
»Ja. Bis dahin wird sie’s überstanden haben.«
»Bleibt es dabei, dass ihr am Freitag kommt?«
»Ja, schon. Und du, wie geht’s dir?«
»Gut, ich habe mir gerade den ersten Gemüsesalat des Sommers gemacht.«
»Du Glückliche! Richard und die Kinder mögen kein Gemüse. Mein Gott, wie ich dich beneide!«
»Wenn du da bist, mache ich dir einen.«
»Mit Speck und Crème fraîche?«
»Aber sicher. Und Richard und seine Arbeit … läuft es gut?«
»Na ja, du weißt ja, der Immobilienmarkt heutzutage … Dauernd neue Angebote, er ist viel unterwegs. Und dir geht’s wirklich gut?«
»Natürlich! Seit zwei Tagen gewittert es, aber am Wochenende soll es schön werden. Ich lese gerade eine Biografie von Colette, das ist wirklich interessant. Was liest du denn zurzeit?«
»Ich hab keine Zeit zum Lesen. Arbeit, Kinder, Haushalt …«
»Das kann ich verstehen, mein Schatz. Man sollte in Rente sein, wenn man jung ist, und arbeiten, wenn man alt ist.«
»In Rente! Wenn man davon so viel hat wie Papa … Entschuldige, Maman, ich bin gerade einfach wahnsinnig gestresst. Am liebsten würde ich zu dir fahren und mich so richtig verwöhnen lassen.«
»Keine Sorge, ich werde dich hegen und pflegen. Du kannst den ganzen Tag auf dem Sofa liegen. Weißt du etwas von deinem Bruder? Ich habe länger nichts von ihm gehört. Habt ihr euch abgesprochen wegen des Besuchs?«
»Du kennst ihn doch. Man weiß bei ihm nie, woran man ist. Er hat immer Zeit und es ist immer alles in bester Ordnung. Keine Ahnung, wie er das macht. Na ja, doch, eigentlich schon. Sandra kümmert sich um alles, um den Kleinen, um den Haushalt, andauernd mit diesem dämlichen Lächeln. Die perfekte Hausfrau!«
»Sprich nicht so schlecht von deiner Schwägerin. Sie ist doch wirklich sehr nett.«
»Ja, supernett, und ich glaube, das nervt mich am meisten an ihr. Diese starre Maske der Glückseligkeit, die sie den ganzen Tag trägt. Wenn man nicht arbeitet, geht das ja auch.«
»Sei nicht so gehässig. Sandra ist eben sehr … traditionell. Dein Bruder verdient genug, sie kümmert sich gerne um den Haushalt – was ist denn daran falsch?«
»Genau das ist es: traditionell. Lass uns über was anderes reden. Läuft dein Wägelchen noch?«
»Bestens. Wie ein Uhrwerk.«
»Maman … Bist du glücklich?«
»Aber natürlich, meine Süße!«
»Ich frag mich, wie du das machst, da unten am Arsch der Welt, wie ihr alle das macht, in dieser beschissenen Welt glücklich zu sein … Erst neulich …«
Éliette hörte ihr nicht mehr zu. Natürlich liebte sie ihre Tochter, doch jetzt gerade interessierte sie das alles überhaupt nicht: die Kleine mit ihren Masern, Richard und seine Probleme in der Arbeit, was Sylvie über ihren Bruder, ihre Schwägerin und diese beschissene Welt dachte …
»Entschuldige, Schätzchen, aber aus der Küche riecht es irgendwie verbrannt.«
»Oh, na dann. Wir reden ein andermal weiter. Ich ruf dich an, wenn was dazwischenkommt, ansonsten bleibt es bei Freitagabend.«
»Hab dich lieb, meine Süße.«
In der Küche verbrannte überhaupt nichts. Nur das beruhigende Blubb Blubb des Gemüses war zu hören, das in einer Ecke des Herdes vor sich hin köchelte. Éliette schob ein Holzscheit zurück, das aus dem Kamin gerutscht war. Die Glutstückchen leuchteten rubinrot, wie die Kerne eines reifen Granatapfels. Es war nicht kalt, aber wegen des Regens und weil sie gerne vor dem flackernden Kamin las, hatte Éliette Lust bekommen, ein Feuer zu machen. Mit einem Lächeln setzte sie sich wieder aufs Sofa.
Das Eingekerkertsein verstärkt sich selbst. Erst wird man dazu genötigt, dann findet man sich, weil man keine Wahl hat, damit ab, richtet sich darin ein, fühlt sich darin sogar ganz wohl, bis die Welt außerhalb der Mauern nur noch ein Sammelsurium von Plagen ist. Natürlich liebte Éliette ihre Kinder und die Kinder ihrer Kinder, so wie man den Himmel liebt, den Wald, die Berge, das Leben ganz allgemein, aber nach zwei Tagen ertrug sie sie nicht mehr. Und ihnen ging es garantiert genauso. Achthundert Kilometer für einen Besuch über das Pfingstwochenende, das war weit, ganz abgesehen von den Kosten. Beide Seiten empfanden es als Verpflichtung, aber wenn es anders gewesen wäre, hätte Éliette mit Sicherheit darunter gelitten. Es war paradox, und doch war es so. Sie hatte eine Weile gebraucht, um es sich einzugestehen: Sie brauchte ihre Familie, aber nach vierundzwanzig Stunden sehnte sie sich danach, dass sie wieder fuhren.
Heute Abend würde wie üblich Marc anrufen und ihr mitteilen, wann genau er kommen würde, und morgen würde er erneut anrufen, um anzukündigen, dass es wahrscheinlich später wurde, weil in der Arbeit so viel los war … Der Form halber würde sie grummeln, aber im Grunde war ihr das völlig egal.
All diese Kleinigkeiten, mit denen sie sich jahrelang verrückt gemacht hatte, kümmerten sie heute nicht mehr im Geringsten. Wo war denn der Unterschied, ob zum Abendessen neun oder fünf Leute da waren? Ein Omelette, eine Schüssel Salat … Ihre Kinder waren Leute wie alle anderen geworden, mit dem kleinen Unterschied, dass sie einen leisen Stich im Herz verspürte, wenn sie wieder fuhren. Was waren Kinder? Drachen, die man steigen ließ, eine Weile an der Schnur hielt, lenkte und dann losließ … und dann pflanzten sie sich ihrerseits fort, irgendwo dort oben in den Wolken … In einem Buch hatte sie einmal gelesen, dass wir alle Kinder von Kindern sind.
Der Gemüsesalat war himmlisch. Während Éliette ihn aß, kam sie sich wie ein Kaninchen vor, das sich an einem Gemüsebeet gütlich tat. Der anschließende Mittagsschlaf war nicht weniger köstlich. Als sie aufwachte, hatte der Regen aufgehört. Über ihr erstreckte sich ein unendlich weiter Himmel, blau und rosa wie Babykleidung. In der Luft lag der Geruch von Waschmittel, als trockneten Leintücher im Wind. Regentropfen, die jeder einen Sonnenstrahl im Bauch trugen, bildeten Fransen an den Blättern des Lorbeerbaums im Garten. Die umliegenden Berge dampften, in Ocker und rötliches Violett getaucht, und auf ihren Flanken perlte ein zartgrüner Flaum, der dem Wind einen leichten Geruch nach Zahnpasta verlieh.
Éliette überlegte, ob es nicht klüger wäre, schon heute in dem großen Supermarkt in Montélimar auf Beutezug zu gehen, anstatt am Wochenende, wenn sich die Einkaufswagen unvermeidlich stauten. Ihre spontane Antwort lautete: Ja, doch. Durch ihr einsames Leben hatte sie eine Abneigung gegen Ortschaften mit mehr als achtzig Einwohnern entwickelt. Aber ihr Kühlschrank und ihre Speisekammer konnten mit nichts von dem aufwarten, was zwei Paare mit Kindern nach einer langen Autofahrt brauchten. Also musste sie heute oder morgen einkaufen gehen.
Es war erst vier Uhr und es regnete nicht mehr. Éliette schluckte ihre Entscheidung wie eine Tablette und ging hinauf in ihr Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Ihr Anblick im Spiegel des Schranks beschämte sie: die ausgeleierte Strickjacke, die an den Knien ausgebeulte Hose, die dicken Strümpfe und die schmutzigen Pantinen. Auch das war das Landleben. Keine Spur eines Mädchens aus einer Fragonard’schen Landidylle, das in gebauschtem Kleid auf einer Schaukel hin und her schwingt. Während die Natur in einem Rausch von Farben und Düften aufblühte, verwandelte Éliette sich nach und nach in eine abstoßende Karikatur der besonders altmodischen Seiten eines Versandhauskatalogs. Zwar war sie in Sachen Mode nie vorn dabei gewesen, hatte sich jedoch stets ein gewisses Maß an Koketterie bewahrt. Aber wenn niemand mehr da ist, dem man gefallen möchte …