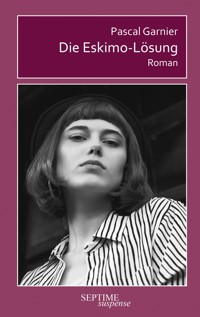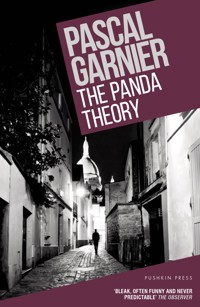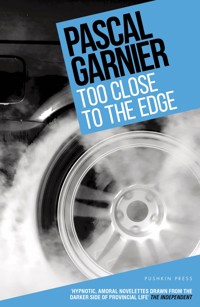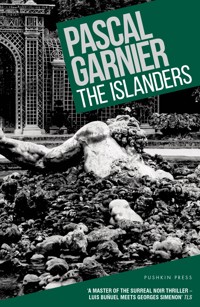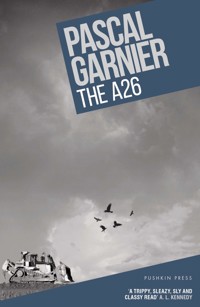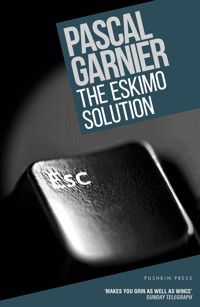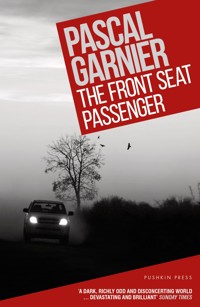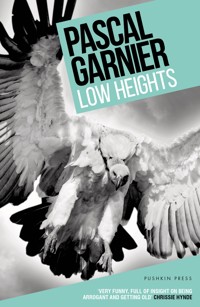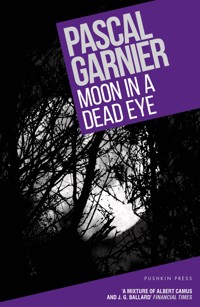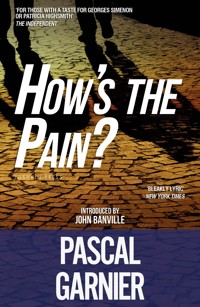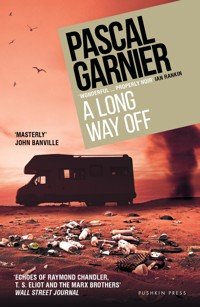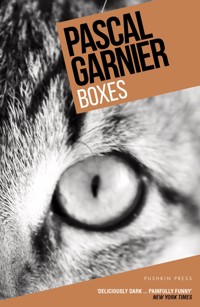13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch wenn sich Fabien und Sylvie dies nicht eingestanden hätten, wussten beide, dass ihre Ehe nicht mehr funktionierte. Doch als Sylvie bei einem Autounfall ums Leben kommt, muss Fabien zur Kenntnis nehmen, dass neben seiner Frau auch ihr Liebhaber zu Tode gekommen ist. Im Leichenschauhaus kommt es zu einer flüchtigen Begegnung mit zwei Frauen, von denen eine Martine, die Witwe des verstorbenen Liebhabers seiner Frau, ist und die andere ihre beste Freundin Madeleine. In Fabien beginnt der Gedanke an Rache zu keimen. Er verfolgt die Witwe auf der Straße, beobachtet sie im Café und bricht wiederholt in ihre Wohnung ein, wobei er dabei immer irgendein Möbelstück verstellt. Bei einem dieser Besuche entdeckt er die Unterlagen für einen Aufenthalt am Meer und bucht dieselbe Reise. Er muss es schaffen, Martine allein zu erwischen, um sie zu verführen und sich so für seine Schmach zu rächen. Auf der Insel kommen sich die beiden rasch näher. Nur Madeleine ist ein permanenter Störfaktor. Fabien weiß, dass er sie loswerden muss, koste es, was es wolle. Aus diesem Spannungsfeld entwickelt Pascal Garnier ein dunkles Spektakel, bei dem plötzlich gar nicht mehr klar ist, wer hier eigentlich wen auf seiner Zielscheibe hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Originaltitel: La Place du mort © Éditions Zulma, 2010
© 2023, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Christie Jagenteufel
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © i-stock
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-99120-030-7
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag
ISBN: 978-3-99120-026-0
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.instagram.com/septimeverlag
Pascal Garnier
(1949–2010) war Romancier, Verfas- ser von Kurzgeschichten, Kinderbuchautor und Maler. In den Bergen der Ardèche, wo er zu Hause war, schrieb er seine in noir-gefärbten Bücher, zu deren Protagonisten er sich durch die einfachen Menschen der Provinz inspirieren ließ. Obwohl seine Prosa zumeist sehr dunkel im Tonfall ist, glitzert sie aufgrund seines trockenen Humors und der schrullig schönen Bilder. Immer wieder mit Georges Simenon verglichen, ist Pascal Garnier der König des französischen Roman noir.
Klappentext:
Auch wenn sich Fabien und Sylvie dies nicht eingestanden hätten, wussten beide, dass ihre Ehe nicht mehr funktionierte. Doch als Sylvie bei einem Autounfall ums Leben kommt, muss Fabien zur Kenntnis nehmen, dass neben seiner Frau auch ihr Liebhaber zu Tode gekommen ist. Im Leichenschauhaus kommt es zu einer flüchtigen Begegnung mit zwei Frauen, von denen eine Martine, die Witwe des verstorbenen Liebhabers seiner Frau, ist und die andere ihre beste Freundin Madeleine.
In Fabien beginnt der Gedanke an Rache zu keimen. Er verfolgt die Witwe auf der Straße, beobachtet sie im Café und bricht wiederholt in ihre Wohnung ein, wobei er dabei immer irgendein Möbelstück verstellt. Bei einem dieser Besuche entdeckt er die Unterlagen für einen Aufenthalt am Meer und bucht dieselbe Reise. Er muss es schaffen, Martine allein zu erwischen, um sie zu verführen und sich so für seine Schmach zu rächen. Auf der Insel kommen sich die beiden rasch näher. Nur Madeleine ist ein permanenter Störfaktor. Fabien weiß, dass er sie loswerden muss, koste es, was es wolle. Aus diesem Spannungsfeld entwickelt Pascal Garnier ein dunkles Spektakel, bei dem plötzlich gar nicht mehr klar ist, wer hier eigentlich wen auf seiner Zielscheibe hat.
Pascal Garnier
Der Beifahrer
Roman | Septime Verlag
Aus dem Französischen von Felix Mayer
Für meinen Bruder Philippe
Les histoires d’amour finissent mal en géné…
Ein Zeigefinger mit einem abgeknabberten Nagel beendet jäh den Song von Les Rita Mitsouko. Die plötzliche Rückkehr zur Stille ist schmerzhaft. Dann trommeln zehn Finger auf das Lenkrad. Ein dumpfes Geräusch, ein monotoner Rhythmus. Wie von Regentropfen. Die Anzeigen des Armaturenbretts tauchen die Finger in leuchtendes Grün. Sonst, im Umkreis von mehreren Kilometern, nirgendwo ein Licht. Keine Sterne, nur hinter den Hügeln ein schwacher Schein, der eine weit entfernte Stadt ahnen lässt. Die rechte Hand löst sich vom Lenkrad und liebkost den Schaltknüppel. Mit derselben Bewegung, mit der man einen Hund, eine Katze oder den Kolben eines Gewehrs streichelt. Es ist ein gutes Auto, leistungsstark, robust, grau. Halb zwölf, gleich müssten sie kommen. Der Sekundenzeiger scheint unter dem starren Blick stehen zu bleiben. Aber nein, unbeirrbar setzt er seine Runde fort, dickköpfig oder resigniert, wie ein Esel, der den Mahlstein einer Mühle dreht.
Dann plötzlich, auf der Kuppe des gegenüberliegenden Hügels, das Licht von Scheinwerfern, das Dunkel wird fahl, weicht zurück … Kontakt. Die rechte Hand spannt sich an und legt den Gang ein. Die linke ergreift das Lenkrad. Der rechte Scheinwerfer des Wagens, der den Abhang gegenüber herunterjagt, leuchtet eindeutig in Richtung Straßenrand. Sämtliche Lichter gelöscht, schießt der graue Wagen wie eine Flipperkugel nach vorn. Die Uhrzeit, der schräg stehende Scheinwerfer – das sind sie. Die Nacht schließt die Augen.
Im Wald hat ein Fuchs einem Kaninchen die Kehle durchgebissen. Als er das Quietschen der Reifen auf dem Asphalt und den Lärm des Blechs hört, die durch die Senke hallen, stellt er die Ohren auf. Es dauert nur wenige Sekunden. Dann ergreift die Stille wieder Besitz von allem. Mit den Zähnen reißt er das Fell des Kaninchens auf und schiebt seine spitze Schnauze in die dampfenden Eingeweide. Abertausende Tiere um ihn herum fressen oder bespringen einander, von den größten bis zu den kleinsten, einzig und allein, um das Spiel fortzusetzen.
»Isst du das Gemüse zusammen mit dem Fleisch?«
»Ähh … ja.«
»Als du klein warst, hast du es gemacht wie ich: erst das Fleisch, dann das Gemüse. Wir alle verändernuns …«
Sein Vater garnierte seine Sätze gern mit derlei Feststellungen – »Wir alle verändernuns«, »Was muss, das muss«, »So ist das Leben«, »So läuft’s nun mal«. Aus seinem Mund klangen sie wie Sentenzen. Wir alle verändernuns … Wie wahr. Die Nachricht von Charlottes Tod hatte den Alten wirklich schwer getroffen, auch wenn er sie fast fünfunddreißig Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Er war zusammengesackt, war auf seine Grundfesten gesunken, als hätte man ihm plötzlich einen Schemel unter den Füßen weggezogen. Er wirkte wie ausgehöhlt. Hätte man ihm auf den Rücken geklopft, wären ihm das Geräusch eines abgestorbenen Baums und eine Handvoll Eulen entfahren. Fabien hatte es eine Woche zuvor am Telefon bemerkt, in der Stimme seines Vaters hatte ein verzerrtes Echo gelegen, wie bei einem Ferngespräch.
»Nächsten Sonntag ist Flohmarkt in Ferranville. Hast du Lust, mir zu helfen? Dieses ganze alte Zeug …« (Und dann, kurz bevor er aufgelegt hatte:) »Ach ja: Charlotte ist gestorben.«
Seitdem sie sie verlassen hatte – Fabien musste damals fünf Jahre alt gewesen sein –, sprachen sie zu Hause von ihr nicht mehr als »Maman«, sondern als »Charlotte«. Fabien hatte seinen Vater niemals etwas Schlechtes über sie sagen hören, ebenso wenig wie Gutes, ganz einfach, weil er überhaupt nicht über sie sprach. Er hatte sie wie Alfred Dreyfus degradiert und in einen Winkel seiner Erinnerung verbannt, der so weit entfernt war wie die Teufelsinsel.
Über seinen Teller gebeugt, formte der Alte mit den Zinken seiner Gabelaus den Karotten, Kartoffeln und Bohnen, die er in seinem Garten gezogen hatte, ordentliche Häufchen.
»Das lief heute doch eigentlich ganz gut, oder? Wie viel hast du denn eingenommen?«
»Keine Ahnung … Fünfhundert, sechshundert Francs. Hauptsache, ich bin das Zeug los.«
»Ich wusste gar nicht, dass du das alles aufgehoben hast.«
»Wie – das alles?«
»Die Sachen von Charlotte.«
Sein Vater zuckte mit den Schultern, stand auf und warf das Essen auf seinem Teller, das er kaum angerührt hatte, in den Komposteimer. Fabien hatte den Eindruck, er nutzte die Gelegenheit, um sich unbemerkt eine Träne aus dem Auge zu wischen. Er ärgerte sich über sich selbst. Er hätte Charlotte nicht erwähnen sollen, aber er war nun schon drei Tage hier und wartete seitdem vergeblich darauf, dass sein Vater auf sie zu sprechen kam. Wie hätte er ahnenkönnen, dass der Alte seitüber dreißig Jahreninsgeheim hoffte, Charlotte würde eines Tages aufkreuzen, um ihre Sachen zu holen? Ihre Sachen … Geister haben keine Besitztümer, keine Schuhe aus Eidechsenleder, keine rote Handtasche. Eine junge Frau hatte die Schuhe und die Tasche gekauft, heute Vormittag auf dem Flohmarkt. Zusammen für siebzig Francs. Sein Vater hatte nicht gehandelt. Als er ihr auf den Hundertfrancsschein dreißig herausgegeben hatte, hatte er nicht gezittert. Er hatte der jungen Frau einfach nur nachgesehen, bis sie in der Menge verschwunden war, und sogar noch ein bisschen länger.
»Wann geht dein Zug?«
»Um sechs Uhr irgendwas.«
»Dann haben wir ja noch Zeit. Ich ruh mich ein bisschen aus. Der Rücken tut mir weh. Lass das Geschirr stehen, ich spül dann heute Abend ab.«
»Nein, ich mach das schon. Ruh du dich nur aus.«
Die beiden Teller und die Handvoll Besteck waren rasch erledigt. Das war schade; Fabien hätte lieber gespült, bis er zum Zug musste. Er mochte dieses Haus nicht, und das Haus hatte ihn nie gemocht. Sein Vater hatte es gekauft und bezogen, als er in Rente gegangen war. Fabien fühlte sich dort immer wie in einem Wartezimmer, wusste nie, wo er sich hinsetzen sollte, alles war quadratisch, kantig, sauber, funktional. Weil er nicht wusste, wohin mit sich, setzte er sich wieder auf den Stuhl, auf dem er schon während des Mittagessens gesessen hatte. Sein Vater saß dösend in einem dieser grässlichen Sessel, die einen sofort an Krankenhaus und Tod denken ließen; die Brille hatte er auf die Stirn geschoben, und auf seinem Bauch lag ein aufgeschlagenes Buch, Wie Sie in allen Lebenslagen Ihre Haut retten. Er hatte immer nur solche Bücher gelesen, Bücher, die vom Überleben handelten, davon, wie man den Krieg überlebte, Kälte, Hitze, die Umweltverschmutzung, Epidemien, radioaktive Strahlung, und das mit derselben Leidenschaft, mit der sich andere Menschen ein Leben nach dem Tod ausmalten. Was für eine Katastrophe hatte er hinter sich? Charlotte? Nein, es reichte weiter zurück, Charlotte war nur die Bestätigung dafür gewesen, dass das Leben lebensgefährlich war. In dieser feindseligen Welt konnte man auf niemanden zählen, außer auf sich selbst. Seit Jahren fühlte sich Fabien in seiner Gegenwart wie in einem Aquarium. Jedes Mal, wenn er sich von ihm verabschiedete, fühlte es sich an, als wären seine Ohren verstopft, und er hatte das Bedürfnis, tief durchzuatmen, als hätte er lange Zeit ohne Sauerstoff unter Wasser verbracht. Wenn sein Vater sterben würde, würde er ihm einen Berg Schweigen hinterlassen.
Einmal hatte er ihn, um ihn zum Reden zu bringen, in ein Restaurant eingeladen. Sein Vater fand Restaurants furchtbar, so wie Cafés, Hotels und überhaupt alle Orte, an denen das Leben anderer Menschen zu spüren war. Fabien hatte sich ein Mittagessen unter Männern erhofft, vielleicht sogar unter Freunden. An ein solches Wunder hatte er nur glauben können, weil er damals noch so jung gewesen war. Aber er wollte unbedingt etwas aus ihm herausbringen, irgendetwas, über seine (des Vaters) Kindheit oder über seine eigene, über die Zeit vor Charlotte, über die Zeit nach Charlotte. Hatte er Geliebte gehabt? Hatte er noch immer welche? Zumindest ein paar Brosamen. Um ihn dazu zu bewegen, hatte er sich dazu hinreißen lassen, ihm ziemlich intime Einblicke in sein eigenes Leben zu geben, und hatte ein Glas Weißwein nach dem anderen gekippt, um sich Mut anzutrinken. Als sie erst beim Hauptgang waren, war er schon völlig betrunken und redete dummes Zeug, während sein Vater bis dahin nur einmal den Mund aufgemacht und gesagt hatte: »Iss, es wird sonst kalt.«
Als er zahlte und sein Vater sorgfältig seine Serviette zusammenfaltete, fühlte sich Fabien entsetzlich erniedrigt. Anstatt seinen Vater dazu zu bringen, ihn ins Vertrauen zu ziehen, hatte er sich nur albern benommen und sich lächerlich gemacht. Zu Hause war er sofort unter die Dusche gestürzt. Doch das war jetzt rund fünfzehn Jahre her. Heute war es anders. Fabien wusste, dass sein Vater niemals mit ihm reden würde, ganz einfach, weil er ihm vermutlich nichts zu sagen hatte, und das war auch gut so. Fabien war der Spross zweier Geister, und die einzigen verwandtschaftlichen Bande waren die Abwesenheit des einen und das Schweigen des anderen. Und er und sein Vater lebten jeder sein Leben auf seiner eigenen einsamen Insel. So einfach war das.
Seit über dreißig Jahren ruhte Charlotte an der rechten Pobacke seines Vaters, zwischen einer Krankenversicherungskarte und einem Personalausweis, der auf den Namen Fernand Delorme ausgestellt war (ein steif gewordenes Foto, das eine kleine, braunhaarige Frau zeigte, die in weißen Söckchen und Sandalen auf einem Waldweg stand und gelangweilt lächelte), und zwischen den beiden war nie Platz für ihn gewesen.
»Mein Gott! Wie hält man das nur aus, mit einer Uhr, die andauernd tickt?«
Eine Pendeluhr aus der Franche-Comté, der ganze Stolz seines Vaters. Ein aufrecht stehender Sarg. Charlotte hätte darin leicht Platz gehabt.
»Ich muss dann mal los, Papa …«
»Was? … Ja, ja, was muss, das muss …«
Der knallgelbe R4, den sein Vater bei der Post erstanden hatte (ein wahres Schnäppchen!), stotterte ein paarmal bedenklich und kam vor dem Bahnhof zum Stehen.
»Wir sind ein ganzes Stück zu früh dran. Jetzt müssen wir noch eine gute Viertelstunde warten.«
»Du brauchst nicht zu warten, Papa. Fahr ruhig wieder nach Hause.«
»Aber es ist schon seltsam, dass du nicht Auto fährst. Dawärstdu viel unabhängiger.«
»Und was würde mir das bringen?«
»Ich sag ja nur. Dann grüß Sylvie von mir. Und hier, vergiss den Flieder nicht. Sag ihr, sie soll ihn gleich ins Wasser stellen.«
»Alles klar. Mach’s gut, Papa. Ich ruf dich nächste Woche an.«
»So machen wir’s.«
Fabien war nicht der einzige Reisende auf dem Bahnsteig, der als Fliederbusch verkleidet war. Das aufgeweichte Zeitungspapier, in das die Zweige eingewickelt waren, zerfiel langsam zwischen seinen Fingern.
Noch nie zuvor war ihm aufgefallen, dass seinem Vater so lange Haare aus den Ohren wuchsen. Von den drei Tagen, die sie zusammen verbracht hatten, war das das Einzige, was ihm im Gedächtnis bleiben sollte.
Wenn man damit gerechnet hat, erwartet zu werden, stellt es immer eine gewisse Enttäuschung dar, eine leere Wohnung zu betreten, aber dass Sylvie nicht da war, war Fabien eigentlich ganz recht. Denn sonst hätte er mit ihr reden und ihr von den zurückliegenden Tagen erzählen müssen, obwohl er absolut nichts zu sagen hatte, weder Sylvie noch irgendjemand anderem; und genauso wenig hatte er Lust, die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (drei Stück) abzuhören. Er kam aus der Welt des Schweigens und der unermesslichen väterlichen Tiefe und brauchte eine Phase der Dekompression. Sylvie war vermutlich mit Laure im Kino. Wenn Fabien nicht da war, machte sie das immer. Fabien ging nicht gern ins Kino, vor allem nicht abends.
Sie musste überhastet aufgebrochen sein, denn auf dem Küchentisch lag kein Zettel. Sylvie war oft zu spät dran, es beruhigte sie, bis zum letzten Moment zu warten. Der Flieder war schlaff geworden, das Zeitungspapier nur noch grauer Matsch. Fabien sah sich nach der großen blauen Vase um, konnte sie aber nirgendwo finden. Er wusste nie, wo Sylvie die Dinge verstaute. Für die Dinge war sie zuständig. Sie war diejenige, die sie ganz nach Belieben auftauchen und verschwinden ließ. Fabien konnte das nicht, er war zu ungeschickt, machte immer alles kaputt. Wenn er allein zu Hause war, verbrachte er die Zeit damit, sämtliche Zimmer abzusuchen, um irgendwo einen Dosenöffner, ein Paar Socken oder ein Verlängerungskabel aufzustöbern. Er drehte dem erbärmlichen Strauß den Hals um und stopfte ihn in den Abfalleimer.
Kühlschrank: vier Eier, eine Scheibe Schinken mit Grünstich und drei Dosen Bier. Weiter forschte Fabien nicht nach, weil er fürchtete, in den Tiefen des Gemüsefachs auf ein verwelktes Salatherz oder eine weiche Karotte zu stoßen. Er begnügte sich mit einem Bier. In den ersten beiden Jahren, nachdem sie zusammengezogen waren, war der Kühlschrank übergequollen vor Kalbsleber, Entrecotes, Schälrippchen vom Schwein, Geflügel, Fisch, frischem Gemüse, Sahne und Süßspeisen, und im Keller hatten sich die Kisten mit Sancerre, Burgunder und Champagner gestapelt … Die eine Hälfte der Zeit hatten sie im Bett verbracht, die andere bei Tisch. Sie hatten ihre Fettpölsterchen mit der belämmerten Verzücktheit einer Schwangeren betrachtet, die sich im Badezimmerspiegel mustert. Sie waren unersättlich, ja verschwenderisch. Dann hatte Sylvie eines Tages beschlossen, dass sie es maßlos übertrieben, dass es so nicht weitergehen konnte, dass das nicht mehr normal war. Also hatten sie die Zeit zwischen sich verrinnen lassen, langsam und beharrlich, wie Wüstensand, der sich ausbreitet. Sie taten nichts, sie sagten nichts. Es kamen keine Kinder, auch kein Pudel und keine Katze. Sie richteten sich in ihrem neuen Leben ein, sie magerten ab.
Das Bier hatte einen metallischen Geschmack, so wie seine Hände, mit denen er das Geländer des Balkons umfasste, und wie die Sterne am Himmel und die gesamte Stadt, die sich zu seinen Füßen erstreckte. Metallisch. Wie Eisen.
»Wie viele sind wir, die sich, ein Bier in der Hand, auf das Fensterbrett stützen und sich fragen, ob es uns noch jemals widerfahren wird? Dabei wissen wir nicht einmal mehr, was wir mit ›es‹ meinen: Ruhm? Reichtum? Liebe? Von der Kindheit ist uns nur noch ein rätselhafter Schwindel geblieben, der gerade einmal ausreicht, das Bedauern zu nähren.«
Einige Tage zuvor hatte auf der Terrasse eines Cafés jemand hinter Fabien gesagt: »Ich frage mich, ob ich mich überhaupt noch einmal verlieben könnte.« Der Mann war in seinem Alter gewesen. Auf dem Gehsteig waren junge Frauen vorübergegangen, leicht wie Zigaretten, umstrahlt vom Glanz der Junisonne, unerreichbar.
Vor etlichen Jahren war der Schirokko über Paris hinweggefegt. Es waren heiße Tage gewesen. Eine dünne Schicht aus rötlichem Sand hatte sich über die Autos gelegt. Fabien hatte an derselben Stelle gestanden, hier auf dem Balkon. Er hatte sich gewünscht, der Sand würde sich einen ganzen Meter hoch türmen, wie der Schnee in seinen Kindertagen. Aber hier war nichts von Dauer, alles verwandelte sich in Dreck. Vermutlich lag das an den mangelhaften Träumen.
Die Werbespots im Fernsehen begriff er immer weniger. Er verstand einfach nicht, was man ihm verkaufen wollte. Ein Getränk? Ein Auto? Ein Putzmittel? Ihm schwante, dass es ganz in seiner Nähe eine Welt gab, die von breitschultrigen Typen bevölkert war, die in Herrenslips durch die Meeresbrandung liefen, von affigen Schicksen, auf deren Haut Seifenschaum abperlte, prächtig gediehenen Kindern, die sich mit Marmelade bekleckerten, und dicken Hündchen, die mit treuherzigem Blick nach Schokokeksen schnappten, aber er fand zu dieser Welt keinen Zugang mehr. Dasselbe galt für die Nachrichten (er teilte sie nur noch in gute und böse ein), für die Spielshows, bei denen er nie wusste, ob das Kalb den Idioten, der als Schnitzel mit Pommes verkleidet war, besteigen sollte oder umgekehrt, sowie für die Frage, warum Polizisten manchmal wie rasend darauf aus waren, es sämtlichen Autos vor ihnen von hinten zu besorgen. Das tat jedoch seiner Überzeugung keinen Abbruch, dass das Fernsehen der beste Freund des Menschen war, noch weit vor dem Hund, dem Pferd und sogar Sylvie.
Er fragte sich, ob er Hunger hatte, und antwortete sich zerstreut: »Vielleicht.« Aber die Vorstellung, mit Pfanne, Butter und Eiern hantieren zu müssen, raubte ihm jeden Elan. Lieber ging er Zähne putzen, das war schneller erledigt. Bis auf Weiteres würde er seinen Vater nicht mehr besuchen. Das verdarb ihm jedes Mal die Stimmung. In jungen Jahren hatte er abends nie die Zeit zum Zähneputzen gehabt. Er war dort eingeschlafen, wo er sich im Leben gerade befunden hatte, und hatte am nächsten Morgen genau dort weitergemacht. Jetzt dagegen war alles in schmale Streifen geschnitten, von Verpflichtungen durchsetzt, denen er wie mechanisch nachkam. Er lag auf dem Bett, hatte das Licht gelöscht, und die Stimme von Macha Béranger schmiegte sich wie ein Einsiedlerkrebs in seine Ohrmuschel. Er war nur noch ein offener Mund auf einem Kopfkissen, der Ausdünstungen von Zahnpasta von sich gab. Ein kleiner Tod, imprägniert mit Wohlgeruch. Was hielt ihn davon ab einzuschlafen? Dass er auf das Geräusch eines Schlüssels im Schloss wartete, oder das nervige Blinken des Anrufbeantworters, das drei Nachrichten anzeigte?
Obwohl er sich vollauf bewusst war, dass er eine Dummheit beging, drückte er auf »Play«.
Erste Nachricht: »Hallo, Fabien, Gilles hier … Jetzt bist du nicht da … Na ja, also … ich hätte Lust gehabt, was trinken zu gehen … Das Junggesellenleben ist nicht wirklich prickelnd … Egal, dann eben ein andermal … Ruf mich an, wenn du wieder da bist. Tschü-hüss! … Ach, und Grüße an Sylvie!«
Zweite Nachricht: »Sylvie? … Sylvie, ich bin’s, Laure! … Wo steckst du denn? … Bist du auf dem Klo? … Okay, du bist nicht da. Also, es ist Samstagabend, und du hattest ja gesagt, dass Fabien dieses Wochenende nicht da ist. Ich hätte Lust, ein Filmchen zu kucken. Es ist jetzt sechs Uhr, also wenn du magst … Bis dann, ciao ciao.«
Dritte Nachricht: »Dies ist eine Nachricht für Fabien Delorme. Bitte melden Sie sich umgehend in der Uniklinik von Dijon. Ihre Frau hatte einen schweren Verkehrsunfall. Sie erreichen uns unter folgender Nummer …«
Drei Mal spielte er das Band ab. Drei Mal hörte er, wie Gilles über sein Singledasein jammerte, wie Laure ihren Vorschlag wiederholte und wie das Krankenhaus in Dijon seine Nummer aufsagte, die er schließlich auf einem Briefumschlag notierte. Nicht eine Sekunde lang glaubte er, dass ihm hier jemand einen Streich spielen wollte oder dass man ihn mit jemandem verwechselte. Er rief nicht sofort zurück. Als Erstes steckte er sich eine Zigarette an und rauchte sie, nackt am Fenster stehend. Er hatte keine Ahnung, was Sylvie in einem Auto in Dijon gemacht hatte, doch einer Sache war er sich sicher, so sicher wie des Windes, der sein Schamhaar kräuselte: dass Sylvie tot war. Er schnippte die Kippe aus dem Fenster, die kurz darauf fünf Etagen tiefer auf dem Dach eines schwarzen Twingo aufschlug.
»Scheiße … Jetzt bin ich Witwer. Ein anderer Mensch. Was soll ich denn jetzt anziehen?«
Seit der Abfahrt