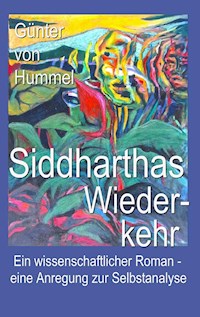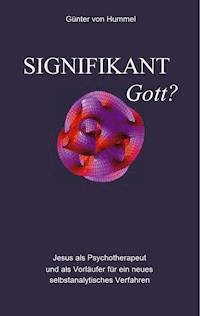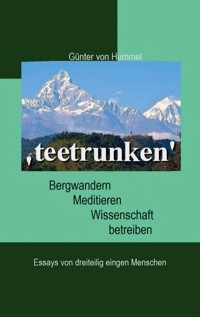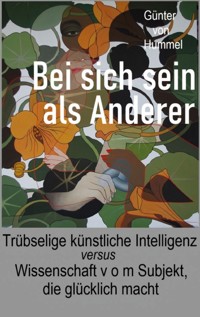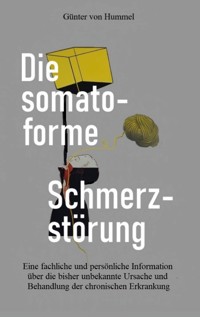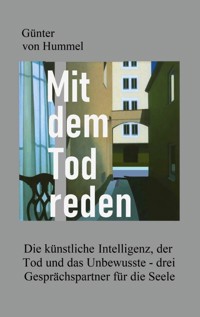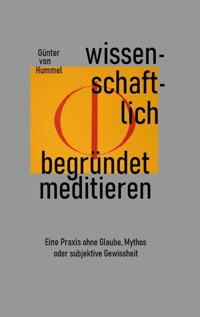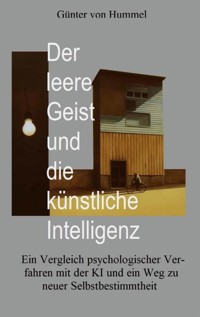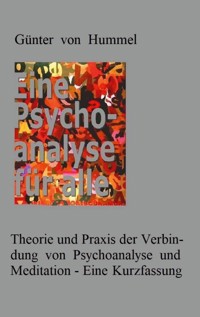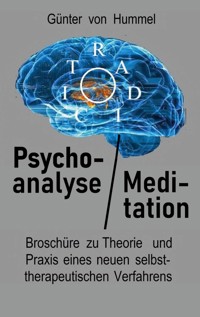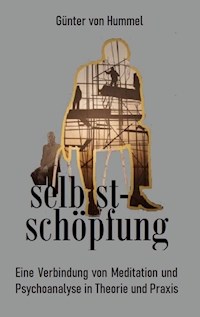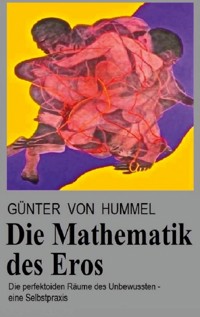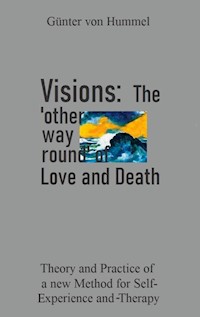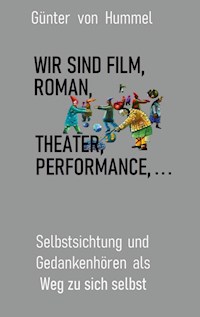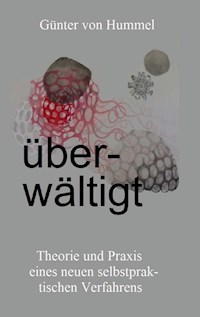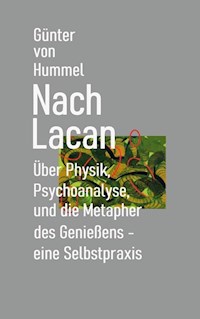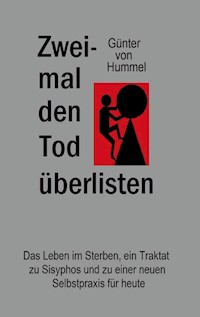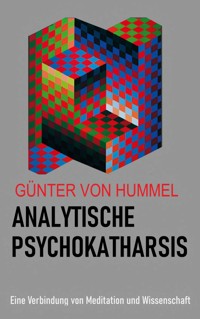
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Analytische Psychokatharsis ist eine neue psychotherapeutische Methode. In ihr sind die wissenschaftlichen Aspekte der Psychoanalyse mit den kathartischen Elementen, wie sie etwa in meditativen Verfahren auftreten, miteinander verbunden. Im Zentrum dieser neuen Methode stehen sogenannte FORMEL-WORTE, die eben in ihrer Struktur genau dem Unbewussten der Psychoanalyse entsprechen, in einer Übungs-Anwendung jedoch dem meditativen Vorgehen gerecht werden. Meditation und Wissenschaft sind somit kein Widerspruch mehr. Das Verfahren kann aus dem Buch selbst erlernt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Bild auf der Umschlagseite zeigt ein Bild des Malers V. Vasarely, der die Op-Art genannte Kunstrichtung verkörperte. Hier handelt es sich um eine ‚konstruktive Geometrie‘ mathematisch berechenbarer und geometrisch ineinander geschachtelter Flächen. So gestückelt und verknotet durchwoben muss man sich auch Körper und Seele des Menschen vorstellen, aber auch so verschiedene psychologische Verfahren wie es die Psychoanalyse auf der einen und die Meditation auf der anderen Seite sind. Es bedarf daher eines ebenso komplex strukturierten Verfahrens, um diese Vielschichtigkeit wissenschaftlich zu behandeln, aufzuschließen und neu zu formen. Ich habe dieses Verfahren „Analytische Psychokatharsis“ genannt, weil es psychoanalytische Erkenntnis mit kathartischer (reinigender, meditativer) Erfahrung in eben solch durchwobener und auch wissenschaftlich klar ausgedrückter Form verbindet.
INHALTSVERZEICHNIS
I.
Einführung in die Thematik
1.1 Hyperräume
1.2 Psychoanalyse und Meditation I
1.3 Kraftlinien
1.4 L‘Autre
1.5 Psychoanalyse und Meditation II
II.
Analytische Psychokatharsis
2.1 Kombinationen des
Erscheinungs- und Wort-
Wirkenden
2.2 Vorübung zum Wesen der Methode
2.3 ARE – VID – EOR und die Praxis des Verfahrens
2.4 Identitäts- oder
Pass-Worte
III.
Zusammenfassung von Theorie und Praxis
3.1 Neurowissenschaftliche Folgerungen
3.2 Jemeinigkeit und formale Unwissenheit
3.3 Die Drei und die ‚Beziehnisliebe‘
3.4 Das Gesetz der patristischen Logik
Anhang
Bibliographie
I.. Einführung in die Thematik
1.1 Hyperräume
Die sogenannten 3-Mannigfaltigkeiten sind etwas Wunderbares. Sie stellen ineinander verwobene Flächen dar, die so komplex sind, dass man sie kaum auf einem Blatt Papier darstellen kann, aber sie verbinden geistige und materielle, gefühlsmäßige und mathematische und weiß Gott was noch für Welten miteinander. Sie sind so sehr ineinander gefaltet, geschachtelt und durchwickelt, dass man von ihnen fast als Körpern ohne Gestalt sprechen muss. Denn körperhaft sind sie, aber um sie zu zeigen und aufzumalen, muss man sie in eigenartige Figuren formen, die sich in sich selbst bewegen und verwirbeln, wie ich es auf der nächsten Seite zeigen will (Abb. 2). Man kann sie auch mit Worten erklären. So gilt für eine einfache kreisförmige Fläche, die auch in ein Rechteck oder in andere Flächen verwandelt werden kann, dass sie eine 1-Mannifaltigkeit oder 1-Sphäre ist, die man auf einer zweidimensionalen Ebene darstellen kann (Abb. 1 unten links). Eine Kugel, obwohl sie drei Dimensionen hat, ist nur eine 2-Mannigfaltigkeit, denn sie hat nur zwei Flächen, eine Innenfläche und eine Außenfläche, die man nicht ineinander überführen, allerdings so mannigfaltig wie man will zerbeulen, dehnen und knautschen kann (Abb. unten rechts, die zeigt, dass die Kugel zur Schüssel hin eingedrückt werden kann, ohne ihre Homöotopie, ihre Gleichstrukturierung, zu verändern).
Abb. 1
Nun schreibe ich hier kein Buch über die erste und zweite Art dieser Gummigeometrie, die man auch Einstein’sche Geometrie oder Topologie nennt, und die – nochmals anders gesagt – in die Hypersphäre, also in einer Art von vierdimensionalem Raum, eingebettet und eingewoben ist. Bei der dritten Art, den 3-Mannigfaltigkeiten oder 3-Sphären, verhält es sich nicht mehr so einfach. Sie rollen also noch eine Dimension mehr ein oder aus, gestalten sie krumm oder quer, lassen sie kreiseln oder auf vielfältigste Weise verbiegen, und gestalten so den hypersphärischen Raum selbst mit. Auf jeden Fall sind sie kaum noch perfekt einsichtig darstellbar. Dennoch ist ihre Existenz für die Abhandlung zu psychischen Phänomenen interessant und hilfreich, denn sie haben nicht nur Bezug zur Form und Wirkung des Universums, beispielsweise im sogenannten hypersphärischen Calabi-Yau-Raum oder in der der Hopf-Fibration (Abb. 2), sondern auch zur Psychoanalyse. „Das Ich“, schreibt Freud beispielsweise, „ist die Projektion einer Oberfläche“, und diese selbst hat wohl mit den komplex gefalteten Gehirnoberflächen zu tun, die neben der Neurologie auch das seelisch Unbewusste betreffen, das über diese hypersphärisch gelegt ist.
Abb. 2 Verdrehung und Verschachtelung (Hopf-Fibration) des Überraums
Bereits das Großhirn stellt die Oberfläche eines Konkavspiegels dar, womit Spiegelungsvorgänge, Optisches, Visuelles mit ins Spiel der psychisch unbewussten Kräfte kommen. Es ist also nicht abwegig, sich solche 3-Mannigfaltigkeiten als optische Modelle auch für neuropsychologische Vorgänge vorzustellen, vorerst einmal ohne konkrete Zuweisungen. Die obenstehende Abbildung zeigt jedenfalls links die Ruhephase und rechts die dynamisch sich wirbelnde Bewegungsphase einer solchen 3-Mannigfaltigkeit. Die Drehungsdynamik um die eingezeichnete Achse der rechten Abbildung wird durch die Filamente oder Fasern angezeigt. Man muss sich vorstellen, dass jede Faser einen Sekundenbruchteil dar-stellt, in dem sich die schalenartigen Besetzungen – von Energie, Strahlung oder was auch immer – turbulent weiterbewegt. In einem Video (z. B. Hopf-Fibration auf YouTube) lässt sich dies alles leicht und besser erkennen.
Warum dies so wunderbar ist, erhellt also nicht nur ein Blick in die Naturwissenschaften wie z. B. die Astrophysik und Topologie, sondern eben auch in ganz andere Bereiche wie die der Kognitionswissenschaften und in deren Zusammenhang mit eigenständigen psychischen Prozessen. Ja, selbst in der Psychoanalyse, der Wissenschaft vom Unbewussten und vom Menschen als purem psychischem Subjekt, dessen Wesen nicht nur mit dem Gehirn und dem Körper erklärt werden kann, finden derartige Anschauungen wie die der 3-Mannigfaltigkeit Anwendung. So hat der französische Psychoanalytiker J. Lacan verschiedene Topologien aus der Welt der 2-Mannigfaltigkeiten dazu benutzt, die Beziehung des Ichs zum Unbewussten, also beispielsweise die Beziehung zum unbewussten Begehren (unbewusster Wünsche) oder die zum ebenso unbewussten Anspruch und speziell auch der beiden untereinander zu verdeutlichen. Diese Gegensätze sind nämlich in der unbewussten Seele des Menschen wie verdreht, verwunden oder anders herum gewickelt als bildhaftes Erscheinungs-Wirkendes, Ikonisches, Optisch-Visuelles, gut zu begreifen, aber auch als Rhetorisches, Symbolisches, Wort-Wirkendes, zu verstehen.1
So ist die 2-Mannigfaltigkeit des Möbius Bandes (Abb. 3) gut dazu geeignet, das bildhafte Erscheinungs-Wirkende im Unbewussten besonders hinsichtlich der Freud‘schen Triebe topologisch darzustellen. Freud nennt die Triebe im Menschen „konstante Kräfte“, die psychische ‚Objekte‘ um- und einkreisen. Dieser Vorgang lässt sich vereinfacht am Möbius Band verstehen, das stets Vor- und Rückseite hat, jedoch nur eine Fläche. Das Gleiche gilt für die Kleinsche Flasche, bei der Außen- und Innenfläche durchgehend ineinander gleiten. In diesen Gestaltungen existieren Ränder, die sich für die Verbildlichung erogener Randzonen (Körperöffnungen) in der Psychoanalyse eignen. Beispiel: die Mund und Schlund Öffnung, die die erogene Randzone für das ‚Objekt‘ des Oral-Triebs (Mundbeziehung zur Brust der Mutter) beim Stillvorgang darstellt. Später wird es der Gaumenkitzel des ‚amuse gueule‘ sein, der diese Triebfunktion übernimmt, und im Assimilierungs-Begehren, also diesem Drang schnell etwas völlig zu verinnerlichen, kann man einen besonders ausgeprägtes, orales, Verschmelzungsbegehren sehen.
Abb. 3 2-Manning-faltig-ketien
Trotzdem wird das Wesen des psychoanalytisch konzipierten Unbewussten durch diese plastisch bildhafte, geometrisierte und mathematisierte Weise nicht praxisnahe genug erfasst. denn in der Psychoanalyse spielen wie erwähnt neben dem Optisch-Bildhaften, dem Erscheinungs-Wirkenden, die Worte, das Wort-Wirkende, die Hauptrolle. Ich verwende diese Bezeichnungen, weil es ja nicht nur ums Bild oder ums Wort geht, sondern um die spezielle Wirkkraft in ihnen, die mit den Freud’schen Trieben zu tun hat. Lacan sprach diesbezüglich vom imaginären und verbalen Signifikanten. Er hat Begriffe aus der Sprachwissenschaft zur besseren Erläuterung psychoanalytischer Vorgänge verwendet. In der Sprachwissenschaft, der Linguistik, und speziell in der darauf bezogenen Psychoanalyse, spielen nicht so sehr das mit Worten Bezeichnete (Signifikat), sondern der/das im Wortzusammenhang Bezeichnende (Signifikant) die entscheidende Rolle.
Was wirkt im Wort, was ist das eigentlich Wort-Wirkende, Symbolische? Wenn die Mannigfaltigkeiten, die Topologie, das Erscheinungs-Wirkende sind, weil es auch die Dynamik, Wirkweise und Ikonische des Bildes vermittelt, so sind eben exakt die aus dem Unbewussten stammenden Beiträge zur Sprache das Wort-Wirkende, verbal Signifikante. Beim Freud‘schen Versprecher beispielsweise wirkt das aus dem Unbewussten kommende Sprachliche zutreffender, wahrer, realer, als das bewusst Gesagte. Es ist wort-wirkender, sprachmächtiger. Dies mag eine kurze Geschichte von Heinrich Heine besser erklären. Heinrich Heine erzählte einmal von einem Mann, der mit seiner Bekanntschaft des reichen Baron Rothschilds prahlen wollte. Er wollte sagen, dass er mit ihm wie „familiär“ verbunden sei, sagte dann aber: „ich bin mit ihm so „famillionär“. Die Wahrheit also, dass es doch die Millionen sind, die ihn faszinierten, und nicht die Familienliebe, rutschte ihm so aus dem Unbewussten heraus. Im Versprecher des „famillionär“ steckt eine Mehrfachbedeutung, nämlich die des Familiären und der Millionen, wie es unten in der Abbildung gezeigt ist. Die Unverblümtheit einer Habgier war also das eigentlich Wort-Wirkende in dieser Geschichte, und nicht all das, was der Betreffende über seine Bekanntschaft mit dem Baron Rothschild bewusst erzählte. Die Abbildung erklärt auch, wie der Versprecher durch das Verrutschen von nur ein paar Buchstaben zustande kommt.
Abb. 4 Die Vielschichtigkeit dreier Bedeutungen entsprechend ihrer laut-bildlichen Struktur unter ei-nander geschrieben.
Mein Vorgehen, das Psychoanalyse und Meditation in einem eigenen Verfahren, Analytische Psychokatharsis genannt, zusammenbringen will, stützt sich auf beide Grundlagen, auf die des Erscheinungs- und die des Wort-Wirkenden, wobei eben ersteres mehr der Meditation, letzteres der Psychoanalyse zuzuschlagen ist. So hat es nichts mit Esoterik oder anderen spekulativen Methoden zu tun. Ich verfüge über eine exakt wissenschaftliche Begründung für dieses aus den beiden Grundlagen zusammengesetzte Verfahren der Analytischen Psychokatharsis, weil es psychoanalytische und kathartisch-meditative Elemente in gleichem Maße enthält. Das Erscheinungs-Wirkende der Mannigfaltigkeiten ist genauso in der Meditation wie in der Psychoanalyse enthalten, wie ich noch im Detail erklären werde. Nun genügen für die Methode der Analytischen Psychokatharsis die bildlichen, 2-oder 3-mannigfaltigen Gestaltungen alleine nicht. Ich muss dafür also auch Teile des Wort-Wirkenden verwenden.
Bekanntlich werden in den Meditation Mantren (Yoga), ‚formelhafte Vorsatzbildungen‘ (autogenes Training) oder anderen Formulierungen als praktische Stütze verwendet, auch wenn dieses Wort-Wirkende nicht die Domäne der Meditation ist. Sie selbst hat viel mehr mit dem Erscheinungs- Wirkenden des Hypersphärischen, der 3-Sphären, zu tun. Und in der Psychoanalyse? Wenn Lacan sagt, dass das Unbewusste strukturiert ist „w i e eine Sprache“, dann liegt in dem ‚w i e‘ der Erscheinungs-Wirkende und im Begriff ‚Sprache‘ der Wort-Wirkende Anteil. Auch im Traum, im Film, im Leben ganz generell vermischen und finden sich ja ständig Bild und Ton, Imaginäres und Symbolisches, Licht und Laut, Erscheinungs- und Wort-Wirkendes.
Wenn ich für die in der Psychoanalyse wesentliche Betonung des Wortes ein Wirkendes dahinter gesetzt habe, so weil in bestimmten Verhältnissen, z. B. im Unbewussten, das Wesen der (verbalen) Signifikanten hervorgehoben wird. Es wird zu einem Symbolisch-Realen. Das Reale ist nicht die äußere Realität, sondern mehr das innere, oder das innen-außen verbindende Wirkende. Eine Signifikanten-Struktur kommt zwar speziell auch dadurch zustande, dass Erscheinungs- und Wort-Wirkendes miteinander kombiniert sind. Doch nachdem ich beim ‚w i e‘ die Mannigfaltigkeiten zur Illustration herangezogen habe, will ich für den Begriff ‚w i e eine Sprache‘ etwas anderes, wenn auch wieder der Geometrie bzw. Topologie Ähnliches zur besseren Verständlichkeit verwenden. Die sogenannte unendliche Gerade verschwindet beispielsweise nicht vollkommen in der Unendlichkeit, sie schließt sich – wie Lacan und andere immer wieder bemerken – irgendwo wieder zum Kreis.(2) Dies gilt vor allem für die ‚Sprache‘ des Unbewussten, wo schon allein der in der Psychoanalyse von Freud herausgehobene Wiederholungszwang typisch ist (etwas kreist immer wieder zur selber unbewussten Stelle zurück).
Eine derartige Kreisbewegung gibt es auch in der Sprachwissenschaft. Verkürzt gesagt, geht es in diesem wi e eine Sprache um die Bewegung vom rein Prosodischen, vompuren Wortklang, bis hin zu den ausgefeilten hochsprachlichen Traktaten, wieder zurück zur Lyrik, in der Klang und Text eine wunderbare Mischung eingehen, und sich schließlich in weiteren hundert anderen wortwirkenden Formen verstrudeln. Ich gehe jetzt allerdings zu schnell, zu vorausgreifend und den Leser überfordernd vor, wenn ich nunmehr ein wichtiges und wesentliches Element der Analytischen Psychokatharsis vorstelle. Aber ich will schon in diesem ersten Kapitel eine Übersicht über das Gesamte geben. Man muss es also unter diesem Aspekt sehen, dass und wie ich für die Analytische Psychokatharsis den Kreis der Worte, also eine Kreisschreibung benutzt habe, um das zentrale Element dieses Verfahrens darzustellen.
Abb. 5
Die oben nebenstehende Abbildung zeigt einen derartigen kreisförmigen Schriftzug. Verwendet wurde die dafür besonders geeignete lateinische Sprache, aber man könnte auch jede andere Sprache gebrauchen. Dieser durchgehende Schriftzug weist aber eine weitere Besonderheit auf. Folgt man der hier im Kreis geschriebenen Lautfolge E-N-S-C-I-S-N-O-M im Uhrzeigersinn, kann man – beginnend an verschiedenen Stellen, die durch die Striche, bzw. Schnittstellen markiert sind, immer wieder eine andere Bedeutung herauslesen. Mehrmals den Schriftzug lesend wird auf diese Weise nicht immer eine Buchstabenfolge, die nur eine Bedeutung hat, wiederholt, sondern mehrere Bedeutungen, die in der Buchstabenfolge stecken. Doch was hat das für einen Sinn? Es geht darum, diese Formulierung zu meditieren, d. h. sie rein gedanklich, langsam und fast etwas monoton zu wiederholen. Denn nur so wird das Unbewusste geweckt und ist es bereit, zu reagieren, zu antworten, denn jetzt ist nicht Bewusstes gefordert, das bewusster Sprache folgt, sondern genau diese w i e eine Sprache, die dem Unbewussten folgt.
Ich gehe im Verlauf des Buches ausführlich darauf ein, was das alles heißen soll. Diese ersten Seiten sollen also nur einen Überblick ermöglichen, um was es sich bei der Analytischen Psychokatharsis handeln wird. Das zentrale Element wird diese im Kreis geschriebene Formulierung sein, und zwar genau deswegen, weil durch die verschiedenen herauszulesenden Bedeutungen, keine einheitliche Gesamtbedeutung mehr zustande kommt, die Sinn macht. Einen schon fertigen Sinn zu meditieren, wäre kontraproduktiv, er würde zu einem lästigen Ohrwurm werden, den man nicht mehr als auswendig lernen und zur Verblödung verwenden könnte.(3)Dagegen provoziert das Überdeterminierte (ein Ausdruck Freuds für die mehrfache Bestimmung einer einzelnen Bedeutung) des im Kreis geschriebenen w i e einer Sprache das Unbewusste dazu seine Wahrheit herauszugeben.
Die Vielschichtigkeit, die Mehrdeutigkeit der Bedeutungen aber gehen also wie beim Versprecher in die Vielschichtigkeit des Unbewussten ein und bewegen es zu einer Reaktion, regen es zu einer Antwort an. Solch ein Element ist in der Meditation wie in der Psychoanalyse wichtig. Das Unbewusste lässt sich meditativ nicht wecken, wenn man ihm bewusste, in Bedeutung und Sinn schon vorgefasste Formulierungen liefert. Es muss eine Überdeterminierung vorliegen, die aus dem mehrdeutigen Schriftzug ein Sprechen macht, das nichts sagt und somit nichts schon Fertiges, Absichtliches, Suggestives vorbringt. Und damit es das Unbewusste ist, das so zu einer Aussage provoziert wird.
In der Psychoanalyse ist das Überdeterminierte im Traum schon da, und nunmehr muss umgekehrt aus dieser Provokation wirrer Traumbilder und -sätze die einzelne, eindeutige Aussage herausgefunden werden, die als vom Unbewussten stammend benötigt wird. Um das Ganze für die Analytische Psychokatharsis nochmals deutlicher zu machen und auch klar zu legen, wie nun die beiden Grundelemente, Grundkräfte, das Erscheinungs- und das Wort-Wirkende, zusammenhängen und ineinandergreifen, habe ich diese überdeterminierte, scheinbar nichts sagende, weil durch zu viele verschiedene, sich nicht ergänzende, sondern eher sich widersprechende Bedeutungen bestimmte Formulierungen auf topologische, mannigfaltige Figuren geschrieben. So kann man sich erst richtig vorstellen, wie das Ganze in der menschlichen Seele wirkt.
Abb. 6 Mit einem Formel-Wort beschriftete Topologien
Ich habe also in die Windungen und Verschachtelungen der 3-Mannigfaltigkeiten Buchstaben geschrieben, die mit ihrer Laut-folge das bildlich Erscheinende ins letztlich Real-Wirkende verwandeln sollen. Die obige Abbildung 6 zeigt derartige Gebilde. Links das bereits oben gezeigte Möbius Band mit aufgezeichnetemSchriftzug. Doch in dem darin befindliche Schriftzug aus der lateinischen Sprache werden durch die topologischen Verdrehungen die Schnittstellen erzeugt, die ich oben wie erwähnt in Form der Striche dargestellt habe. Schließlich arbeitet das Unbewusste genau so, erscheinungs-wirkend verknotet und wort-wirkend verfasst. Eigentlich ist alles ganz einfach, denn es geht immer wieder nur um diese zwei Grundgegebenheiten und ihren gebildeten und verlautenden Zusammenhang. Doch noch einfacher ist die Praxis, die ich mit dem Teil, der meditiert werden soll, schon angedeutet habe und später noch ausführlicher beschreiben will.
Nochmals: Ich habe damit – was den eigentlichen Inhalt des Buches angeht – schon viel zu weit vorausgegriffen und viel zu viele Begriffe eingeführt. Ich wollte nur anfänglich schon einmal auf die zwei wesentlichen Grundprinzipien hinweisen und werde mich im Folgenden einfacher ausdrücken. Für welche Anwendungen diese Buchstabenschnittstellen wichtig sind und was sie hinsichtlich des Unbewussten bewirken ist schon in etwa sichtbar geworden. Es ist gezeigt, dass es Wege gibt, das Erscheinungs- und das Wort-Wirkende zusammengefügt oder gar ineinander verschachtelt, ‚verschränkt‘. darzustellen, Das ist das Wesentliche, denn, wie gesagt, in der Psychoanalyse fällt das Erscheinungs-Wirkende, Imaginäre, zu schwach aus, in der Meditation dagegen schwächelt das Wort-Wirkende, Symbolische zu deutlich. Sie sind in beiden Fällen nicht effektvoll kombiniert, weshalb es die Analytische Psychokatharsis notwendig macht, in der beide Gegebenheiten gleichgewichtig zusammenarbeiten.
Für das weitere Verständnis des Buches will ich noch etwas zum Begriff des gerade benutzten ‚ineinander verschränkt‘ sagen. Das Wort ‚Verschränkung‘ und der etwa gleichwertige Begriff der Komplementarität kommt aus der Quantenmechanik von N. Bohr und W. Heisenberg. Das Quant war für diese Physiker das kleinst mögliche und nicht mehr weiter herkömmlich methodisch zu bestimmende, energetische Element in der Natur. Man kann Lage und Geschwindigkeit (Impuls) eines Elementarteilchens wie etwa des Elektrons nicht gleichzeitig bestimmen, und so einen kontinuierlichen Energieanstieg dieses Teilchens nicht messen. Nur ein unkontinuierlicher, sprunghafter Zustandswechsel kann pauschal gemessen werden, das Quant; was dazwischen liegt bleibt ‚unbestimmt‘ (Unschärferelation), obwohl es eine rätselhafte ‚Verschränkung‘ der Quanten untereinander gibt.
Viele Physiker, einschließlich A. Einstein hat dies beunruhigt, da damit weiteres Forschen nach der Kausalität im Inneren des Atoms und bezüglich der Quanten Grenzen gesetzt waren. Es hat daher Versuche gegeben (Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment) die Komplementaritäs- bzw. ‚Verschränkungs‘-Theorie anzugreifen. „Wenn wir die Gegenwart genau kennen, können wir die Zukunft berechnen“, meinten sie, aber Heisenberg entgegnete ihnen, „dass hier nicht der Nachsatz, sondern schon die Voraussetzung falsch ist.“ Es ist eben unmöglich die Gegenwart in all ihren Bestimmungsstücken genau kennenzulernen. Die Physik war somit in einer Sackgasse, in der sie bis heute steckt, da sich diese Quantenmechanik Bohrs und Heisenbergs (Theorie des ganz Kleinen) nicht mit der Relativitätstheorie Einsteins (Theorie des ganz Großen) verbinden lässt. Ein gewisses Zusammenwirken der Quanten, ihre sogenannte ‚Verschränkung‘ untereinander bleibt ungeklärt.
Deswegen kehren heute viele Wissenschaftler zu mehr mythischen und fast magischen Erklärungsversuchen der Welt und des Alls zurück. Die Physikerin und Professorin für feministische Philosophie K. Barad, stützt sich in ihren Aussagen zu dem Phänomen der ‚Verschränkung’ zwar auf die erwähnte Komplementaritätstheorie, zusätzlich aber auch auf den Dekonstruktivismus des Philosophen J. Derrida. Barad postuliert, dass Messinstrument und zu messendes Objekt zwar getrennt, andererseits aber auch vollkommen ‚verschränkt‘ und ineinander verwoben sind. Aber nicht nur die Objekte verhalten sich komplementär, sondern auch die Messinstrumente und die Objekte untereinander. Damit verlässt sie zwar eine strengere mathematisch-physikalische Sichtweise, in der gilt, dass eine Einheit (Entität), die in der Physik wirkt, nicht an zwei Punkten zugleich sein kann, sonst bekommt sie eine subjektbezogene, irrationale Form. Denn die ‚Verschränkung‘ von Objekten ist etwas anderes als die der Quanten. Aber an dieser Stelle kommt bei Barad nun Derrida zum Zug.
Dieser meinte, dass selbst die Sprache, mit der wir von der Natur reden, weitgehend unbestimmt ist, man kann immer wieder weiter etwas sagen und so zu keinem endgültigen Sinn gelangen. Deswegen muss man die Aussagen dekonstruieren, um zu ihrer letztlichen Aussage zu kommen. Damit versucht nun Barad die generellen Unbestimmtheiten in allen Lebensbereichen aufzeigen, und macht in etwa folgende Bemerkung: nicht A ist mit B verschränkt, sondern jedes weist bereits in sich selbst eine Unbestimmtheit auf. Selbst Objekte sind in letzter Hinsicht unbestimmt wie auch die Sprache und die Zahlentheorie. Insofern ist eigentlich nur die Unbestimmtheit mit der Unbestimmtheit verschränkt. Die ‚Verschränkung‘ in Physik und anderswo ist nur eine Lücke, ein Fauxpas, ein grundsätzlicher Mangel, und dieser findet sich eben auch in anderen Bereichen, wo Unbestimmtheit auf Unbestimmtheit trifft.
Die ‚Verschränkung‘, der grundsätzliche Mangel, besteht schließlich darin, dass es nicht nur eine ‚Interaktivität‘ zwischen A und B gibt, sondern in jedem der Teile auch eine ‚Intraaktivität‘ herrscht, die ‚iterativ‘, also sich ständig wiederholend ist. All dies nennt Barad auch die Raumzeitmaterialisierung. An jedem Ort zu jeder Zeit realisieren sich Raum und Zeit fassbar, fest umrissen, materialisiert. Aber überschreitet sie damit nicht doch ein bisschen ihre Logik, in der der Physiker und der Philosoph miteinander verschmolzen werden, als seien sie identisch. Ganz im Sinne ihres Hinterfragens von Realismus, dem sie den Konstruktivismus gegenüberstellt, oder Objektivität, die sie oft als simple ‚Verkörperung‘ verstanden wissen will, kommt sie zu etwas, hinter dem die Verführung lauert, von der ich vorhin gesprochen habe: alles ist mit allem wunderbar verbunden und der Mensch kann diese Verbindungen frei benutzen.
Ist nicht die Psychoanalyse mit ihrer Kombination der Triebe eine ähnliche, aber vielleicht bessere Art der ‚Verschränkung‘? Denn die Kombination von Freuds Grundtrieben, dem Wahrnehmungs-, Schautrieb (Raum-, Bild- und Blickbezogenes) und dem dazugehörigen Entäußerungs-, Sprechtrieb (Zeit, Wortbezogenes, Verlautendes), beinhaltet die Möglichkeit eines jeden Einzelnen tatsächlich am Verschränkenden, am Materialisierenden oder am ‚inter‘-, ‚intra‘-‚ und ‚iterativ‘ Agierenden teilzunehmen.(4) Auch Meditation beinhaltet eine Verschränkung (eine Selbst-Verschränkung, könnte man sagen), und damit kann jeder selbst seine Raumzeit – vielleicht nicht gerade ‚materialisieren‘ – aber doch in einer gewissen Weise realisieren. Ich entschuldige mich für diesen Ausflug in wissenschaftliche Spekulationen, aber in Umrissen deuten diese bereits an, um was es in der Analytischen Psychokatharsis geht.
Besser und genau in diesem Sinne schreibt der Philosoph Byung-Chul Han über die heutige Situation: „Die Atomisierung des Lebens geht mit einer atomistischen Identität einher. Man hat nur sich selbst, das kleine ich. Man nimmt gleichsam radikal ab an Raum und Zeit, ja an Welt, an Mit Sein. Die Weltarmut ist eine dyschronische Erscheinung. Sie lässt den Menschen auf seinen kleinen Körper zusammenschrumpfen, den er mit allen Mitteln gesund zu erhalten sucht. Sonst hat man ja gar nichts. Die Gesundheit seines fragilen Körpers ersetzt Welt und Gott. Nichts überdauert den Tod. So fällt es einem heute besonders schwer zu sterben“.5 Man lebt schlecht und altert also, ohne reif und ohne fertig zu werden und ist sozusagen schon tot, bevor es zu Ende ist. Man ist zu sehr vereinzelt und weiß nichts vom großen Ganzen, so Byung-Chul Han‘s Statement.
Die ‚Verschränkung‘ von Realismus und Konstruktivismus und vielen anderen Komplementaritäten wie sie Barad propagiert, sind wohl zu abstrakt, zu metaphysisch, obwohl erst vor kurzem Forscher etwas Passendes dazu realisiert haben, wofür der deutsche Physiker K. v. Klitzing 1985 den Nobelpreis erhielt. Man konnte nachweisen, dass in fester Materie beschleunigte Flussrichtungen von Elektronen existieren, die den genannten topologischen Figuren wie von Geisterhand gesteuert folgen. Inzwischen ist klar geworden, dass es sich um bestimmte Materialklassen handelt und keine rätselhaften Materieeigenschaften bestehen. Es ist wohl nicht so, dass jeder Grashalm, jeder Stein, lebendige Kreisdurchströmungen in sich birgt, mit denen wir, selbst von Energieströmen durchkreist, in Verbindung treten könnten. Wir wären mit allem um uns herum spürbar verschränkt.
Viele Philosophen wie etwa Jane Bennett imBuch ‚Lebhafte Materie‘(6 ) und E. Coccia in seinem Buch ‚Sinnenleben‘, haben ähnlich argumentiert.(7) „Ein Augenöffner“, schreibt eine Rezensentin zu diesen Schilderungen, „und ein neuer wissenschaftlicher Anfang?“ (8) „Kann man sagen“, frägt in einem anderen Zusammenhang (Corona-Krise) die Redakteurin A. Roedig, „dass ein Virus ‚handelt‘“?(9) Ist das Virus nicht der Prototyp des viral Materiellen, indem wir es in seine RNA, Spike-Proteine und seine Moleküle, genau zerlegen können wie eine Harley Davidson, das aber dann die eigenwilligste Lebhaftigkeit entwickelt (extrem unterschiedlichste Verläufe der Krankheit), die man sich vorstellen kann. Seltsam, dass ausgerechnet jetzt solche Bücher erscheinen, die sich gegen die Vereinzelung der Menschen wehren, und eine Rückkehr zum ‚Viruszustand‘ propagieren. All diese Autoren, so kommt mir vor, wollen einen Gott (omnipotentes Virus) und Teufel (eigensüchtiger Mensch) zu einem Pakt, zu einer ‚Verschränkung‘, zu einer Rettung des heutigen Hiob zusammenschließen.
Mich erinnern diese Argumentationen eher an Freuds Libido, die ja seiner Meinung nach beim Mann mehr nach außen strömt, während sie sich in der Frau im wellenartigen, ‚fließenden Rhythmus‘, zum Kreis schließt. Während die Psychoanalytiker daher beim Mann von der ‚phallischen Lust‘ sprechen, bezieht sich Lacan bei der Frau aufs autochthone Genießen (Jouissance). Prädestiniert dies nicht die Frauen zur perfekten libidinösen Kommunikation mit der Natur und dem Kosmos? Dass sich die Frauen dieses ‚fließenden Rhythmus‘ nicht so bewusst sind, weil sie sich oft der männlichen Art der Libido annähern, ändert nichts an der Tatsache, dass es sich hier ums Reale (Freuds ‚psychische Realität‘) handelt. Und welche 3-Mannigfaltigkeit wäre hier als Vermittler dieser ‚Verschränkungserfahrungen‘ zuständig? Und welche Rhetorik? Ich lasse die Frage offen, zu viele wissenschaftliche Zwischenschritte wären hierzu noch zu klären. Man kann vielleicht nur eines sagen: die ‚Verschränkung‘, der ‚vitale Materialismus‘ lässt sehr stark an das in der Psychoanalyse bekannte ‚Verschmelzungsphantasma‘ denken, das im tiefen Unbewussten eines jeden Menschen wohnt und das ich bereits mit dem Assimilierungs-Begehren beschrieben habe. Im Hintergrund steht nämlich nicht die Trennung von der Mutter bei der Geburt, sondern die von der Plazenta, die ja ein großer Teil des eigenen kindlichen Körpers ist, und die damit so eine unbewusste, dunkle Rück-Verschmelzungssehnsucht im Menschen weckt und unerfüllt zurücklässt.
Dem korreliert die am Schau-Trieb festgemachte Blick-Überkreuzung, der man täglich vielfach ausgesetzt ist. Nur jemanden, den man sehr gut kennt und vertraut, oder jemand, mit dem man in intensiver Liebesbeziehung verbunden ist, kann man tief in die Augen schauen. Ansonsten muss man den Blick begrenzen, seinen Drang nach Tiefe hemmen und blockieren, um ein vielschichtiges Soziallleben haben zu können. Im Alltag bemerkt man nicht, dass dieses Beispiel am besten das Wesen der Freud‘schen Triebkraft oder des Lacanschen Begehrens ausdrückt und verbildlicht, weil der ‚Blick‘ als psychisches Objekt nur schwer fassbar ist. Es gibt ein unbewusstes Sehen, das der psychoanalytischen Bearbeitung und Behandlung kaum zugänglich ist, wohl aber in der Analytischen Psychokatharsis – wenn auch eingeschränkt – eine Bedeutung hat und therapeutische Klärung findet.10
In meinem Verfahren der Analytischen Psychokatharsis sehe ich auch eher eine Chance, den Verschränkungsgedanken ganz anders weiter zu verfolgen.(11) Die, Möglichkeit dazu, die ich in den nächsten Kapiteln erklären werde, ist von vornherein so gestaltet, dass die in diesem Verfahren verwendeten und noch weiter zu erklärenden Formel-Worte ‚inter-/intra-aktiv‘ wirken und noch dazu beim Meditieren gedanklich wiederholt werden müssen, sie also auch immer schon ‚iterativ‘ sind. Sie wirken, wie in der Abbildung auf Seite 11 gezeigt nur, indem ihre verschiedenen Bedeutungen zusammen (inter-aktiv) keinen Sinn ergeben und so – immer wieder verworfen – das Unbewusste in sich selbst intraaktiv werden lassen – und zwar durch ständige ‚Iteration‘, Wiederholung. Mehr will ich von der eigentlichen Thematik, um die es geht, in diesem Kapitel nicht schreiben. Jedenfalls liegt in dieser Methode eine Hilfe nicht nur zur Selbsthilfe, wie man gerne sagt, sondern auch zu hilfreicher ‚Selbstverschränkung‘. Dazu noch ein letzter Hinweis.
Ich bin ich zu der Entwicklung des Verfahrens der Analytischen Psychokatharsis letztlich nur gekommen, weil ich mit meinem psychoanalytischen Ausbildungsinstitut nach einiger Zeit nicht so gut zu Rande kam. Ich konnte meine Ausbildung zwar abschließen, fand auch die dortigen Lehrbefugten nett und gebildet, aber mir fehlte eine beeindruckende, schon durch Ausstrahlung überzeugende Persönlichkeit. Diese fand ich dann nach einem längeren Aufenthalt in Indien bei dem Meditationslehrer der damaligen Ministerpräsidentin Indiens, Indira Gandhi, in der Person Kirpal Singhs. Er lehrte einen passiven Yoga (Surat-Shabd Yoga), also hauptsächlich ein meditatives Verfahren, in dem ebenfalls die beiden Grund-Kräfte, -Triebe, das Erscheinungs- und Wort-Wirkende die Hauptrolle spielten. Er bezeichnete sie etwas metaphysisch als ‚Licht‘ (das Luzides des Schautriebs) und ‚Laut‘ (den symbolischen Automatismus des Sprechtriebs).
Dass die Psychoanalyse und der meditative Yoga so große Ähnlichkeiten haben, wurde mir erst klar, als ich mich ausgiebig mit den Seminaren J. Lacans beschäftigte. Denn Lacan betonte den gerade oben erwähnten ‚Blick‘ als ein Objekt des ebenso gerade genannten Luziden und die ‚Stimme‘ als ein Objekt des symbolischen Automatismus bzw. der Signifikanten Struktur. Damit war für mich der Weg frei aus beiden Bereichen, aus dem der Psychoanalyse und aus dem der Meditation, das Wirkungsvollste zu isolieren und es in einem eigenen, neuen therapeutischen, aber auch allgemein stützenden Verfahren zusammen zu führen.
Wie an den in der Psychoanalyse wichtigen Begriffen Regression, seelische Rückkehr, und an der immeditativen Yoga wichtigen Involution zu frühkindlichen Erfahrungsstadien, zu sehen ist, sind solche Zustände für gewisse Erholungs- und Wiederherstellungsvorgänge notwendig und viel bedeutender, als die voll bewusste geistige Tätigkeit und Verfassung. Man spricht dann nicht nur vom Verdrängten, sondern auch von elementareren, ursprünglichen „Urverdrängten“, also einem Zustand psychoanalytischer Notwendigkeit, mit der dann die weniger analysierbaren Bereiche erklärt werden können. Gerade diese elementareren, stärker regressiv genannten Zustände sind für den meditativen Yoga besser zugänglich, während für die Psychoanalyse die Behandlung des Verdrängten den Schwerpunkt darstellt.
Und noch eine Unterscheidung ist wesentlich. Der Neurologe A. R. Lurija hat einen Zusammenhang von Gehirn und Unbewussten schon vor Jahrzehnten begründet, der das Freud’sche ‚Es‘, das Subjekt des Unbewussten, mit den unteren Hirnregionen (Mittel- und Zwischenhirn) in Beziehung setzte. Es geht also nicht um das von der Neurowissenschaft als höhere Hirnfunktionen Bezeichnete, das wesentlich für die Basis des Seelischen sei, sondern eben um die elementareren Funktionen des unbewusst Seelischen. Wie angedeutet, ist das Erscheinungs-Wirkende stärker am Neurowissenschaftlichen beteiligt und kann in einer meditativen Weise besser erfahren werden, es ist auch anfälliger für die Freud‘sche Ur-Verdrängung, und auch das erwähnte Verschmelzungs- bzw. Assimilierungsphantasma, das sich in üblichen Leben eben nie ganz herstellen lässt, spielt hier eine Rolle.(12) Der Mensch sucht nach diesem angeblich verlorenen Glück sein Leben lang, hält es aber nicht verdrängt, sondern direkt seelisch abgespalten, urverdrängt fest.
1.2 Psychoanalyse und Meditation I
Schon die Art, wie man von Meditation spricht, welchen Diskurs, welche Ausdrucksform, man wählt, kann ganz entscheidend sein für das meditative Geschehen selbst. Die Veranschaulichung des Meditativen in einer Theorie steht nämlich in engster Wechselbeziehung zu dem Authentischen der meditativen Praxis und umgekehrt wirkt sich der meditative Vorgang als solcher ganz direkt auf die Theorie aus. Bereits die Schreibweise Meditation/ Wissenschaft oder Meditation / Psychoanalyse, nämlich mit dem Schräg-, bzw. Bruchstrich zwischen den beiden Begriffen, zeigt, dass man mit derartigen Kürzeln etwas ganz knapp ausdrücken kann, was sonst nur umständlich zu umschreiben wäre. Ein senkrechter Strich würde nur Trennung, ein waagerechter nur Verbindung bedeuten. Ich kann damit also ganz kompakt ausdrücken, dass Meditation │Psychoanalyse zu schreiben nicht korrekt wäre, weil beide nicht völlig getrennt sind, aber auch Meditation―Psychoanalyse wäre falsch, weil beide nicht unmittelbar zu verbinden sind. Ich befinde mich wieder bei den schrägen Strichen der Buchstabenschnittstellen, die ebenfalls Verbindendes und Trennendes zugleich bedeuten wie ich ja noch erläutern will.
Natürlich nimmt zu viel undifferenziertes Gerede dem meditativen Vorgang von vornherein etwas weg. Insbesondere deswegen will ich wissenschaftlich (speziell vom Standpunkt der Psychoanalyse Lacans her) und von Meditation (speziell von Standpunkt des Surat-Shabd Yoga ausgehend) sprechen und es auch zeigen. Denn die Wissenschaft ist direkt, unmittelbar und offen, man muss nichts darum herum faseln. Mir ist es – einfach gesagt – eine Herzensangelegenheit, das Schöne und Tiefgründige der Meditation mit der wissenschaftlichen Arbeit zu kombinieren, die ich seit mehreren Jahrzehnten ausübe. Beides eben, Wissenschaft (Psychoanalyse) und Meditation haben so viel Faszinierendes an sich, dass es schade wäre, könnte man sie nicht auf einen direkten Nenner bringen.(13) Selbst wenn wirklich der Kern der Meditation etwas Undefinierbares, Geheimnisvolles, ‚Spirituelles‘ ist, so ist es doch offensichtlich möglich, soviel darüber zu sagen, dass nur noch ein letzter Sprung ins Irrationale des meditativen Vorganges als solchem nötig ist, um in Verbindung mit der Psychoanalyse Theorie und Praxis zu vereinen.
Es gibt ausführliche psychologische Untersuchungen von Meditationssystemen wie beispielsweise von Hölzel, Kniffki, Sudbrack, Huth und anderen.(14), (15) Jedoch führen derartige Forschungen nicht unbedingt zu effektiveren Verfahren. In der Ergründung des Zusammenhangs von Meditation und Wissenschaft kommt man viel weiter, wenn man sich direkt an das Wesen ihrer jeweiligen Einordnung ins Symbolische, ihrer Linguistik und Semiotik und zusätzlich ihres Topologischen und Ikonischen selber hält. Me-ditat-ion enthält geradezu immer schon sein didit (verbreitet), dicit (sagt) und datus (gibt) in sich, wenn ich es einmal durch ein derartiges etymologisch untermauertes Wortspiel sagen darf. Zwar haben in letzter Zeit viele Untersuchungen über Meditation anhand neurowissenschaftlicher Befunde stattgefunden. Das Neuro-Imaging ist eines der beliebtesten Methoden geworden, die Effekte von Meditation durch moderne radiologische Technik zu belegen. Stars solcher Kongresse sind nicht mehr buddhistische Mönche oder Entspannungstherapeuten, sondern Neuroradiologen, die mit Computer- oder Kernspintomographie, am besten noch in Kombination mit einer Positronenemissions-Tomographie (PET), zeigen, wie und was im Gehirn der jeweiligen meditierenden Versuchsperson gerade stattfindet.
Ich werde neueste Ergebnisse dieser Wissenschaft mit entsprechendem Bildmaterial noch in einem späteren Kapitel diskutieren und auch dabei wieder auf die 3-Mannigfaltigkeiten verweisen. Ich möchte jedoch gleich zu Anfang erneut sagen, dass diese Gehirn-Techniken dem Ganzen meist seine Wärme, Subjektbezogenheit und Liebe nehmen, die doch irgendwie so wesentlich für die Meditation sind. In der Meditation will man doch zu sich und evtl. noch über sich hinauskommen, Einsicht gewinnen und noch mehr zu seelischer Reife kommen, und so stehen die Bilder vom Gehirn nicht unbedingt im Vordergrund. Man kann Wissenschaft und Meditation nicht einfach dadurch verbinden, dass man beispielsweise – wie schon geschehen – sagt, die Wissenschaft passiert im linken und die Meditation im rechten Gehirn. Trotzdem sind die Neurologen und ihre Bilder nicht mehr weg zu denken und ich werde also dazu Stellung nehmen.
Die analytischen Psychotherapeuten A. Huth und W. Huth fragen sich in ihrem „Handbuch der Meditation" „vor allem nach dem für die Meditation spezifischen Wissen“.(16) Der Begriff des Wissens ist ein idealerer Parameter für die Darstellung des vorhin geäußerten Zusammenhangs von Meditation / Wissenschaft, als wenn ich jetzt nur einen Gedanken an den anderen reihe, um den besagten gemeinsamen Nenner zu finden. Auch hier wäre vor allem die Psychoanalyse der geeignetste Vermittler, denn in der Psychoanalyse wird das Wissen niemandem aufgedrängt oder suggeriert, sondern aus dem Unbewussten des Einzelnen selbst enthüllt. Doch obwohl A. und W.