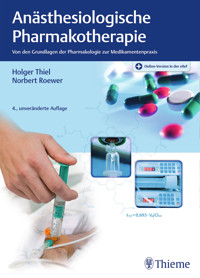
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zum Lernen und Nachschlagen
Fakten und Hintergründe
- Grundlagen der Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Medikamentenapplikation.
- Ausführliche Darstellung der Wirkungsweise aller in Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie gebräuchlichen Pharmaka.
- Vielfältige Therapieschemata zur Medikamentenanwendung und wertvolle Zusatzinformationen, z. B. zur Narkosetheorie.
Aufbau und Ausrichtung
- Übersichtlich: systematische und homogene Gliederung, benutzerfreundliches Register für eine rasche Orientierung.
- Praxisnah: zahlreiche Handlungsempfehlungen, Merkhilfen und Anwendungshinweise.
- Ideal geeignet für die anästhesiologische Weiterbildung und die D.E.S.A.-Prüfung.
- Das fächerübergreifende Nachschlagewerk für alle Ärzte der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1343
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anästhesiologische Pharmakotherapie
Von den Grundlagen der Pharmakologie zur Medikamentenpraxis
Holger Thiel, Norbert Roewer
4., unveränderte Auflage
101 Abbildungen
Vorwort zur 3. Auflage
Der Zweifel nährt den rechten Menschen wohl, hebt ihn hinweg von ach so sichereren Gestaden durch all der düstren Stunden ungelöste Fragen zur reinsten Schönheit wahrer Sinn empor. Ho Thi
Käsebrot ist ein gutes Brot. Helge Schneider
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die „Anästhesiologische Pharmakotherapie“ bietet Ihnen in ihrer nunmehr 3. Auflage einen umfassenden, systematischen Überblick über die wichtigsten Arzneistoffe, die Sie als (angehender) Anästhesist oder (angehende) Anästhesistin einzusetzen pflegen oder mit deren Anwendung Sie in Ihrer klinischen Tätigkeit konfrontiert werden oder werden könnten. Darüber hinaus werden eingehend die Grundprinzipien der Arzneimitteltherapie erläutert, und auf diesem Grundlagenwissen aufbauend wird der Bogen geschlagen zu den speziellen Erfordernissen des anästhesiologischen Alltags.
Bei jeder Neuauflage ist es natürlich nicht nur wichtig, die relevanten Neuerungen aufzunehmen, sondern auch inzwischen überflüssig Gewordenes auszusortieren. In den vergangenen Jahren sind wiederum zahlreiche Medikamente vom (deutschen) Markt verschwunden, aber eben auch zahlreiche hinzugekommen (z.B. Dexmedetomidin, Sugammadex, neue orale Antikoagulanzien) oder wiederentdeckt worden (so z.B. das Antibiotikum Colistin). Schwierig wird es immer dann, wenn es um die Berücksichtigung (hoch)aktueller Entwicklungen und deren potenzielle Auswirkungen in der Zukunft geht. Dies betrifft im konkreten Fall den Stellenwert der Kolloide in der Volumentherapie. Wahrscheinlich steht hier ein radikaler Umbruch bevor.
Den Autoren ist es eine Herzensangelegenheit, dass sich ein jeder Arzt und jede Ärztin gerade neuen Präparaten mit kritischer Distanz nähert, ohne sich diesen aber zu verschließen. Hier gilt es, fernab von Hochglanzprospekten und Marketingaktivitäten der Hersteller sachlich und auf rein wissenschaftlicher Grundlage die Spreu vom Weizen zu trennen und dabei das rechte Augenmaß zu wahren. Wir hoffen ferner, dass Ihnen auch die 3. Auflage unseres Buches auf diesem Weg ein wenig Hilfestellung zu leisten vermag und dass sie das Denken in pharmakologischen Zusammenhängen fördert. Wir hoffen ferner, diesem Anspruch in einer verständlichen Ausdrucksweise gerecht geworden zu sein.
Würzburg im Juli 2013 Holger Thiel Norbert Roewer
Vorwort zur 1. Auflage
Theorie ohne Praxis ist leer – Praxis aber ohne Theorie ist blind. Frei nach Immanuel Kant
Solide pharmakologische Kenntnisse sind für jeden Arzt, ganz besonders aber für den Anästhesisten, unentbehrlich. Denn neben der Physiologie, Pathophysiologie und Nosologie ist gerade die Pharmakologie für ihn ein unbestreitbar wichtiges Rüstzeug, um den Anforderungen der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie tagtäglich gerecht werden zu können. Gleichwohl ist die Aversion vieler gegenüber der Pharmakologie groß – und manch einer findet nie den rechten Zugang. Woran liegt das eigentlich? Zugegeben: die Pharmakologie gründet zunächst einmal auf Theorie – und damit ist sie grau und trocken. Doch wo sonst – wenn nicht in der Anästhesiologie – ließe sich der praktische Erfolg (und leider auch der Misserfolg) besser und schneller wahrnehmen oder, anders gesagt, die Theorie an der Praxis überprüfen und damit die Faszination der Pharmakologie besser erleben?! Allerdings hat die Sache auch einen Pferdefuß, die Theorie nämlich, und die hat gleich zwei Namen: Pharmakodynamik und – womöglich schlimmer noch – Pharmakokinetik. Beide zusammen bilden aber das notwendige Fundament für die klinische Anwendung ebenso wie für die kritische Bewertung von Arzneimitteln und Grundkenntnisse in diesen Gebieten erleichtern nicht nur den rationalen Umgang mit Medikamenten ganz erheblich – sie machen überhaupt erst die Zusammenhänge begreifbar. Die Pharmakodynamik und Pharmakokinetik sind zudem eng mit der Physiologie und Pathophysiologie verflochten. Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, gerade das bei der Betrachtung der Pharmakotherapie herauszustellen, denn je besser man als Arzt mit eben diesen Grundlagen vertraut ist, umso leichter wird es einem fallen, im klinischen Alltag für seine Patienten die richtige Entscheidung zu treffen. Hiernach ist klar: Dieses Buch ist kein Kochbuch – ebenso wenig wie der Anästhesiearbeitsplatz eine Probierstube ist …!
Die „Anästhesiologische Pharmakotherapie“ ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert: einen allgemeinen Teil, in dem die pharmakologischen Grundlagen erläutert werden, und einen speziellen („Medikamentenkunde“), in dem systematisch die für die Anästhesiologie wichtigsten Medikamente besprochen werden. Deren Wirkungen werden soweit wie möglich im physiologisch-pathophysiologischen Kontext dargestellt, die sich daraus ergebenden Anwendungsmöglichkeiten diskutiert und anschließend konkrete Empfehlungen für die Praxis gegeben. Der schnellen Orientierung dienen Medikamentenprofile, die die anwendungsrelevanten Daten tabellarisch zusammenfassen. Im Anschluss an die Besprechung der Inhalations- und intravenösen Anästhetika findet sich außerdem eine kurze Abhandlung über die grundlegenden Wirkungsmechanismen der Narkose, wobei wir versucht haben, uns diesem Thema ganzheitlich zu nähern. Die einzelnen Kapitel und Abschnitte, insbesondere die des speziellen Teils, lassen sich im Wesentlichen auch selektiv lesen und nutzen. Falls erforderlich, wird auf die entsprechenden Stellen in den Grundlagenkapiteln verwiesen. Sonst schlage man einfach im Sachverzeichnis nach.
Die „Anästhesiologische Pharmakotherapie“ richtet sich an den anästhesiologischen Weiterbildungsassistenten ebenso wie an den Facharzt und darüber hinaus fachübergreifend an all diejenigen, die den Umgang mit den besprochenen Medikamenten pflegen.
Würzburg im Juli 2003Holger ThielNorbert Roewer
Abkürzungsverzeichnis
Ach
Acetylcholin
ACT
„activated clotting time“
ACTH
„adrenocorticotropic hormone“
ACE
„angiotensin-converting enzyme“
ADH
antidiuretisches Hormon
ADP
Adenosindiphosphat
ANP
atriales natriuretisches Peptid
AP
Aktionspotenzial
ARDS
„adult respiratory distress syndrome“
ASS
Acetylsalicylsäure
AT
Angiotensin; Antithrombin
AVK
arterielle Verschlusskrankheit
BE
„base excess“
BET
Bolus, Elimination, Transfer
BGA
Blutgasanalyse
BtMG
Betäubungsmittelgesetz
CBF
„cerebral blood flow“
CBV
„cerebral blood volume“
CMRO
2
„cerebral metabolic rate of oxygen“
CO
Kohlenmonoxid
„cardiac output“
CO
2
Kohlendioxid
COPD
„chronic obstructive pulmonary disease“
COX
Zyklooxygenase
CPP
„cerebral perfusion pressure“
CYP
Cytochrom P450
DNA
„deoxyribonucleic acid“
ECT
„ecarin clotting time“
EEG
Elektroenzephalogramm oder -grafie
EF
Ejektionsfraktion
EKG
Elektrokardiogramm oder -grafie
EZR
Extrazellulärraum
FDA
„Food and Drug Administration“
FFP
„fresh frozen plasma“
FIO
2
„fraction of inspired oxygen“
FRC
„functional residual capacity“
GABA
„γ-aminobutyric acid“
GFR
glomeruläre Filtrationsrate
HA
Humanalbumin
HES
Hydroxyethylstärke
HF
Herzfrequenz; Hämofiltration
HI
theparininduzierte Thrombozytopenie
HLM
Herz-Lungen-Maschine
HPV
hypoxische pulmonale Vasokonstriktion
HAT
Hydroxytryptamin
HHL
Hypophysenhinterlappen
HVL
Hypophysenvorderlappen
HZV
Herzzeitvolumen
HWZ
Halbwertszeit
ICP
„intracranial pressure“
IE
Internationale Einheit(en)
INR
„international normalized ratio“
IOP
„intraocular pressure“
IZR
Intrazellulärraum
KG
Körpergewicht
KHK
koronare Herzkrankheit
KOD
kolloidosmotischer Druck
KOF
Körperoberfläche
LA
Lokalanästhesie, Lokalanästhetikum
LMWH
„low molecular weight heparin“
LVEDP
„left ventricular enddiastolic pressure“
MAC
„minimum alveolar concentration“
MAK
maximale Arbeitsplatzkonzentration; minimale antibakterielle Konzentration
MAO
Monoaminoxidase
MAP
„mean arterial pressure“
MH
maligne Hyperthermie
MPS
mononukleäres phagozytierendes System
MR
Muskelrelaxans
NA
Noradrenalin
NMDA
N-Methyl-D-aspartat
NMH
niedermolekulares Heparin
NNM
Nebennierenmark
NNR
Nebennierenrinde
NO
Stickstoff(mon)oxid
N
2
O
Stickoxydul, Lachgas
NOS
NO-Synthetase
NSAID
„non-steroidal anti-inflammatory drug“
PaO
2
arterieller Sauerstoffpartialdruck
PBA
Plexus-brachialis-Anästhesie
PCA
„patient-controlled analgesia“
PChE
Pseudo- oder Plasmacholinesterase
PCWP
„pulmonary capillary wedge pressure“
PDE
Phosphodiesterase
PG
Prostaglandin
PONV
„postoperative nausea and vomiting“
pH
„potentia hydrogenii“
Ppm
„parts per million“
RM
Rückenmark
RAAS
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
RNA
„ribonucleic acid“
rt-PA
„recombinant tissue plasminogen activator“
SB
Standardbicarbonat
SHT
Schädel-Hirn-Trauma
SIRS
„systemic inflammatory response syndrome“
SVES
supraventrikuläre Extrasystole
SvO
2
Sauerstoffsättigung des zentralvenösen Bluts
SVR
„systemic vascular resistance“; „small volume resuscitation“
TCI
„target-controlled infusion“
TENS
transkutane elektrische Nervenstimulation
TIA
transitorische ischämische Attacke
TIVA
total intravenöse Anästhesie
TOF
„train of four“
t-PA
„tissue plasminogen activator“
TPR
„total peripheral resistance“
TTS
transdermales therapeutisches System
UAW
unerwünschte Arzneimittelwirkungen
UFH
unfraktioniertes Heparin
VES
ventrikuläre Extrasystole
WHO
World Health Organization
ZAS
zentralanticholinerges Syndrom
ZNS
zentrales Nervensystem
ZVD
zentralvenöser Druck
ZVK
zentralvenöser Katheter
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Teil I Allgemeiner Teil
1 Grundlagen der Pharmakologie
1.1 Das Pharmakon
1.2 Allgemeine Pharmakodynamik
1.2.1 Wirkungsmechanismen
1.2.2 Rezeptortheorie
1.2.3 Agonisten und Antagonisten
1.2.4 Struktur-Wirkungs-Beziehungen
1.2.5 Quantifizierung von Pharmakaeffekten
1.2.6 Veränderung rezeptorgekoppelter Effekte
1.2.7 Gewöhnung
1.3 Allgemeine Pharmakokinetik
1.3.1 Einführung
1.3.2 Physikochemische Substanzeigenschaften
1.3.3 Aufnahme und Applikationswege
1.3.4 Verteilung und Verteilungsräume
1.3.5 Elimination
1.3.6 Grundlegende pharmakokinetische Berechnungen
1.3.7 Lineare und nicht lineare Kinetik
1.3.8 Kompartimentmodelle
1.3.9 Klinische Konsequenzen
1.4 Allgemeine Arzneimittelnebenwirkungen
1.4.1 Toxische Effekte
1.4.2 Sekundäre oder indirekte Nebenwirkungen
1.4.3 Interaktionen
1.4.4 Leberschädigung
1.4.5 Nierenschädigung
1.4.6 Allergische und allergoide Reaktionen
1.5 Arzneimittelzulassung
1.5.1 Präklinische Untersuchungen
1.5.2 Klinische Untersuchungen
1.6 Bewertung (neu) eingeführter Arzneimittel
1.6.1 Situation auf dem deutschen Arzneimittelmarkt
1.6.2 Generika
1.6.3 Analogpräparate
1.6.4 Bewertungskriterien
1.6.5 Offizinelle Präparate
1.7 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch von Arzneimitteln
1.7.1 Ärztliche Therapiefreiheit
1.7.2 Problematik in der klinischen Anästhesie
2 Praktische Anwendung von Pharmaka
2.1 Allgemeine pharmakotherapeutische Grundsätze
2.1.1 Auswahlkriterien
2.1.2 Kombinationskriterien
2.1.3 Applikationskriterien
2.2 Intravenöse Applikation
2.2.1 Peripher- oder zentralvenös?
2.3 Applikationswege in der Übersicht
2.4 Physikochemische Inkompatibilitäten
2.4.1 Diagnose und Konsequenzen
2.4.2 Prophylaxe
2.5 Leitsätze zur intravenösen Injektion und Infusion
Teil II Medikamentenkunde
3 Anästhetika, Hypnotika und Sedativa
3.1 Begriffsbestimmungen
3.1.1 Dämpfung zerebraler Funktionen
3.2 Inhalationsanästhetika
3.2.1 Zentralnervöse Pharmakodynamik
3.2.2 Nebenwirkungen von Inhalationsanästhetika
3.2.3 Umweltbelastung durch Inhalationsanästhetika
3.2.4 Arbeitsplatzbelastung durch Inhalationsanästhetika
3.2.5 Pharmakokinetik
3.2.6 Stellenwert der einzelnen Substanzen
3.2.7 Klinische Anwendung der Inhalationsanästhesie
3.3 Intravenöse Hypnotika und Sedativa
3.3.1 Barbiturate
3.3.2 Propofol
3.3.3 Etomidat
3.3.4 Benzodiazepine und benzodiazepinartige Verbindungen
3.3.5 Ketamin
3.3.6 Clonidin
3.3.7 Klinische Anwendung der intravenösen Anästhesie
3.3.8 Appendix
3.4 Lokalanästhetika
3.4.1 Chemische Struktur
3.4.2 Pharmakodynamik
3.4.3 Pharmakokinetik
3.4.4 Allgemeine Nebenwirkungen von Lokalanästhetika
3.4.5 Klinische Anwendung der Lokalanästhetika
4 Analgetika
4.1 Physiologie und Pathophysiologie des Schmerzes
4.1.1 Grundaufbau des nozizeptiven Systems
4.1.2 Schmerzentstehung
4.1.3 Schmerzmodulation
4.1.4 Pathophysiologische Auswirkungen von Schmerzen
4.1.5 Postoperativer Wundschmerz
4.2 Pharmakologische Grundprinzipien der Schmerzhemmung
4.2.1 Pharmakologische Hauptansatzpunkte
4.2.2 Analgesie als Komponente der Anästhesie
4.2.3 Multimodale Schmerztherapiekonzepte
4.3 Opioide
4.3.1 Substanzübersicht und Anwendungsgebiete
4.3.2 Chemie
4.3.3 Pharmakodynamik
4.3.4 Nebenwirkungen der Opioide
4.3.5 Pharmakokinetik
4.3.6 Klinische Anwendung der Opioide
4.3.7 Opioidantagonisten
4.4 Nicht-Opioid-Analgetika
4.4.1 Substanzübersicht und Anwendungsgebiete
4.4.2 Nicht steroidale Antiphlogistika
4.4.3 Anilinderivate
4.4.4 Pyrazolderivate
4.4.5 Triptane
4.4.6 Spasmolytika
4.4.7 Klinische Anwendung der Nicht-Opioid-Analgetika
5 Muskelrelaxanzien
5.1 Substanzübersicht
5.2 Grundlagen der neuromuskulären Übertragung
5.2.1 Nikotinerger Rezeptor
5.2.2 Inaktivierung von Acetylcholin
5.3 Pharmakodynamik
5.3.1 Chemische Grundstruktur der Muskelrelaxanzien
5.3.2 Depolarisierende Muskelrelaxanzien
5.3.3 Nichtdepolarisierende Muskelrelaxanzien
5.3.4 Dosis-Wirkungs-Beziehung
5.4 Nebenwirkungen
5.4.1 Atmung
5.4.2 Herz und Kreislauf
5.4.3 Histaminfreisetzung
5.4.4 Intrakranieller und intraokularer Druck
5.4.5 Besondere Nebenwirkungen unter Succinylcholin
5.4.6 Interaktionen
5.5 Pharmakokinetik
5.5.1 Ablauf der neuromuskulären Blockade
5.5.2 Elimination der Muskelrelaxanzien
5.6 Stellenwert der einzelnen Substanzen
5.6.1 Succinylcholin
5.6.2 Nichtdepolarisierende Muskelrelaxanzien
5.7 Antagonisten
5.7.1 Cholinesterasehemmer
5.7.2 Sugammadex
5.8 Klinische Anwendung
5.8.1 Allgemeines
5.8.2 Beurteilung der neuromuskulären Funktion
5.8.3 Muskelrelaxanzien bei neuromuskulären Erkrankungen
6 Perioperative Pharmakotherapie
6.1 Flüssigkeits- und Volumenersatz
6.1.1 Physiologische Grundzüge der Organdurchblutung und O2-Versorgung
6.1.2 Kristalloide Infusionslösungen
6.1.3 Kolloidale Plasmaersatzmittel
6.1.4 Hypertone Kolloidpräparate
6.2 Puffersubstanzen
6.2.1 Pufferungsrelevante Störungen des Säure-Basen-Haushalts
6.2.2 Alkalisierende Substanzen
6.2.3 Azidifizierende Substanzen
6.3 Kardiovaskulotrope Pharmaka
6.3.1 Grundzüge der Herz-Kreislauf-Regulation
6.3.2 Parasympatholytika
6.3.3 β1-Adrenozeptor-Agonisten
6.3.4 Einfache Vasopressoren
6.3.5 Katecholamine und Kalziumsensitizer
6.3.6 β-Adrenozeptor-Antagonisten
6.3.7 Zentrale α2-Adrenozeptor-Agonisten
6.3.8 α-Adrenozeptor-Antagonisten
6.3.9 Direkte Vasodilatatoren
6.3.10 Kalziumantagonisten
6.3.11 Reninhemmer, ACE-Hemmer und AT1-Rezeptor-Antagonisten
6.3.12 Phosphodiesterase-III-Hemmer
6.3.13 Stickstoff(mon)oxid
6.3.14 Arachidonsäurederivate
6.3.15 Herzglykoside
6.3.16 Diuretika
6.3.17 Antiarrhythmika
6.3.18 Medikamentöse Differenzialtherapie bei kardiovaskulären Erkrankungen
6.3.19 Kardiovaskulotrope Pharmaka und Lungendurchblutung
6.3.20 Kardiovaskulotrope Pharmaka und Hirndurchblutung
6.4 Antiasthmatika
6.4.1 Bronchodilatatoren
6.4.2 Glukokortikoide
6.4.3 Antiallergika
6.4.4 Expektoranzien
6.4.5 Antitussiva
6.4.6 Medikamentöse Differenzialtherapie bei COPD und Asthma bronchiale
6.5 Antihistaminika
6.5.1 Histamin und Histaminrezeptoren
6.5.2 H1- und H2-Rezeptor-Antagonisten
6.6 Antiemetika
6.6.1 Anatomisch-physiologische Grundlagen von Übelkeit und Erbrechen
6.6.2 Übelkeit und Erbrechen in der postoperativen Phase
6.6.3 Antiemetische Substanzen
6.6.4 Perioperative Emesisprophylaxe
6.7 Gastrointestinal und urogenital wirkende Pharmaka
6.7.1 Ulkustherapeutika
6.7.2 Prokinetika
6.7.3 Spasmolytika
6.7.4 Laxanzien
6.7.5 Antidiarrhoika
6.7.6 Karminativa
6.8 Uterusaktive Pharmaka
6.8.1 Uterusstimulanzien
6.8.2 Tokolytika
6.9 Hormone und endokrin wirkende Pharmaka
6.9.1 Antidiabetika
6.9.2 Glukokortikoide
6.9.3 Schilddrüsenmedikamente
6.9.4 Antidiuretisches Hormon
6.10 Gerinnungsaktive Substanzen
6.10.1 Pharmakologische Möglichkeiten der Hämostasebeeinflussung
6.10.2 Hemmstoffe der plasmatischen Gerinnung (Antikoagulanzien)
6.10.3 Thrombozytenaggregationshemmer
6.10.4 Fibrinolytika
6.10.5 Antifibrinolytika
6.10.6 Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren
6.10.7 Kalzium
6.10.8 Rückenmarknahe Anästhesie und Antikoagulanzien
6.11 Antiinfektiosa
6.11.1 Grundprinzipien des Einsatzes antimikrobieller Wirkstoffe
6.11.2 Grundlagen der Antibiotikatherapie
6.11.3 Kurzcharakteristik von Antibiotikagruppen und einzelnen Substanzen
6.11.4 Antimykotika
6.11.5 Kalkulierte antiinfektiöse Therapie bei ausgewählten Erkrankungen
6.11.6 Perioperative Antibiotikaprophylaxe
7 Perioperative Besonderheiten
7.1 Vorgehen bei Dauermedikation
7.2 Arzneimittelinteraktionen
7.3 Dantrolen bei maligner Hyperthermie
7.3.1 Maligne Hyperthermie
7.3.2 Dantrolen
7.4 Medikamente bei Porphyrie
7.4.1 Grundlagen des Porphyrinstoffwechsels
7.4.2 Akuter Krankheitsschub
Teil III Anhang
8 Therapeutische Plasmaspiegel von Pharmaka mit geringer therapeutischer Breite
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Allgemeiner Teil
1 Grundlagen der Pharmakologie
2 Praktische Anwendung von Pharmaka
1.2.4 Struktur-Wirkungs-Beziehungen
1.2.4.1 Komplementarität
Die Struktur-Wirkungs-Beziehungen basieren auf der Rezeptortheorie. Hiernach werden spezifische pharmakologische Wirkungen auf bestimmte chemische Strukturmerkmale sowie physikochemische und physikalische Eigenschaften der Reaktionspartner zurückgeführt. Voraussetzung für die bevorzugte Anlagerung eines Liganden an „seinen“ Rezeptor ist seine molekulare Passgenauigkeit für die Strukturen des Rezeptors („Affinität“). Dies bedingt neben der Grundpassform (Molekülgröße, Form und räumliche Anordnung) eine Strukturkomplementarität zwischen den Ligand- und den Rezeptormolekülen.
Komplementarität besteht am ehesten zwischen elektrisch geladenen Gruppen des Liganden und entgegengesetzt geladenen Gruppen der Rezeptorbindungsstellen. Zwischen ihnen werden elektrostatische Anziehungskräfte wirksam, die zu einer reversiblen Ionenbindung der Partner führen. Da das „aktive“, die Konformationsänderung einleitende Zentrum eines Rezeptormoleküls immer geladen ist, tritt die Ionenbindung typischerweise zwischen einer agonistisch wirkenden Substanz und dem Rezeptor auf. Die Ionenbindung ist auch für die primäre Phase der Interaktion von Agonist und Rezeptor von entscheidender Bedeutung, weil ihre Bindungskräfte – verglichen mit den anderen Bindungsarten – die größte Reichweite haben. Solche anderen Bindungsarten sind die Wasserstoffbrückenbindung zwischen den permanenten Dipolen von Peptidketten sowie die apolare Bindung über Van-der-Waals-Kräfte, die für die Bindung von Antagonisten entscheidend ist und zwischen passageren Dipolen abläuft. Ihre Bindungsenergie, besonders die der Van-der-Waals-Kräfte, ist jedoch um einiges geringer als die der Ionenbindung, weshalb diese Bindungen auch leichter reversibel sind. Solcherart Bindungen tragen aber wesentlich zur Ausrichtung des Liganden am Rezeptor und damit zur (reversiblen) Fixierung des Bindungskomplexes bei. Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Bindungen steht die Atom- bzw. kovalente Bindung. Sie ist irreversibel und hat die größte Bindungsenergie, kommt jedoch bei Interaktionen zwischen Rezeptoren und natürlichen, endogenen Liganden üblicherweise nicht vor. Nur einige exogene Liganden, also Pharmaka, sind in der Lage, sich derart mit biologischen Strukturen zu verbinden (z.B. Organophosphat-Intoxikation mit irreversibler Bindung von Phosphorsäureestern an die Acetylcholinesterase).
Auch die unterschiedliche Affinität zu einem bestimmten Rezeptortyp beruht mit auf den Struktureigenschaften der Pharmaka. Hierfür können Seitenketten im Molekül verantwortlich sein. Sie können bei entsprechender Anordnung die Anlagerung an die Rezeptormoleküle sterisch behindern und so zu einer schlechteren Passgenauigkeit führen.
Die Tatsache, dass die Komplementarität über die Ligand-Rezeptor-Bindung entscheidet, macht auch verständlich, dass Agonisten, die an ein und demselben Rezeptor wirken, nicht zwangsläufig eine große strukturelle Ähnlichkeit haben müssen (z.B. wirken Phenothiazine an Muskarinrezeptoren anticholinerg, obwohl sie chemisch nicht mit Acetylcholin verwandt sind). Damit lassen sich viele Nebenwirkungen von Pharmaka erklären.
1.2.4.2 Chiralität
Isomere sind chemische Verbindungen mit gleicher Summenformel. Sie können sich aber in der Struktur („Strukturisomere“) oder auch nur in ganz bestimmten Eigenschaften („Stereoisomere“) voneinander unterscheiden. Bei den Strukturisomeren sind einzelne Atomgruppen, Atome oder Bindungen im Molekül verschieden angeordnet (z.B. cis- oder trans-Position von Aminogruppen). Strukturisomere haben also die gleiche Summenformel, jedoch unterschiedliche Strukturformeln. Demgegenüber ist bei den Stereoisomeren (Syn.: optische Isomere, Enantiomere) nicht nur die Summen-, sondern auch die Strukturformel gleich; sie verhalten sich wie Bild und Spiegelbild (man spricht hier von Chiralität, da auch die Hände zueinander spiegelbildlich symmetrisch sind). Stereoisomere entstehen bei hinreichend komplex aufgebauten Molekülen, die ein Asymmetriezentrum haben (meist ein C-Atom mit 4 verschiedenen Substituenten) und so 2 symmetrische Konfigurationen zulassen. Solche Isomerenpaare werden als Razemate bezeichnet. Sie unterscheiden sich nicht in ihren physikochemischen Eigenschaften, sondern lediglich physikalisch, indem sie polarisiertes Licht mit entgegengesetztem Drehsinn brechen. Folglich existieren rechtsdrehende (+) oder D-Formen („dexter“) und linksdrehende (–) oder L-Formen („laevus“). Dieses D/L-System wird allerdings heute fast nur noch für Kohlenhydrate und Aminosäuren verwendet. Eine neuere Nomenklatur teilt die Stereoisomere nach ihrer „absoluten“ chemischen Konfiguration ein (R/S-System [„rectus“ und „sinister“]). Grundlage des R/S-Systems sind die Position der atomaren Substituenten am asymmetrischen Zentrum und die Priorität ihrer Ordnungszahlen im Periodensystem der Elemente.
Wenn Stereoisomere auch physikochemisch gleich reagieren, so differieren sie doch zum Teil recht deutlich in ihren biologischen Wirkungen. Dies liegt daran, dass wesentliche Strukturen im menschlichen Organismus chiral, also stereoselektiv, aufgebaut sind. Für spezifische biologische Reaktionen (also solche mit Rezeptor- oder Enzymbeteiligung) ist somit eine chirale Passform meist unerlässlich ( ▶ Abb. 1.8). So können z.B. nur L-Aminosäuren und D-Glukose vom menschlichen Organismus verwertet werden. Abweichungen von der Chiralität haben eine verminderte, fehlende oder auch qualitativ andere Wirksamkeit zur Folge. Während spezifische Reaktionen stereoselektiv ablaufen, benötigen unspezifische Wirkungen, die z.B. durch Einlagerung von Substanzen in Zellmembranen entstehen, keine besondere Passform, sodass hier rechts- und linksdrehende Formen gleich wirksam sind. Auf diese Art und Weise kann die nicht spezifisch wirkende Form also durchaus zu unerwünschten Effekten beitragen.
Abb. 1.8 Stereospezifität eines Rezeptors (dargestellt am Beispiel eines Tetraeders).
Auch komplex aufgebaute Pharmaka zeigen das Phänomen der Chiralität und sind Razemate (ca. 50 % der im Verkehr befindlichen Wirkstoffe). Die zu gleichen Teilen enthaltenen Enantiomere können sich pharmakodynamisch und pharmakokinetisch erheblich unterscheiden. In manchen Fällen liegt die gesamte pharmakologische Aktivität bei einem der Enantiomere, d.h., nur dieses hat die nötige Komplementarität zur Rezeptorbindungsstelle, während das andere inaktiv ist oder zu unerwünschten, ja sogar antagonistischen Wirkungen führt. Bekannte Beispiele sind L-Noradrenalin, L-Thyroxin, L-Dopa. L-Methadon und L-Hyoscyamin.(5) Sie sind alle wesentlich wirksamer als ihre optischen Antipoden. Das stärker wirksame Enantiomer wird Eutomer, das schwächer oder gar nicht wirksame Distomer genannt. Auch bei der metabolischen Umwandlung von Enantiomeren lassen sich Unterschiede ausmachen, sowohl was die Art als auch was die Geschwindigkeit der Elimination angeht. Dies lässt sich wieder auf die Komplementarität von Arzneistoffen und abbauenden Enzymen zurückführen. Ähnliches trifft auf das pharmakologische Wechselwirkungspotenzial zu. Genau genommen sind Razemate also pharmakologische Kombinationspräparate. Das hat dazu geführt, bei der Neuentwicklung von Pharmaka mit Asymmetriezentren die stereospezifischen Vorteile optischer Isomere zu berücksichtigen und Handelspräparate nicht mehr, wie früher üblich, als Razemat auf den Markt zu bringen, sondern in Form von R- oder S-Isomeren (z.B. S(–)-Ropivacain). Auch bei älteren Präparaten werden zunehmend die Razemate durch Enantiomere ersetzt (z.B. S(+)-Ketamin, S(–)-Bupivacain, S(–)-Omeprazol, S(–)-Ofloxacin). Der Vorteil liegt nicht nur in der besseren Wirksamkeit „maßgeschneiderter“ Arzneistoffe, sondern es lassen sich auch unnötige Substanzbelastungen für den Organismus vermeiden und Nebenwirkungen verringern.
Merke
Die Vorteile der Verwendung von Enantiomeren liegen in einer Erhöhung der Wirkungsspezifität und in einer Reduktion von Nebenwirkungen.
1.2.5 Quantifizierung von Pharmakaeffekten
1.2.5.1 Grundbegriffe
Neben der qualitativen Wirkung eines Arzneimittels interessieren bei seiner praktischen Anwendung auch die Zusammenhänge zwischen der zugeführten Menge (Dosis) und deren Effekt, und zwar im Hinblick auf die Haupt- und die Nebenwirkungen. Mit folgenden Grundbegriffen lässt sich die Wirksamkeit eines Pharmakons im Organismus charakterisieren:
intrinsische Aktivität
Affinität
Dosis-Wirkungs-Kurve
effektive Dosis
therapeutische Breite
Intrinsische Aktivität und Affinität
Von der intrinsischen Aktivität, unter der man die größtmögliche Wirkung eines Arzneimittels versteht (s. auch Kap. ▶ 1.2.3), muss streng der Begriff Affinität (Syn.: Potenz, Bindungsstärke/-intensität, relative Wirkungsstärke) abgegrenzt werden. Er bezieht sich auf die Menge eines Arzneimittels, die verabreicht werden muss, um eine definierte Wirkung hervorzurufen. Je genauer ein Ligand, abhängig von seiner chemischen Struktur, auf eine Rezeptorbindungsstelle passt („Schlüssel-Schloss-Prinzip“), umso niedriger ist die benötigte Substanzdosis, und umso höher sind seine Affinität und Spezifität. Substanzen mit gleicher intrinsischer Aktivität sind zwar äquieffektiv (die durch sie auslösbaren Maximaleffekte sind also gleich), sie sind jedoch nur dann äquipotent, wenn zur Erzielung der gleichen Wirkungsstärke auch die gleichen Dosen benötigt werden!
Beispiel
Morphin und Fentanyl sind beide reine Opioidagonisten, ihre intrinsische Aktivität ist also gleich. Von Morphin benötigt man 10 mg und von Fentanyl lediglich 0,143 mg, um die gleiche Wirkung zu erreichen. Bezogen auf die bei diesen Substanzen relativ ähnliche Molmasse, bedeutet dies, dass die Affinität von Fentanyl ungefähr um den Faktor 100 größer ist als die von Morphin.
Merke
Die intrinsische Aktivität bestimmt die Maximalwirkung einer Substanz, die Affinität die Dosis, die nötig ist, um diese Wirkung zu erreichen.
Dosis-Wirkungs-Kurve
Die Abhängigkeit der Wirkung eines Pharmakons von seiner Dosis bzw. Konzentration lässt sich grafisch in Form einer Dosis-Wirkungs-Kurve darstellen ( ▶ Abb. 1.9). Hierbei fällt auf, dass die Beziehung zwischen verabreichter Pharmakondosis und biologischem Effekt in der Regel nicht linear verläuft, d.h., eine Dosisverdopplung führt nicht zu einer Verdopplung der Wirkung. In halblogarithmischer Darstellung erhält man – ähnlich der O2-Bindungskurve des Hämoglobins – typischerweise sigmoidale (S-förmige) Kurven, die mit der Hill-Gleichung, einer erweiterten Michaelis-Menten-Gleichung, beschrieben werden können. Bei der Auswertung dieser Kurven interessieren vor allem:
die Schwellendosis, d.h. die kleinste Dosis, bei der ein Effekt eintritt (Maß für die Affinität),
der erreichbare Maximaleffekt (intrinsische Aktivität) sowie
die Anstiegssteilheit der Kurve (Maß für den Dosisbereich zwischen Eintritt und Maximum der Wirkung).
Abb. 1.9 Verschiedene Dosis-Wirkungs-Kurven.
In die Dosis-Wirkungs-Kurve gehen die Beziehungen ein zwischen der Konzentration eines Arzneistoffs im Plasma (bzw. in der Umgebung des Wirkorts) und seiner Bindung an die Rezeptoren sowie zwischen der Bindung und der folgenden Wirkung. Die Dosis-Wirkungs-Kurve ist arzneistoffspezifisch; sie muss zudem für jede einzelne Wirkung eines Pharmakons separat bestimmt werden. So können unerwünschte Wirkungen Kurven aufweisen, die flacher oder steiler verlaufen, links oder rechts von der Kurve der gewünschten Wirkung(en) liegen, was für den klinischen Nutzen und die therapeutische Sicherheit eines Pharmakons entscheidend sein kann.
Effektive Dosis
Ferner wird aus der Dosis-Wirkungs-Kurve die effektive Dosis ermittelt, in der Regel als sog. ED50. Darunter versteht man diejenige Dosis, mit der bei 50 % der Probanden bzw. Patienten der spezifische Maximaleffekt einer Substanz erzielt werden kann oder unter der 50 % des Maximaleffekts bei nur einer Person auftreten. Im ersten Fall, der Untersuchung an einem Kollektiv, wird die biologische Streuung berücksichtigt, also die mitunter sehr ausgeprägte interindividuelle Variabilität der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Die ED50 charakterisiert die Wirksamkeit systemisch verabreichter Pharmaka, z.B. intravenöser Hypnotika, und entspricht dem MAC50-Wert bei den Inhalationsanästhetika (s. Kap. ▶ 3.2.1). Eine weitere wichtige Größe ist die ED95, d.h. die Dosis, die erforderlich ist, um bei einem Individuum 95 % der möglichen Wirkung oder bei 95 % einer Population die maximal mögliche Wirkung zu erreichen. Mit der ED95 wird demnach der submaximale Effekt einer Substanz erfasst.
Therapeutische Breite
Die therapeutische Breite gibt Aufschluss über den Sicherheitsabstand, den ein Arzneimittel bei regelgerechtem Gebrauch in Bezug auf toxische Wirkungen hat. Sie wird gemeinhin mit dem im Tierversuch ermittelten therapeutischen Index„LD50/ED50“ angegeben. Die LD50 bezeichnet dabei die Dosis, die bei 50 % der Tiere einen letalen Effekt hervorruft. Je höher der Index ist, desto sicherer ist das Arzneimittel in seiner klinischen Anwendung. Pharmaka, deren Dosis-Wirkungs-Kurven für toxische Effekte links von der Kurve der gewünschten Hauptwirkung liegen oder sich mit dieser überlagern, eignen sich in der Regel nicht für den Einsatz am Patienten. Hierbei spielt allerdings die Art der Nebenwirkung eine Rolle, was durch folgendes Beispiel verdeutlicht werden soll. Die therapeutische Breite zentral wirkender Anästhetika ist, bezogen auf ihre atemdepressorischen Nebenwirkungen, durchweg sehr niedrig. Sie liegt für volatile Inhalationsanästhetika im Bereich von 1,5–2,0. Das bedeutet, dass bereits bei 1,5–2-facher Dosierung eine potenziell letale Konzentration erreicht wird! Hier überlagern sich die Dosis-Wirkungs-Kurven für den erwünschten und den unerwünschten Effekt. Da die Atemdepression jedoch leicht überwunden werden kann, nämlich durch Beatmung, ist dies von untergeordneter Bedeutung. Anders wäre es, wenn es sich stattdessen um kardiotoxische Nebenwirkungen handelte. Glücklicherweise ist der Sicherheitsabstand in dieser Hinsicht jedoch um ein Vielfaches höher.
1.2.5.2 Synergismus
Im Gegensatz zur Wirkungsabschwächung beim Antagonismus (s. Kap. ▶ 1.2.3) handelt es sich beim Synergismusum eine Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Gabe zweier (oder mehrerer) Pharmaka. Hierbei können sich die Wirkungen der einzelnen Substanzen addieren, manchmal sogar potenzieren.
Addition Eine Addition liegt vor, wenn die Gesamtwirkung gleich der Summe der Einzelwirkungen ist. Sie findet sich vor allem dann, wenn die Substanzen an den gleichen Rezeptoren oder Rezeptorsystemen ansetzen.
Potenzierung Von einer Potenzierung (Supraaddition) spricht man dagegen erst, wenn der Gesamteffekt größer ist, als es sich von der Addition der Einzeleffekte erwarten ließe.(6) Voraussetzung für eine wirkliche Potenzierung ist ein Angriff der Wirkstoffe an unterschiedlichen Rezeptor- bzw. Effektorsystemen. Potenzierende Effekte lassen sich z.B. in der antimikrobiellen Therapie durch sinnvolle Kombination verschiedenartiger bakterizider Antibiotika erzielen (z.B. β-Lactam-Antibiotikum + Aminoglykosid; Einzelheiten s. Kap. ▶ 6.11.2).
Dosis-Wirkungs-Kurven
Um entscheiden zu können, ob ein Synergismus vorliegt und welcher Art er ist, muss der meist sigmoidale Verlauf der Dosis-Wirkungs-Kurven berücksichtigt werden. Erst so lassen sich die quantitativen Aspekte einer Medikamentenwechselwirkung erfassen. Hierbei kann man, wie das Beispiel in ▶ Abb. 1.10 verdeutlicht, wie folgt vorgehen: Um abschätzen zu können, wie ein bestimmter Effekt der Substanz X von der Substanz Y beeinflusst wird, benötigt man von beiden Substanzen zunächst die jeweilige ED50 und ED95 für den untersuchten Effekt. Anschließend werden die Substanzen simultan verabreicht, und zwar in ihrer ED50. Der so erzielte Kombinationseffekt wird mit dem Einzeleffekt von Substanz X auf deren Dosis-Wirkungs-Kurve verglichen ( ▶ Abb. 1.10a). Es sind 4 unterschiedliche Ergebnisse möglich:
Der Kombinationseffekt von X-ED50 und Y-ED50 ist gleich dem Effekt der X-ED95.
Der Kombinationseffekt von X-ED50 und Y-ED50 ist größer als der Effekt der X-ED95.
Der Kombinationseffekt von X-ED50 und Y-ED50 ist kleiner als der Effekt der X-ED95, aber immer noch größer als der Effekt der X-ED50.
(Der Kombinationseffekt von X-ED50 und Y-ED50 ist kleiner als der Effekt der X-ED50.)
Im 1. Fall handelt es sich um einen additiven, im 2. Fall um einen potenzierenden Synergismus. Im 3. Fall dagegen liegt kein Synergismus vor, denn hier können beide Substanzen nicht ihre volle Teilwirkung entfalten. Der erzielte Kombinationseffekt ist subadditiv. Möglicherweise behindern sich die beiden Stoffe gegenseitig auf pharmakodynamischer Ebene oder sie beeinflussen sich in ihrem pharmakokinetischen Verhalten, sodass nicht mehr die ursprünglichen Wirkstoffmengen zu den Wirkorten gelangen können. Der 4. Fall schließlich beschreibt einen partiellen Antagonismus. Er ist in diesem Zusammenhang allerdings nur theoretischer Natur, denn schon bei der Prüfung der ED50 und der ED95 wäre aufgefallen, dass zumindest mit einer der Substanzen überhaupt keine 95%ige Wirkung zu erzielen ist, also gar keine ED95 zu definieren ist.
Isobolografie
Eine weitere Möglichkeit, Kombinationswirkungen darzustellen, bietet die Isobolografie nach Loewe. Im Beispiel in ▶ Abb. 1.10b sind für 2 fiktive Wirkstoffe alle möglichen Dosiskombinationen wiedergegeben, die für die Erzielung eines 95%igen Effekts nötig sind. Bei additiver Wirkung ergibt sich als Isobole (Linie gleicher Wirkung) eine Gerade, bei subadditiver eine Hyperbel und bei Potenzierung eine Parabel.
Abb. 1.10 Beziehung zwischen Dosis und Wirkung bei Pharmakakombinationen.
Abb. 1.10a Mögliche Effekte einer Kombination zweier in ED50 verabreichter Pharmaka.
Abb. 1.10b Isobologramm für die Kombination zweier Pharmaka.
Wirkungsprofile
Synergistische Wechselbeziehungen zwischen Pharmaka können im Hinblick auf erwünschte und unerwünschte Wirkungen bestehen. Therapeutisch positive Synergismen haben oft den Vorteil, dass Nebenwirkungen reduziert werden, weil die gezielt miteinander kombinierten Substanzen jeweils in geringerer Dosis zugeführt werden können. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch ein weiteres Ineinandergreifen von Pharmakawirkungen erwähnt, das vom Synergismus abgegrenzt werden muss. Man spricht nämlich nicht von einem Synergismus, wenn sich lediglich die Wirkungsprofile von Substanzen addieren, d.h. ergänzen oder überschneiden. In der Anästhesie gilt hierzu als das Paradigma schlechthin die Kombinationsnarkose, wenngleich natürlich bei der parallelen Anwendung von Hypnotika, Analgetika und Muskelrelaxanzien auch Synergismen eine Rolle spielen ( ▶ Tab. 1.5 ).
Merke
Beim additiven Synergismus ist der Gesamt- oder Kombinationseffekt zweier (oder mehrerer) Pharmaka gleich der Summe der Einzeleffekte, beim potenzierenden Synergismus ist er größer als die Summe der Einzeleffekte.
Tab. 1.5
Synergismen bei der Kombinationsnarkose.
Substanzkombination
Verstärkter Effekt
Art der Verstärkung
volatile Anästhetika + N2O
Hypnose, Analgesie, Atemdepression
Addition
volatile Anästhetika + Muskelrelaxanzien
Muskelrelaxation
Potenzierung (?)
volatile Anästhetika + Opioide
Analgesie, Atemdepression
Potenzierung (?)
intravenöse Hypnotika + Opioide
Hypnose, Atemdepression
Addition
intravenöse Hypnotika untereinander
Hypnose, Atemdepression
Addition
1.2.6 Veränderung rezeptorgekoppelter Effekte
Rezeptorgekoppelte Homöostasesysteme unterliegen verschiedenen Arten von Rückkopplungssteuerungen oder Feedbackmechanismen. Diese dienen der akuten oder chronischen Modulation des Effekts, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Stimulationsbedingungen gewährleistet werden soll.
1.2.6.1 Akute Effektmodulation
Die Freisetzung des Neurotransmitters Noradrenalin (NA) in den synaptischen Spalt führt parallel zu einer Aktivierung von prä- und postsynaptischen α-Rezeptoren. Während die postsynaptische Erregung die klinische Wirkung vermittelt, bremst die präsynaptische die weitere Ausschüttung von Noradrenalin („negative Rückkopplung“, auch „Feedback-Hemmung“ genannt). Hierdurch werden akut überschießende Reaktionen verhindert. Solche einfachen Gegenregulationsvorgänge finden sich vermutlich bei allen von Zelle zu Zelle ablaufenden rezeptorgekoppelten Signalübertragungen. Im Gegensatz zur negativen Rückkopplung, die im menschlichen Organismus an vielen Rezeptorsystemen anzutreffen ist, kommt eine positive Rückkopplung nur verhältnismäßig selten vor (z.B. steigert an der motorischen Endplatte die Aktivierung präsynaptischer Nikotinrezeptoren durch Acetylcholin die Ausschüttung weiteren Acetylcholins; s. Kap. ▶ 5.2).
Handelt es sich bei den präsynaptischen Rezeptoren um solche, an denen der freigesetzte Überträgerstoff selbst ansetzt (im Beispiel NA), dann spricht man auch von „Autorezeptoren“. Sie müssen von „Heterorezeptoren“ unterschieden werden, die zwar ebenfalls präsynaptisch vorkommen können, aber von anderen Neurotransmittern erregt werden (z.B. kann ACh über cholinerge Rezeptoren die NA-Freisetzung bremsen). Auch durch die Erregung von Heterorezeptoren kann die Ausschüttung des eigentlichen Überträgerstoffs gehemmt oder verstärkt werden.
1.2.6.2 Chronische Effektmodulation
Auch die Bildung von Rezeptoren und deren Aktivitätszustand sind regulativen Veränderungen unterworfen („Rezeptoradaptation“). So verringert sich bei anhaltender Rezeptorstimulation, wie sie bei einer Dauertherapie mit Agonisten oder auch bei einigen chronischen Erkrankungen (z.B. Opioidabhängigkeit, Alkoholismus, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus Typ 2) vorzufinden ist, typischerweise die Wirkungsstärke endogener und exogener Liganden. Dieses Phänomen wird als Desensibilisierung bezeichnet und mit einer Verminderung der Rezeptoraffinität sowie einer Abnahme der Rezeptorzahl erklärt (homologe „Down-Regulation“ von Rezeptoren). Auch hormonelle Einflüsse können hierbei eine Rolle spielen (z.B. Unterfunktion von der Schilddrüse oder Nebennierenrinde). Eine verminderte Rezeptoraffinität hat zur Folge, dass höhere Dosen eines Agonisten zur Erzielung des gewünschten Effekts benötigt werden, eine verringerte Rezeptorzahl reduziert darüber hinaus die maximal erreichbare Wirkung, da weniger stimulierbare Rezeptoren zur Verfügung stehen.
Der umgekehrte Fall einer Hypersensibilisierung tritt bei nachlassender Rezeptorstimulation ein, z.B. bei chronischer Therapie mit Antagonisten, nach Denervierung (z.B. nach Herztransplantation oder bei Querschnittlähmung) oder bei einem Mangel an Neurotransmittern. Auch daran können Störungen des Hormonhaushalts beteiligt sein (z.B. Überfunktion von der Schilddrüse oder Nebennierenrinde). Mit einer Zunahme der Rezeptoraffinität und -zahl (homologe „Up-Regulation“ ) erklärt man sich ferner sog. Rebound-Effekte, das sind z.B. überschießende agonistische Wirkungen nach abruptem Absetzen eines Antagonisten (z.B. Clonidin, β-Rezeptoren-Blocker). Eine Veränderung rezeptorgekoppelter Effekte wird nicht durch den kurzzeitigen Gebrauch einer Substanz ausgelöst (z.B. Narkosen für operative Eingriffe), spielt aber bereits beim Intensivpatienten eine Rolle (z.B. Nachlassen einer über Tage bis Wochen durchgeführten Analgosedierung, wobei hieran auch pharmakokinetische Faktoren beteiligt sind).
Pharmaka, die nur indirekt auf ein bestimmtes Rezeptorsystem einwirken, können ebenfalls dessen Rezeptorendichte verändern (z.B. Zunahme der myokardialen β-Rezeptoren unter dem Einfluss von Schilddrüsenhormonen). Man spricht in solchen Fällen von heterologer Up- bzw. Down-Regulation.
Auch die Kopplung zwischen G-Proteinen und Effektorproteinen unterliegt Veränderungen mit ähnlichen Auswirkungen. Werden z.B. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren vermehrt stimuliert, so soll sich der räumliche Abstand zwischen G-Protein und zugehörigem Effektorprotein vergrößern, was die Signalübertragung erschwert („G-Protein-Desensibilisierung“).
1.2.7 Gewöhnung
Unter Gewöhnung versteht man einen Zustand, in dem bei wiederholter Zufuhr eines Arzneimittels die Dosis gesteigert werden muss, um die gleiche Wirkung wie bei der ersten Applikation zu erzielen. Man spricht hier auch von Toleranzerhöhung.(7) Eine Gewöhnung kann pharmakodynamische (rezeptorgekoppelte), pharmakokinetische oder physiologische Ursachen haben.
Down-Regulation Siehe Kap. ▶ 1.2.6.
Tachyphylaxie Hierunter versteht man eine Gewöhnung, die sehr rasch einsetzt. Man findet sie typischerweise bei der Behandlung mit indirekten Mimetika, die Agonisten aus präsynaptischen Speichern freisetzen. Die in Abständen von Minuten bis Stunden wiederholte Anwendung solcher Mimetika führt zu einer Wirkungsabschwächung, weil die Agonisten nicht mehr schnell genug nachgebildet werden können und deshalb in den Speicherorten nur noch in verminderter Konzentration vorliegen (z.B. nachlassende vasokonstriktorische Wirkung indirekt sympathomimetischer Nasentropfen bei chronischem Gebrauch). Die Speichervorräte können sich auch ganz erschöpfen, was dann einen völligen Wirkungsverlust nach sich zieht. Auch die unter Nitraten eintretende Toleranzerhöhung wird zur Tachyphylaxie gerechnet (s. Kap. ▶ 6.3.9).
Enzyminduktion Hierbei handelt es sich um einen pharmakokinetischen Effekt. Die metabolische Aktivität besonders der Enzyme des Cytochrom-P450-Monooxygenasensystems in der Leber kann durch zahlreiche Pharmaka gesteigert („induziert“) werden (z.B. durch Barbiturate). Das führt bei wiederholter oder kontinuierlicher Gabe solcher Substanzen nach wenigen Tagen zu einem vermehrten Abbau nicht nur ihrer selbst, sondern aller hierüber metabolisierten Stoffe, mit dem Ergebnis, dass sich auch deren Wirkungen abschwächen (Näheres s. Kap. ▶ 1.3.5 und Kap. ▶ 1.4.3).
Physiologische Gegenregulation Hierunter fallen die autonomen Reflexe (z.B. die Kreislaufreflexe) und die humoralen Regulationssysteme (z.B. das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System). Ihrer beider Funktion ist die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Homöostase. An der Entstehung von Gewöhnung sind jedoch nur die humoralen Regulationssysteme beteiligt; die ausschließlich der akuten Kontrolle dienenden autonomen Reflexe spielen keine Rolle. Ebenso bleiben pharmakokinetische und pharmakodynamische Größen unverändert.
Beispiel
Die Zufuhr eines vasodilatierenden Antihypertensivums lässt den Blutdruck zunächst absinken. Dies wird vom Organismus als scheinbarer Volumenmangel interpretiert und führt zu „Gegenmaßnahmen“ wie der Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems. Hierdurch kommt es zu einer Natrium- und Wasserretention und zu einem allmählichen Wiederansteigen des Blutdrucks, auch wenn das Medikament in unveränderter Dosis weiter zugeführt wird. An diesem Beispiel kann man bereits erahnen, wie komplex die Auswirkungen eines pharmakologischen „Eingriffs“ in den Organismus sein können.
Merke
Die Wirksamkeit eines Pharmakons ist keine absolute Größe; sie schwankt nicht nur interindividuell, sondern auch intraindividuell.





























