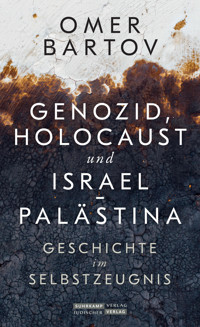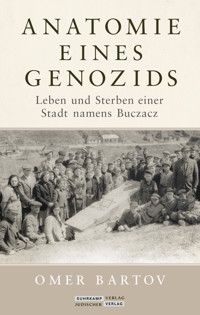
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Juedischer Verlag im Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Buczacz war jahrhundertelang eine vielsprachige Kleinstadt in einer osteuropäischen Grenzregion. Als die polnischen und ukrainischen Nationalbewegungen sich gegen die imperiale Macht auflehnten, geriet eine Gruppe zwischen alle Fronten: die Juden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden sie zu den Leidtragenden einer gescheiterten Minderheitenpolitik.
1942/1943 richteten sich die Angehörigen der deutschen Besatzungsmacht mit ihren Familien in der Stadt ein. Angestellte der Firma Ackermann, die bei Brückenarbeiten die Erschießung jüdischer Zwangsarbeiter mitansehen. Oder eine Frau wie Berta Herzig, die ein jüdisches Kindermädchen beschäftigt und sich mit Henriette Lissberg, der Frau des Landkommissars, die Friseurin teilt. Ungerührt genießen sie die idyllische Provinz. Etwa 10 000 Juden wurden damals in Buczacz umgebracht – vor aller Augen.
Ausgehend von einem Gespräch mit der Mutter in Tel Aviv kurz vor ihrem Tod, beginnt Bartov seine Recherchen, die ihn durch unzählige Archive führen. Seine glänzend geschriebene Mikrogeschichte der ostgalizischen Stadt ist ein Meilenstein der Holocaust-Forschung.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
3Omer Bartov
Anatomie eines Genozids
Vom Leben und Sterben einer Stadt namens Buczacz
Aus dem amerikanischen Englisch von Anselm Bühling
Widmung
5Für meine Familie
Wai-yee, Raz, Shira und Rom,
Fels meines Lebens und Brunnen meiner Seele,
und in memoriam
Yehudit (Szimer) Bartov, 1924-1998
Hanoch (Helfgott) Bartov, 1926-2016
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Kindheitserinnerungen
Der Sturm zieht auf
Feindschaft bricht aus
Zusammen und jeder für sich
Die Sowjetmacht
Die deutsche Ordnung
Der Alltag des Völkermords
Nachbarn
Die Zeit danach
Danksagung
Zur deutschen Übersetzung
Abkürzungsverzeichnis
Register
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
245
243
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
277
279
280
281
282
283
284
285
286
287
289
288
290
291
293
292
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
344
343
346
345
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
399
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
7Ich schloss die Augen, um die Tode meiner Brüder nicht sehen zu müssen, der Söhne meiner Stadt. Denn ich habe die schlechte Angewohnheit, meine Stadt und ihre Getöteten zu sehen, wie sie von ihren Peinigern gequält, wie sie niederträchtig und grausam umgebracht werden. Und noch aus einem anderen Grund schloss ich die Augen. Wenn ich sie schließe, werde ich gleichsam zum Eigner der Welt und sehe, was ich zu sehen begehre. Also schloss ich die Augen und rief meine Stadt, dass sie vor mir erstehe, mit all ihren Bewohnern und all ihren Bethäusern. Ich setzte jeden Mann auf seinen Platz, wo er zu sitzen pflegte, wo er zu studieren pflegte, und wo seine Söhne, Schwiegersöhne und Enkel saßen, denn in meiner Stadt kamen alle zum Gebet.
SAMUELJOSEPHAGNONDIESTADTINIHRERFÜLLE, 1973
10
111213
Mutter, Großmutter und Schwester des Autors in Tel Aviv 1979.
15Kindheitserinnerungen
Die Mutter des Autors als Kind in Buczacz, Ende der 1920er Jahre.
»Erzähl mir von deiner Kindheit«, sagte ich.
Wir standen in der Küche meiner Mutter in Tel Aviv. Sie trug ein schlichtes Kleid und hatte eine große Schürze umgebunden. Eine zierliche, energische Frau mit immer noch vollem, lockigem, braunrot getöntem Haar. Die heiße Sonne des Nahen Ostens und Jahre der Not hatten Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie war ganz in ihrem Element. Die geräumige Küche, in der wir saßen, war der Mittelpunkt der Wohnung, die wir ein Vier16teljahrhundert zuvor bezogen hatten, wenige Jahre bevor ich mein Elternhaus verließ und zur Armee ging.
Es war im Sommer 1995. Sie machte Hühnersuppe, und neben uns spielte mein Sohn, der damals sieben Jahre alt war. Bis zu diesem Tag hatte ich sie nie nach ihrer Kindheit in Ostpolen gefragt – der Zeit, bevor ihre Eltern 1935 mit der Familie nach Palästina zogen. Sie war einundsiebzig. Ich war einundvierzig und hatte von ihrer Jugend nur vage Vorstellungen. Ich schaltete den Kassettenrekorder ein.
Ich bin in Kośmierzyn [ukrainisch: Kosmyryn] geboren, einem kleinen Dorf am Ufer des Dnjestr in Polnisch-Podolien. Heute liegt es in der Ukraine. Alle Dorfbewohner waren Ukrainer. Der Vater meines Vaters verwaltete dort das Anwesen von Graf Potockis Witwe. Er lebte auf dem Landgut. Da gab es ein ziemlich großes Haus. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, vielleicht vier oder fünf, also kam es mir riesig vor. Das Haus hatte zwei Stockwerke. Dort wohnte die Grafina [Gräfin], wie sie genannt wurde, zusammen mit ihren Söhnen und der Schwester des Grafen. Es gab einen weiten Hof, Pferdeställe, Kuhställe und eine große Scheune. Mein Großvater lebte in einem einstöckigen Haus. Großvater, Großmutter und die Söhne. Ich wurde im Dorf geboren. Bald darauf zogen wir nach Potok Złoty. Und dann nach Buczacz.
Buczacz (ausgesprochen »Butschatsch«) ist heute ein heruntergekommenes postsowjetisches Provinznest – arm, verfallen und depressiv. Es hat etwa dreizehntausend Einwohner, das entspricht dem Stand von 1919. Dafür ist es wunderschön gelegen, auf einer Reihe von Hügeln, zwischen denen sich ein Flusslauf hindurchwindet. Als meine Mutter dort lebte, war Buczacz eine malerische kleine Stadt, und als solche ist es ihr in Erinnerung geblieben. Sie hat aus ihrer Vergangenheit nur Bruchstücke behal17ten, ähnlich wie die Fragmente der Sprachen aus dieser Welt, die sie irgendwo in ihrem Kopf aufbewahrte – Jiddisch, Polnisch, Ukrainisch, Deutsch und das Russisch, in dem sie mir Lieder vorsang, als ich ein Kind war. Behutsam zog sie kleine Erinnerungsfäden ans Licht und verwebte sie liebevoll zu ihrem eigenen Kindheitsstoff. Sie war lange Jahre als Lehrerin tätig gewesen, hatte eine klare, kräftige Stimme und sprach jedes Wort deutlich aus.
Wir wohnten alle zusammen mit Großvater in einem Haus. Es hatte zwei Wohnungen. In einer lebten wir, auf der rechten Seite. Links wohnten Großvater und Großmutter und die Schwester meines Vaters, die später heiratete. Das Haus lag auf einem Hügel und war durch eine steinerne Treppe mit der Straße verbunden. An die Straße kann ich mich noch erinnern – sie führte zum Bahnhof.
Sie hat nie davon gesprochen, dass auf der Straße, an der ihr Haus lag, wenig später Tausende Buczaczer Juden den Weg in die Deportation antreten sollten. Unter Demütigungen und Schlägen wurden sie zu ebendiesem Bahnhof geführt und von dort aus in vollgezwängten Viehwaggons unter unmenschlichen Bedingungen ins Vernichtungslager Bełżec transportiert. Von den Verwandten, die zurückblieben – auf ihrer Seite und auf der meines Vaters –, hat niemand überlebt. Sie sind alle ermordet worden. Auch das hat sie nie so gesagt. Aber unser Gespräch muss in meiner Mutter tief verschüttete Erinnerungen geweckt haben. Nicht lange danach begann sie davon zu sprechen, dass sie noch einmal nach Buczacz fahren wollte.
Dazu kam es nicht mehr. Drei Jahre später starb sie.
Nach diesem Gespräch mit meiner Mutter wollte ich mehr über meine Vorfahren wissen – darüber, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Deshalb habe ich zwei Jahrzehnte lang nach Spuren gesucht. Ich habe drei Kontinente und neun 18Länder bereist und in unzähligen Archiven geforscht. In einem davon, in Lˈviv, fand ich einen Vermerk vom März 1935. Es ging um drei Männer aus Buczacz, die eine Erlaubnis für die Einreise nach Palästina beantragt hatten. Unter den drei Namen war der von Izrael Szimer, meinem Großvater mütterlicherseits.
Ich fand auch heraus, dass das Schiff, auf dem meine Mutter und ihre Familie nach Palästina fuhren, 1910 in Glasgow vom Stapel lief. Bis zu ihrer Abwrackung im Jahr 1939 hat die Polonia 123 Fahrten zwischen dem rumänischen Hafen Constanţa und Palästina unternommen und Tausende von Juden dorthin gebracht.1
Aber viel mehr habe ich nicht herausgefunden. Ich hatte mit der Suche zu spät begonnen. Die Menschen, die sich noch weiter zurückerinnern konnten als meine Mutter, waren alle tot. Einige der wenigen erhaltenen Familienfotos sind auf der Rückseite beschriftet und datiert. Manchmal erkenne ich eine Familienähnlichkeit, doch es gibt niemanden mehr, der mir dazu etwas sagen kann. Die wenigen, die es wussten, können längst nicht mehr befragt werden.
Ich habe jedoch in diesen beiden Jahrzehnten sehr viel über die Geschichte von Buczacz erfahren und über die Katastrophe, die sich dort während des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. In zahlreichen Archivbeständen, Bibliotheken und anderen Forschungseinrichtungen habe ich viele Dokumente gefunden, die oft niemand mehr angesehen hat, seit sie dort hinterlegt wurden. Ich habe auch eine große Zahl von Überlebenden aufgespürt und Hunderte von Zeitzeugnissen ausfindig gemacht – schriftliche Berichte, Ton- und Videoaufzeichnungen. Die ersten davon sind noch vor dem Ende des Krieges gesammelt worden, und bis weit in die 1990er Jahre hinein sind neue hinzugekommen. Alle diese Dokumente – private Tagebücher, Augenzeugenberichte, Aussagen aus Gerichtsverfahren, Aufzeichnungen, veröffentlichte und unveröffentlichte Memoiren – zeigen, wie jede Seite sich selbst verstand und die jeweils anderen wahrnahm.
19Im vorliegenden Buch wird diese Geschichte in den Worten derer erzählt, die sie erlebt haben. Mit diesem Ansatz und den begleitenden Fotos soll versucht werden, das Leben von Buczacz in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu rekonstruieren. Es soll deutlich werden, wie die polnischen, ukrainischen und jüdischen Einwohner der Stadt jahrhundertelang Seite an Seite lebten – wie sie an verschiedenen Erzählungen über die Vergangenheit strickten, ihr je eigenes Verständnis der Gegenwart zum Ausdruck brachten und Zukunftspläne schmiedeten, die weit auseinandergingen. Das Leben in Städten wie Buczacz beruhte auf der ständigen Wechselbeziehung zwischen verschiedenen religiösen und ethnischen Gemeinschaften. Die Juden lebten nicht getrennt von der christlichen Bevölkerung. Das Schtetl als eine Art abgeschiedener Idylle (oder Misere) ist eine Erfindung der jüdischen Literatur und Folklore. Diese Verflechtung machte die Existenz solcher Städte erst möglich. Und ohne sie 20hätte sich schließlich der Genozid in diesen Gemeinden nicht in dieser so grausamen wie intimen Form abspielen können. Willkürliche Gewalt und Verrat waren allgegenwärtig, und dazwischen gab es immer wieder Augenblicke der Selbstlosigkeit und Güte.
Vermerk des Ortsverbands der Jüdischen Organisation an die Zentrale in Lwów über den Versand von Dokumenten zur Ausstellung von Einwanderungszertifikaten für drei Männer aus Buczacz, darunter Izrael Szimer, der Großvater des Autors. Quelle: Centralˈnyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukrajiny, m. Lˈviv (Zentrales Staatliches Historisches Archiv der Ukraine in Lwiw, im Folgenden CDIAL), fond 338, op. 1, spr. 240, S. 12.
Die Mutter des Autors (erste Reihe links) zusammen mit anderen Auswanderern unmittelbar vor dem Betreten des Schiffs nach Palästina, 1935.
Wenn ich aus der Geschichte von Buczacz etwas gelernt habe, dann dies: Wir alle sind nur Glieder der zerbrechlichen und doch erstaunlich haltbaren Kette von Generationen, Schicksalen und Kämpfen, in der sich die historischen Ereignisse unablässig entfalten. Wer wir sind und woran wir uns erinnern, wie wir unsere Kinder erziehen, was wir sagen und woran wir glauben, was wir lieben und was wir verachten – all das verdankt sich dem Zusammenspiel willkürlicher Zufälle mit menschlichen Handlungen – unserem eigenen Handeln und dem unserer Vorfahren, aus guten oder schlechten Gründen, bewusst oder gedankenlos. Auch wenn ich über meine eigene Familie nicht viel in Erfahrung gebracht habe: Geschichte ist in gewissem Sinn immer auch Fami21liengeschichte. Wir alle tragen tief in uns ein Bruchstück der Erinnerung an die langen Jahrhunderte, in denen wir, im Guten wie im Schlechten, am Ende der Welt lebten, ek velt, wie meine Mutter auf Jiddisch sagte – die Erinnerung an den Ort unserer Herkunft, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wird wie das abklingende Echo einer verlorenen, doch nie ganz vergessenen Kindheit.
23Der Sturm zieht auf
Der Name Buczacz findet sich erstmals in mittelalterlichen polnischen Chroniken. Darin wird der Ort 1260 als Liegenschaft der Adelsfamilie Buczacki erwähnt, die sich bei der Verteidigung der östlichen Grenzlande Polens einen Namen gemacht hatte. Diese frühen Besitzer von Buczacz errichteten in ihrer Blütezeit eine palastartige Holzburg auf einem Hügel, von dem der Blick hinab auf das Dorf und den Fluss im darunter gelegenen Tal fiel. Die weitläufige Landschaft dieser Region, die die Polen kresy24(Grenzlande) nennen, ist tief in der Vorstellungswelt der polnischen Romantik verankert. (Der Name der Herrscherfamilie und damit auch der Name der Stadt leiten sich wahrscheinlich von den umliegenden Buchenwäldern oder buczyny her.) 1882 veröffentlichte Sadok Barącz, ein polnischer Dominikanermönch armenischer Herkunft, der sein ganzes Leben in der Region verbrachte, eine farbenreiche Geschichte von Buczacz, die seitdem als ergiebige Quelle für Fabeln und Legenden aus der Umgebung dient.
Wahlkundgebung in Buczacz im Jahr 1907. Vorn in der Mitte ist der jüdische Kandidat Natan Birnbaum zu sehen; rechts in der Menge mit weißem Filzhut Samuel Joseph Agnon. Quelle: The Nathan & Solomon Birnbaum Archives, Toronto.
Er beschreibt die Lage der Stadt »in den Grenzgebieten Podoliens und Rotrusslands« – auch Rotreußen oder Rotruthenien genannt – in einem »grünen Tal auf felsigem Grund, das durch den schmalen Strom der Strypa geteilt ist. Es ist eines von mehreren bezaubernden, herrlichen Tälern in der von der launischen Natur so reich bedachten Region. Die düsteren, uralten Wälder, die klaren Seen, die bewaldeten Hügel, die reichen Weiden, Gottes heilige Macht, die sich herrlich ausbreitet – all das kann die slawische Seele, die Freiheit und Sicherheit sucht, kraftvoll nutzen.« Der Ort habe auch direkt auf dem »Weg der Tataren« gelegen, doch die Krieger jener »tapferen Familie aus Buczacz« hätten ihn »mit den eigenen Körpern« gegen Raubzüge dieser »wilden Unterdrücker« verteidigt. Die Buczackis, so Barącz, »gaben den Rittern Rutheniens und Podoliens ein Beispiel«, indem sie »eine Verteidigungsfestung bauten, um die erfolgreiche Entwicklung der Stadt zu schützen«, beflügelt durch »die heilige Flamme der Liebe zum Land und zu ihren Vorfahren«. Sobald sie »den furchtbaren Widerhall des Feindes hörten, der aus dem dunklen Tal aufstieg«, tauchten diese »Militäreinheiten auf ihren tapferen, in ganz Polen bekannten Rössern« auf, »als seien sie der Erde entsprungen«. Die Pferde aus dieser Region »waren sehr begehrt und man zeigte voller Stolz auf sie: Schau! Dies ist ein Pferd, das in Buczacz aufgezogen wurde.«1
Auch der Literaturnobelpreisträger Samuel Joseph Agnon, der 1887 in Buczacz geboren wurde, bringt die zauberhafte La25ge der Stadt mit göttlicher Gnade in Verbindung. In seinem posthum veröffentlichten Erzählungsband ʿIr u-meloʾah (Die Stadt in ihrer Fülle), der von Buczacz und seiner Geschichte handelt, beschreibt er es als »eine Stadt, der Gott, wie es scheint, etwas von der Herrlichkeit Seines eigenen Landes verliehen hat«. Er stellt es als paradiesischen Ort vor, »auf Bergen und Hügeln gelegen«, umgeben von »dichten Wäldern mit Bäumen und Büschen« und gespeist von einem Fluss, der »sie durchfließt und umfließt«, von Bächen, die »Schilf, Büsche und Bäume nähren« und von »guten Quellen«, die »reich an frischem Wasser« sind. Agnons Erzählung zufolge wurde seine Heimatstadt von einer Karawane von Juden gegründet, deren »reine Herzen es danach verlangte, in das Land Israel zu ziehen«. Stattdessen fanden sie sich an einem Ort »endloser Wälder voller Vögel, Getier und wilder Bestien« wieder. Dort trafen sie auf eine Schar »großer, bedeutender Edelleute«, die »so erstaunt über ihre Weisheit und angenehme Rede« waren, dass sie die Neuankömmlinge einluden, »bei ihnen zu verweilen«. Als die Adligen »erkannten, dass 26die Juden ihnen zum Segen gereichten«, sagten sie zu ihnen: »Das ganze Land steht euch weit offen. […] Lasst euch nieder, wo ihr es wünscht, und wenn ihr handeln wollt, um so besser, denn es gibt in diesem Land niemanden, der sich auf den Handel mit Waren versteht.« Und so blieben die Juden. Sie »schlugen Wurzeln im Lande und bauten sich Häuser, und Augen und Herzen der Vornehmen des Landes waren ihnen geneigt, und einige Frauen waren schwanger, einige stillten, bei einigen waren die Kräfte erschöpft und sie waren geschwächt, und die Alten waren noch mehr gealtert und die Reise würde ihnen schwer werden.« Es »fehlte ihnen an nichts, um die Tora und das Wissen von Gott zu studieren, und sie waren ihres Reichtums und ihrer Ehre, ihres Glaubens und ihrer Gerechtigkeit sicher.«2
Buczacz Anfang des 20. Jahrhunderts. Quelle: Österreichisches Staatsarchiv, Wien (im Folgenden: AT-OeSt)/Kriegsarchiv (im Folgenden: KA), BSIWK Fronten Galizien, 5839.
Die Ereignisse, die Agnons mythischer Bericht schildert, fügen sich in den historischen Kontext ein. Nach der Realunion der Nationen Polen und Litauen im Jahr 1569 hatte das neue Gemeinwesen große Gebiete in Osteuropa und der Ukraine erobert. Im Zuge der Ostexpansion Polens lud der Adel die Juden ein, Städte, Handel und Produktion zu entwickeln und bot ihnen günstige Pachtbedingungen und Privilegien an. Der älteste Grabstein auf dem jüdischen Friedhof von Buczacz wurde auf das Jahr 1587 datiert.
1612 wurde die Stadt von Stefan Potocki eingenommen und blieb anderthalb Jahrhunderte lang Privatbesitz der Potockis, einer äußerst reichen und mächtigen polnischen Adelsfamilie. Stefan hatte genügend Weitblick, um die alte hölzerne Befestigungsanlage in eine gewaltige steinerne Burg umzubauen. Sie war von einem System von Stadtmauern und Schützengräben umgeben, das die ganze Stadt miteinschloss. Unter seinem Sohn Jan, der die Stadt 1631 erbte, sollte die Wehrhaftigkeit der Festung in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wiederholt auf die Probe gestellt werden.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts waren die 450 000 polnischen Juden die größte zusammenhängende jüdische Bevölke27rungsgruppe weltweit. Die Kolonialisierung dieser Gebiete hatte jedoch auch zur Folge, dass die Feindseligkeit unter den Bauern und dem Kleinadel der Region zunahm. 1648 kam es schließlich zum Ausbruch des großen Kosaken- und Bauernaufstands unter Führung von Bohdan Chmelˈnycˈkyj. Die Zerstörung jüdischer Gemeinden hat der Augenzeuge Nathan Neta Hannover in seinem Bericht Jawen Mezula (»Tiefer Schlamm«) eindringlich geschildert. Die Szenen, die er beschreibt, sind so blutrünstig, dass man sie kaum glauben möchte. Und doch haben sie die Vorstellungen der Menschen geprägt, als Signum der Vergangenheit wie als Bedrohung oder Handlungsmuster für die Zukunft. Die Juden, so schreibt Hannover, wurden »unter ausgesuchten, bittern Todesarten umgebracht … Einem Teil zogen sie die Haut ab, und das Fleisch warf man den Hunden vor. Einigen schnitt man Hände und Füße ab und warf sie dann auf die Heerstraße, daß man mit Wagen über sie hinfuhr und Rosse sie zertraten. […] Viele begrub man lebendig.« Die grau28samste Gewalt richtete sich gegen die Wehrlosesten: »Kinder schlachtete man auf dem Schoße ihrer Mütter; andere zerriß man wie Fische in Stücke. Schwangere Frauen schlitzte man und die herausgekommene Frucht zerschlug man in ihrer Gegenwart. Einigen ritzte man den Leib auf und nähte ihnen eine lebendige Katze ein und ließ sie so am Leben, indem man sie wieder zunähte; die Hände schnitt man ihnen ab, damit sie die lebendige Katze nicht herausziehen konnten.« In anderen Fällen »spießte man« Kinder, »briet sie am Feuer und brachte sie den Müttern, die davon essen mußten.«
Ansicht der Festung (Anfang 20. Jh.). Quelle: AT-OeSt/KABSIWK Fronten Galizien, 5840.
Hannover berichtet von mehreren Fällen, in denen die Polen die Juden verrieten und den Rebellen auslieferten, um die eigene Haut zu retten. In anderen Fällen verteidigten Juden Seite an Seite mit Polen die Stadtmauern, doch selbst dann kam es vor, dass sie schließlich von ihren eigenen Mitbürgern verraten wurden. Hannover berichtet: »[W]ir wanderten von Ort zu Ort, durch Städte und Dörfer, lagerten auf offenen Straßen, und auch hier fanden wir keine Rast: hier beraubte und da trat man uns; hier schimpfte und da schmähte man uns […]« Im Oktober 1648 wurde neben einer Reihe von anderen Städten auch Buczacz, wohin sich zahlreiche Juden aus dem Osten geflüchtet hatten, durch die Kosaken belagert: »[a]lle Edelleute und Juden [leisteten] Widerstand. Sie schossen auf sie und töteten von den Belagerern eine große Menge, und es war denselben unmöglich, eine dieser starken Städte einzunehmen.« Doch »viele Tausend und Zehntausend Juden starben« an »Pest und Hunger«, die infolge des Krieges in der Region wüteten.
Während des Chmelˈnycˈkyj-Aufstands wurde ein erheblicher Teil der jüdischen Bevölkerung im östlichen Polen-Litauen niedergemetzelt. Die Gesamtzahl der jüdischen Opfer liegt zwischen zwanzig- und fünfzigtausend Personen. Der Aufstand endete im Sommer 1649 mit der Gründung eines Kosakenstaates, aus dem Polen, Juden und Jesuiten vertrieben wurden. Fünf Jahre später wurde der neue Staat mit dem Moskauer Reich verei29nigt, der aufstrebenden Macht, aus der später das Russische Reich hervorgehen sollte.3
Ein geschmolzenes Kanonenrohr aus dem 17. Jahrhundert in der Festung Buczacz (Foto: Anfang 20. Jh.). Quelle: AT-OeSt/KABSIWK Fronten Galizien, 5502.
In den folgenden Jahrzehnten war es friedlich in Buczacz. Der Deutsche Ulrich von Werdum besuchte den Ort im Februar 1672. In seinem Reisejournal hält er fest: »Dies ist eine große Stadt, sehr possierlich auf Bergen und Tälen durcheinander gelegen […] Es geht eine steinerne Mauer herum, und sind ziemliche Häuser darin, auch drei päpstische Kirchen, mit einem reussischen Kloster, welches jetzund die Dominikaner einhaben. Die Armenier haben auch ihre Kirche und die Juden eine Synagoge, und schönen Kirchhof, mit absonderlicher Mauer umgeben, und mit hohen lustigen Bäumen bepflanzet, das Schloss ist von steinern Gebäu und Fortifikation, und liegt auffm Berge, von welchem der Fluss Stropa herunter fällt, und wohl zehn oder zwölf übereinander liegende Wassermühlen treibet […] Dieser Ort gehört dem Herrn Polotskj […], und ist, im Anfang der kosackischen Revolte, von Moskowitern und Kosacken ganz ausgebrennet gewesen, anjetzo aber in etwas, fürnehmlich durch die Juden, wieder erbauet; welche hier sowohl als in ganz Podolien und Reussen in großer Menge wohnen […].«
Nur wenige Monate nach von Werdums Besuch wurde Buczacz von einem riesigen osmanischen Heer belagert. Da Jan Potocki, der Herr der Stadt, andernorts gegen die Osmanen kämpfte, ergab sich die Stadt nach kurzer Verteidigung den Invasoren. 30Bald darauf tat das auch ganz Polen. Im Oktober 1672 trafen sich König Michael Wiśniowiecki und Sultan Mehmed IV. in Buczacz und unterzeichneten einen Vertrag, dem zufolge Polen einen Großteil seiner Ostgebiete an die Türken abtreten und hohe jährliche Tributzahlungen an den Sultan leisten musste.4
1675 stürmten die Osmanen Buczacz erneut, obwohl Jan Potocki diesmal Vorkehrungen getroffen hatte. Er lud sogar Vertreter der jüdischen Gemeinde ein, um über die Verteidigung von Buczacz zu sprechen, und ernannte einen eigenen Oberaufseher, der mit der Verteidigung des jüdischen Viertels beauftragt war. Der osmanische General Şişman İbrahim Paşa, auch bekannt als Abraham der Fette, überwand rasch alle Verteidigungsbestrebungen und setzte die Stadt in Brand. Während die Adligen und einige Stadtbewohner sich in die Burg flüchteten, überließ man die jüdischen Einwohner vor den verschlossenen Toren sich selbst. Sie wurden, in den Worten Samuel Agnons, »von den Türken wie Widder und Schafe geschlachtet, und ihre Leichen fanden ihr Grab in den Bäuchen wilder Tiere und Raubvögel«.
Die Festung konnte die Belagerung durchhalten, bis eine Armee unter dem Befehl des polnischen Königs Johann III. Sobieski eintraf. Im Jahr darauf aber wurde sie – diesmal verteidigt von Jans Nachfolger Stefan Potocki – schließlich eingenommen. François-Paulin Dalairac, ein französischer Höfling von Johann Sobieski, stellt fest, die osmanischen Truppen hätten die Stadt »dauerhaft zerstört, […] so schwer, dass von den Mauern und Türmen nur noch Trümmer blieben und kaum ein Gebäude für mehr als eine Ruine durchgehen konnte«. Stanisław Kowalski, ein polnischer Autor, der in der Zwischenkriegszeit in Buczacz lebte, erwähnt in seinen Memoiren, dass dort auch noch weit über zwei Jahrhunderte später die Legende kursierte, das mächtige Schloss sei nur wegen »des Verrats einer Frau« gefallen. Ihr Geist, so erzählte man sich, »erscheint am Auferstehungstag im 31Tor des Schlosses, weinend und voller Reue über die Sünde ihres Verrats«.5
In den folgenden Jahren markierte die Strypa, die Buczacz durchfließt, die Grenze zwischen Polen und den Osmanen. 1683 wurde Buczacz schließlich durch König Johann Sobieski befreit. Als Dalairac, der die Stadt ein Jahr später besuchte, seine Eindrücke niederschrieb, bemerkte er, dass Buczacz, »einst aus Stein gebaut und von allen Seiten von viereckigen Türmen umgeben«, heute größtenteils »zerstörte und teils verbrannte Gebäude und nur noch einige aus Holz errichtete Schenken mit Strohdächern« aufweise. Die einst »sehr bedeutende und gut verteidigte Stadt« von solch »großer strategischer Bedeutung«, dass »der Sultan Mehmed IV. in eigener Person« an der Belagerung teilnahm, war nur noch ein Schatten ihres früheren, stolzen Selbst. Zu den Einwohnern vermerkt Dalairac, dass »die Umgebung der Stadt reich an Quellen und Obstgärten ist« und »die Bauern ihre Hütten nach alter polnischer Sitte vor dem Stadttor und unter den Kanonen errichten. In der Stadt leben nur Juden und einige Polen.«
Als die Juden nach den Türkenkriegen nach Buczacz zurückkehrten, so schrieb Samuel Agnon drei Jahrhunderte später, »fanden sie die Stadt verwüstet und ihre Häuser teils zerstört, teils von Nichtjuden besetzt. Die Synagogen und Studienhäuser waren mit den Wurzeln aus dem Boden gerissen und untergepflügt worden, und man konnte nicht mehr sagen, wo sie gestanden hatten.« Doch Potocki, der Herr von Buczacz, gab den Juden Land für den Bau einer neuen Synagoge, »damit sie in seiner Stadt blieben und mit ihrer Wohnstatt zufrieden seien, denn es war seit den Tagen seiner frühesten Vorfahren in Polen die Regel, dass ein Ort auflebte, wenn Juden in ihm weilten«.
1699 bestätigte und erweiterte Potocki die Privilegien, die seine Vorgänger der jüdischen Gemeinde in Buczacz gewährt hatten, und bereitete damit den Boden für das jüdische Leben in der Stadt bis zur Annexion durch Österreich siebzig Jahre später. 32Juden durften in Buczacz Handel und Gewerbe betreiben, alkoholische Getränke herstellen und verkaufen und Häuser von Christen erwerben. Sie waren auch vor der städtischen Gerichtsbarkeit geschützt, da Potocki sich bei von Juden begangenen »geringfügigen und schweren Verbrechen« die alleinige Schiedsgewalt vorbehielt, während Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft vom rabbinischen Gericht behandelt wurden. Am jüdischen Sabbat durfte kein Markttag gehalten werden, und es war den Juden gestattet, »den Weg [zu] benutzen, der von den Mauern der Kirche und dem Haus des Priesters zu ihrer Synagoge am Ufer der Strypa führt«.6
1728 wurde die hölzerne Synagoge durch einen massiven Steinbau ersetzt. Er war, wie in dieser Region üblich, als »Festungssynagoge« mit fast fünf Meter dicken Mauern angelegt, damit er der Gemeinde in Kriegs- und Gewaltzeiten als Zuflucht dienen konnte. Weil das Gebäude die benachbarten Kirchen nicht überragen sollte, wurde der Boden ausgehoben, so dass es weit unterhalb der Straßenhöhe stand. Für Agnon war die Synagoge das pochende Herz der Gemeinschaft: »Solange es Buczacz gab, ist dort unablässig gebetet worden.« Das prachtvoll geschmückte Innere wurde von zwölf opaken Fenstern und vier Bronzekandelabern erhellt. Ihr Licht fiel auf die Wandmalereien mit Blumen- und Engelsmotiven, die beiden von Metallpalmen gekrönten eisernen Widder zu beiden Seiten des Toraschreins, die marmorne Bima (Kanzel) in der Mitte des Saals und weitere kostbare Objekte.
Die eindrucksvollsten Bauten der Stadt wurden von Stefan Potockis exzentrischem Sohn Mikołaj errichtet, der 1733 die Herrschaft übernahm. Er finanzierte den Bau des Rokoko-Rathauses, des Basilianerklosters, einer angrenzenden zweistöckigen Schule und einer Klosterkirche. Noch wichtiger ist, dass Mikołaj Potocki 1754 mit einer Stiftung an das Collegium des hl. Josaphat in Buczacz die Gründung der ersten weiterführenden Schule der Stadt ermöglichte, die den Schülern auch Unterkunft, 33Essen und Kleidung bot. Innerhalb von fünfzehn Jahren zählte die Schule 343 griechisch-katholische und römisch-katholische Schüler, die hier Fächer wie Theologie, Geschichte, Geographie, Physik, Latein und Griechisch erlernten. Jüdische Schüler gab es äußerst selten, obgleich immer mehr Juden in der Stadt lebten – 1765 waren es mehr als eintausend.7
Große Synagoge und Studienhaus 1921/22. Quelle: Beit Hatfutsot (Museum des jüdischen Volkes) Tel Aviv (im Folgenden BH), 30544, 31266.
34Am 3. Oktober 1772, so beschreibt es Barącz, sah Mikołaj Potocki »traurig zu«, wie die österreichischen »Streitkräfte […] in sein Buczacz einmarschierten«. »Zutiefst verzagt« durch die Demütigung der Besatzung, übergab der Magnat den Besitz 35Buczacz im folgenden Jahr an seinen Verwandten Jan Potocki. Als Mikołaj ein Jahrzehnt später starb, hatte sich die Provinz, die dem südöstlichen Polen entrissen und dem Habsburgerreich einverleibt worden war und die nun den Namen Galizien trug, vollkommen verändert.8
Rathaus, Stadtpanorama mit Basilianerkloster (Anfang 20. Jh.). Quelle: AT-OeSt/KABSIWK Fronten Galizien, 5492, 5541.
Die Mehrzahl der insgesamt 2,6 Millionen Einwohner waren Leibeigene. Dazu kamen 300 000 christliche Stadtbewohner, 200 000 Juden und 100 000 Adlige. Buczacz lag jetzt in Ostgalizien, wo die Ruthenen die Mehrheit der Bevölkerung stellten.
Die neuen österreichischen Herrscher ergriffen Maßnahmen, um die Zahl der in Galizien ansässigen Juden zu begrenzen. 1773 führten sie eine »Toleranzsteuer« ein, und wer sie nicht entrichten konnte, wurde nach Polen abgeschoben. Für die Erteilung der amtlichen Heiratserlaubnis wurde eine Gebühr verlangt, die sogenannte Heiratstaxe. Gleichzeitig hoffte die Regierung, dass assimilierte Juden die Germanisierung befördern könnten. Zu diesem Zweck mussten ab 1787 alle Juden deutsche Familiennamen tragen, und die religiöse Führung der Juden wurde einer zentralisierten Kontrolle durch die Regierung unterstellt. Die Österreicher versuchten auch, die soziale und wirtschaftliche Lage der Juden in Galizien zu ändern und die starke Konzentration in Handel und Handwerk zu reduzieren. Um Landwirtschaft und Ackerbau zu fördern, wurde es Juden, die nicht direkt auf dem Land arbeiteten, verboten, Landgüter, Mühlen, Gasthöfe, Wirtshäuser und Brauereien zu pachten. In der Folge verlor ein Drittel der galizischen Juden die Lebensgrundlage. Sie mussten in die Städte ziehen, wo ihre Armut sich nur verschärfte und es noch stärker auffiel, dass sie in einer engen wirtschaftlichen Nische angesiedelt waren.
Unter dem Einfluss der Französischen Revolution gewährte die österreichische Regierung den Juden »die Privilegien und Rechte anderer Untertanen«. Sie durften ihre Religion praktizieren und die Ehebeschränkungen wurden aufgehoben, doch sie mussten weiterhin die »Toleranzsteuer« und Koscherfleisch36gebühren zahlen. Dazu kam nun der »Lichteraufschlag«, eine Abgabe auf die für die jüdischen religiösen Riten unentbehrlichen Kerzen. Das größte Problem für orthodoxe Juden war die Auferlegung des Militärdienstes, da die Rekruten ihre religiösen Bräuche nicht ausüben konnten. Auf lange Sicht führte die Dynamik der Gleichstellungsmaßnahmen jedoch zu einer deutlichen Besserstellung der Juden. Das lag teils daran, dass Steuern und Einschränkungen umgangen werden konnten, und teils daran, dass die Regierung mit mehr Bedacht vorging.9
Nationalitäten des Habsburgerreiches. Quelle: A. J. P. Taylor, The Habsburg Monarchy, 1809-1918 (Harmondsworth 1985), S. 36-37.
Die Bestrebungen der Regierung, die Juden in die moderne Welt zu führen, zeigten sich besonders deutlich im Bildungswesen. 1787 wurde Naftali Herz Homberg, ein Maskil (Anhänger der jüdischen Aufklärungsbewegung Haskala) aus Böhmen, zum Superintendenten aller deutsch-jüdischen Schulen in Galizien ernannt. Homberg gründete 107 öffentliche »Normalschu37len« in der Provinz, darunter die jüdische Knabenschule in Buczacz, die 1788 eröffnet wurde. Mit dieser radikalen Bildungsreform sollte eine neue Generation von Juden geschaffen werden, denen das Deutsche ebenso geläufig war wie die Regeln der hebräischen Grammatik und die mit dem Moralgesetz vertraut und darauf vorbereitet waren, ein produktives Gewerbe zu ergreifen. In der Knabenschule in Buczacz stieg die Anzahl der Schüler von achtundzwanzig im Jahr 1788 auf zweihundert im Jahr 1790. Das zeigt deutlich, dass sich die Juden zunehmend für Bildung begeisterten, und entspricht der Entwicklung in ganz Galizien, wo die Zahl der Schüler im gleichen Zeitraum von sechstausend auf dreißigtausend stieg.
Bei den orthodoxen Juden Galiziens stieß diese Initiative überwiegend auf heftige Ablehnung. Hombergs Bildungssystem wurde schließlich abgeschafft und die Schule in Buczacz 1806 geschlossen. Doch es gab weiterhin Kräfte, die sich für eine jüdische Bildungsreform einsetzten – etwa Mendel Lefin und seinen Schüler Joseph Perl, zwei moderate galizische Maskilim, die Bräuche, Gesetze und Identität des Judentums an die Veränderungen anpassen wollten, die sich in der umgebenden Welt vollzogen. 1814 gründete Perl die Israelitische Freischule in Tarnopol, 65 km nördlich von Buczacz. Hier erhielten Jungen und Mädchen gemeinsam eine Grundschulausbildung in »gereinigtem Deutsch«, die jüdische und allgemeine Fächer verband. Auch Perls Vorschläge zur Einführung einer Berufsausbildung stießen auf Ablehnung, und sein Aufruf zur Ausmerzung der chassidischen Mystik und des Obskurantismus fand ebenso wenig Gehör. Der weit verbreitete Glaube, ein Jude, der sich mit irgendeiner Art nichtjüdischen Wissens befasst, gebe sowohl die Tora als auch die Gebote auf – so Perls Bilanz 1838 –, bringe die Unwissenden dazu, reformierte Juden fast bis zu ihrem Tod zu hassen und zu verfolgen.10
1850 veröffentlichte der Maskil Moriz Bernstein in Wien eine Broschüre, in der er die »geringe Kultur«, den »Fanatismus«, 38»alles Meinungsstarre, alle Vorurtheile und oft auch alles geistige Verkümmern« des galizischen Judentums der dort üblichen Erziehung zuschreibt. Zu Hause lernten die Kinder, die Religion sei Produkt einer »unendlichen Reihe von Geschlechtern […] Da ist’s, wo Eltern einem Kinde Sklavensinn […] mitgeben; da ist’s, wo die Freiheit des Menschen zu Grabe getragen wird […] Jene bange religiöse Scheidewand, die die Menschen in feindliche Nachbarn trennt und das Eine Menschengeschlecht in viele Abarten zerklüftet, erhebt sich thurmhoch schon da!« Im Cheder, der traditionellen Religionsschule, hätten »Schmutz und Unreinlichkeit« des Klassenzimmers »die nachtheiligste Wirkung auf die physische Natur des Kindes«. Die Lehrer, denen »jedes Savoir-vivre, jeder gesellige Takt, so wie jede richtige Lebensansicht fehlte«, seien »beflissen, dem armen Kinde das Bibelkapitel, für diese Woche quasi vorgeschrieben, einzuhämmern«, und legten ein »oft sehr hartes« Verhalten an den Tag. »[A]lle Geistesträgheit, aller Unsinn und Irrglaube und oft alle Seelenverknöcherung, die dann den Menschen durch’s Leben begleiteten«, seien darauf zurückzuführen. Der so erzogene galizische Jude sei immer noch »durch seinen langen Kaftan« und »mißtönenden Jargon« markiert, weshalb ihm »die Zirkel seiner gebildeten Nachbarn fast unzugänglich« seien. Nur durch das Erlernen der »Landessprache« [gemeint ist Polnisch; A. d. Ü.] würden sich die Juden Galiziens »zu Hause mit ihrer Nationalität aussöhnen, einen friedlichen Verkehr mit ihren Nebengenossen bis in die Freundschaftsverhältnisse derselben einleiten können, und nach und nach die Scheidewand zwischen sich und ihnen […] stürzen sehen«.
Der Jude existiere in Galizien »als Geduldeter in einem Lande, somit als Fremder, der die Heiligthümer desselben nicht zu den seinen machen und ihnen auf diese Weise keine nationalen, noch weniger aber patriotische Interessen abgewinnen konnte«. Dieses Problem, so glaubte Bernstein, lasse sich lösen, indem man den Juden gleiche Rechte einräumte. Wenn sie andere Beru39fe ausüben könnten, würden »die bittersten Vorwurfsangriffe und der Pasquillschlamm, die ihr Sittlichkeits- und Rechtsgefühl herzlos kränken«, sie nicht mehr treffen und nicht »den Juden in ihnen verletzen […] Denn nicht der Jude ist ein Betrüger, ein Wucherer, wie man ihn häufig nennen hört«; vielmehr sei er durch gesetzliche Einschränkungen genötigt, der von den Nachbarn verachtete »gewinnsüchtige Kaufmann« zu werden.11
Die Emanzipation kam schließlich 1867 mit der Sanktionierung der Dezemberverfassung durch Kaiser Franz Joseph. Die Juden wurden nicht als eine der Nationalitäten des Reichs eingestuft, sondern als Glaubensgemeinschaft. Das hatte zur Folge, dass sie Jiddisch nicht als Umgangssprache angeben konnten, denn die Sprache galt als Kriterium der nationalen Zugehörigkeit. Juden mussten eine andere Sprache benennen und wurden dann der betreffenden Nationalität zugeordnet. Die Österreicher hatten ursprünglich gehofft, auf diese Weise die Zahl der Deutschen in Galizien steigern zu können. Doch um 1910 waren fast alle Juden als polnischsprachig registriert.12
Die Beziehungen zwischen den Juden und ihren Nachbarn wurden durch die Emanzipation grundlegend verändert. Im Jahr 1848 hatte das Habsburgerreich unter dem Eindruck der Revolutionen, die ganz Europa erschütterten, die Leibeigenschaft in Galizien abgeschafft. In den beiden folgenden Jahrzehnten bildete sich im größeren und bevölkerungsreicheren Ostteil des Kronlandes eine neue Nation heraus. Schon vor der Revolution von 1848 hatten sich erste Regungen eines ruthenischen Nationalismus gezeigt, angeführt von einer Handvoll Priester, Seminaristen, Studenten und Intellektueller. Doch vor der Abschaffung der Leibeigenschaft konnten sie nicht auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen. Nach der Revolution und vor allem nach den Reformen in den 1860er Jahren erwachten die Bauernmassen aus dem sprichwörtlichen Schlummer.
Die meisten ehemaligen Leibeigenen lebten weiterhin im Elend, konnten weder lesen noch schreiben und wurden von den Land40besitzern skrupellos ausgebeutet. Die ruthenischen Bauern sahen in den Polen ihre Grundherren, und Juden waren für sie Krämer, Händler, Laden- und Wirtshausbesitzer. Die Ukrainophilen – die Narodovci oder Populisten –, die die Idee einer eigenen ruthenisch-ukrainischen Nationalität und Sprache propagierten, konnten die politischen Implikationen dieser sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten am besten ausformulieren. Als sich die Alphabetisierung mit der Einführung von Dorfschulen allmählich ausbreitete und die Bauern begannen, Zeitungen zu lesen, erreichten sie auch eine immer größere Anzahl von Menschen. Weil sie die Sorgen der Bauern in ihren eigenen Worten direkt ansprachen, gewannen die Narodovci immer mehr Einfluss. Dabei kam ihnen auch die tolerante Haltung des Habsburgerreichs gegenüber dem Nationalismus zugute.
Während die ruthenische Landbevölkerung durch Lesevereine und politische Rhetorik nationalisiert wurde, konnten die Juden dank der Aufhebung der Berufs- und Wohnortbeschränkungen wieder aufs Land zurückkehren. Zugleich befand sich das Land im Umbruch vom Feudalsystem zur Geldwirtschaft. Vor diesem Hintergrund beförderten die verstärkte Präsenz und die wirtschaftliche Funktion der Juden in den Dörfern in weiten Kreisen das Gefühl, materiell ausgebeutet und kulturell herabgesetzt zu werden. Jüdische Geldverleiher, Laden- und Wirtshausbesitzer, Viehhändler, Land- und Mühlenpächter wurden als Leute dargestellt, die die unwissenden Bauern schröpften, sie zur Alkohol- und Tabaksucht verleiteten, ihnen Geld gegen Wucherzinsen liehen und die Entwicklung einer gesunden ruthenischen Nation hemmten. In der neuen ruthenischen Presse gab es schon nach kurzer Zeit mehr antijüdische Kommentare als Angriffe auf polnische Grundbesitzer.13
Die ruthenische Zeitung Batˈkivščyna (Vaterland), die 1879 von der national-populistischen Vereinigung Prosvita (Aufklärung) gegründet wurde, hatte eine eigene Rubrik mit Berichten lokaler Aktivisten aus galizischen Dörfern und Städten, in der 41solche Stimmungen zum Ausdruck kamen. In einem der Berichte heißt es, in manchen Dörfern lasse sich »unter hundert Haushalten kaum ein einziger Bauer mit Landbesitz finden, der nicht verschuldet ist – natürlich bei den Juden«. In einem anderen Bericht wird behauptet, ein Bauer, der einmal Geld bei einem Juden leihe, »wird diesen nie wieder los; er zahlt und arbeitet die Schulden ab, und schließlich verliert er doch sein Land.« Die Folge sei, so einer der Autoren, dass »unsere eigene ruthenische Lebensweise aussterben wird; stattdessen führt man schlechte Sitten von außen ein«. Auch der amerikanische Radierer, Lithograf und Autor Joseph Pennell war der Ansicht, die Juden zerstörten die ländlichen Kulturen. Er reiste 1891 durch Europa und kam zu dem Schluss, dass »der Durchschnittsjude im ganzen südöstlichen Teil des Kontinents alles daransetzt, den Bauern jeden Kunstsinn auszutreiben, indem er ihre wirklich gute Handarbeit durch das scheußlichste maschinell hergestellte Zeug ersetzt, das er irgend findet«.14
Ein weiterer Korrespondent von Batˈkivščyna schrieb, der Handel sei »in unserem Land so weitgehend in jüdischer Hand, dass offenbar niemand sonst ein Geschäft betreiben oder eine staatliche Konzession erlangen kann«. Solchen Argumenten spielte sicherlich der Umstand in die Hände, dass im Jahr 1900 nur 20 000 Ukrainer, jedoch 280 000 Juden im Handel beschäftigt waren oder indirekt davon lebten. Die seltenen Berichte über Unternehmen in ruthenischem Besitz waren ein Quell des nationalen Stolzes. Als ein Jude einen Laden betreten habe »und Heiligenbilder an der Wand sah, kriegte er solche Angst, dass er sofort floh«, wie ein Bauer schadenfroh schrieb.
Der Inbegriff der angeblichen jüdischen Raffgier war für polnische wie ukrainische Nationalisten jedoch die Dorfschenke. In ihr sahen sie den Grund für den chronischen Alkoholismus der Bauern, ihre Verschuldung und dafür, dass Landbesitz in jüdische Hand überging. Abstinenzbewegungen verwendeten oft antisemitische Phrasen, und die Bauern lernten, den Juden die 42Schuld an ihrer eigenen Trunksucht zu geben. Ein Berichterstatter schrieb: »Du gehst in die Schenke, um Tabak zu kaufen, und der Jude […] preist seinen Alkohol an und spottet über die Nüchternheit. […] Ehe du dich versiehst, hast du ein Glas getrunken und dann noch eines.« Am Ende »verkauft der Bauer seine Stiefel für Schnaps und zahlt alles, was er trinkt, doppelt«, während »Judka die Hand in die Tasche steckt, um mit den Münzen zu klimpern und den Trunkenbold auslacht.«
Die traditionelle bäuerliche Sicht auf Juden war vielfältiger und ambivalenter. Gerade weil sie so allgegenwärtig waren, boten sich Juden als Verkörperung des Fremden an. Weil sie das Bindeglied zwischen den landwirtschaftlichen Erzeugern und dem Markt waren, galten sie auch als Mittler zwischen der isolierten ländlichen Umgebung und der arglistigen Welt da draußen, dem Reich des Todes und des Teufels. Mit Letzterem wurden Juden häufig in Verbindung gebracht; wie er galten sie als wichtige, wenngleich bösartige Erscheinungen im Zyklus des Lebens. Weil die Bauern auch zutiefst religiös waren, hatten sie zudem die christliche Auffassung verinnerlicht, nach der die Juden einerseits als Christusmörder verdammt und andererseits als einzige Zeugen der Passion Christi gesegnet waren. Ebenso kam es vor, dass galizische Bauern den jüdischen Volksglauben an die magischen Heilkräfte von Wunderrabbis und Zaddiks teilten; dabei fürchteten sie jedoch zugleich die Bedrohung, die angeblich von solchen Kräften ausgehen konnte.15
Unter dem Einfluss des Nationalismus erfuhr diese komplexe Vorstellung der galizischen Bauern von den Juden eine radikale Veränderung. Schon in der ersten Ausgabe der Batˈkivščyna war knapp von »zwei schrecklichen Feinden« der Ruthenen in Galizien die Rede: »Einer ist der schlaue Jude, der unser Blut saugt und an unserem Fleisch nagt, der andere der hochmütige Pole, der nach unserem Körper und unserer Seele trachtet.« In den folgenden Ausgaben griff die Zeitung immer wieder auf antisemitische Wendungen zurück. Sie beschrieb jüdische Schen43ken als »eine schwelende Wunde, die unseren Körper vergiftet und zerstört; sie verderben die […] Seele unserer Dorfbewohner […] nehmen ihnen ihr Eigentum und treiben sie ins Verbrechen.« Als Gegenmittel empfahl sie nicht Pogrome, sondern den Boykott jüdischer Geschäfte: »Dann brauchen wir die Juden nicht zu vertreiben, sie werden uns aus freien Stücken verlassen.« Auch andere Zeitungen verliehen solchen Stimmungen Ausdruck. Die russophile Russkaja Rada warnte, der Zustrom von Juden werde so lange anhalten, bis »sie ihr Spinnennetz um das gesamte Dorf gewoben haben« und »Wodka und Geld die Bauern von ihrem angestammten Land verdrängen. […] Einst waren wir die Herren unseres Landes, doch heute sagt der Jude: Ich bin hier der Herr, dies ist mein Land!«16
Die Emanzipation hatte eine Reihe unbeabsichtigter Folgen. Als die Leibeigenschaft abgeschafft war, konnten die Bauern ihr Eigentum verkaufen. Doch ihre Höfe waren von vornherein klein und wurden immer wieder unter den Erben aufgeteilt. Deshalb konnte das Land sie bald nicht mehr ernähren. Die Juden hingegen nutzten die Emanzipation, um den überfüllten, elenden armen Ghettos zu entkommen und sich anderswo nach Existenzmöglichkeiten umzusehen. Wer es zu Vermögen brachte, konnte jetzt Land von Bauern erwerben, die darauf angewiesen waren, ihr Grundstück zu verkaufen und sich einen anderen Beruf zu suchen. Um 1902 besaßen etwa 15 000 Juden in Galizien Höfe oder Ländereien. Angesichts einer jüdischen Bevölkerung von fast einer Million Menschen war das keine sehr hohe Zahl, aber es waren weit mehr als je zuvor. Vor allem die ruthenischen Nationalisten störten sich daran. Für sie lief diese Entwicklung auf eine Übernahme der Provinz durch die Juden hinaus. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs besaßen Juden über 10 Prozent der Ländereien, stellten 20 Prozent der Grundbesitzer und machten mehr als 50 Prozent der Landpächter in Galizien aus.17
Als Gutsbesitzer und Leiter landwirtschaftlicher Betriebe 44entsprachen die Juden weder dem Stereotyp des Schtetlbewohners noch dem des wurzellosen Revolutionärs oder zionistischen Separatisten. Viele von ihnen betrachteten sich als polnisch; allerdings wurde dieses Gefühl nicht in vollem Umfang erwidert. Die Welt der jüdischen Grundbesitzer, die den meisten städtischen Juden unbekannt war, ähnelte in gewisser Weise derjenigen der polnischen Grundherren. Es gab jedoch auch markante Unterschiede. Die jüdischen Gutshöfe boten zudem reichlich Gelegenheit zu Kontakten mit nichtjüdischen Landarbeitern und Dorfbewohnern.
Oskar Kofler, der 1897 auf dem Gut seiner Familie in Petlikowce (ukrainisch: Petlykivci) etwa 15 km nördlich von Buczacz geboren wurde, erinnerte sich Jahrzehnte später an diese vergessene Lebensweise vor dem Ersten Weltkrieg. Sein Urgroßvater hatte schon 1837 in Anerkennung seiner Verdienste als Hofjude das Recht auf Grundbesitz erlangt. Sein Großvater besaß bereits ein Herrenhaus in der Nähe von Mogielnica (ukrainisch: Mohylˈnycja) und sein Vater Salomon erwarb das Gut und das Herrenhaus von Petlikowce. Als effizienter Verwalter unterhielt Salomon auch gute Beziehungen zu den Arbeitern auf dem Gutshof und den polnischen und ukrainischen Dorfbewohnern. Das Personal auf dem Anwesen war jedoch »fast ausschließlich« jüdisch, und viele andere landwirtschaftliche Berufe wie der Vieh- und Pferdehandel sowie der Getreidemarkt waren gleichfalls »fast ein jüdisches Monopol«. Kofler erinnert sich, wie er als Kind mit den Tieren auf dem Gutshof spielte und deutsche Klassiker las. Er besuchte polnischsprachige öffentliche Schulen in Drohobycz (ukrainisch: Drohobyč). Zuhause sprach die Familie Jiddisch und Polnisch und verständigte sich mit den Dorfbewohnern auf Ruthenisch. Seinen Vater beschreibt Kofler als »areligiös«; sagt jedoch auch, dass er »fließend Hebräisch sprach und in jüdischen Schriften und Ritualen gründlich bewandert war«. Die Mutter unterhielt eine koschere Küche, zündete am Sabbat und an den Feiertagen Kerzen an und sprach 45alle Segnungen. Zu Pessach leitete sein Vater »den Sederabend, wie es Vorschrift war«, und an Jom Kippur trug er einen weißen Gebetsschal und Jarmulke.18
Kofler selbst kam nach seinem Vater und wurde ähnlich »areligiös« wie dieser. Und während seine Familie in politischer Hinsicht »fraglos ›polnisch gesinnt‹ war«, hatte er die ruthenischen Landarbeiter in guter Erinnerung. Generell zeichnet sich in seinen Lebenserinnerungen das Bild eines sozialen Umfelds ab, das vor 1914 zwar ethnisch gemischt, aber durchaus harmonisch war – nicht zuletzt, »weil die gesamte Bevölkerung Ukrainisch sprach, es zahlreiche Mischehen gab und es keine Rolle spielte, ob man zur römisch-katholischen oder zur griechisch-katholischen Kirche ging«. Dem Brauch entsprechend wurden »die männlichen Kinder aus Mischehen in der Konfession des Vaters und die Töchter in der Konfession der Mutter großgezogen«. Rückblickend ist Kofler durchaus bewusst, dass sich »die Feindseligkeit zwischen Polen und Ruthenen, die bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts schwelte, einige Jahre vor dem Krieg noch verschärfte«. Doch ihm zufolge brachen offene Konflikte »vor allem in den größeren Städten, besonders in Lwów, aus« und »drangen kaum in die weiter entfernten Dörfer vor«.
Kofler bestreitet auch, dass alle Gutsarbeiter »in Elend und Erniedrigung« gelebt hätten – dies sei »von der Persönlichkeit des Dienstherrn und seiner Einstellung zu den Menschen« abhängig gewesen. Auf polnischen Gütern beobachtete er einiges an Feindseligkeit zwischen Landarbeitern und Landbesitzern, auch weil Letztere keinen »ständigen und direkten Umgang mit den Menschen« pflegten und ihre Zeit lieber fern von ihrem Besitz in der Stadt und in Kurorten verbrachten. Sein Vater hingegen habe aufgrund »seiner Besonnenheit, seines Gleichmuts, der anständigen Behandlung aller Menschen gleich welcher Stellung und seinem tiefen Gerechtigkeitssinn« ein »außergewöhnlich freundliches« Verhältnis zu den Bauern gehabt. Im Nachhinein fragt sich Kofler, wie das »eigentlich möglich war«, da »all diese 46Leute sehr gut wussten, dass Vater Jude war«. Sie seien mit Sicherheit durch die »in der Kirche aufgeschnappten Vorurteile über die schädliche Rolle der jüdischen Pächter« beeinflusst gewesen, »auf die angeblich alles Unglück der Bauernschaft zurückzuführen war«. Zum Teil hätten die guten Beziehungen zwischen den Bauern und seinem Vater vielleicht mit dessen »ungewöhnlichen persönlichen Eigenschaften« und seinem »allgemeinen äußeren Erscheinungsbild« zu tun gehabt, das nicht »als ›typisch jüdisch‹ betrachtet wurde«. Doch Kofler erinnert sich auch, dass die Dorfbewohner einem jüdischen Bauern halfen, der wie »ein Urbild des konservativen Juden« aussah, nur weil sie ihn für einen »anständigen Mann« hielten. Kofler führt dieses Verhalten letztlich darauf zurück, dass »die Leute damals viel höhere moralische Maßstäbe hatten [und] es im Ostgalizien der Vorkriegszeit allgemein keinen so tiefsitzenden Antisemitismus gab«.
Der Erste Weltkrieg setzte alldem ein Ende. Kofler wurde eingezogen und seine Eltern wurden gezwungen, das Gut aufzugeben und nach Wien zu ziehen. Infolge der antijüdischen Landreformpolitik der Zweiten Polnischen Republik erhielten sie ihr Landgut nie mehr zurück. Koflers Vater starb 1927 »als jemand, der den Untergang seines Lebenswerks erleiden und erdulden musste«. 1939 wurde Kofler erneut eingezogen, diesmal in die polnische Armee, und geriet bald in deutsche Gefangenschaft. Seine Enkelin Ewa Koźmińska-Frejlak, die seine Memoiren herausgegeben und eingeleitet hat, merkt dazu bitter an: »Die Jahre, die er in Gefangenschaft verbrachte«, teils in der sogenannten Judenbaracke, »bedürften einer gesonderten Erörterung.« Koflers erste Frau, sein Sohn sowie seine Mutter und Schwester wurden 1942 ermordet; sein Neffe starb 1941 bei der Deportation durch die Sowjets. Nach dem Krieg änderte Kofler seinen Namen in das polnisch klingende Koźmiński und arbeitete zwei Jahrzehnte lang im polnischen Ministerium für Schifffahrt und Außenhandel. Es habe immer Leute gegeben, die ihm 47»gern seine ›jüdische Herkunft‹ und seine ›Klassenherkunft‹ vorhielten«, sagt seine Enkelin.19
Auf die Zerstörung und Auslöschung der galizischen Gesellschaft, die vor 1914 bestanden hatte, folgten drei Jahrzehnte, in denen die Nationalisten und Ideologen das Sagen hatten – Fanatiker und Vorkämpfer eines neuen Menschenschlags, die lieber Blut vergossen, als Kompromisse einzugehen, und entschlossen waren, eher ihre Vorherrschaft durchzusetzen, als das Zusammenleben zu wahren. Sie hatten wenig Geduld, aber dafür Gewehre und Bomben, ihre Anführer waren oft halbgebildet und kampfesdurstig. Doch so war es nicht von Anfang an. Bevor der Nationalismus zu hassen begann, ging es ihm auch um Bildung und Aufklärung, materielle Verbesserung, gemeinsame Verantwortung und Gruppenidentität. Die Entwicklung hin zur Gewalt war weder vorgesehen noch unausweichlich.
Mit dem Begriff »Aufklärung« verbanden sich unterschiedliche Vorstellungen. 1906/07 wurde der Versuch unternommen, eine hebräische Schule zu gründen. Er scheiterte nach nur fünf Jahren, weil sich der Schuldirektor Baruch Berkovitz aufgrund der Anfeindungen konservativer religiöser Kreise genötigt sah, Buczacz wieder zu verlassen. Auch jüdische Jugendliche, die eine öffentliche weiterführende Schule besuchen wollten, hatten viele Hürden zu überwinden. Naftali Menatzeach (ursprünglich Naftale Hertz Siegman) berichtet, wie er gezwungen wurde, die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium am jüdischen Sabbat abzulegen, an dem Juden nicht schreiben dürfen. Nachdem er dies akzeptiert hatte, musste er »die ›nichtjüdische‹ Uniform des Gymnasiums tragen und meine kurzen Schläfenlocken abschneiden«. Zudem war es sein »Schicksal, [sich] mit antisemitischen Lehrern herumzuschlagen«. Menatzeach, der in einem abgelegenen Dorf mit nur wenigen jüdischen Familien aufwuchs, 48erinnert sich daran, dass sein Vater ihm einen Zeitungsartikel über den Ersten Zionistischen Kongress von 1897 vorlas – und auch an ein Buch aus Odessa namens Chowewe Zion (Zionsliebende), das ihn nachhaltig beeindruckte. Er verschlang viele der damals beliebten zionistischen Geschichtsromane und war ein eifriger Leser der Literaturzeitschrift Sifrei Sha’ashuim (Bücher der Freude), die in Buczacz von Yitzchak Fernhof herausgegeben wurde. Menatzeach wurde zunächst von seinem Vater zu Hause unterrichtet und besuchte dann die moderne Baron-Hirsch-Grundschule, bevor er ins Gymnasium aufgenommen wurde.20
Während 1900 ein Fünftel der fünfhundert Schüler des Gymnasiums jüdisch waren, stieg ihr Anteil bis 1914 auf ein Drittel. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil der griechisch-katholischen Schüler von einem Drittel auf ein Viertel, und die Anzahl der römischen Katholiken war nur geringfügig größer als die der Juden. In den Jahresberichten des Gymnasiums vor 1914 finden sich viele Namen von Jugendlichen, die im selben Klassenzimmer nebeneinandersaßen oder sich auf den Schulkorridoren begegneten und später äußerst unterschiedliche, manchmal entgegengesetzte Wege einschlugen: Emanuel Ringelblum, der Historiker und Chronist des Warschauer Ghettos, der 1944 mit seinem Sohn denunziert und ermordet wurde; Verwandte des »Nazijägers« Simon Wiesenthal; Bernhard Seifer, der später dem Judenrat angehörte, und der künftige Arzt Max Anderman. Es hat etwas Verstörendes, einen ganz alltäglichen Schulbericht zu sehen, in dem so viele Familien erwähnt sind, die drei oder vier Jahrzehnte später ermordet, deportiert oder zerstreut werden sollten. Zugleich passt diese Namensliste kaum zum pädagogisch-politischen Selbstverständnis der polnischen, römisch-katholischen Gymnasialleitung.21
Die Schule war unter österreichisch-ungarischer Herrschaft gegründet und gefördert worden, die zu dieser Zeit ihrem Ende entgegenging. Der Lehrplan verkörperte exemplarisch die Ideale 49einer klassisch-humanistischen Ausbildung. Trotzdem begriff sich diese öffentliche Einrichtung von Anfang an, ungeachtet des stetig zunehmenden Anteils jüdischer und ruthenischer Schüler, als Bastion des polnischen Nationalismus. Die Lehrerschaft bestand vorwiegend aus Polen. Im Jahr 1901 war von siebzehn Lehrern nur einer ruthenisch und einer jüdisch. Selbst 1914 befanden sich unter den insgesamt 28 Lehrkräften vielleicht fünf jüdische und noch weniger ukrainische – alle anderen waren Polen und römisch-katholischer Konfession.
Das Gymnasium von Buczacz zur Zeit des Ersten Weltkriegs; im Hintergrund die Türme des Basilianerklosters und die Festungsruine. Quelle: AT-OeSt/KABSIWK Fronten Galizien, 5534.
Schon bei der Einweihung des neuen öffentlichen Gymnasiums im Jahr 1899 wurde die Richtung vorgegeben. Zahlreiche Würdenträger nahmen an der Veranstaltung teil, darunter der polnische Gouverneur von Galizien, der örtliche Grundbesitzer Emil Potocki, der römisch-katholische Prälat Stanisław Gromnicki, der griechisch-katholische Pfarrer Telakowski und der jüdische Bürgermeister der Stadt, Bernard Stern. Ein geistlicher Vertreter der Juden war nicht dabei. Gromnicki hielt einen Got50tesdienst ab, und der Gouverneur rief das Gymnasium auf, »stets tapfere Menschen heranzubilden, die zum Nutzen von Gesellschaft und Nation handeln«. Dann trat der neubestellte Schuldirektor Franciszek Zych ans Podium. Er ermahnte seine jungen Zuhörer, sie sollten ihre privilegierte Ausbildung »dem Land vergelten«, den »Verlockungen und Vergnügungen der Welt« widerstehen und die »destruktiven Lehren des materialistischen Zeitalters sowie die wilden Theorien der Revolution« verschmähen. Ihre Aufgabe sei es, »Eurer Heimat Stolz zu bringen«. Diese müsse »darauf zählen können, dass mehr tapfere Getreue und Bürger bereit sind, Opfer zu bringen«. Die Heimat bestand aus »unseren brüderlichen Nationen, der polnischen und der ruthenischen«. Die Schüler sollten sich darauf besinnen, dass sie »Söhne eines Landes« waren, und nicht »auf falsche Ratgeber hören, die versuchen, das Gift des Hasses in Eure jungen Herzen zu säen.«
Mit anderen Worten: Heimat war für Zych gleichbedeutend mit dem »historischen« Polen, und die Brüderlichkeit, der er das Wort redete, schloss die Unterordnung der galizischen Ruthenen unter die polnische Herrschaft ein. Diese Vision ließ keinen Raum für einen eigenen ukrainischen Staat. Die 75 jüdischen Schüler unter den Zuhörern wurden in der Rede des Direktors erst gar nicht erwähnt, und im Bruderbund der von ihm beschworenen Nationen war für sie kein Platz vorgesehen.22
Nicht alle polnischen Lehrer vertraten diesen extremen Nationalismus. So erhob etwa der Lehrer Leon Kieroński in einem Beitrag für den Jahresbericht 1906 die eindringliche Forderung, die Schüler zu Offenheit und Klarsichtigkeit zu erziehen. Ziel der Bildung sei es, Neugier, Toleranz, Rationalität und Objektivität zu fördern. Die populäre sozialdarwinistische Sichtweise des Lebens als »rücksichtsloser Überlebenskampf« solle »keinen Platz in einer Schule haben, die Menschen im humanitären Geist erzieht«. Es handle sich um eine schwerwiegende Entscheidung: »Entweder gehen wir davon aus, dass die Gesell51schaft zu Recht humanitär ist [oder wir] entwickeln Mittel, um einander auf möglichst einfache Weise zu vernichten.« Die größte Bedrohung des humanitären Ideals sei daher das Konzept einer »nationalen Bildung« – eben weil es »diesen edlen Begriff« in »leere Plattitüden oder Chauvinismus« verwandle, was lediglich »nationale Differenzen verschärft und Streit und Konflikte hervorruft«. Eine Bildung »im Geiste der Humanität« sei die Voraussetzung dafür, dass der Patriotismus »erblühen und edle, nicht wilde Früchte tragen« könne. Die Lehrer sollten im Ganzen bestrebt sein, ihre Schüler in einem Geist der »reinen Harmonie« zu erziehen, der letztlich »zum selben Ziel führt wie die christliche Idee«.23
Von der Harmonie, die Kieroński vorschwebte, war im Alltag wenig zu spüren. Teofil Ostapowicz, der das Gymnasium in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts besuchte, erinnert sich, dass die fünf Wohnheime für arme Schüler vom Land nach Religionszugehörigkeit aufgeteilt waren. So wurden etwa polnische (römisch-katholische) Schüler im Głowacki- und Mickiewicz-Heim untergebracht, griechisch-katholische Ruthenen konnten Unterstützung durch das »Bauernstipendium« oder das »ruthenische Stipendium« beantragen, und für jüdische Schüler gab es ein »jüdisches Stipendium«, das Unterbringung und Verpflegung vollständig abdeckte und auch fachkundige Nachhilfe für die einschloss, die sich in der Schule schwer taten.24 Alle drei Volksgruppen sahen die Schule als Nährboden ihrer nationalen Eliten von morgen. Die Institution selbst jedoch verstand sich ausschließlich als polnisch.
Die meisten jüdischen Kinder erhielten nach wie vor nur eine rudimentäre Schulbildung. Die Fehlzeiten und Abbrecherquoten blieben sehr hoch, nicht zuletzt aufgrund wirtschaftlicher Not. Zwar ging es den Juden vergleichsweise besser als den Bauern. Aber was immer auch antijüdische Stimmen behaupten mochten: Bis auf eine sehr dünne Schicht relativ wohlhabender Familien war die große Mehrzahl von ihnen arm, in Buczacz 52wie im restlichen Galizien. Viele Juden wanderten in dieser Zeit von dort in die USA aus, um sich jenseits des Atlantiks eine neue Existenz aufzubauen. Die neuen Einwanderer riefen schon bald nach ihrer Ankunft Selbsthilfeverbände ins Leben.
1892 wurde in New York City die First Buczacz Benevolent Association gegründet. Sie sollte »ihre Mitglieder und deren Familien in Krankheits- und Notfällen substanziell unterstützen« und ihr »soziales, geistiges und sittliches Wohlergehen« fördern. Sieben Jahre später wurde diese Vereinigung durch die Independent Buczaczer Congregation and Benevolent Association of the City of New York abgelöst, deren Gründungsmitglieder zu zwei Dritteln bereits Staatsbürger der USA waren. 1901 und 1904 wurden zwei weitere Verbände von Einwanderern aus Buczacz gegründet, die sich beide der Hilfe für Kranke und Bedürftige widmeten.
Erst 1911 fühlten sich diese Einwanderer wirtschaftlich genügend abgesichert, um mit der Unterstützung ihrer Herkunftsgemeinde in Buczacz zu beginnen. In diesem Jahr wurde die Buczacz Relief Society of America gegründet. Ihr ausdrückliches Ziel war es, »wohltätige Zwecke zu erfüllen und die Not der Einheimischen der Stadt Buczacz zu lindern« sowie »den Schülern der einheimischen Schulen zu helfen, sei es in der Stadt Buczacz, dem Königreich [sic!] Österreich oder anderen Orten und Ländern«. Die Bereitschaft, Hilfe für andere zu leisten, zeugte nicht nur von der verbesserten wirtschaftlichen Lage der Einwanderer, sondern war auch ein Zeichen dafür, dass sie sich zunehmend in die amerikanische Gesellschaft integrierten. Im Oktober 1918, achtzehn Monate nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg, verkündete die neue American Buczaczer Relief Society voller Stolz, dass alle Unterzeichner ihres Registrierungsantrags US-Bürger waren. Sie gelobte, »in Österreich geborene amerikanische Staatsbürger, die jetzt in der Marine oder im Militär der Regierung der Vereinigten Staaten dienen, finanziell und anderweitig zu unterstützen«.2553Aus den alten Buczaczern waren patriotische Amerikaner geworden.