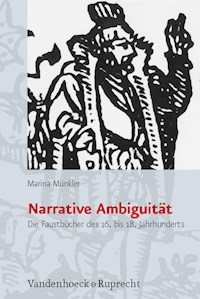29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von Die Zeit, Deutschlandfunk und ZDF: «Marina Münkler entwirft das Panorama einer revolutionären Epoche. Lehrreich und mitreißend zugleich.» Im 16. Jahrhundert ändert sich die Welt von Grund auf. Als Christoph Kolumbus 1492 einen bis dahin unbekannten Erdteil entdeckt, entsteht zugleich der Anspruch einer europäischen Herrschaft über diese «neue» Welt; das Christentum wird zu einer globalen Religion. Gleichzeitig steht die Alte Welt unter dem enormen Druck der tief nach Europa expandierenden Osmanen, und wenig später zerfällt mit dem Thesenanschlag Martin Luthers ihre religiöse Einheit. Marina Münkler durchmisst dieses dramatische Zeitalter der Entdeckungen und Konflikte, erzählt von den «Wilden» der Neuen Welt und den «Heiligen» der Alten ebenso wie von den Auseinandersetzungen um die «Türken». Münkler schildert die Medienrevolution des Buchdrucks und die Reformation, die das Verhältnis jedes Einzelnen nicht nur zur Kirche, sondern auch zu Glauben und Heilsgewissheit vollkommen veränderte, die Geburt der modernen Naturforschung, aber auch Bauernkriege und Hexenverbrennungen. Ein Jahrhundert, das in jeder Hinsicht grundstürzend war – und das, wie Marina Münkler zeigt, viel mit uns verbindet. Ein großes Geschichtswerk über den Anbruch einer neuen Zeit, unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marina Münkler
Anbruch der neuen Zeit
Das dramatische 16. Jahrhundert
Über dieses Buch
Im langen 16. Jahrhundert ändert sich die Welt von Grund auf. Als Christoph Kolumbus 1492 einen bis dahin unbekannten Erdteil entdeckt, entsteht zugleich der Anspruch einer europäischen Herrschaft über diese «neue» Welt; das Christentum wird zu einer globalen Religion. Gleichzeitig steht die Alte Welt unter dem enormen Druck der tief nach Europa expandierenden Osmanen, und wenig später zerfällt mit dem Thesenanschlag Martin Luthers ihre religiöse Einheit. Marina Münkler durchmisst dieses dramatische Zeitalter der Entdeckungen und Konflikte, erzählt von den «Wilden» der Neuen Welt und den «Heiligen» der Alten ebenso wie von den Auseinandersetzungen um die «Türken». Münkler schildert die Medienrevolution des Buchdrucks und die Reformation, die das Verhältnis jedes Einzelnen nicht nur zur Kirche, sondern auch zu Glauben und Schicksal vollkommen veränderte, die Geburt der modernen Naturforschung, aber auch Bauernkriege und Hexenverbrennungen. Ein Jahrhundert, das in jeder Hinsicht grundstürzend war – und das, wie Marina Münkler zeigt, viel mit uns verbindet. Ein großes Geschichtswerk über den Anbruch einer neuen Zeit, unserer Zeit.
Vita
Marina Münkler ist Professorin für Mittelalterliche und Frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden. Sie ist Autorin kulturgeschichtlicher und politischer Bücher, darunter «Lexikon der Renaissance» (2000) und «Marco Polo» (2015). Gemeinsam mit Herfried Münkler veröffentlichte sie 2016 «Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft», ein Buch, das zum «Spiegel»-Bestseller wurde und enormes Echo fand.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Karten Peter Palm
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung «Triumph des Dogen Niccolo da Ponte» (Ausschnitt). Deckengemälde von Tintoretto, 1580/84. Venedig, Dogenpalast, Sala del Maggior Consiglio (akg-images/Cameraphoto); «Das Paradies» (Ausschnitt). Entwurf für das Deckengemälde im Sala del Maggior Consiglio von Tintoretto, 1588. Paris, Musée du Louvre (akg-images/Erich Lessing)
ISBN 978-3-644-10008-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Das 16. Jahrhundert ist eine Epoche grundlegender Veränderungen und extremer Spannungen. Es ist das Jahrhundert, in dem Europa die Herrschaft über die Welt antritt, sich zugleich aber als bedroht und in den letzten Winkel der Welt gedrängt begreift. Drei große Konfliktlinien prägen das Jahrhundert: das Vordringen der Spanier und Portugiesen auf den amerikanischen Kontinent und in den Indischen Ozean, die Expansion des Osmanischen Reichs und der Zerfall der Christenheit in zwei sich unversöhnlich gegenüberstehende Lager im Zuge der Reformation. In der europäischen Selbstwahrnehmung haben die sich daraus ergebenden Spannungen lange Zeit keine Rolle gespielt. Von der «Entdeckung der Welt und des Menschen» haben die Historiker Jules Michelet und Jacob Burckhardt in ihren emphatischen Beschreibungen der Renaissance gesprochen und damit das Pathos des Entdeckers als heroischem Überwinder unüberwindlich scheinender Grenzen begründet. Sie haben ein Bild der Renaissance entworfen, das durchgängig positiv gefärbt war und den Europäern Eigenschaften wie Neugier, Inspiration und Offenheit zuschrieb. Schon das von italienischen Humanisten erfundene Wort «Renaissance», Wiedergeburt, das zur Selbstauszeichnung der eigenen Zeit diente, war mit dem Pathos der Entdeckung verbunden – zunächst der Wiederentdeckung antiker Schriften, dann aber auch der Entdeckung «des Menschen» in der Bildungsbewegung des Humanismus und einer neuen Welt. Unter der Dominanz dieses Pathos ist der Eroberer quasi im Windschatten des Entdeckers gesegelt und hat an dessen Ruhm partizipiert.
Diese Sichtweise hat einer kritischen Betrachtung, wie sie seit dem Beginn der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg üblich wurde, nicht standhalten können. Aber lange Zeit dominierte nach wie vor die positive Sicht des Entdeckers, von dem der Eroberer zunehmend negativ abgegrenzt wurde. Erst seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich in der Kolonialgeschichtsschreibung die Erkenntnis durchgesetzt, dass Entdecker wie Christoph Kolumbus und Eroberer wie Hernán Cortés zusammengehören wie die beiden Seiten einer Medaille. Dennoch genießt der Entdecker bis heute einen sehr viel besseren Ruf als der Eroberer. Ihm werden Eigenschaften wie Inspiration, Wagemut und Unbeirrbarkeit angesichts von Widerständen und mangelnder Anerkennung zugeschrieben. Demgegenüber erscheint der Eroberer als der Prototyp schlechter Eigenschaften, als jemand, den Habgier, Brutalität, Grausamkeit und Verschlagenheit auszeichnen. Wo dem Eroberer dennoch Anerkennung zuteilwird, werden in erster Linie sein strategisches Geschick und sein Scharfsinn gerühmt, mit deren Hilfe er zahlenmäßige Unterlegenheit und logistische Defizite auszugleichen vermochte. Zwar konnte bei näherer geschichtlicher Betrachtung niemandem verborgen bleiben, dass Entdecker und Eroberer nicht nur eng miteinander verbunden, sondern häufig auch ein und dieselbe Person waren, dass der Entdecker von Beginn an auf die Inbesitznahme des von ihm entdeckten Landes aus war, dass er sich jederzeit in einen Eroberer verwandeln konnte und dass umgekehrt die meisten Eroberer das von ihnen eroberte Gebiet zuvor entdeckt hatten. Dennoch blieb die Betrachtung des Entdeckers als Grenzüberschreiter und -überwinder gegenüber dem Eroberer als Grenzverletzer beherrschend, und selbst diese Grenzverletzungen wurden vielfach gerechtfertigt – nicht zuletzt mit dem Argument der Ausbreitung des christlichen Glaubens, von dem angenommen wurde, dass er die Seelen der vormals Ungläubigen rette.
Während aber das Christentum in der Neuen Welt mehr oder minder gewaltsam expandierte, zerbrach seine Einheit in der Alten Welt, weil ein Augustinermönch in der deutschen Provinz einige zuvor schon im Schwange befindliche Überlegungen über Gott und die Welt zu Ende gedacht und die Freiheit Gottes entdeckt hatte, vor der alle menschliche Gewissheit zu Staub zerfiel. Das betraf insbesondere die von der römischen Kirche eingerichteten Heilsvergewisserungen: Ablass, Wallfahrt, Reliquien, Heilige. Sie hatten den Menschen einen permanenten Aushandlungsprozess mit dem göttlichen Richter ermöglicht und machten einen Weg zu Gott jenseits der Kirche und ihrer religiösen Praktiken undenkbar. Luther setzte ein Buch und eine Gewissheit dagegen, die der Einzelne in sich selbst finden musste: die Bibel und den Glauben. Damit rüttelte er an den Grundfesten des Christentums, was ihn der Verfolgung als Ketzer aussetzte. Als er 1521 angstvoll von Wittenberg zum Reichstag nach Worms fuhr, wo ihn, nachdem ihn der Papst im Jahr zuvor gebannt hatte, die Reichsacht erwartete, konnte er sich nicht sicher sein, die Stadt lebend wieder zu verlassen. Doch abgesehen von seinem Gottvertrauen konnte er auch Mut daraus schöpfen, dass ihm unterwegs eine ungeheure Welle der Begeisterung entgegenschlug: In Erfurt ritt ihm der Rektor der Universität, der berühmte Humanist Crotus Rubeanus, mit vierzig anderen entgegen und begrüßte ihn feierlich. Der Erfurter Latinist und neulateinische Dichter Helius Eobanus Hessus schrieb mehrere Elegien auf ihn und pries ihn nicht nur als einen neuen Herkules, der gekommen sei, um den Schafstall Christi auszumisten, sondern auch als denjenigen, der «der Christenheit ihren gebührenden Namen» zurückgebe. In Frankfurt begrüßte eine Patrizierin Luther gar als den Verkünder einer neuen Zeit, eines Neuanfangs, den sie euphorisch feierte. Während aber bei den einen Aufbruchsstimmung herrschte, wähnten die anderen das Ende der Welt nahe, wenn es nicht gelang, die «ketzerische» Bewegung, die Luther losgetreten hatte, in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzuführen oder zu zerschlagen.
Insgesamt wurde der Anbruch der neuen Zeit keineswegs als etwas grundsätzlich Positives begriffen. Vielmehr dominierten apokalyptische Vorstellungen. Die neue Zeit wurde vielfach eher als Endzeit denn als Aufbruch verstanden. Das hatte nicht zuletzt mit der Zertrümmerung des Alten zu tun. Die protestantische Ablehnung der Heiligenverehrung und Luthers Verspottung der Heiligenlegenden als «Lügenden» räumte nicht nur den Himmel leer, sondern erschütterte auch die Fundamente von Glauben und Frömmigkeit. Bis zum Beginn der Reformation war die christliche Welt mit der ihr zugehörigen Zeitvorstellung von den Heiligen durchwirkt: Jeder Tag des Jahres war einem Heiligen gewidmet, jede Stadt, jede Kirche hatte ihren eigenen Heiligen, für jede Krankheit und jeden Notfall gab es einen Heiligen, den man um Hilfe anrufen konnte. Und jede Sünde konnte durch die Fürbitte der Heiligsten aller Heiligen, der Gottesmutter Maria, vergeben werden. Ein Angriff gegen diese Art von Verehrung war eine Attacke gegen die bestehende Frömmigkeitspraxis. Die Auseinandersetzung um die Heiligen bildete deshalb auch einen der erbittertsten Kampfplätze in dem Konflikt zwischen den sich ausprägenden protestantischen Konfessionen und der römisch-katholischen Kirche – einem Konflikt, der nicht nur in der Alten, sondern auch schon bald in der Neuen Welt ausgetragen wurde.
Zahlreiche Gewissheiten gingen damit zum Teufel, die gesellschaftliche Ordnung selbst schien ins Wanken geraten zu sein, und die darüber entstehenden Gegensätze wurden mit äußerster polemischer Schärfe vorgetragen: Beschimpfungen, Verunglimpfungen, Herabsetzungen und Schmähungen prägten die Kontroversen zwischen Katholiken und Protestanten, die dann häufig in Gewalt mündeten. Alle Konflikte wurden jetzt auf offener Bühne ausgetragen, denn die lateinische Sprache verlor ihre Vormachtstellung in den religiösen und politischen Diskursen. Die Auseinandersetzungen «ergriffen die Massen», weil sie in der Volkssprache geführt wurden, und es entstand erstmals so etwas wie eine «Öffentlichkeit». In diesen Gärungsprozessen geriet auch die Produktion und Verbreitung von Texten unter einen bis dahin nie dagewesenen Aktualitätsdruck. Die religiösen Kämpfe um die wahre Religion brachten eine Flut von Streitschriften hervor, Flugschriften, Flugblätter, die jedermann aufforderten, sich der einen oder der anderen Seite anzuschließen. Die Eroberung der Neuen Welt produzierte einen Strom von Americana, Berichten über die Neue Welt; gleichzeitig vervielfältigte sich durch den Bekenntnisdruck die Zahl der Selbstzeugnisse, wie Autobiographien, Tagebücher oder Briefe. Die unteren Schichten wurden Teil der Literatur, als Verfasser wie als Protagonisten. Im Reformationsdialog etwa trat der Bauer dem Kleriker selbstbewusst entgegen. Und die ritterliche Welt verlor ihre Vormachtstellung, trotz zahlreicher Versuche, ihre Vorbildlichkeit in neuem Glanz erscheinen zu lassen, etwa in Ariosts Epos Orlando Furioso (Der rasende Roland), in dem Liebesgeschichte und Kreuzzugsidee miteinander verknüpft werden, oder im Roman Amadis von Gallien, der noch einmal das Bild eines perfekten Ritters präsentierte.
Auf Letzteren bezog sich der Abgesang auf die Ritterlichkeit in Cervantes’ Don Quijote, des «Ritters von der traurigen Gestalt», der karikierte, was in den Kriegen mit den Osmanen wie den Kriegszügen in der Neuen Welt überdeutlich geworden war: Das Zeitalter der ritterlichen Kämpfe war zu Ende, es kam die Zeit der Kanonen und des Massakers. So sehr sich die Eroberer auch als Ritter zu inszenieren versuchten, so wenig konnten sie leugnen, was die Basis ihrer Erfolge war: hinterhältige Bündnisse und rücksichtslose Gewalt. In der Literatur ging das einher mit der Entdeckung des negativen Helden, der nicht mehr am «gemeinen Wohl» einer ständischen Gesellschaft orientiert, sondern auf die rücksichtslose Durchsetzung seiner Interessen aus ist, was auch durch Komik kaum noch gebändigt werden kann, denkt man beispielsweise an den verbreiteten Schwankroman Till Eulenspiegel oder die spanischen pícaro-Romane mit ihren «bauernschlauen» und amoralischen Protagonisten. Auch die bildenden Künste entdecken in der Genremalerei, etwa des Flamen Pieter Bruegel, die unteren Schichten und ihren Alltag. Insbesondere die Kupferstiche der Zeit zeigen aber auch das Hässliche und Verwerfliche. Sie entfalten daneben ein Bildreservoir von Ängsten und Bedrohungen, das von den menschenfressenden «Kannibalen», die in den Illustrationen zu Berichten und auf Karten abgebildet wurden, bis zu den «Hexen» reicht, die neben anderen Hans Baldung Grien in ihrer Mischung aus verführerischer Schönheit und abstoßender Hässlichkeit gezeigt hat. «Kannibalen» und «Hexen» schienen nunmehr die Welt zu bevölkern. Was Bilder und Texte als gefährlich vermitteln, wird als Bedrohung für die gesamte Ordnung wahrgenommen, auf die im Gebiet des Reichs am Ende des 16. Jahrhunderts sowohl Katholiken als auch Protestanten mit der ersten Hochphase der Hexenverfolgung (1580 bis 1590) reagieren.
Daneben gibt es allenthalben Versuche, Ordnung zu stiften oder wiederherzustellen: mit den wissenschaftlichen Neuerungen der Astronomie, die zunächst auf die «Rettung der Phänomene» (Mittelstraß) setzt, dann aber ein neues heliozentrisches Weltbild (Kopernikus) entwirft, das mit Galileo Galileis Entdeckung der Jupitermonde einen schlagenden Beweis erhält und mit Johannes Kepler in eine schlüssige Theorie verwandelt wird; mit der systematischen Organisation von Herrschaftswissen über ferne Gebiete, aus der dann Staatsbeschreibung und Statistik hervorgehen; mit dem entstehenden Völkerrecht, das der europäischen Expansion einen rechtlichen Rahmen gibt; mit den Grammatiken, die eine Ordnung der Volkssprachen zu schaffen suchen; und mit den neuen Disziplinarregimen, die nicht nur von den jeweiligen Obrigkeiten entwickelt werden. Ordnung wiederherstellen sollen auch Abkommen, wie der 1494 geschlossene Vertrag von Tordesillas, der die sogenannte Neue Welt zwischen Spanien und Portugal aufteilte, und Verträge, wie der Augsburger Religionsfrieden von 1555 zwischen den widerstreitenden konfessionellen Parteien. Die meisten dieser Vereinbarungen und Verträge erweisen sich jedoch als brüchig und befeuern nicht selten das, was sie eigentlich stillstellen sollen. Im 16. Jahrhundert stehen sich damit Chaos und Ordnung, Selbstgewissheit und tiefe Verunsicherung, Aufbruchs- und Endzeitbewusstsein, Umbruch und Konsolidierung, Wagemut und Verzweiflung nicht nur gegenüber, sondern vermischen sich in einer Weise, die das Jahrhundert als ein alchemistisches Labor erscheinen lassen, aus dem neue Lebensformen und Wissensordnungen hervorgehen.
Diese Dynamik hält auch Einzug in die Sprache. Das 16. Jahrhundert prägt mit zahlreichen neuen oder bedeutungsveränderten Worten unsere Sprache bis heute in vielfältiger Weise: «Neue Welt», «Amerika» und «Kannibalen» sind Neuschöpfungen des 16. Jahrhunderts. Andere Wörter sind zwar älter, erhalten in der damaligen Zeit aber eine andere Bedeutung. Dazu gehören die Bezeichnungen «Wilde» oder «Barbaren» für die indigenen Völker des amerikanischen Kontinents wie für die Osmanen, deren abwertender Grundtenor unmittelbar deutlich ist, aber auch «Türken» für alle Angehörigen des Osmanischen Reichs, was nicht sogleich als diskreditierend erkennbar ist. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerreich, und seine Führungsämter sowie seine Armee wurden zum großen Teil aus Europäern (zwangs-)rekrutiert. Es mit einer Ethnie gleichzusetzen, die obendrein mit «Barbarei», «Grausamkeit» und «Tyrannis» unauflöslich verknüpft wurde, prägte ein Bild, das bis heute nachwirkt.
In solchen Wörtern zeigt sich eine eurozentrische Perspektive, die mit ihren prägenden Bedeutungen so facettenreich ist, dass es nach wie vor lohnt, ihr nachzugehen. Diese Perspektive war im 16. Jahrhundert nicht nur deshalb dominant, weil die Europäer die Beherrschung der Welt anstrebten und durchsetzten – mit massiven Folgen für die indigene Bevölkerung der Neuen Welt –, sondern auch, weil sie sich zugleich als bedroht erlebten: von außen durch die Osmanen und von innen durch die Spaltung der Christenheit. Der Gedanke von Europa als einer kulturellen Einheit, der von den Humanisten erstmals entfaltet wurde, entstand aus einem Gefühl der Bedrohung und ist darin bis heute wirksam. Andererseits wurden zu kaum einem Zeitpunkt in Europa die Rechte von Nicht-Europäern entschiedener verteidigt, als dies im 16. Jahrhundert der Fall war. Die völkerrechtlichen Bestimmungen, von denen einige bis heute im internationalen Recht wirksam sind, wurden wesentlich im 16. Jahrhundert geprägt.
Überhaupt scheint vieles von dem, was das 16. Jahrhundert kennzeichnet, auch ohne vordergründige Aktualisierungen, heute besonders aktuell: der Kampf um Worte, der Kampf um die Beherrschung der Diskurse, der Kampf um die Wirkmacht der Bilder. Es ist zweifellos kein Zufall, dass diese Kämpfe mit einem Medienwandel einhergingen, der mit der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts begann, aber erst im 16. Jahrhundert seine eigentliche Wirkmacht entfaltete. Was einmal dafür gedacht war, eine perfekte Bibel herzustellen, erwies sich als ideale Voraussetzung für die Produktion sehr viel schnelllebigerer Schriften. Flugschriften und Flugblätter wurden zu den Medien, die nicht nur für die rasche Verbreitung von Neuigkeiten geeignet waren, sondern auch für die vielfältigsten Arten von herabsetzender Kommunikation. Was sich heute wieder beobachten lässt, gilt auch für das 16. Jahrhundert: Die schmähendste Rede, das bösartigste Wortspiel, die übelste Anschuldigung erzeugen die größte Aufmerksamkeit und bilden damit den dominanten Kommunikationsmodus, der soziale Grenzen wie auch Grenzen der Bildung spielend überwindet. Der gelehrte Doktor kann sich nicht minder herabsetzend ausdrücken als der «Bauernrüpel».
Nicht alle diese Prozesse beginnen im 16. Jahrhundert oder finden darin ihren Abschluss. In der Regel wird das 16. mit dem 17. und 18. Jahrhundert unter dem Begriff «Frühe Neuzeit» zusammengefasst, wobei das 16. Jahrhundert eher als namenlose Epoche gefasst wird, auf die dann namhaftere folgen, wie Barock, Rokoko oder Aufklärung. Bisweilen wird auch von Spätrenaissance gesprochen. Die Konzentration auf das erste Jahrhundert der Frühen Neuzeit rechtfertigt sich durch den äußerst vielschichtigen Zusammenhang unterschiedlicher Bewegungen, die es zu einem dramatischen Jahrhundert machen – von der Entdeckung und Eroberung des amerikanischen Kontinents bis zur Zuspitzung jener Konflikte, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts schließlich in den Dreißigjährigen Krieg münden. Einen solchen Krieg wie den von 1618 bis 1648 hat das 16. Jahrhundert nicht gekannt, doch seine kriegerisch ausgetragenen Konflikte waren so zahlreich und vielfältig – von den Hegemonialkriegen zwischen Frankreich und den Habsburgern über die Konfessionskriege zwischen Katholiken und Protestanten bis zu den Kriegen gegen die Osmanen und den Eroberungskriegen in der Neuen Welt, um nur einige zu nennen –, dass man es auch als ein Jahrhundert der Kriege bezeichnen könnte.
Dies in den Blick zu nehmen setzt jedoch voraus, dass man das 16. Jahrhundert gerade nicht von seinen Gipfelwerken der Kunst, Literatur oder des politischen Denkens aus beschreibt, also nicht ein weiteres Mal Dürer, Michelangelo oder Tizian, Shakespeare oder Cervantes, Machiavelli oder Bodin in den Mittelpunkt rückt. Eine solche Perspektive auf das 16. Jahrhundert mag lehrreich sein, aber man würde dabei die grundlegenden Konfliktlinien der Zeit übersehen. An den Auseinandersetzungen um die «Wilden», die «Heiligen» und die «Türken» dagegen kann man das 16. Jahrhundert als eine durch und durch dramatische Epoche erkennen – den Anbruch der Neuen Zeit als einen Beginn, der sein Ende schon in sich trägt.
1. KapitelEine grundstürzende Epoche: Das 16. Jahrhundert aus globaler Perspektive
Von der Entdeckung Amerikas bis zum Dreißigjährigen Krieg
Im Allgemeinen wird dem 16. Jahrhundert als einzelnem Jahrhundert keine große Aufmerksamkeit gewidmet.[1] Üblicherweise wird es der Frühen Neuzeit zugerechnet, die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert reicht, und keiner eigenen Betrachtung für würdig befunden. Das ist erstaunlich, denn in kaum einer anderen Zeit bis in die Moderne hinein hat sich die Welt so fundamental verändert. Die Entdeckung und Eroberung der sogenannten Neuen Welt hat dazu geführt, dass Europa weite Teile der Erde beherrschte. Die Expansion des Osmanischen Reichs hatte zur Folge, dass viele Europäer sich in ihrer Identität bedroht fühlten. Die Medienrevolution des Buchdrucks hat bewirkt, dass Geschriebenes nicht mehr nur von einer überaus kleinen Schicht der Gelehrten zur Kenntnis genommen wurde und sich eine bis dahin unvorstellbare kommunikative Dynamik entwickelte. Die Reformation hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Christentum in Europa sich aufspaltete und für große Teile der europäischen Bevölkerung sich nicht nur ihr Verhältnis zur Kirche, sondern auch zu Gott und den Heiligen grundlegend änderte.[2] Gewiss finden sich zu allen diesen Themen zahlreiche Untersuchungen, aber sie sind auf die unterschiedlichen Aspekte fokussiert und beschreiben kaum deren Vernetzungen. Außerdem konzentrieren sie sich nicht auf das 16. Jahrhundert. Dafür gibt es durchaus gute Gründe: Die europäische Expansion wie die des Osmanischen Reichs begannen bereits im Jahrhundert zuvor, der Buchdruck mit beweglichen Lettern wurde ebenfalls im 15. Jahrhundert erfunden; Debatten um eine Reform der Kirche und Kirchenspaltungen gab es schon seit der Trennung von oströmischer und weströmischer Kirche und während des gesamten Mittelalters immer wieder.
Dies gilt selbst für die genuin mit dem 16. Jahrhundert verbundenen technischen und wissenschaftlichen Innovationen: die Entwicklung der Astronomie, die in Europa zu einem revolutionären Wandel von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild führte; die Entwicklung der Nautik, die Hochseefahrten in großem Stil und damit die Beherrschung der Meere ermöglichte; die militärische Revolution, die eine Veränderung der Kriegführung zur Folge hatte und überhaupt erst so etwas wie Kontrolle über den Welthandel ermöglichte; die Entstehung einer Naturforschung in Europa, die nicht mehr der Erkenntnis Gottes in seiner Schöpfung, sondern der Erkenntnis der Verwertbarkeit der Natur diente – sie alle werden selten allein auf das 16. Jahrhundert bezogen, und auch das mit guten Gründen.
Jahrhunderte sind mehr oder weniger willkürliche Einteilungen, die mit historischen Entwicklungen, Brüchen oder Transformationen kaum in Übereinstimmung zu bringen sind. Kolumbus entdeckte die Neue Welt 1492, aber das Vorhaben, einen Seeweg nach Indien zu finden, um die osmanischen und arabischen Zwischenhändler für die begehrten Waren des Fernen Ostens zu umgehen, reicht tief ins 15. Jahrhundert zurück. Die osmanische Expansion hatte bereits mit der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 einen der für die Europäer schockierendsten Erfolge. Am ehesten lässt sich die Reformation klar dem 16. Jahrhundert zuordnen, mit Luthers Veröffentlichung der 95 Thesen gegen den Ablass am 31. Oktober 1517. Das gilt jedoch nur für den Beginn der Reformation und nicht für die auf sie folgende Konfessionalisierung und schon gar nicht für deren Bekämpfung im Dreißigjährigen Krieg – wenn man diesen Konflikt allein auf die Reformation zurückführt –, der nahezu die komplette erste Hälfte des 17. Jahrhunderts einnimmt.[3]
In der Geschichtsschreibung ist es üblich geworden, zwischen «langen» und «kurzen» Jahrhunderten zu unterscheiden. Das 20. Jahrhundert etwa war, wenn man es mit dem Ersten Weltkrieg anfangen und dem Zusammenbruch der Sowjetunion enden lässt, ein «kurzes» Jahrhundert, während das 19. Jahrhundert, das zumeist vom Beginn der Französischen Revolution 1789 bis zum Ausbruch der Oktoberrevolution im Jahr 1917 datiert wird, ein «langes Jahrhundert» war. Bei einer nicht an Daten, sondern an historischen Zäsuren orientierten Betrachtung gehört das 16. Jahrhundert zu den «langen» Jahrhunderten, lässt man es etwa mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 einsetzen und mit der Entdeckung der Jupitermonde durch Galileo Galilei im Jahr 1610 enden. Der französische Historiker Fernand Braudel hat es im Sinne einer weltgeschichtlichen Epoche noch weiter gefasst: von etwa 1450 bis 1620.
Was die Zäsur in der Mitte des 15. Jahrhunderts anbetrifft, hätte Braudel sich auf den Reformator Philipp Melanchthon berufen können, der die Eroberung Konstantinopels durch die Türken und das damit verbundene definitive Ende des Oströmischen Reiches als eine grundstürzende Zeitenwende begriffen hat. Ebenso gut hätte er sich aber auch auf den – freilich weniger genau datierbaren – Beginn der portugiesischen Entdeckungsreisen an der westafrikanischen Küste beziehen können, mit dem das Zeitalter der Entdeckungen und Eroberungen seinen Anfang nahm. Beides waren Ereignisse beziehungsweise Entwicklungen, die das 16. Jahrhundert zutiefst geprägt haben, weswegen es durchaus sinnvoll erscheint, es als Epoche bereits tief im 15. Jahrhundert beginnen zu lassen.
Die beiden Datierungen des Beginns weisen in entgegengesetzte Richtungen und stellen damit verschiedene Aspekte des Jahrhunderts heraus: Der Fall Konstantinopels war ja nicht nur ein Ende, sondern auch ein Anfang, nämlich der des Aufstiegs der Osmanen zu einem Europa bedrohenden Imperium, während der Beginn der Entdeckungsfahrten unter dem portugiesischen Kronprinzen Heinrich dem Seefahrer im 15. Jahrhundert eine bis dahin unvorstellbare Expansion Europas und seiner Macht einleitete. Der Blick nach Osten auf die Osmanen steht für die Bedrängnis Europas und seinen Abwehrkampf, also für das Selbstverständnis einer Kultur, die sich in ihrer Lebensweise und religiösen Prägung bedroht fühlt. Der Blick nach Süden und Westen, in den atlantischen Raum, steht hingegen für ein Europa, das sich anschickte, große Teile der Welt zu beherrschen, die diversen «Weltwirtschaften» miteinander zu verknüpfen und einen globalen Wirtschaftskreislauf herzustellen, wie es ihn zuvor noch nie gegeben hatte. Es ist ein Europa, das die indigenen Völker Mittel- und Südamerikas unterjocht, ihr Land erobert und sie in grausamen Kriegen, durch eingeschleppte Seuchen und das eingeführte System des Bergbaus und der Plantagenwirtschaft erheblich dezimiert und teilweise vernichtet hat. Mit beiden historischen Zäsuren, dem Aufstieg der Osmanen und der europäischen Expansion in die Neue Welt, ergeben sich unterschiedliche Signaturen des 16. Jahrhunderts.
Die Datierung des Jahrhundertendes auf die Zeit um 1610 lässt sich einerseits mit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges, andererseits mit der definitiven Verschiebung des ökonomischen und finanziellen Zentrums der europäischen Wirtschaft in die Niederlande und nach England begründen, also dem säkularen Bedeutungsverlust der Spanier und Portugiesen. Gegen diese zeitliche Begrenzung kann man geltend machen, dass die Konfessionskriege, denen auch der Dreißigjährige Krieg in Zentraleuropa zuzurechnen ist, in Westeuropa bereits tief im 16. Jahrhundert begonnen haben, etwa mit den Hugenottenkriegen in Frankreich zwischen 1562 und 1598 und dem Aufstand der Niederlande gegen die spanische Herrschaft ab dem Jahr 1568. Konsequenterweise müsste man das 16. Jahrhundert dann bis 1648 ausdehnen, bis zum Friedensschluss von Münster und Osnabrück, was bedeuten würde, dass es sich – bei einem Beginn Mitte des 15. Jahrhunderts – um ein Doppeljahrhundert handelt, das je die Hälfte des vorangehenden und nachfolgenden Jahrhunderts einnimmt. Aber vermutlich würde ein Schlusspunkt von 1648 einen Anfang um 1517, dem Beginn der Reformation, nahelegen. Damit hätte man freilich das 16. Jahrhundert als Epoche der Glaubenskämpfe und Konfessionskriege definiert – und die Zeit der Entdeckungen und Eroberungen marginalisiert.
Betrachtet man das 16. Jahrhundert aus einer globalen Perspektive, schrumpft allerdings das Gewicht der Reformation. Im gleichen Zug gewinnen nicht nur die spanischen Entdeckungen und Eroberungen als Grundlage der Bildung eines Weltreichs an Bedeutung, auch die Bedrohung von dessen östlichem Zentrum durch die osmanischen Ambitionen einer Beherrschung der Welt rückt stärker in den Fokus. Die Eroberung der Neuen Welt führte außerdem dazu, dass zwei Großreiche untergingen, die zuvor weite Teile des mittel- und südamerikanischen Kontinents beherrscht hatten: die Reiche der Azteken und der Inka. Während die Azteken große Teile Mittelamerikas kontrollierten, hatte das Reich der Inka sein Zentrum in den Anden und erstreckte sich über ein Gebiet, das in der Zeit seiner größten Ausdehnung Teile des heutigen Kolumbiens und Ecuadors über Peru, Zentralbolivien, das nordwestliche Argentinien und einen weiten Teil des heutigen Chile umfasste. Beide Reiche waren relativ junge Imperien: Die Inka hatten ihre Eroberungs- und Unterwerfungszüge etwa 1438 aufgenommen, und auch die Azteken expandierten seit den 1430er Jahren.[4] Dass diese Reiche unter dem Druck der Eroberer sang- und klanglos untergingen, hatte unterschiedliche Gründe. Ihr Kollaps resultierte keineswegs nur aus ihrer zivilisatorischen oder waffentechnischen Unterlegenheit, sondern war auch eine Folge ihrer imperialen Politik. Die Eroberung dieser Reiche gelang den Spaniern nicht zuletzt durch Bündnisse mit anderen indigenen Völkern, wie den Tlaxcalteken. Diese waren von den Azteken unterworfen worden und hatten ein eigenes Interesse an einem Bündnis mit den neu aufgetauchten Fremden, mittels derer sie das aztekische Joch abzuschütteln versuchten – nicht ahnend, dass ihnen das ein neues Joch einbringen würde.
Weltreichsbildung, globale Wirtschaftskreisläufe und Revolution der Kriegführung
Man könnte im Zeichen der Eroberung der Neuen Welt durch die Spanier das 16. Jahrhundert auch als das habsburgische Jahrhundert bezeichnen. Und tatsächlich ist es noch nicht lange her, dass gängige Darstellungen der Zeit sich vor allem um den Aufstieg des Hauses Habsburg drehten: das burgundische Erbe Kaiser Maximilians, das spanische Erbe seines Enkels Karl und schließlich die Ausweitung zu einem Weltreich im Gefolge der Entdeckungen und Eroberungen.[5] Das ist die Leiterzählung einer eurozentrischen Geschichtsbetrachtung, die den Aufstieg der Habsburger überdies als erheblich friedlicher und menschenfreundlicher ausgibt, als er tatsächlich war. Darin ist die ebenso geschickte wie vom Zufall begünstigte Heiratspolitik seit Friedrich III. zur Formel einer vorgeblich gewaltfreien Reichsbildung geronnen: Während andere Eroberungskriege führten, sei das Haus Habsburg durch Heiraten unaufhörlich gewachsen – Bella gerant alii, tu felix Austria nube («Lass die anderen Krieg führen, du aber, glückliches Österreich, heirate»). Für das 15. Jahrhundert, als Friedrich III. wenig Neigung zeigte, Europa gegen die Expansion des Osmanischen Reichs zu verteidigen, und die Kreuzzugsaufrufe von Papst Pius II. geflissentlich überhörte, mochte dieser Merksatz noch gelten, nicht aber für die Zeit danach. Außerdem führte die habsburgische Heiratspolitik, aus der die späteren Zentren des Hauses Habsburg, Österreich und Spanien, hervorgingen, keineswegs nur zu einer friedlichen Vergrößerung des Reichs: Im 16. Jahrhundert führten die Habsburger nicht nur die innereuropäischen Hegemonialkriege gegen Frankreich und die Niederlande sowie die Abwehrkriege gegen das expandierende Osmanische Reich, sondern eroberten und beherrschten zumeist mit brutaler Gewalt auch die Neue Welt. Tatsächlich war das 16. Jahrhundert eines der Kriege – freilich mit dem Unterschied gegenüber den vorherigen Jahrhunderten, dass diese Kriege nicht nur in Europa, sondern auch in der neuentdeckten Welt und zunehmend auf den Weltmeeren, im Atlantischen und Indischen Ozean, ausgetragen wurden. In dieser Hinsicht war es tatsächlich ein Jahrhundert der europäischen Expansion, wie es auch häufig in der Geschichtsschreibung charakterisiert wird.[6]
Eine solche Perspektive sollte jedoch nicht übersehen lassen, dass die Bildung von Imperien im 16. Jahrhundert kein europäisches oder gar habsburgisches Sonderprojekt war. Etwa zur gleichen Zeit entstanden auch drei islamische «Welt»- beziehungsweise Großreiche: das der Osmanen, das der Safawiden im Mittleren Orient und das der Moguln in Indien. Auch die Ming-Dynastie in China hat sich als ein Weltreich begriffen. Es waren also mindestens fünf große Reiche, die im 16. Jahrhundert ihre politisch und wirtschaftlich mehr oder weniger integrierten «Welten» beherrschten. Die Annahme einer habsburgisch-spanischen Sonderrolle lässt sich schon deswegen schwerlich aufrechterhalten, weil sich das Osmanische Reich im 16. Jahrhundert ebenfalls auf drei Kontinente erstreckte: den Südosten Europas (den die Osmanen in Anlehnung an Rom Rumelien nannten), Teile Asiens mit Anatolien, der Levante und Mesopotamien sowie Nordafrika mit Ägypten, großen Teilen der Arabischen Halbinsel sowie dem Maghreb.[7] Und selbst wenn man geltend macht, die Europäer hätten den Welthandel revolutioniert,[8] so ist doch festzuhalten, dass das Osmanische Reich in diesem Jahrhundert die wichtigsten der über Land verlaufenden Handelsverbindungen zwischen Europa, Asien und Afrika unter seine Kontrolle gebracht hatte und insofern ebenfalls als ein Akteur gelten kann, der globale Wirtschaftskreisläufe beherrschte.
Der wohl entscheidende Unterschied zwischen den Imperien der Habsburger und der Osmanen lag darin, dass Ersteres, zumal seitdem Spanien und Portugal unter Philipp II. in Personalunion regiert wurden, ein Reich der Weltmeere war, während das Zentrum des Osmanischen Reichs auf dem Festland lag – auch wenn Sultan Mehmed II. sich am Eingang seines Palastes nicht nur als «Herrscher zweier Kontinente», sondern auch als «Herrscher zweier Meere» bezeichnete,[9] womit das Schwarze und das Weiße Meer – wie die Türken das Mittelmeer nannten – gemeint waren. Das waren freilich Binnenmeere und keine Ozeane. Man beobachtete in Konstantinopel die atlantische Expansion der beiden iberischen Staaten zwar sehr genau und war auch bestrebt, die Informationen über Kolumbus’ Entdeckungen und Vasco da Gamas Umsegelung der Südspitze Afrikas in Karten zu verarbeiten.[10] Doch unternahm man keine Anstrengungen, eigene Schiffe in den Atlantik zu entsenden. Sehr wohl bemühte man sich aber nach der Eroberung und Zerschlagung des Mamlukenreichs im Jahr 1517 um die Wiederbelebung des arabisch-ägyptischen Indienhandels. Dabei blieb man jedoch im Wesentlichen auf das Rote Meer und den Persischen Golf beschränkt, da im Indischen Ozean zu dieser Zeit bereits portugiesische Schiffe kreuzten, die den Aufbau einer mehr als episodischen osmanischen Seemacht zwischen der Arabischen Halbinsel und Indien blockierten.[11] Die schiffbautechnische und waffentechnologische Unterlegenheit der osmanisch-arabischen Schiffe auf dem Ozean gegenüber denen der Portugiesen war für die Erringung einer osmanischen Seeherrschaft, wie sie im östlichen und südlichen Mittelmeer ja bestand, zu groß.[12] Im Mittelmeer wurde der Seekrieg nach wie vor mit von Ruderern angetriebenen Galeeren geführt, die am Bug über einen Rammsporn verfügten, mit dem sie gegnerische Schiffe zunächst bewegungsunfähig machten und dann enterten oder in den Grund bohrten. Auf den Ozeanen hingegen wurde mit kanonenbestückten Segelschiffen Krieg geführt. Bei der Konstruktion solcher Schiffe waren die West- und Südeuropäer den Osmanen weit überlegen. Sie waren schon bald nicht mehr nur auf den Heckaufbauten mit Kanonen ausgestattet, sondern auch beidseits unter Deck, wodurch sie Breitseiten abfeuern konnten. Daraus entwickelte sich im Verlauf des 16. Jahrhunderts ein technologischer Vorsprung auf den Ozeanen, dem die Osmanen nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hatten.
In der Kriegführung zu Land, auch in der zwischen osmanischen und habsburgischen Truppen, war die Situation hingegen genau umgekehrt. Hier verfügten die Osmanen seit dem späten 14. Jahrhundert über eine taktische und strategische Überlegenheit gegenüber europäischen Heeren, die sie bis weit in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts aufrechterhalten konnten. Sie folgte einerseits aus der zentralen osmanischen Reichsorganisation, andererseits daraus, dass das in den (west-)europäischen Heeren lange vorherrschende ritterliche Ethos und die ihm verpflichtete Kampfweise eine Lernblockade darstellte, die der Entwicklung einer effektiven Kampftaktik gegen die Türken entgegenstand. In der Schlacht bei Nikopolis 1396 etwa bestanden die französisch-burgundischen Ritter auf ihrem Vorkampfrecht gegenüber den ungarischen Fußtruppen und führten ihren Stoßangriff gegen die leichte Reiterei der Osmanen, die sich seitlich zurückzog. So stießen die Ritter auf die an der Sultansschanze postierten Bogenschützen, in deren konzentriertem Feuer der Angriff dann unter hohen Verlusten zusammenbrach. Dem türkischen Gegenangriff hatten die christlichen Heere anschließend nichts mehr entgegenzusetzen, sodass ihre Gefechtsführung unmittelbar von einem kühnen Angriff in eine heillose Flucht umschlug. Ähnlich verlief die Schlacht des ungarischen Heeres bei Mohács 1526, in der sich erneut Teile der osmanischen Reiterei zurückzogen und damit die ungarischen Ritter dazu verlockten, in die Reichweite der auf einem Hügel postierten Kanonen vorzustoßen, von denen sie zusammengeschossen wurden. Das ritterliche Kampfethos verhinderte, dass man aus den Niederlagen lernte und zu einer ebenfalls taktisch defensiven Schlachtordnung überwechselte oder den Kampf der gefechtsverbundenen Waffengattungen pflegte.
Das verweist darauf, dass das 16. Jahrhundert eine Zeit des zu Ende gehenden Rittertums und seiner Ehrauffassung war. Das Rittertum war zwar bereits im vorangegangenen Jahrhundert in eine tiefe Krise geraten, hatte sich aber als verhaltensprägendes Ethos zu halten vermocht, preisend besungen im beliebtesten europäischen Ritterroman der Zeit, dem Amadis von Gallien, bis es dann in Cervantes’ Don Quijote (1605) literarisch verabschiedet wurde.[13] Im ritterlichen Ethos schiebt sich die mittelalterliche Welt bis in die Neuzeit hinein, die mit dem Einsatz immer leistungsfähigerer und zunehmend auch in der offenen Feldschlacht verwendbarer Kanonen sowie der Zusammenstellung von Fußsoldaten und Bogenschützen zu geschlossenen Formationen längst begonnen hatte.
Damit veränderten sich auch die Träger des Krieges. Man hat die Ersetzung der adligen Panzerreiter im Zentrum der Schlacht durch zu Gevierthaufen formierte Fußsoldaten, die mit langen Spießen und zunehmend auch mit Arkebusen und Musketen bewaffnet waren, auf Europa bezogen als «Plebejisierung des Krieges» bezeichnet.[14] Dieser sich vom 14./15. bis zum 17. Jahrhundert hinziehende Übergang steht ebenso wie die Entdeckungen und Eroberungen sowie die Glaubensspaltung im Gefolge der Reformation dafür, dass im 16. Jahrhundert eine Epoche zu Ende ging und eine neue begann. Söldner, die als Angehörige der Fußtruppen dienten, bildeten zunehmend das Gros der Heere.[15] Am Anfang dieser militärischen Entwicklung stehen die Schweizer Fußtruppen, die 1386 bei Sempach ein habsburgisches Ritteraufgebot und 1477 bei Nancy das Heer des burgundischen Herzogs Karl des Kühnen besiegten, des Repräsentanten eines hochadligen Hoflebens und ritterlichen Kriegerethos. Die Formel von der «Plebejisierung des Krieges» hebt auf den Wechsel der sozialen Schichten als Träger der Kriegführung ab und stellt somit die Ablösung des Adels durch Angehörige unterer Schichten als schlacht- und kriegsentscheidendes Element heraus. Demgegenüber betont der in angloamerikanischen Darstellungen vorherrschende Begriff einer «militärischen Revolution» stärker die grundlegende Veränderung der Waffentechnologie,[16] also den Einsatz von Kanonen nicht nur im Belagerungskrieg, wo sie schon seit längerem eingesetzt wurden, sondern auch in der offenen Feldschlacht, wie etwa 1512 bei Ravenna. Die in der Militärgeschichtsschreibung kontrovers diskutierte Frage, ob im weiteren Sinn soziopolitische Veränderungen oder waffentechnische Innovationen für die historischen Zäsuren in Militärwesen und Kriegführung maßgeblich gewesen seien, muss für den hier behandelten Zeitraum nicht zu einer Alternative zugespitzt werden. Vielmehr lassen sie sich als gleichzeitige, sich gegenseitig befördernde Entwicklungen betrachten: Das eine setzte das andere voraus und wurde davon vorangetrieben.
Eine fundamentale politische Veränderung infolge waffentechnischer Innovationen ist hier indes besonders herauszustellen, weil sie für den Fortgang der europäischen Geschichte wie der des Nahen und Mittleren Ostens von herausragender Bedeutung war: die Entstehung der sogenannten Schießpulverreiche, wie vor allem die Reiche der Osmanen, der Safawiden und der indischen Moguln bezeichnet werden.[17] Über etwa ein Jahrtausend, von der Völkerwanderung in der Spätantike bis zu den Kriegszügen des Timur Lenk am Ende des 14./Anfang des 15. Jahrhunderts, sind immer wieder nomadische Reitervölker aus dem Inneren Asiens bis nach Europa und in den Nahen Osten vorgedrungen, haben die gegen sie errichteten Befestigungslinien überrannt, die schwerfälligen Ritter ausmanövriert oder sie mit Hilfe taktischer Manöver in der Schlacht besiegt und weite Gebiete erobert und verwüstet. Das beginnt bei den Hunnen und setzt sich über die Ungarn fort bis zu den Mongolen[18] und dem einer turko-mongolischen Völkerschaft entstammenden Timur Lenk (oder Tamerlan).[19] Die im Verlauf der Eroberungszüge entstandenen Steppenimperien waren zwar selten von langer Dauer,[20] aber die «Bedrohung aus der Steppe» war eine ständige Herausforderung für die Herrschaftsbildungen in Europa und im Nahen und Mittleren Osten. Das änderte sich mit der Entstehung der «Schießpulverreiche», denn am Einsatz der Kanonen zerbrachen die Reiterattacken der Nomaden, deren strategische Offensivkraft in Kombination mit einer komplexen Gefechtstaktik sich bis dahin fast immer als überlegen erwiesen hatte. Die vernichtende Niederlage der Osmanen in der Schlacht bei Ankara (1402) gegen die turko-mongolische Armee Timur Lenks war der letzte große Sieg der Steppenreiter.[21] Seitdem die Osmanen in der offenen Feldschlacht Kanonen einsetzten, waren die Reiterheere ihnen nicht mehr gewachsen. Im Laufe des 15. Jahrhunderts verwandelte sich das Osmanische Reich in einen stabilen und eroberungskräftigen «military patronage state», der bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts mit seinen militärischen Eliten, insbesondere den durch «Knabenlese» zwangsrekrutierten Janitscharen, den gesamten Osten und Süden des Mittelmeeres unter seine Kontrolle gebracht hatte.[22]
So wie der Blick auf die fünf Imperien, die in globalgeschichtlicher Perspektive das 16. Jahrhundert prägten, eine eurozentrische Sichtweise relativiert, rückt auch die Beschäftigung mit den innereuropäischen Kräfteverhältnissen das überhebliche habsburgische AEIOU in ein anderes Licht, jenes Akrostichon, das Kaiser Friedrich III. an verschiedenen Bauten seines Herrschaftsgebiets hatte anbringen lassen: Austria erit in orbe ultima («Österreich wird bis ans Ende der Welt bestehen»). Es wurde unter Friedrichs Urenkel Karl V. beibehalten, aber mit einer neuen Bedeutung gefüllt: Austriae est imperare omni universo («Es ist Österreich bestimmt, über die ganze Welt zu herrschen»). Tatsächlich erstreckte sich die österreichische Herrschaft nicht einmal über Westeuropa, da die Habsburger sich am Beginn des Jahrhunderts in lange währenden Hegemonialkriegen mit Frankreich und am Ende des Jahrhunderts in einem für sie wenig erfolgreichen Krieg mit den Niederlanden und England befanden. Weder der Erdkreis noch Europa, nicht einmal Westeuropa war ihnen vollständig untertan. Ihr Weltreich war tatsächlich mehr ein Anspruch als eine Realität, und die «Welt» mussten sie sich zunächst mit den Portugiesen teilen. Selbst die verbreitete Charakterisierung, es handele sich um ein Reich, «in dem die Sonne niemals untergeht», galt keineswegs für die Zeit Karls V., sondern erst für die seines Sohnes Philipp II., also erst nach der Inbesitznahme der nach dem spanischen König benannten Philippinen.
Tatsächlich bildet das 16. Jahrhundert nicht nur eine Epoche der Imperien, sondern auch, zumindest in Europa, die Anfangsphase eines auf territorialen Grenzziehungen beruhenden Staatensystems. Dessen Protagonisten waren Frankreich, die Niederlande und England, die den habsburgischen Reichsanspruch und die Oberhoheit des Kaisers nicht mehr anerkannten.[23] Vielmehr agierte Frankreich als Konkurrent Spaniens im Kampf um die europäische Hegemonie, und die Niederlande führten in den letzten Dekaden des Jahrhunderts einen erbitterten Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien, bei dem sie von England indirekt unterstützt wurden.[24] Zu dieser Zeit war England bereits der wichtigste Konkurrent des Habsburgerreichs im Kampf um die Kontrolle der atlantischen Handelswege, während die Niederlande gegen das von Spanien mitregierte Portugal um die Vorherrschaft im Indischen Ozean rangen. Für das 16. Jahrhundert gilt, was in den folgenden Jahrhunderten die politischen Konflikte der europäischen Mächte geprägt hat: Viele der ausgetragenen Konflikte griffen auf die überseeischen Territorien der europäischen Mächte über oder wurden in Form von Kaperkriegen gegen die ozeanischen Handelsverbindungen der Konkurrenten geführt. Die Entstehung von Weltreichen und Weltwirtschaften hatte bei einer wachsenden Konfliktstruktur in Europa zur Folge, dass Kriege, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch auf europäische Schauplätze begrenzt waren – etwa auf die Poebene oder Flandern –, nun als Kriege in der ganzen Welt geführt wurden. Das unterscheidet die Bildung europäischer Großreiche von den anderen, den islamischen Reichen der Safawiden und Moguln und dem chinesischen Reich, aber auch von dem der Osmanen.
Das ist umso bemerkenswerter, als Papst Alexander VI. am 4. Mai 1493 in der Bulle Inter caetera die neu entdeckte Welt zwischen Portugal und Spanien aufgeteilt hatte und beide Mächte diese päpstliche Entscheidung im Vertrag von Tordesillas (1494) bestätigt hatten. Dies war, faktisch wie symbolisch, der Schluss- und Endpunkt einer die lateinische Christenheit umfassenden Ordnungsvorstellung, die ihrer hierarchischen Idee nach mit Papst und Kaiser an der Spitze als eine Ordnung begriffen werden kann, die auf die Verhinderung von Kriegen zwischen christlichen Herrschern zielte. Zumindest theoretisch hatten sie bei strittigen Fragen die Möglichkeit und – bei einer starken Auslegung – sogar die Verpflichtung, solche Fragen auf dem Rechtsweg mit Kaiser und Papst als letztinstanzlichen Entscheidern klären zu lassen. Das hat erwiesenermaßen nicht immer funktioniert, zumal sich Kaiser und Papst wiederholt gegenseitig bekriegten. Aber es war doch eine Ordnung, die den Frieden als uneingeschränkten Sollzustand postulierte, dem Krieg allenfalls den Platz der Ausnahme zuwies und diesen obendrein durch die – auf Augustinus zurückgehende und von Thomas von Aquin ausformulierte – Auffassung von einem bellum iustum, einem gerechten Krieg, normativ eingrenzte.[25]
Diese Friedensordnung war indes auf die lateinische Christenheit beschränkt, ließ also Krieg gegen nichtchristliche Reiche zu, zumal gegen Mächte der islamischen Welt, und kannte für solche interkulturellen Kriege auch kaum Regeln oder normative Eingrenzungen – im Gegenteil: Hier konnte der Krieg zum «Heiligen Krieg» gesteigert werden,[26] zu einem Krieg, der «von Gott gewollt» war, wie es im Schlachtruf der christlichen Ritter beim Ersten Kreuzzug in der Formel deus lo vult seinen Ausdruck fand. Wer «das Kreuz auf sich nahm», also dem Aufruf folgte und im Kampf gegen die Muslime (oder bereits auf dem Weg ins Heilige Land) den Tod fand, war, so die von den Päpsten immer wieder erneuerte Zusage, zumindest eines Teils der Strafen ledig, die sonst im Jenseits ob seines sündhaften Lebens auf ihn gewartet hätten.
Die Friedensordnung im Innern und die Erwartung von Kampf- und Kriegsbereitschaft gegen die «Feinde der Christenheit» wurde im 16. Jahrhundert außer Kraft gesetzt. Sie hatte zwar bereits mit dem Ende des staufischen Kaisertums Mitte des 13. Jahrhunderts und dem abendländischen Schisma der römischen Kirche Anfang des 14. Jahrhunderts an Durchsetzungskraft verloren, spielte aber als Leit- und Ordnungsvorstellung nach wie vor eine erhebliche Rolle, wie nicht zuletzt die Weltaufteilungsbulle Alexanders VI. zeigt. Die von Deutschland ausgehende und sehr bald auf ganz Europa übergreifende Reformation stellte jedoch die Autorität des Papstes grundsätzlich in Frage, sodass sich schon bald nicht nur die zum Protestantismus übergetretenen Fürsten nicht mehr an dessen Entscheidungen gebunden fühlten, sondern auch katholisch gebliebene Herrscher wie der französische König. Damit trat an die Stelle des rechtsförmigen Instanzenwegs zur Klärung politisch strittiger Fragen nunmehr der Krieg als letzte Entscheidungsinstanz. In dieser Deutlichkeit hat das freilich erst der niederländische Rechtsgelehrte Hugo Grotius in seinem 1625 erschienenen Werk De iure belli ac pacis libri tres («Drei Bücher über das Recht des Krieges und des Friedens») formuliert – der Sache nach galt es aber bereits für das 16. Jahrhundert.
Osmanen und Habsburger: Die geopolitische Grundierung des Jahrhunderts
Die Auflösung der europäischen Ordnung von Krieg und Frieden hatte nicht nur Folgen für den Umgang der christlichen Herrscher untereinander, sondern auch für deren Verhältnis zum Osmanischen Reich. Seit Ende des 14. und während des 15. Jahrhunderts hatte man die Idee des Kreuzzugs, die auf die Rückeroberung des Heiligen Landes mit Jerusalem als Zentrum bezogen war, auf das immer weiter nach Europa hinein expandierende Reich der Osmanen umgelenkt. Im Jahr 1353 war den Osmanen der «Sprung nach Europa» gelungen, als sie aus ihren bisherigen Herrschaftsgebieten östlich und südlich des Marmarameeres die Meerengen überquerten und sich in Thrakien festsetzten.[27] Im Verlauf des 16. Jahrhunderts trat jedoch die Kreuzzugsvorstellung zurück,[28] die Rückeroberung von Konstantinopel verblasste als politische Leitidee, und in den Vordergrund trat die Erfahrung eines zähen Grenzkriegs, in dem es um die Behauptung der habsburgischen Macht über Teile Ungarns ging. Aus den Kreuzzügen wurden im Verlauf dieser Entwicklung die Türkenkriege, in denen die Frage des Glaubens und des Bekenntnisses zwar weiterhin eine herausragende propagandistische Rolle spielte, daneben aber – und mitunter auch davor – standen die politischen und materiellen Interessen der sich formierenden Staaten.
Kurzfristig hat das Haus Habsburg vom türkischen Vordringen nach Europa profitiert, denn der junge ungarische König Ludwig II. hatte in der Schlacht von Mohács (1526) den Tod gefunden, und die Stephanskrone war, wie viele andere Kronen zuvor, an das Haus Habsburg gefallen. Mit dem Ende der ungarischen Großmachtstellung – Sultan Süleyman wollte Ungarn als Pufferstaat gegenüber Habsburg erhalten und unterstützte die Ansprüche von János Szapolyai gegen Habsburg – kam es zu einer unmittelbaren Konfrontation zwischen Osmanen und Habsburgern. In den eineinhalb Jahrzehnten nach Mohács wurde das übriggebliebene Ungarn zwischen den beiden Großmächten zerrissen. 1541 kam dann das Ende eines selbständigen Ungarn; es zerfiel in drei Teile: einen von den Habsburgern kontrollierten, einen von den Osmanen beherrschten und einen im weiteren Sinn unabhängigen Teil, der de facto aber von den Osmanen abhängig war und sich im Wesentlichen auf Siebenbürgen beschränkte.[29]
Die strategischen Ziele der Osmanen waren weit gespannt und im Wesentlichen an ihrem Weltmachtanspruch orientiert. Begreift man das türkische Landeunternehmen bei Otranto (1480) nicht nur als den Versuch, einen Brückenkopf in Apulien zu errichten, um von dort aus die italienische Halbinsel unter Kontrolle zu bringen und das Vordringen auf dem Balkan von der Flanke her abzusichern, sondern auch als Griff nach dem «Roten Apfel», wie Rom in der osmanischen Metaphorik hieß, so ist dies als Projekt zu verstehen, einen Anspruch auf Weltherrschaft durchzusetzen. Wie ja auch die erwähnte türkische Bezeichnung der südosteuropäischen Herrschaftsgebiete als Rumelien den Rom-Bezug zum Ausdruck bringt:[30] Nach der Eroberung Konstantinopels sahen die Osmanen sich in der Nachfolge des Römischen Reichs, womit sie in unmittelbare Konkurrenz zu den Habsburgern traten, die als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ebenfalls die Rom-Nachfolge deklarierten. Und auch der Griff nach dem «Goldenen Apfel», dem türkischen Namen für Wien – ein Griff, der bei der ersten Belagerung der Stadt im Jahr 1529 fehlschlug –, war ein Versuch, die osmanische Herrschaft über den Balkan hinaus zu erweitern und ganz Europa, wenn nicht unter Kontrolle, so doch in Abhängigkeit und Folgebereitschaft zu bringen. Die logistischen Probleme, an denen in beiden Fällen der Griff nach dem jeweils begehrten «Apfel» scheiterte, zeigt die Grenze der osmanischen Expansionsfähigkeit. Sie zu überschreiten, hieß, in eine Situation imperialer Überdehnung zu geraten, und davor scheute der politisch umsichtige und strategisch versierte Sultan Süleyman zurück.[31]
Dafür, dass die Grenze der Expansionsfähigkeit ihm nicht zum politisch-militärischen Nachteil gereichte, waren vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend: zunächst die mangelnde Offensivkraft des österreichischen Zweigs der Habsburger, also des in Wien regierenden Königs Ferdinand, dessen Bruder Karl V. mit anderen Herausforderungen beschäftigt war.[32] Das Habsburgerreich, dessen Zentrum in der zweiten Dekade des Jahrhunderts auf der Iberischen Halbinsel und nicht in Zentraleuropa lag, konzentrierte sich auf die Expansion nach Westen, also auf die Inbesitznahme der Neuen Welt, die bei geringerem Ressourceneinsatz größere territoriale Zugewinne und materielle Bereicherung versprach als eine langwierige kriegerische Auseinandersetzung mit den Osmanen. Die Osmanen wiederum gelangten zu einem ähnlichen Ergebnis, nämlich dass bei einer Expansion nach Süden und Osten die logistischen Verbindungen sehr viel weiter ausdehnbar waren als bei einer Expansion nach Nordwesten.
Bereits unter Süleymans Vorgänger Selim I. kam es zu einer erheblichen Ausweitung des Osmanischen Reichs in östliche und südliche Richtung, vor allem in die Gebiete Aserbaidschans und nach Mesopotamien, die beide dem Reich der Safawiden abgerungen wurden.[33] In der zwischen osmanischen und safawidischen Truppen ausgetragenen Schlacht von Çaldiran (1514) gab der Einsatz mobiler Feldartillerie den Ausschlag zugunsten der Osmanen,[34] und diesen Erfolg wiederholten die Osmanen 1517 bei der Eroberung des Mamlukenreichs, dessen letzter Sultan nach der Eroberung Kairos hingerichtet wurde. Anschließend gliederte Selim Syrien, den Libanon, Palästina, Ägypten sowie große Teile der Arabischen Halbinsel mit den heiligen muslimischen Stätten Mekka und Medina seinem Reich ein.[35]
Dem entsprechen auf habsburgischer beziehungsweise spanischer Seite die transatlantischen Eroberungen, in deren Verlauf die spanischen Konquistadoren die Karibik unter ihre Kontrolle brachten, sich in Mittelamerika festsetzten und schließlich das Aztekenreich eroberten (1519) – ein Sieg, der vor allem durch das erwähnte Bündnis der nur sehr kleinen Truppe spanischer Eroberer mit einigen indigenen Völkern möglich wurde, die erst kurz zuvor von den Azteken unterworfen worden waren. Die Entwicklungsdynamik sowohl des habsburgisch-spanischen als auch des osmanischen Imperiums stand demzufolge in den ersten Dekaden des 16. Jahrhunderts im Zeichen der Expansion, und das ist ein Grund dafür, warum – mit Ausnahme der ersten Belagerung Wiens durch die Türken – beide Reiche keine größeren Feldzüge mehr gegeneinander führten. Das Vordringen der Osmanen beziehungsweise der mit ihnen verbündeten Korsaren an der nordafrikanischen Küste mit ihren Stützpunkten in Tunis und Algier war möglich, weil Portugiesen und Spanier mit der Expansion in den Atlantischen und in den Indischen Ozean beschäftigt waren und den Korsarenstaaten an der nordafrikanischen Küste keine besondere Aufmerksamkeit schenkten.[36] In gewisser Hinsicht war auch das ein Anzeichen für eine Überdehnung oder zumindest für die Überforderung der spanischen Macht und den damit verbundenen Zwang, Schwerpunkte zu setzen.
Der andere Grund für den Verzicht auf eine unmittelbare, groß angelegte Konfrontation beider Großreiche, also auf einen Ausscheidungskampf, bei dem nur eines von ihnen übrigbleiben würde, war die drohende «zweite Front» im Rücken oder an der Flanke beider Reiche. Sofern man eine solche Front im Rücken des Gegners sah, konnte man ihr durchaus viel abgewinnen. So reicht die strategisch nutzbare Idee von einem Widersacher im Rücken der muslimischen Macht in Europa bis weit ins Mittelalter zurück und verdichtete sich in der Vorstellung von einem angeblichen Priesterkönig Johannes, der den bedrängten christlichen Mächten zu Hilfe kommen und die Muslime von Osten her angreifen werde.[37] Immer wieder beschäftigte dieser Johannes die abendländische Phantasie, doch er war und blieb eine politische Chimäre. Anders war das mit dem Reich der Aq Qoyunlu («die mit den weißen Hammeln»):[38] Dieser aus verschiedenen Turkvölkern bestehende Stammesbund unter dem Fürsten Uzun Hasan beherrschte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vorübergehend große Gebiete Ostanatoliens sowie des heutigen Iran und Irak.[39] Zeitweilig setzten einige europäische Mächte darauf, der «Weiße Hammel» werde sich zu einer Macht im Rücken der Osmanen entwickeln, mit deren Hilfe sich die Expansion des Osmanischen Reichs eindämmen lasse. Aber auch diese Erwartung zerstob schnell, denn der Stammesbund hatte keine innere Stabilität, beruhte allein auf dem Charisma Uzun Hasans und zerfiel nach dessen Tod. Dagegen entwickelte sich das Safawidenreich trotz der Niederlage bei Çaldiran zu einer dauerhaften Bedrohung des Osmanen von Südosten her und wurde so im politisch-strategischen Kalkül des Wiener Zweigs der Habsburger zu einer festen Größe. Die osmanischen Sultane mussten sich wiederholt der Ruhe im Südosten vergewissern, bevor sie den Blick nach Westen richten konnten. Das begrenzte ihre Fähigkeiten wie ihr Interesse, sich auf einen Eroberungskrieg im Westen, über die besetzten Teile Ungarns hinaus, einzulassen.
Dafür gelang den Osmanen die von den Habsburgern skandalisierte Allianz mit Frankreich. Sie wuchs im 16. Jahrhundert zu einem Bündnis heran, das die geostrategischen Konstellationen beeinflusste. Zwischen 1526 und 1541 gab es zunächst eine Achse Paris–Buda–Istanbul, bei der König János Szapolyai, der gegen die Habsburger ein eigenständiges Ungarn bewahren wollte, in einem formellen Bündnisvertrag mit den Osmanen und einer Allianz mit Frankreich stand. Auch nach seinem Tod hatte das faktische Bündnis zwischen Paris und der Hohen Pforte Bestand.[40] Aber nicht nur Frankreich verbündete sich zugunsten seiner antihabsburgischen Politik mit einem islamischen Reich, sondern auch England, das gelegentlich mit den teils unter osmanischer Kontrolle stehenden sogenannten Barbareskenstaaten an der nordafrikanischen Küste kooperierte und damit Allianzen zwischen London, Rabat-Salé, Algier und Istanbul aufbaute.[41] Als empörend galten diese Allianzen (wobei die habsburgische Propaganda an der Skandalisierung kräftig beteiligt war), weil sie nicht an der Einheit der Christenheit orientiert waren, also das Koalitionsverbot mit muslimischen Mächten missachteten und im Wesentlichen einer machtpolitischen Logik folgten. Die Christenheit verlor ihre Bindekraft als Leitidee der Allianzbildung, und eine an Machtkalkülen ausgerichtete politische Rationalität bestimmte zunehmend die Bündnispolitik. Die Entfaltung der habsburgischen Macht in Europa fand damit am Osmanischen Reich wie an Frankreich ihre Grenze. Die vom Großkanzler Karls V., Mercurino Gattinara, verfolgte Idee, eine Monarchia universalis zu errichten,[42] ein tatsächliches Weltreich mit Europa als einheitlichem Zentrum, war folglich zum Scheitern verurteilt.
Die De-facto-Koexistenz der beiden Großreiche, dem der Habsburger und dem der Osmanen, mit dem Nebeneinander von Kaiser Karl V. und Sultan Süleyman «dem Prächtigen», wurde zur geopolitischen Grundkonstellation des 16. Jahrhunderts in Europa. Beide Großreiche, stellt man sie zum Zweck des strukturellen Vergleichs nebeneinander, wiesen freilich erhebliche Unterschiede auf: Das spanisch-habsburgische Reich war aufgrund seiner überseeischen Komponente sicherlich das dynamischere und wohl auch das mächtigere, zeigte aber deutlich mehr Konfliktfelder und Verwundbarkeiten. Das osmanisch-türkische Reich war infolge seiner Zentrierung kompakter und geschlossener und zumindest im Mittelmeer ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor. Hätte man Mitte des 16. Jahrhunderts einen gut informierten Beobachter beider Großreiche befragt, welchem der beiden er die größeren Potenziale und die besseren Zukunftsaussichten zubillige, so hätte man vermutlich keine eindeutige Auskunft erhalten. Das Osmanische Reich hatte in der Jahrhundertmitte große Teile des mediterranen Welthandels unter seine Kontrolle gebracht,[43] woran auch die Niederlage in der Seeschlacht von Lepanto (1571) nichts änderte. Diese festigte im Ergebnis aber eine Pattsituation, bei der ein Ausgreifen der Osmanen ins westliche Mittelmeer ausgeschlossen war.
Ebenso hätte aber auch ein im Verbund mit den italienischen Seerepubliken vorgetragener Angriff der Spanier ins östliche Mittelmeer, verbunden mit einer Wiederherstellung der maritimen Machtposition, wie sie die Venezianer und Kreuzritterorden dort im 15. Jahrhundert noch innegehabt hatten, die Ressourcen und Fähigkeiten der «westlichen» Mächte überfordert.[44] Der Sieg der Heiligen Liga bei Lepanto – einem aus Spanien, Genua, Venedig, Malta, Savoyen und dem Kirchenstaat bestehenden Bündnis, dessen vereinigte Flottenverbände unter dem Kommando von Don Juan de Austria standen, einem unehelichen Sohn Karls V. – ist häufig als Wendepunkt in den Türkenkriegen dargestellt worden. Das war er keineswegs. Das strategische Ziel der Heiligen Liga, die Rückeroberung der 1570 von den Osmanen besetzten Insel Zypern, wurde nicht erreicht. Der osmanische Großwesir Sokollu Mehmed Pascha kommentierte die Niederlage spöttisch mit der Bemerkung, Lepanto habe ihm nur den Bart versengt, er aber habe Venedig mit Zypern einen Arm abgeschlagen.[45] Schon zwei Jahre nach Lepanto verfügten die Osmanen weitgehend über dieselben Schiffskapazitäten wie zuvor. 1574 eroberten sie Tunis. Die Heilige Liga zerfiel; Venedig schloss 1573 mit dem Osmanischen Reich einen Separatfrieden und zahlte für dessen Verluste in der Schlacht von Lepanto dreihunderttausend Dukaten – danach konnte es den Export der zyprischen Baumwolle wieder übernehmen.
Der Traum von einer Weltreichsbildung auf Grundlage einer Herrschaft zu See oder zumindest einer Beherrschung des ganzen Mittelmeers war für das Osmanische Reich allerdings vorbei. Im mediterranen Raum galt nach Lepanto eine ähnliche Konstellation wie im ungarischen Grenzgebiet zwischen habsburgischem und Osmanischem Reich: Auf dem Land fand ein zäher Krieg um einzelne Festungen an strategisch günstigen Positionen statt, begleitet von gelegentlichen Raubzügen in gegnerisches Gebiet. Das Ziel bei diesen Angriffen waren möglichst große Verheerungen und viele Gefangene, die man zum Freikauf anbieten oder versklaven konnte. Auf See wurde ein fortgesetzter Kaperkrieg geführt, in dem es neben der Erbeutung von Geld und Waren um die Gefangennahme von Schiffsbesatzungen und Passagieren ging, die von den Kaperkapitänen anschließend gegen Geld freigelassen oder in die Sklaverei verkauft wurden. Der Kaperkrieg zur See und der Kleinkrieg zu Land unterschieden sich in dieser Hinsicht kaum.
Teilhabe und Unterwerfung: Vom Mittelmeer zur ozeanischen Expansion
Wenn Konfrontation und Koexistenz des Habsburgischen und des Osmanischen Reichs ein entscheidendes Merkmal des 16. Jahrhunderts waren, so bestand eine andere zentrale Prägung darin, die im Mittelmeerraum im 14. und 15. Jahrhundert gemachten Erfahrungen – die Organisation von Wirtschaftskreisläufen, der Aufbau eines Stützpunktsystems und die Entwicklung einer Plantagenwirtschaft mit dem Einsatz von Arbeitssklaven – auf die entstehende Weltwirtschaft zu übertragen. Die Expansion der italienischen Seerepubliken ins westliche, vor allem aber ins östliche Mittelmeer und die dabei angewandten Methoden der Bereicherung, seien es die aus dem Fernhandel gezogenen Gewinne, sei es die Auspressung einer gewaltsam unterworfenen Bevölkerung durch Zwangsarbeit, wurde im 16. Jahrhundert zur Blaupause für die Organisation von Wirtschaftskreisläufen mit der neu entdeckten Welt und auf den neu erschlossenen Handelswegen. In vielen Darstellungen des Zeitalters der Entdeckungen und Eroberungen werden nur die Inselgruppen der Kanaren und Azoren als Erfahrungsraum und Übungsfeld angesehen, aber der mediterrane Erfahrungsraum hatte eine sehr viel größere räumliche und zeitliche Tiefe. Er war nicht auf die im Atlantik, westlich von Afrika und Portugal gelegenen Inseln begrenzt, sondern umfasste die gesamte Welt des Mittelmeers. Damit soll die Bedeutung der Kanaren wie der Azoren für die Unterwerfungs- und Beherrschungspraxis in der Karibik und in Mittelamerika keineswegs in Abrede gestellt werden, aber die Beherrschung und Ausbeutung der Mittelmeerinseln gingen ihnen voran.
Tatsächlich haben die italienischen Seerepubliken bei ihrer Expansion ins Mittelmeer zwei grundlegend unterschiedliche Formen entwickelt, an Wirtschaftskreisläufen teilzuhaben beziehungsweise sie nach eigenen Interessen umzugestalten. Im Anschluss an den Historiker John Morrissey kann man sie als Teilhabe- und Unterwerfungsmodell bezeichnen. Ersteres ist von der Seehandelsstadt Amalfi entwickelt worden, und Amalfi hat sich ausschließlich an diesem Modell orientiert; Letzteres ist von den Seerepubliken Venedig, Genua und Pisa praktiziert worden, wenn sich ihnen die Möglichkeit dazu bot, während sie dem amalfitanischen Vorbild folgten, wenn die Verhältnisse ihnen keine andere Möglichkeit ließen.[46] Das amalfitanische Modell drehte sich um einen Handelshof, einen fondaco, ein abgegrenztes Viertel innerhalb einer Stadt, in der das Recht der Kaufleute aus ihrem Herkunftsort galt, weswegen diese Handelshöfe zumeist mit dem Verweis auf die Herkunftsorte der Kaufmannsgemeinschaft versehen wurden.[47] Ansonsten aber galt das Recht des jeweiligen Herrschaftsgebiets, an das sich die europäischen Fernhandelskaufleute halten mussten.[48] Daher erlangten die fremden Kaufmannschaften auch keinen Einfluss auf die regionale Produktion, bei dem sie etwa die Art und Menge der gehandelten Güter hätten festlegen können. Es ging allein um den Tausch oder Ankauf von Waren.
Das war anders, wenn eine der Seehandelsrepubliken die politische und wirtschaftliche Kontrolle über eine Mittelmeerinsel erlangt hatte. Zur politischen Unterwerfung kam dann die unbegrenzte Ausrichtung der Produktion an den Interessen der Handelsrepublik hinzu. Die unterworfenen Gebiete wurden zu Rohstoffproduzenten des mediterranen Wirtschaftskreislaufs, und das lief auf ein System des ungleichen Tauschs sowie der Auspressung der Bevölkerung und der ökologischen Zerstörung ihres bisherigen Lebensraums hinaus. So kompensierten die Pisaner ihre Niederlage im Konkurrenzkampf mit Genua und Venedig um den Zugang zum östlichen Mittelmeer damit, dass sie die Wirtschaft Sardiniens beherrschten, wodurch sie eine führende Rolle beim Handel mit Erzen im europäisch-mediterranen Raum erlangten. Sie mussten die Insel dazu nicht einmal militärisch unter ihre Kontrolle bringen, sondern konnten auf die Kooperation mit Teilen der einheimischen Führungsschicht setzen, die auf die Unterstützung der Pisaner angewiesen war, um ihre eigene Position auf der Insel zu sichern. Das war eine eher kostengünstige Variante des frühen Kolonialismus: «Korrumpierung der indigenen Eliten zur Bewahrung ihres sozialen Status und Lebensstandards».[49] Dieses Kolonisierungsmodell ist im 16. Jahrhundert von den Portugiesen vor allem im Indischen Ozean praktiziert worden.
Im Unterschied zu Pisa standen Venedig und Genua bei der Expansion ins östliche Mittelmeer auf der Gewinnerseite und trotzten dem schwächelnden Byzanz in der Ägäis und an den Küsten des Schwarzen Meeres Handelsbedingungen ab, die weit über die Konditionen des fondaco-Systems hinausgingen. So wurde auf Kreta, Zypern und Chios eine vielfältige Landwirtschaft durch die monokulturelle Ausrichtung auf Agrarprodukte für die mediterranen Märkte ersetzt, und das hieß: «Unterwerfung der bäuerlichen Bevölkerung zur beliebigen Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Zerschlagung beziehungsweise Übernahme von Handwerk und Gewerbe, dirigistische Handelspolitik zur Versorgung des Mutterlandes oder für den Export».[50] Das ging so weit, dass die Venezianer, bevor sie im Verlauf des 16. Jahrhunderts von den Osmanen aus dem östlichen Mittelmeer verdrängt wurden, auf mehreren der von ihnen beherrschten Inseln eine Plantagenwirtschaft errichteten, die sie nicht zuletzt mit Sklaven betrieben. Dieses Modell wurde zum Leitfaden der spanischen Kolonisierung Mittel- und Südamerikas, während sich die Portugiesen im Indischen Ozean überwiegend am amalfitanischen Vorbild des fondaco-Systems orientierten. Sie trafen dort auf konsolidierte Herrschaftsgebiete, in denen sie nicht nach Belieben wirtschaften konnten, sondern sich zumindest teilweise an die Regeln des gleichen und gerechten Tauschs halten mussten.[51]
Die ozeanische Expansion der Europäer entwickelte sich im 16. Jahrhundert folglich nach den Modellen der Teilhabe und/oder der Unterwerfung und Ausbeutung. An die Stelle des fondaco in der mittelmeerischen Wirtschaft traten bei der Übertragung des Teilhabemodells auf die ozeanische Welt Stapel- und Handelsplätze, die sogenannten Emporien. Dort wurden die von den europäischen Kaufleuten nachgefragten Güter gesammelt und zusammengeführt, bis sie von Umfang und Gewicht her eine Schiffsladung ausmachten, wodurch die vorhandene Transportkapazität und die der Jahreszeit entsprechend günstigen Winde ausgenutzt werden konnten. Die Europäer kauften diese Güter zu den am Handelsplatz üblichen Preisen, sodass die Gewinnspanne der Kaufleute im Wesentlichen aus der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis resultierte – allenfalls beeinflussbar durch die optimale Nutzung der Transportkapazität eines Schiffes und die Dauer seiner Seereise. Nur durch gesteigerte oder reduzierte Nachfrage hatten die europäischen Händler Einfluss auf die Art und Menge der gehandelten Güter. Wenn die Produzenten den Erwartungen der Händler nicht nachkamen, blieb nur ein Wechsel des Handelsplatzes. Der Einsatz von Zwangsmitteln zwecks Umstellung der Produktion nach den Vorstellungen der Europäer war nicht möglich. Dieses Teilhabemodell wurde von den Europäern dort praktiziert, wo ihnen keine militärische Eroberung gelungen war.
Das war in der Karibik sowie in Mittel- und Südamerika anders, wo die Spanier die Reiche der Azteken und Inka zerschlugen und die eroberten Gebiete dem spanischen Königreich eingliederten. Ihr Problem war eher, dass die Indigenen sich