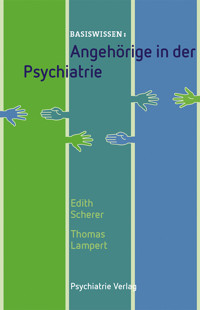
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Basiswissen
- Sprache: Deutsch
Angehörige sind längst im psychiatrischen Alltag angekommen, aber die konkrete Arbeit mit ihnen fordert professionell Tätigen einiges ab: eine klare Haltung, einen konstanten Perspektivwechsel und Sicherheit im kommunikativen Umgang. Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Angehörigen als Mitverursacher von Störungen sind immer noch groß und verstärken die Unsicherheit im Umgang mit Familienmitgliedern, Partnern oder engen Vertrauten. Gefühlte Defizite und wenige qualitative Standards in diesem Arbeitsbereich sorgen für Unsicherheiten bei der Kommunikation von Bedürfnissen und Absprachen, gerade im Mehrpersonensetting. Das Buch bietet grundlegende Hilfe: Es formuliert praxisbewährte Leitlinien für den Arbeitsalltag, arbeitet systemische Grundlagen ab und widmet sich in einem Extrakapitel dem Thema »Kinder als Angehörige«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edith Scherer, Pflegefachfrau, Erwachsenenbildnerin MAS A & PE, arbeitet seit 1988 in den Kantonalen Psychiatrischen Diensten – Sektor Nord, St. Gallen. Vorstandsmitglied im Verein Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie, Autorin verschiedener Publikationen und Broschüren. Verheiratet, Mutter eines erwachsenen Sohnes.
Thomas Lampert, Pflegefachmann, systemischer Therapeut ZSB, arbeitet seit 1988 bei den St.-Gallischen Psychiatrie-Diensten Süd. Seit 2008 Koordinator für Prävention und Angehörigenarbeit mit dem Aufbau einer Angehörigenberatungsstelle. Postgraduale Weiterbildung in systemischer Therapie und Beratung. Vorstandsmitglied des Netzwerks Angehörigenarbeit Psychiatrie. Autor verschiedener Publikationen und Broschüren. Verheiratet, Vater von zwei Töchtern.
Die Reihe Basiswissen wird herausgegeben von:
Michaela Amering, Ilse Eichenbrenner, Caroline Gurtner, Michael Eink, Klaus Obert und Wulf Rössler
Edith Scherer, Thomas Lampert
Basiswissen: Angehörige in der Psychiatrie
Basiswissen 34
1. Auflage 2017
ISBN-Print: 978-3-88414-638-5
ISBN-PDF: 978-3-88414-907-2
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http: //dnb.ddb.de abrufbar.
Weitere Informationen zu psychischen Störungen und ihrer Behandlung im Internet unter: www.psychiatrie-verlag.de
© Psychiatrie Verlag GmbH, Köln 2017
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Umschlaggestaltung: Iga Bielejec, Nierstein
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Inhalt
Cover
Titel
Die Autoren
Impressum
Einleitung
Angehörigen begegnen
Beziehung als Ressource
Angehörige und der gesellschaftliche Kontext
Angehörige in der Geschichte der Psychiatrie und heute
Gegen die Stigmatisierung
Autonomie als wertvolles Gut
Belastungen von Angehörigen
Eltern, Partner, Geschwister, Kinder – unterschiedliche Rollen
Objektive und subjektive Belastungen
Hilflosigkeit und Ohnmacht
Angst
Schuldgefühle
Selbstwirksamkeitserwartung
Auswirkungen auf die Familie
Die Bedrohung des Familienzusammenhalts
Der Verlust der Selbstverständlichkeit
Die Ungewissheit
Die Veränderung der eigenen Biografie
Eltern: Und wie wird es später weitergehen?
Bewältigungsstrategien der Angehörigen
Schock – Verharmlosung – Verleugnung
Wahrnehmung und Akzeptanz
Suche nach den Ursachen
Infragestellen des Helfersystems
Bewusstwerdung und Trauerprozess – neue Balance finden
Die Zusammenarbeit mit Angehörigen
Aktiver Einbezug der Angehörigen
»Schwierige« Angehörige
Umgang mit der Schweigepflicht
Verschiedene Formen des Einbezugs von Angehörigen
Systemisches Intervenieren
Unterschiedliche Wahrnehmungen
Die Interpunktion von Ereignisfolgen
Motivation: die Suche eines kleinsten gemeinsamen Nenners
Die allparteiliche Haltung
Leitlinien für die Durchführung eines Mehrpersonengesprächs
Sprachliche Einschränkungen, Kooperationsunwilligkeit, Suizidalität – spezifische Herausforderungen
Die Ausgrenzung von Angehörigen aus der Behandlung
Empowerment und Recovery für Angehörige
Kinder als Angehörige
Angehörigenarbeit außerhalb der Behandlung
Psychoedukation für Angehörige
Separierte Angehörigenberatung
Konzeptuelle Vernetzung unter Fachleuten
Vernetzung unter Angehörigen
Vernetzung zwischen Angehörigen und Fachleuten
Eine psychiatrische Arbeit für alle – Schlussbemerkung
Internetadressen
Ausgewählte Literatur
Einleitung
Angehörigen begegnen
Wer sind eigentlich die Angehörigen? Sprechen wir von einer besonderen Gruppe Menschen bezüglich sozialer Schichtzugehörigkeit, von Verwandtschaftsgrad, Geschlecht oder Rolle? Wenn wir uns vor Augen führen, wie hoch der Anteil an Menschen mit einer psychischen Störung bzw. Erkrankung in der Bevölkerung ist, und uns bewusst machen, wie viele betroffene Menschen wir in unserer unmittelbaren Nähe kennen, so können wir davon ausgehen, dass wir alle in irgendeiner Form im Laufe unseres Lebens einmal oder immer wieder »Angehörige« sind.
Die Definition, wer Angehörige sind, beschreibt das »Schweizer Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie« nicht anhand des Verwandtschaftsgrades, sondern anhand der Beziehung, in der wir zu Menschen stehen. So kann es durchaus sein, dass eine Bezugsperson nicht aus derselben Familie kommt und sie trotzdem eine Angehörigenrolle innehat, da die Beziehung auf Verantwortung und Vertrauen basiert und die Bezugsperson somit eine wichtige Stütze für die psychisch erkrankte Person darstellt.
Die Erfahrung zeigt, dass es gerade für Fachpersonen, die sich mit der Situation der Angehörigen in der psychiatrischen Versorgung befassen, äußerst hilfreich ist, zum Einstieg einmal diesen Perspektivenwechsel zu vollziehen und sich mit Situationen aus dem eigenen Leben zu beschäftigen, in denen man selbst in der Rolle eines Angehörigen war. Die Fragen »Was war in dieser Situation hilfreich? Was hat gefehlt?« helfen so, ein eigenes Verständnis der Situation Angehöriger zu entwickeln.
Die Angehörigen sind also so vielfältig wie die Menschen überhaupt, sie sind Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn und vieles mehr. Mehrheitlich haben wir es aber im institutionellen Rahmen mit Familienangehörigen, Freunden und Arbeitskollegen zu tun. Die erhobenen Daten aus den Angehörigenberatungsstellen in der Schweiz zeigen allerdings klar auf, dass Angehörige, die eine Beratung aufsuchen, vorwiegend in einer familiären Beziehung zur erkrankten Person stehen. Damit verbunden ist zudem, dass oft Mütter und Partnerinnen Beratungen in Anspruch nehmen.
Alle diese Angehörigen verbindet die Tatsache, dass sie einen nahen Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder in einer schweren psychischen Krise haben.
Um Angehörige zu verstehen, ist es wichtig, uns in ihre Rolle zu versetzen. Dazu helfen diese Fragen: Wie wäre es für mich selbst, wenn ich in dieser Situation wäre? Wie ginge es mir, wenn sich mein zwanzigjähriger Sohn immer mehr zurückziehen würde, nicht mehr mit seinen Kollegen ausgeht, immer wirrer redet und das Gefühl hat, er werde ständig beobachtet und kontrolliert? Wie ginge es mir, wenn meine Partnerin es nicht mehr schaffte, den Kindern ein Mittagessen zu kochen, den Haushalt zu versorgen, und jedes Mal, wenn ich in den Kirchenchor gehe, sagen würde, dass sie vielleicht nicht mehr lebe, wenn ich zurückkomme?
Was diese Angehörigen aber ebenfalls gemeinsam haben: Sie sind in großer Sorge, sie sind verletzlich und sie sind auf uns Fachpersonen angewiesen. Darauf, dass wir ihre Belastungen erkennen und ihnen wertfrei und wertschätzend begegnen – so wie wir den Patientinnen und Patienten auch begegnen.
MERKE→ Angehörige sind Menschen, die in einer engen und vertrauensvollen Beziehung zur erkrankten Person stehen. Sie befinden sich in einem Ausnahmezustand und sind emotional sehr hoch belastet. Das macht sie zu besonders verletzlichen Menschen, die unsere Zuwendung und Wertschätzung brauchen.
Die Begegnungen, die wir Fachpersonen mit den Angehörigen haben, finden an ganz vielen Orten und in unterschiedlichen Kontexten statt. Und jede dieser Begegnungen prägt unsere Beziehung zu den Angehörigen und entscheidet darüber, wie die Angehörigen die Fachwelt der Psychiatrie und ihre Institutionen wahrnehmen.
Die Grundlagen für dieses Buch resultieren in erster Linie aus Begegnungen mit Angehörigen im institutionellen Kontext. Viele der Beispiele beschreiben somit eine Klinikperspektive. Die Belastungen von Angehörigen einerseits und die Haltung ihnen gegenüber andererseits sind jedoch Grundlagen für alle Begegnungen mit Angehörigen, sei es im stationären, ambulanten oder im aufsuchenden Rahmen.
Beziehung als Ressource
Beziehungen prägen unser Leben, ob wir es möchten oder nicht. Bereits vor der Geburt sind wir mit der Umwelt verbunden und äußeren Einflüssen ausgesetzt. Das Neugeborene entwickelt später eine spezielle Beziehung zu seinen Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen – diese Beziehung ist sogar existenziell. Ohne Unterstützung und Bindungserfahrung überlebt der Mensch in diesem Lebensabschnitt nicht. Das Bindungsbedürfnis veranlasst das Kleinkind, im Falle vorhandener oder erlebter Bedrohung wie Gefahr, Angst oder Schmerz Schutz und Beruhigung bei seinen Bezugspersonen zu suchen.
Die eigenen Bindungserfahrungen Erwachsener haben wiederum Auswirkungen auf die Bindungsqualität ihrer Kinder, aber auch auf den Umgang mit eigenen Impulsen und Emotionen. Erwachsene mit unsicheren oder gestörten Bindungsbeziehungen fühlen sich weniger sozial akzeptiert und sind häufig depressiver. Auch zeigen sich die Folgen von Misshandlung im Erwachsenenalter oft durch Gewalttätigkeit, Drogenmissbrauch, Alkoholismus, Suizidalität, Angst, Depressionen und die Neigung zur Somatisierung (DORNES 1997). In einer Therapie, welche die Erkenntnisse der Bindungstheorie einschließt, ermöglicht die therapeutische Beziehung durch die Bearbeitung von Beziehungen, durch Veränderung der Affekte, der Kognitionen und des Verhaltens eine neue Bindungserfahrung (BRISCH 1999, 2011).
Unterschiedliche psychotherapeutische Schulen betonen in ihrer Ausrichtung differente Schwerpunkte. Mögliche Zugänge zu Fragestellungen erfolgen bei gesprächsorientierten Behandlungen beispielsweise über Probleme im Hier und Jetzt, betreffen vorrangig die Lebensgeschichte, das Verhalten oder das Umfeld des Patienten. Egal, ob das Gespräch im Einzelsetting oder unter direktem Einbezug signifikanter Bezugspersonen stattfindet, Beziehungen spielen stets eine wichtige Rolle.
»Familienbeziehungen beinhalten sowohl ein Risikopotenzial mit die Störung aufrechterhaltenden Faktoren als auch ein Ressourcen- und Chancenpotenzial mit protektiven und die psychische Entwicklung der einzelnen Mitglieder fördernden Faktoren« (LIECHTI & LIECHTI-DARBELLEY 2011, S. 23). Doch oft verorten Patientinnen und Patienten gerade in diesen Beziehungen den Ursprung ihres Leidens: Handfeste Konflikte oder das Gefühl einer als ungerecht, einschränkend, schädigend erlebten Beziehung befinden sich sowohl als ursächliche und auslösende wie auch als aufrechterhaltende Faktoren im Zentrum ihrer Wahrnehmung. Dabei sind es lineare Betrachtungen von Ereignisabfolgen, die im Vordergrund stehen und als Wenn-dann-Konstruktion die »Interpunktion der Abläufe« betonen. In solchen Momenten explizit von Ressourcen zu sprechen würde beim Gegenüber wohl auf wenig Verständnis stoßen. Hilfreicher ist der Blickwinkel, dass sich die Entwicklung der Beziehung und der Kommunikation verwickelt hat. Sie stockt, geht nicht mehr weiter. →Interpunktion von Ereignissen, Seiten 79f.
Entwicklungsfaktoren
»Intime und familiäre Beziehungen sind bezüglich Entwicklungsfaktoren von Individuen stets einflussreiche Beziehungen. Personen in engen Beziehungen beeinflussen einander in erheblichem Maße, und so geben Grundformen menschlichen Erlebens wie Bindung, Loyalität, Verpflichtung, Rücksicht, Freiheit, Toleranz, Geborgenheit und Aufrichtigkeit den Ausschlag für die Beziehungsqualität. Der Einbezug der Angehörigen als wichtige Bezugspersonen eröffnet in dieser Hinsicht entwicklungsfördernde Formen der Transaktion« (LIECHTI & EGGEL 2004, S. 18).
Dabei geht es nicht um die Wiederherstellung oder Nutzung von Hierarchien in diesen Beziehungen, sondern um eine demokratische, allparteiliche Grundhaltung (BOSZORMENY-NAGY & SPARKS 2006) seitens des Therapeuten. Diese Grundhaltung ermöglicht es dem Therapeuten, sich jedem Gesprächsteilnehmer zuzuwenden, sich kurzzeitig zu verbünden und dem beklagten Leid Verständnis entgegenzubringen. Da jedem diese Erfahrung zugestanden wird, erhalten Gefühle, Grenzen, Sorgen und Bedürfnisse Raum, und zwar als Basis für eine weitere Auseinandersetzung.
Ob Angehörige gleich zu Beginn in die Behandlung einbezogen werden, ist grundlegend vom Einverständnis der Patienten abhängig. Auch wenn sie dies ablehnen, ist es wichtig, die Fragestellung nach dem Einbezug im Laufe der Zeit wiederholt vorzubringen und die Hintergründe der Zurückhaltung zu erörtern. Unter Umständen benötigt ein Patient selbst erst Zeit für sich, für seine Situation, Wünsche, Bedürfnisse, um seine Sorgen, Ängste und Befürchtungen klären zu können. Aus der Sicht von Angehörigen scheint es wichtig, dass Fachleute diesen Umstand ausdrücklich festhalten, damit keine Missverständnisse entstehen.
Angehörige und der gesellschaftliche Kontext
Angehörige in der Geschichte der Psychiatrie und heute
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich die Rolle der Angehörigen in der psychiatrischen Versorgung stark verändert. »Psychiatrie«, das war etwas, was hinter Mauern und weitab des gesellschaftlichen Lebens stattfand. Wer in der Institution versorgt wurde, den besuchte man eher nicht. Zudem hatte die Familie oft nicht die Möglichkeit, weit zu reisen, um jemanden zu besuchen, und oft auch keine Zeit dafür. Die gesellschaftlichen Wertvorstellungen waren andere als heute, Autonomie noch lange nicht das höchste Gut für jeden Einzelnen, und wenn jemand interniert wurde, dann hatte das schon seine Richtigkeit und gute Gründe. Diese Hospitalisationen hatten nicht selten auch einen erzieherischen Charakter und die Aktivitäten der Angehörigen wurden schnell als »Einmischen in ärztliche Angelegenheiten« angesehen – sie galten dann als »Störenfriede«, wenn nicht sogar als Täter und Ursprung der psychischen Erkrankung.
Im Verlauf der letzten fünfzig Jahre veränderte sich das Bild der Psychiatrie enorm. Neben allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen und bestimmten sozialen Bewegungen (etwa die Angehörigenbewegung) resultierte dies auch aus den Behandlungsmöglichkeiten mit Neuroleptika seit Anfang der Fünfzigerjahre sowie neuer psychotherapeutischer Haltungen.
In dieser Zeit liegt auch der Ursprung der Angehörigenbewegung, und zwar in Großbritannien. Mit umfassenden Psychiatriereformen bekamen die Institutionen einen neuen Auftrag, und so wurden viele Patientinnen und Patienten aus der Hospitalisation entlassen und zurück in ihre Familien geschickt. Dies war dann auch die Trendwende auf dem europäischen Festland. Institutionen, die Anfang des letzten Jahrhunderts noch mit tausend und mehr Betten gebaut worden waren, wurden verkleinert und die stationären Betten massiv reduziert. Damit veränderte sich auch schlagartig die Rolle der Angehörigen.
Mit dem Aufkommen verschiedener therapeutischer Interventionen in den Sechzigerjahren wurde ein neues Interesse an den Angehörigen entdeckt. Zwar galten sie nach wie vor als Täter und Verursacher psychischer Erkrankungen, sie dienten aber auch als Informanten zur Anamnese und Psychopathologie. Die Informationen der Angehörigen erleichterten die diagnostische Einordnung des Patienten. Die im Gegenzug erwartete Information und Aufklärung der Angehörigen blieb jedoch zunächst noch aus.
Mit dem Aufkommen der Expressed-Emotion-Forschung wurden Angehörige zudem als Verursacher von Rückfällen »entdeckt«, was zu erneuten Schuldzuweisungen und einem Wiederaufleben des Konzepts der schizophrenogenen Mutter führte (PITSCHEL-WALZ u.a. 2003).
Die Anfänge der organisierten Angehörigenbewegung in Europa geht auf die Siebzigerjahre zurück. Die erste relevante Angehörigenorganisation wurde 1971 in London gegründet, nämlich die »National Schizophrenia Fellowship«.
In der Folge wurden in verschiedenen europäischen Ländern weitere Angehörigenorganisationen gegründet. Mehrheitlich verfolgte die Angehörigenbewegung zwei Stoßrichtungen: Selbsthilfe und gesundheitspolitische Aktivitäten. Daraus entstand im Laufe der Jahre eine neue Angehörigenrolle: Wir begegnen heute in unserer Arbeit informierten und kompetenten Angehörigen, die an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind. Heute können wir sagen, dass knapp fünfzig Jahre organisierte Angehörigenbewegung die Rolle der Angehörigen in der Psychiatrie entscheidend verändert hat. Dies zeigt sich in unserem Alltag in ganz unterschiedlichen Bereichen: In den Institutionen wird bereits beim Empfang auf Angehörigenorganisationen aufmerksam gemacht. Psychiatrische Beschwerdestellen sind vermehrt auch mit Angehörigen besetzt. Qualitätsstandards in der psychiatrischen Versorgung interessieren sich für die Zufriedenheit der Angehörigen und definieren die Angehörigen als Ansprechgruppe.
Durch den vermehrten Einbezug der Angehörigen und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit der psychiatrischen Institutionen werden psychiatrische Themen in die Gesellschaft getragen und leisten somit ihren Beitrag gegen Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und letztendlich fördert diese Entwicklung auch eine gesellschaftspolitische Sensibilität für die Situation der Angehörigen. Angehörige werden in der Gesundheitspolitik vermehrt wahrgenommen als wichtige Leistungserbringer. Wir werden uns als Gesellschaft mit der Frage, ob die geleistete Betreuung der Angehörigen eine finanzielle Entschädigung braucht, weiter befassen müssen.
Angehörige als Ressource
Mit den sozialpsychiatrischen Reformen der Achtzigerjahre gab es eine neue Wahrnehmung der familiären Last. Daniel Hell schrieb damals: »Ein Vierteljahrhundert Sozialpsychiatrie hat uns gelehrt, dass Angehörige in der Regel die treusten Begleiter von Menschen mit psychischer Erkrankung und ungünstigen Krankheitsverläufen sind« (HELL 1996).
Nachdem Angehörige jahrzehntelang als Mitverursacher für die Entstehung und als Faktor der Aufrechterhaltung psychischer Erkrankungen, insbesondere der Schizophrenie, betrachtet wurden, hat sich ihre Situation inzwischen etwas verbessert.
In den letzten dreißig Jahren wurde die Hälfte bis zwei Drittel aller Psychiatriebetten abgebaut. Das ist grundsätzlich positiv, bedeutet aber eben auch, dass Familien und Angehörige größeren Belastungen ausgesetzt sind.
Durch das Aufkommen des Vulnerabilitäts-Stress-Modells wurde zunehmend auch der positive Einfluss auf die stützende Funktion der Angehörigen interessant. Damit Angehörige diese Rolle wahrnehmen können, brauchen sie jedoch Unterstützung und Informationen.
Für die Situation der Angehörigen war also zunächst kaum Verständnis vorhanden. Ihr Verhalten wurde entweder als krankheitsverursachend oder mindestens als schädlich betrachtet. Viel Anteil an der Schuldzuweisung hatte die Theorie der »schizophrenogenen Mutter« von Frieda FROMM-REICHMANN (1948). In den Fünfzigerjahren war es die Double-bind-Theorie von Gregory BATESON und Kollegen (1956) sowie die Theorie von Lyman C. WYNNE und Kollegen (1985), wonach eine Schizophrenie durch »Anomalien familiärer Kommunikation« verursacht wurde. Für alle diese Theorien fehlten zwar die empirischen Grundlagen, trotzdem wurden sie schnell verbreitet, in Lehrbücher aufgenommen und sind mit dafür verantwortlich, dass Eltern und insbesondere Mütter noch heute allzu oft als Verursacher und Schuldige betrachtet werden bzw. sie sich selbst oft diese Rolle zuschreiben.
Die Situation der Angehörigen hat sich also, betrachten wir die letzten fünfzig Jahre, wesentlich verbessert. Und doch ist die Begegnung mit den Angehörigen psychisch erkrankter Menschen für uns Professionelle nach wie vor mit ambivalenten Gefühlen verbunden. Zwar anerkennen wir heute mehrheitlich die Belastungen des Familiensystems, doch es gibt in unserem Alltag immer wieder Situationen mit Angehörigen, bei denen wir nicht ganz frei sind von Schuldzuweisungen.
Professionelle Begegnung
Ausgesprochen oder nicht, werden Angehörige nach wie vor oft als Verursacher von Krankheit in Betracht gezogen, und es braucht unsere volle Achtsamkeit, um in der täglichen Hektik einer psychiatrischen Institution diese vorschnellen und mehrheitlich gar nicht böse gemeinten Schuldzuweisungen zu erkennen und zu reflektieren. Dies ist wichtig, um mit den Angehörigen in einen partnerschaftlichen Kontakt treten zu können. Für ein gelingendes Miteinander müssen wir die Not der Angehörigen erkennen, müssen ihre Aufgabe als Angehörige respektieren und wertschätzen sowie sie ermutigen, Grenzen zu setzen und eigene Bedürfnisse aufrechtzuerhalten.
Wir sollten uns also – um die Geschichte der Angehörigen in der Psychiatrie weiterzuschreiben – nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern uns weiter Gedanken dazu machen, wie psychiatrische Einrichtungen den Angehörigen respektvoll gegenübertreten können. Dazu müssen wir wissen, was die Angehörigen von uns Professionellen brauchen und wie wir den allparteilichen Dialog fördern können.
Das geht weit über die Diskussion hinaus, ob wir den Angehörigen, wenn sie zu Besuch kommen, einen Kaffee anbieten oder nicht. Wie angehörigenfreundlich eine Institution ist, zeigt sich schon bei der Einfahrt aufs Gelände, beim ersten Telefonat, am Empfang oder am Internetauftritt einer Institution. Neben den sichtbaren Hinweisen, die Angehörige willkommen heißen, geht es aber auch darum, sich als Institution bewusst zu werden, welchen Stellenwert die Angehörigen haben und welche Haltung die Institution den Angehörigen gegenüber vertritt.
Der Weg der Angehörigen in der Psychiatrie, weg vom Sündenbock und hin zu ernst genommenen Partnern, braucht weiterhin viel Sensibilisierungsarbeit und darf nicht in der Diskussion darüber, wer warum wann was richtig oder falsch gemacht hat, stecken bleiben.
Gegen die Stigmatisierung
So wie Asmus FINZEN (2011, 2013) die Stigmatisierung als »zweite Krankheit« beschreibt, so beschreiben auch die Angehörigen die Stigmatisierung als zusätzliche Belastung, die ihre sozialen Funktionen nicht selten massiv beeinträchtigt.
Noch vor wenigen Jahrzehnten galt die Theorie der schizophrenogenen Mutter als Ursache insbesondere für Schizophrenie. Zwar wissen wir heute, dass diese Theorie so nicht zutreffend ist, schon gar nicht als generalisierte Vorannahme, doch die Auswirkungen davon sind nicht einfach zu ignorieren. Gerade Mütter erleben auch heute immer noch Vorurteile und Schuldzuweisungen und ziehen sich aus Angst davor in die soziale Isolation zurück. Dabei fehlen geeignete Ansprechpersonen, Belastungen nehmen noch mehr zu und genau diejenigen Kontakte zur gesunden Welt fehlen, um Stigmatisierung überhaupt überwinden zu können.
Angehörige, die den Weg aus ihrer sozialen Isolation finden und den Mut haben, trotz Angst vor Stigmatisierung über ihre Situation zu reden, beschreiben diesen Schritt oft als Befreiungsschlag gegen die eigene Verzweiflung und Ohnmacht.
In der Expressed-Emotion-Forschung sind die Angehörigenbeziehungen psychisch kranker Menschen vor allem dahin gehend überprüft worden, welchen Einfluss ihr Verhalten auf die weitere Entwicklung der Erkrankung hat. Durch diverse Studien gesichert ist die Tatsache, dass das Familienklima mit einer psychisch erkrankten Person deutlich mehr Stress beinhaltet und dass ein feindseliges Familienklima keine positiven Auswirkungen auf den Verlauf einer Erkrankung hat. Schwierig dabei ist, wenn die Angehörigen für diese komplexen Vorgänge im Familiensystem alleinig verantwortlich gemacht werden, denn in Familien mit einem psychisch kranken Menschen gibt es weder Täter noch Opfer, sondern ganz einfach Menschen, die gemeinsam eine schwere Situation zu meistern haben.
Stigmatisierung beschreiben Angehörige immer wieder auch in kleinen Alltagssituationen im nächsten sozialen Umfeld. So kommentieren beispielsweise nahe Verwandte, dass Eltern, obschon die Tochter in der Psychiatrie untergebracht werden musste, in die Ferien fahren. Oder Bemerkungen wie »Aha, du gibst deine demenzkranke Mutter ins Heim – ich habe diese Aufgabe selbst übernommen!« sind für Angehörige wie Stiche in die Seele. Dabei müssen sie sich eine dicke Haut zulegen, um nicht jedes Mal an ihren (vermeintlich egoistischen) Entscheidungen zu zweifeln.
Angehörige sollten darin bestärkt werden, über ihre Situation zu reden – weil schon das häufig hilft. Trotzdem ist es wichtig, Angehörige auch darin zu bestärken, die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gut auszuwählen. Die Tatsache, dass man in der Familie oder im nahen Umfeld einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung begleitet, muss nicht überall breitgetreten werden. Was mit wem und wie viel wovon mit jemandem beredet wird, entscheiden Angehörige für sich selbst.
Hier leisten die Angehörigenorganisationen eine äußerst wichtige Aufgabe. Oft beschreiben Angehörige, dass sie erst im geschützten Rahmen einer Angehörigengruppe gelernt haben, über ihre Belastungen und ihre Situation zu reden. Der Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation ist sehr hilfreich, um aus der sozialen Isolation wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen. Angehörigengruppen sollten auch in der stationären Versorgung, wann immer möglich, gefördert werden. Sie leisten einen wichtigen Beitrag gegen die Stigmatisierung.
Autonomie als wertvolles Gut
Grundformen menschlicher Werte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in unserer modernen westlichen Gesellschaft stark verändert. Compliance beispielsweise beschrieb das konsequente Verfolgen der ärztlichen Ratschläge seitens der Patienten und war Ausdruck einer paternalistischen Arzt-Patienten-Beziehung. Glücklicherweise verändert sich diese Werthaltung zunehmend hin zu einem neuen Verständnis und zu partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Fachpersonen, Betroffenen und Angehörigen. Konzepte wie Adhärenz, Recovery, Trialog und Patientenorientierung werden in der psychiatrischen Versorgung zunehmend selbstverständlich.
Autonomie ist ein wertvolles Gut. In einer demokratischen Gesellschaft bedeutet die Selbstbestimmung jedes Individuums das Fundament des Zusammenlebens. Autonomie ermöglicht unterschiedliche Lebensformen, was letztlich die Vielfältigkeit einer Gesellschaft bestimmt.
Stetig entfernen wir uns weg von einer paternalistischen Grundhaltung hin zu einer individuumszentrierten Haltung, die grundlegend vorhandene Kompetenzen betont. Diese Entwicklung ist für das Fach Psychiatrie und deren Akzeptanz in der Gesellschaft von hoher Bedeutung – und sie verändert auch die Rolle der Angehörigen. Die Autonomie des Patienten wird in der psychiatrischen Versorgung – die Urteilsfähigkeit des Erkrankten vorausgesetzt – als wichtiges Prinzip geachtet. Eine psychische Erkrankung bedeutet keine globale Inkompetenz und auch das Ablehnen sinnvoller medizinischer Interventionen kann nicht automatisch mit Irrationalität oder Urteilsunfähigkeit gleichgesetzt werden. Das individuelle Wohl besteht somit nicht aus medizinischer Normalität, sondern hat für jeden Einzelnen eine unterschiedliche Bedeutung (SCHRAMME 2009).
Das folgende Beispiel macht auf das Spannungsfeld von Angehörigen aufmerksam, die als wichtigste Bezugspersonen der Frage von Fürsorge versus Autonomie in hohem Maße ausgesetzt sind.
BEISPIEL→ Karl, 24-jährig





























