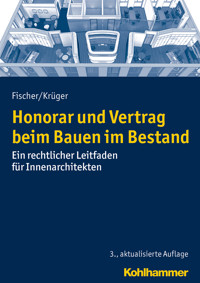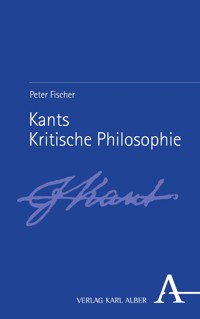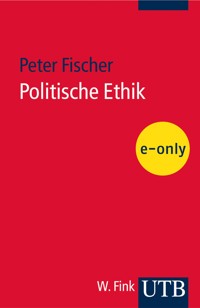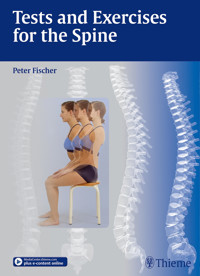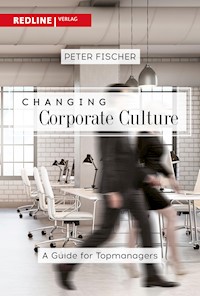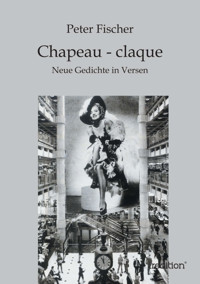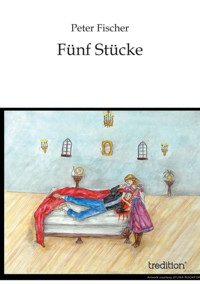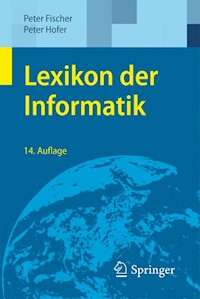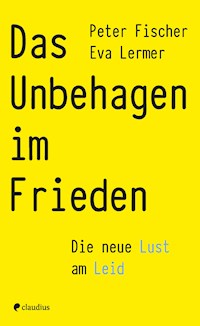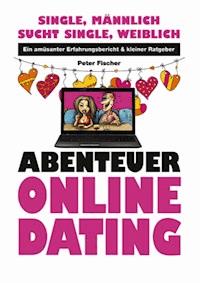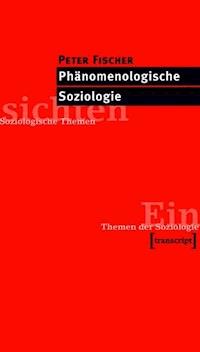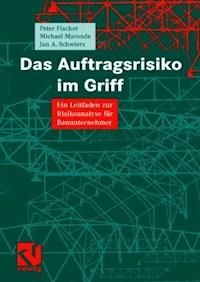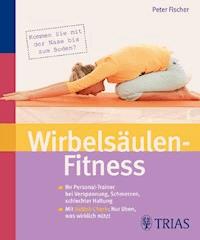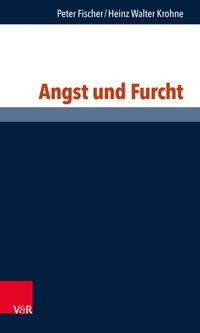
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophie und Psychologie im Dialog
- Sprache: Deutsch
In der Alltagssprache wird zwischen Angst und Furcht selten unterschieden. In der Philosophie und in der Psychologie aber gibt es eine Reihe unterschiedlicher Differenzierungsversuche, die in diesem Band vorgestellt und diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehen der existenzialphilosophische Ansatz Heideggers und neuere, an die Stressforschung anschließende Ansätze der empirischen Psychologie. Außerdem werden angst- und furchtspezifische Erkrankungen – wie Phobien, Panikattacken, generalisierte Angststörung und Depression – thematisiert. Die begrifflichen und methodologischen Schwierigkeiten des interdisziplinären Dialogs werden klar benannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philosophie und Psychologie im Dialog
Herausgegeben von Christoph Hubig und Gerd Jüttemann
Band 16:Peter Fischer / Heinz Walter Krohne Angst und Furcht
Peter Fischer / Heinz Walter Krohne
Angst und Furcht
Mit einer Abbildung und 4 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99854-1
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Peter Fischer
Furcht und Phobie, Angst und Depression. Zur begrifflichen Strukturierung eines Phänomenbereichs
Heinz Walter Krohne
Angst, Furcht und Stress
Briefwechsel
Literatur
Peter Fischer
Furcht und Phobie, Angst und Depression
Zur begrifflichen Strukturierung eines Phänomenbereichs
»Angst ist grundverschieden von Furcht.«
Martin Heidegger
Paradigmatische Positionen zu Angst und Furcht aus der Geschichte der Philosophie
Umgangssprachlich werden die Wörter »Angst« und »Furcht« oft synonym gebraucht. Wir bezeichnen mit ihnen ein unangenehmes Gefühl, das uns angesichts einer Gefahr überfällt oder in Erwartung einer bedrohlichen Situation in uns aufsteigt. Dieses Gefühl wird von Veränderungen körperlicher Zustände begleitet: So steigen zum Beispiel die Atmungs- und Herzschlagfrequenz, es kann zu Atemnot, Schweißausbrüchen und anderen physiologischen Reaktionen kommen. Wir können wie gelähmt sein, zittern oder in Panik geraten, also kopflos handeln. Das mit »Angst« oder »Furcht« bezeichnete Gefühl wird als Bedrückung und als Einengung erlebt und daher den erhebenden und befreienden Gefühlen oder Stimmungen, wie Freude und Hoffnung, gegenübergestellt. Andererseits stellen wir aber auch fest, dass die Furcht eine gesteigerte Aufmerksamkeit und motorische Anspannung mit sich bringt, also gerade das Gegenteil einer Lähmung oder Hemmung.
Als flüchtige Erregung vergeht Angst oder Furcht mit der Situation, die sie hervorbringt. Aber das Gefühl kann sich auch zu einer Einstellung verfestigen, die das Verhalten von Menschen dauerhaft bestimmt. Dies geschieht, wenn es sich zu einer Charaktereigenschaft ausprägt, die dann als Laster gesehen wird und »Ängstlichkeit«, »Furchtsamkeit« oder »Feigheit« heißt. Die Psychoanalyse bzw. die Psychologie diagnostizieren bestimmte Ausprägungen des Gefühls als Angstneurose oder Angstpsychose bzw. Angststörung und unterscheiden dann zum Beispiel zwischen Phobie, Panikattacke und generalisierter Angststörung.
Bedrückende Affektionen, Laster, Neurosen, Phobien und dergleichen möchten wir lieber vermeiden.1 Und wenn sie denn doch auftreten, möchten wir ihnen so schnell wie möglich entfliehen. Diese Einstellung zu Angst oder Furcht bestimmt zunächst und zumeist auch deren philosophische Thematisierung. Ein kurzer philosophiegeschichtlicher Streifzug belegt dies hinsichtlich der antiken und der neuzeitlichen Philosophie. Die christlich-religiöse Philosophie dagegen bezeugt eine andere Einstellung zu Angst oder Furcht.
Angst und Furcht als Störungen vernünftigen Denkens und Handelns
Angst oder Furcht gelten seit der antiken Philosophie als Beeinträchtigungen vernünftigen Denkens und Handelns und damit als Behinderungen der Möglichkeit, glücklich bzw. moralisch zu leben. Epikureer und Stoiker stellen den Affekten die Ideale der Seelenruhe bzw. der Leidenschaftslosigkeit gegenüber. Insbesondere die Todesfurcht soll gebannt werden. Epikur gibt den Tenor dieser Bemühungen, der sich dann auch bei den Stoikern findet, vor, indem er schreibt: »Das schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft uns überhaupt nicht; wenn wir sind, ist der Tod nicht da; wenn der Tod da ist, sind wir nicht. Er betrifft also weder die Lebenden noch die Gestorbenen, da er ja für die einen nicht da ist, die anderen aber nicht mehr für ihn da sind« (Epikur, 2000, S. 45). Diese vernünftige Überlegung soll Angst oder Furcht niederhalten, sogar ausschalten.
Das Wort für Vernunft beeinträchtigende Ergriffenheit durch Affekte, nämlich »Pathos«, wird in unserer Sprache zum Begriff des Krankhaften, des Pathologischen. In diesem Sinne schreibt bereits Seneca: »Es ist oft die Frage aufgeworfen worden, was besser sei, die Mäßigung der Leidenschaften oder ihre völlige Tilgung. Die Unsrigen (die Stoiker) fordern ihre Tilgung, die Peripatetiker ihre Mäßigung. Ich sehe nicht, wie irgendwelche Ermäßigung einer Krankheit heilsam oder nützlich sein könne. Wirf alle Furcht von dir: ich raube dir nichts von dem, was du dir nicht versagt wissen willst« (Seneca, 1993, S. 288 f.). Die Erfolgsaussichten des stoischen Konzepts der Tilgung der Leidenschaften stehen freilich nicht so gut, wie Seneca hofft, denn ein sinnliches Wesen wie der Mensch erleidet mit Notwendigkeit Affektionen. Daher scheint der aristotelische Vorschlag, durch tätige Gewöhnung an das Handeln in entsprechenden Situationen das rechte Maß an Affektivität auszubilden, also eine tugendhafte Charakterstärke – neudeutsch: Selbstkontrolle – zu erlangen, der menschlichen Natur angemessener zu sein. Wenn Aristoteles im Hinblick auf die Furcht die Tapferkeit als das rechte Maß zwischen Feigheit und Tollkühnheit empfiehlt, wird die Furcht nicht gänzlich getilgt (vgl. Aristoteles, 1995, S. 33–43; 1105b–1109b). Stattdessen wird einsehbar, dass die maßvolle Furcht sogar eine wichtige Bedingung erfolgreichen Handelns sein kann: Furcht im rechten Maß warnt ebenso vor Gefahr, wie sie vor Selbstüberschätzung schützt. Die Warn- und Schutzfunktion der Furcht findet anscheinend auch in den Flucht- oder Angriffsreaktionen der Tiere in Gefahrensituationen ihren Ausdruck.
Neuzeitliche Philosophen, wie der Rationalist René Descartes, empfehlen, die Einbildungskraft zu nutzen, um der unliebsamen Wirkung bestimmter Affekte entgegenzuwirken. Nach dieser Psychomechanik soll der Betroffene seine Gedanken von der Gefahr abwenden und sich zum Beispiel Ruhm und Ehre vorstellen, die ihm für seine Tapferkeit zuteilwerden können. Die durch die Vernunft gelenkte Einbildungskraft soll also durch Vorstellungsbilder handlungsförderliche Affekte erzeugen, deren motivationale Kraft die der ursprünglichen situativen Affektion, welche handlungshemmend wirkt oder nicht erwünschte Handlungen initiiert, übertrifft (vgl. Descartes, 1649/1980, S. 335 f., § 211).
Alle Nuancierungen zwischen der griechischen, der römischen und der neuzeitlichen Philosophie ändern letztlich doch nichts an dem Befund, dass die Affekte bzw. Dispositionen Angst oder Furcht generell als Störfaktoren vernünftigen Denkens und Handelns gedacht werden. Daher wird empfohlen, sie zu tilgen oder zu beherrschen.
Angst und Furcht als Weisen religiöser Wahrheit der Existenz
Es bleibt der christlich-religiösen Philosophie vorbehalten, hinsichtlich Angst oder Furcht einen deutlich anderen Akzent zu setzen. Bei mittelalterlichen Denkern findet sich die Unterscheidung zwischen der knechtisch niederen Furcht, die sich auf Strafe und Übel in der Welt bezieht, und der reinen, gotteskindlichen Furcht, die als Ehrfurcht vor Gott zugleich die Liebe zu Gott ausdrückt. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Differenzierung nur als religiöse Analogie zur antiken Gegenüberstellung von lasterhafter Feigheit und tugendhaftem Mut, der das rechte Maß an Furcht einschließt. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Gottesfurcht eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber der Vernunft behaupten soll: Sie sei nicht wider die Vernunft, aber doch über diese hinausgehend als eine unersetzliche Weise religiöser Einsicht. Die Gottesfurcht wurzele damit in der Gotteskindlichkeit und in der Religiosität als den Wesensbestimmungen des Menschen und sei deren genuiner Ausdruck. Im gottesfürchtigen Sein zu Gott stelle sich die Sehnsucht nach Überwindung von Angst und Tod, das heißt die Sehnsucht nach Erlösung, dar.
Der Görlitzer Schuhmachermeister und mystische Naturphilosoph Jakob Böhme nennt die Erlösung – also das Sein in Gott, das ewige Leben –, »Freiheit«. In seiner Schrift »De signatura rerum« schreibt Böhme: »Die Begierde der Freiheit ist sanft und licht, und wird Gott genannt, und die Begierde zur Natur macht in sich finster, dürre, hungerig und grimmig: die wird Gottes Zorn genannt; und die Finsterwelt, als das erste Prinzip, und die Lichtwelt das andre Prinzip, ist zwar kein abteilig Wesen, sondern eines hält das andere in sich verschlossen, und eines ist des andern Anfang und Ursache, auch Heilung und Arznei; welches erweckt wird, das bekömmt das Regiment, und offenbart sich im Äußern mit seinem Charakter, und macht eine Gestaltnis nach seinem Willen im Äußern nach sich, wie man solches an einem erzürneten Menschen oder Tier sieht. Obgleich der äußere Mensch und Tier nicht die innere Welt sind, so hat doch die äußere Natur eben dieselben Gestaltnisse, denn sie urständet von der innern, und steht auf der innern Wurzel. Die dritte Gestalt ist die Ängstlichkeit, die urständet in der Natur von der ersten und andern, und ist der ersten und andern Behalter oder Erhalter […]. Diese drei Gestalten sind ineinander als eine, und sind auch nur eine, teilen sich aber durch den Urstand in viel Gestälte, und haben doch nur eine Mutter, als den begehrenden Willen zur Offenbarung, das heißt, der Vater der Natur und des Wesens aller Dinge« (Böhme, 1635/1974, S. 222 f.; 2. Kap., §§ 23, 24, 26).
Nach Böhme ist das Leben der Geschöpfe durch die innere Lichtwelt der Freiheit und die äußere Finsterwelt der Verfallenheit an die Natur charakterisiert. In der Angst finde diese doppelte Bestimmtheit wie auch die Sehnsucht des »wiedergefaßten Willens« (Böhme, 1635/1974, S. 223; 2. Kap., § 27), der zurück zur Freiheit strebe, ihren kreatürlichen Ausdruck. In und mit der Angst sind also nach Böhme die ganze Bestimmung des Kreatürlichen und sein Sein in der Welt dem Menschen gegeben. In der Angst selbst »blitzt« (Böhme, 1635/1974, S. 223; 2. Kap., § 24 und öfter) damit die Wahrheit der kreatürlichen Existenz auf. Insofern wird die Angst als Zugang zur und Ausdruck der Wahrheit gedacht, anstatt in ihr eine Störung der Vernunft und daher ein notwendiges Verfehlen der Wahrheit zu sehen.
Die Thematisierung der Angst in der christlich-religiösen Philosophie bleibt freilich immer auf das Jenseits und auf die Kreatürlichkeit des Menschen bezogen. Weltangst, Gottesfurcht und Liebe zu Gott sind hier aufs Engste ineinander verwoben. Diese Konzepte erscheinen daher stets als Interpretationen zu Johannes 16, 33, wo es heißt: »In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Womit eben auch gesagt ist, dass Angst notwendigerweise zum Sein des Menschen in der Welt gehört.
Die verdienstlichen Bemühungen der christlich-religiösen Philosophie, in Angst oder Furcht Weisen der Wahrheit anstatt Störungen der Vernunft zu sehen, erreichen ihren Höhepunkt in Sören Kierkegaards Werk »Der Begriff Angst« aus dem Jahre 1844. Dieses Werk darf, von Pascals »Gedanken« und den Schriften Böhmes einmal abgesehen, als die philosophische Geburtsurkunde des Existenzialismus gelten. Martin Heidegger hebt diese Schrift aus allen theoretischen Schriften Kierkegaards heraus: In ihr habe sich Kierkegaard im Vergleich mit seinem sonstigen Schaffen am ehesten von Hegels Ontologie emanzipiert (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 235/Anm.) und sei am weitesten von allen Denkern in der Analyse des Angstphänomens vorgedrungen (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 190/Anm.). Allerdings bleibe Kierkegaards Ansatz in zweifacher Hinsicht beschränkt: Zum einen erfolgten seine Analysen im theologischen Zusammenhang, zum anderen gelange Kierkegaard über die existenzielle Thematisierung nicht hinaus zur existenzialen (Heidegger, 1927/1986, S. 235/Anm., S. 338/Anm.).2 Beide Beschränkungen möchte Heidegger mit seiner Analyse von Angst und Furcht im Rahmen der Daseinsanalyse überwinden.
Weil Heideggers Ansatz noch immer der elaborierteste Versuch ist, Angst und Furcht als Weisen der Wahrheit der Existenz im Kontext einer weltlichen Philosophie zu denken und sie begrifflich konsequent voneinander zu unterscheiden, soll er im Folgenden ausführlicher betrachtet und schließlich mit empirischen Konzepten verglichen werden. Es soll aber zuvor nicht unerwähnt bleiben, dass bereits vor Kierkegaard und Heidegger im Rahmen einer nichtreligiösen Philosophie ein Phänomen der Furcht als symbolischer Hinweis auf die Freiheit und damit auf die Wahrheit der Existenz gedeutet wurde.
Die furchtlose Betrachtung des Furchtbaren: Fühlbarkeit der Freiheit
Diese Deutung gibt Immanuel Kant mit seiner Theorie des ästhetischen Urteils über das Dynamisch-Erhabene. Kant bemerkt, dass wir einen Gegenstand oder eine Begebenheit als furchtbar einschätzen können, ohne uns dabei zu fürchten. Dies ist dann der Fall, wenn wir – uns in Sicherheit wähnend – gewaltige Naturerscheinungen betrachten, denen wir nicht widerstehen könnten, wären wir ihnen ausgesetzt. Kant schreibt: »Auf solche Weise wird die Natur in unserm ästhetischen Urteile nicht, sofern sie furchterregend ist, als erhaben beurteilt, sondern weil sie unsere Kraft (die nicht Natur ist) in uns aufruft, um das, wofür wir besorgt sind (Güter, Gesundheit und Leben), als klein, und daher ihre Macht (der wir in Ansehung dieser Stärke allerdings unterworfen sind) für uns und unsere Persönlichkeit demungeachtet doch für keine solche Gewalt anzusehen, unter die wir uns zu beugen hätten, wenn es auf unsre höchste Grundsätze und deren Behauptung oder Verlassung ankäme. Also heißt die Natur hier erhaben, bloß weil sie die Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Fälle erhebt, in welchen das Gemüt die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung, selbst über die Natur, sich fühlbar machen kann« (Kant, 1790/1992, S. 186; B 105, § 28). Die furchtfreie Betrachtung von Naturgewalten, die in einer anderen Situation Furcht erregen würden, versetzt uns in eine Stimmung der Selbstschätzung, die zur Reflexion unserer Freiheit als Autonomie führt. Also nicht die reine praktische Vernunft allein, wie dies Kant in der »Kritik der praktischen Vernunft« erläutert, vermittelt uns durch die Achtung vor dem moralischen Gesetz unsere Selbstachtung als freie, das heißt autonome, Wesen. Auch die ästhetische Kontemplation des Furchtbaren, die zum Urteil über das Dynamisch-Erhabene führt, ermöglicht diese Selbstschätzung, indem sie das Selbstgesetzgebungsvermögen der Persönlichkeit dem Gemüt fühlbar macht. Das ästhetische Wohlgefallen am Dynamisch-Erhabenen »entdeckt«, wie Kant sagt, »die Bestimmung unseres Vermögens, so wie die Anlage zu demselben in unserer Natur ist« (Kant, 1790/1992, S. 186; B 106, § 28). Der furchtlosen Betrachtung des Furchtbaren erschließt sich also die Möglichkeit der moralischen Selbstbestimmung des Menschen (vgl. Fischer, 2003a, S. 289 ff.).
Dieses Entdecken geschieht weder in der Weise des theoretischen noch des praktischen Vernunftgebrauchs, sondern durch ein Gefühl, welches Kant auf das Verhältnis von Einbildungskraft und Vernunft anlässlich der furchtlosen Betrachtung des Furchtbaren zurückführt. Ein solches Entdecken oder Fühlbarmachen müsste Heidegger als eine existenziale Erschließung anerkennen, aber die »Kritik der Urteilskraft« findet in »Sein und Zeit« keine Erwähnung, obwohl Kant dort der nach Aristoteles am häufigsten genannte Philosoph ist. Wie nun bestimmt Heidegger seinerseits Angst und Furcht?
Die existenzialphilosophische Analyse von Angst und Furcht
Die existenzialphilosophische Analyse erfolgt im Prinzip in zwei Schritten. Zuerst wird phänomenologisch beschrieben, wie es ist, sich zu ängstigen oder zu fürchten. Damit wird die Befindlichkeit des Daseins in diesen Stimmungen existenziell, das heißt inhaltlich, charakterisiert, und zwar zunächst in ihrer durchschnittlichen Alltäglichkeit. Im zweiten Schritt werden diese Weisen des gestimmten In-der-Welt-seins zum Thema einer hermeneutischen Betrachtung. Diese möchte verstehen, welche Daseinsstrukturen diese Stimmungen ermöglichen und welche in der Stimmung noch nicht explizit verstandenen Daseinsmöglichkeiten sich damit bieten. Auf die existenzielle Charakterisierung folgt also die existenziale, das heißt strukturelle und modale, Interpretation.3
Die existenzielle Charakteristik der Furcht
Heidegger beschreibt zunächst das Phänomen der Furcht. Dabei unterscheidet er zwischen dem Wovor der Furcht, dem Worum der Furcht und dem Fürchten selbst.
Das Wovor der Furcht, also das Furchtbare, ist ein innerweltlich Begegnendes (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 140). Das Furchtbare hat den Charakter des Bedrohlichen. Die Phänomenologie des Bedrohlichen stellt Heidegger durch sechs Merkmale dar: 1) Das Bedrohliche hat die Bewandtnisart der Abträglichkeit. Die Bewandtnis des Bedrohlichen ist also in der Furcht thematisch. 2) Die Abträglichkeit ist eine bestimmte: Sie kommt aus einer bestimmten Gegend und betrifft bestimmte Aspekte des Daseins. 3) Das Bedrohliche ist dem Dasein nicht geheuer, das heißt das Dasein ist mit ihm nicht vertraut, während es mit dem im alltäglichen Umgang Zuhandenen vertraut ist. 4) Die Abträglichkeit naht drohend. Dieses Nahen muss immer als ein zeitliches verstanden werden, kann aber zusätzlich auch im räumlichen Sinne gemeint sein. 5) Das Bedrohliche ist in der Nähe, sodass es jederzeit treffen kann oder auch nicht. Aber diese Nähe ist wiederum nicht die vertraute Nähe des Zuhandenen. 6) Diese Spannung zwischen der Möglichkeit des Ausbleibens und Vorbeigehens einerseits und der Möglichkeit des Treffens andererseits steigert die Furcht und bildet sie aus. Durch diese Merkmale ist das Wovor der Furcht phänomenal charakterisiert.4
Über das Fürchten selbst schreibt Heidegger: »Das Fürchten selbst ist das sich-angehen-lassende Freigeben des so charakterisierten Bedrohlichen« (Heidegger, 1927/1986, S. 141; Hervorh. i. Original). Das Furchtbare setzt also eine Weise der Erschlossenheit voraus, die es als solches sein lässt, es freigibt. Die Furcht entdeckt, konstituiert sogar, das Furchtbare. Diese Befindlichkeit im Modus der Latenz ist Furchtsamkeit: »Das Fürchten als schlummernde Möglichkeit des befindlichen In-der-Welt-seins, die ›Furchtsamkeit‹, hat die Welt schon darauf hin erschlossen, daß aus ihr so etwas wie Furchtbares nahen kann« (Heidegger, 1927/1986, S. 141). Furchtsamkeit in diesem Sinne ist keine individuelle Veranlagung oder Charaktereigenschaft, also keine Neigung zu besonderer Furchtsamkeit oder Schreckhaftigkeit, sondern eine existenziale Möglichkeit der Befindlichkeit des Daseins überhaupt. Ethologische oder psychologische Theorien sprechen in diesem Zusammenhang von der Furcht als Disposition, die dann in der Furcht als Zustand aktualisiert wird.
Das Worum der Furcht ist das Dasein selbst. Weil es mit dem Furchtbaren eine bestimmte Bewandtnis hat, weil es in bestimmter Weise abträglich ist, deshalb fürchtet das Dasein um sich in einer bestimmten Hinsicht. Wenn das Dasein um Hab und Gut, um »Haus und Hof« (Heidegger, 1927/1986, S. 141), fürchtet, dann fürchtet es um sich, weil es sich von dem her versteht und dessen bedarf, was es besorgt. Fürchtet das Dasein, dass anderen Bedrohliches widerfährt, dann fürchtet es doch um sich: um sein Mitsein mit den anderen, die ihm entrissen werden könnten. Fürchten kann es sich auch um seine körperliche Unversehrtheit, seine Gesundheit, sein Leben. Und schließlich kann es sich davor fürchten, in bestimmten Situationen in Furcht zu geraten, nicht mutig zu sein. Fürchten kann sich daher, wie Heidegger dies ausdrückt, nur ein Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Sein geht. Das Worum der Furcht in seinem vollen Umfang eignet daher nur dem Menschen.
Befürchtet werden also ein bestimmter Verlust oder eine bestimmte Trennung von etwas, von dem her das Dasein sich definiert. Heidegger schreibt daher: »Die Furcht erschließt das Dasein vorwiegend in privativer Weise« (Heidegger, 1927/1986, S. 141). Weil die drohende Beraubung das bisherige Seins- und Selbstverständnis gefährdet, macht die Furcht verwirrt und kopflos, sie macht panisch. Deshalb muss sich das Dasein nach gewichener Furcht erst wieder zurechtfinden.
Derivate der Furcht sind nach Heidegger das Erschrecken, wenn das Bedrohliche plötzlich naht, das Grauen, wenn das Bedrohliche etwas Unbekanntes ist, das Entsetzen, wenn Erschrecken und Grauen zugleich eintreten. Andere Abwandlungen sind Schüchternheit, Scheu, Bangigkeit, Stutzigwerden (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 142).
Die existenzielle Charakteristik der Furcht erfasst jene Phänomene, auf welche sich der synonyme Gebrauch der Wörter »Angst« und »Furcht« im Alltag bezieht. Diese Phänomene sind auch grundlegend für den Gebrauch dieser Wörter als Begriffsnamen in Ethologie und Psychologie.
Die existenziale Interpretation der Furcht
Hinsichtlich der Befindlichkeit des Daseins ist der alltägliche umsichtige Umgang durch Vertrautheit und Sicherheit geprägt. Dasein geht in seinem Besorgen und Fürsorgen auf und kann dabei der Auslegung seines In-der-Welt-seins durch das Man folgen, also das tun und sagen, was Man tut und sagt, ohne diese existenzielle Bestimmtheit eigens gewählt zu haben. Heidegger begreift diese durchschnittliche Alltäglichkeit der Existenz eines jeden, das Man-selbst, als Verfallenheit. Die Furcht bedeutet hinsichtlich der Befindlichkeit eine partielle und zumeist bloß kurzfristige Störung der Vertrautheit und Sicherheit. In der Furcht wird zwar etwas erschlossen, was in bestimmter Hinsicht abträglich, bedrohlich und nicht geheuer ist, aber der Gesamtzusammenhang der alltäglichen Bedeutsamkeiten wird dadurch nicht infrage gestellt, das Dasein wird nicht gezwungen, sich auf sich selbst zu besinnen. Die Weisen des durch die Furcht motivierten Verhaltens sind darauf ausgerichtet, schnellstmöglich die Vertrautheit und Sicherheit zu erneuern bzw. auf Dauer zu stellen: Die kurzfristigen, unüberlegten Reaktionsweisen zielen darauf ab, dem Bedrohlichen zu entkommen bzw. dieses aus der Welt zu schaffen. Die Furcht vor der Furcht motiviert Überlegungen und Vorkehrungen, die die Daseinsrisiken in Zukunft minimieren sollen. Der existenziale Sinn der Furcht besteht also darin, dass sie die Flucht des Daseins in die Verfallenheit antreibt, deren Vertrautheit und Sicherheit erneuert und verfestigt, womit sich das Dasein zugleich von seiner möglichen Selbstbesinnung abkehrt. Es ist dies die Abkehr von der Last und Verantwortung der Selbstbestimmung. In der Furcht bleiben dem Dasein sowohl seine Hinwendung zur Verfallenheit als eine solche verborgen als auch seine Flucht vor sich selbst, vor seiner Selbstbestimmung zum eigentlichen Dasein. Heideggers existenziale Analyse der Furcht gipfelt in der These, dass die Abkehr im Verfallen von der existenzialen Möglichkeit eigentlichen Daseins, eine Abkehr, die sich in der Furcht vollzieht, letztlich in der Angst als einer Grundbefindlichkeit des Daseins gründet (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 186). Um dieses Verhältnis von Angst und Furcht weiter aufzuklären, sind also zunächst die Beschreibung und die Analyse der Angst notwendig.
Die phänomenale Charakteristik der Angst und ihre existenziale Analyse
Auch das Wovor der Angst hat den Charakter eines Bedrohlichen, ist aber kein bestimmtes innerweltlich Seiendes. Mit dem Bedrohlichen, das in der Angst gegeben ist, hat es daher keine Bewandtnis, es ist nicht in einer bestimmten Hinsicht abträglich. Diese privative Bestimmtheit des Bedrohlichen ist in der Angst gefühlsmäßig gegeben als Leere, Halt- und Sinnlosigkeit, als Belanglosigkeit, Irrelevanz, Unbedeutsamkeit alles Weltlichen, aber nicht als Abwesenheit der Welt. Unter dem Aspekt des Innerweltlichen wird das Wovor der Angst als das »Nichts und Nirgends« (Heidegger, 1927/1986, S. 186) offenbar. Das Nichts steht dafür, dass alle Bewandtnis nichtig, belanglos ist. Das Nirgends steht dafür, dass wegen der Belanglosigkeit des Innerweltlichen die Bedrohung nicht aus einer bestimmten zeitlichen oder räumlichen Gegend kommt, sondern schon da ist, so nah, dass sie beengt und einem den Atem verschlägt.
Das Nichts und Nirgends des Innerweltlichen führt dazu, dass sich die Welt einzig als Weltlichkeit schlechthin aufdrängt, denn die Unbedeutsamkeit des Innerweltlichen ist nur aufgrund von Weltlichkeit überhaupt möglich: Unbedeutsamkeit ist nicht schlechthin Negation der Bedeutsamkeit, sondern bedrohliche Privation der Bedeutsamkeit. In der Befindlichkeit der Angst erschließt sich also dem Dasein die Welt als solche, sein bloßes In-der-Welt-sein (vgl. Heidegger, 1927/1986, S. 187). Dieses nimmt in der Angst den Charakter des Bedrohlichen an, weil das Dasein in der Angst keinen Halt mehr findet an irgendeiner Bewandtnis irgendeines Innerweltlichen, auch nicht am bedrohlich Abträglichen der Furcht: »Die ›Welt‹ vermag nichts mehr zu bieten, ebensowenig das Mitdasein Anderer« (Heidegger, 1927/1986, S. 187).
Das Dasein ist also in der Angst vor die Welt und vor die Nichtigkeit des Innerweltlichen gebracht. Das Wovor der Angst ist das In-der-Welt-sein selbst und als solches. Insofern könnten wir die Angst »Weltangst« nennen. Das In-der-Welt-sein ist aber ein Existenzial des Daseins: Es ist die Grundverfassung des Existierens. Insofern ängstigt sich das Dasein vor sich selbst. Daher könnten wir die Angst auch »Daseinsangst« nennen. Dasein und Welt sind korrelative Begriffe: Kein Dasein ohne Welt, keine Welt ohne Dasein.
Das Worum der Angst ist gleichfalls das Dasein selbst, und zwar in derselben existenzialen Bestimmung. Das in der Angst erschlossene innerweltliche Nichts und Nirgends, die Nichtigkeit des Innerweltlichen, nimmt dem Dasein die Möglichkeit sich über die Verfallenheit an das Innerweltliche zu definieren: Ihm ist die Vertrautheit, Sicherheit und Bewandtnis, die das Mitsein im Man und die vom Man-selbst besorgte Welt des Zu- und Vorhandenen bieten, entzogen. Damit ist das Dasein auf sich selbst zurückgeworfen. Zugleich ist das Dasein vereinzelt: Es kann nicht mehr als Man-selbst im Man aufgehen. Im Modus der Befindlichkeit, nicht des Begreifens, erschließt sich dem Dasein die Aufgabe, sein eigenes In-der-Welt-sein-können zu entwerfen. Um dieses In-der-Welt-sein-können ängstigt es sich, weil es im Innerweltlichen keinen Halt mehr findet. Heidegger schreibt: »Mit dem Worum des Sichängstigens erschließt daher die Angst das Dasein als Möglichsein und zwar als das, das es einzig von ihm selbst her als vereinzeltes in der Vereinzelung sein kann« (Heidegger, 1927/1986, S. 187 f.; Hervorh. i. Original). Das Dasein ist vor sein Möglichsein, also vor sein eigentliches Können gebracht, das darin besteht, frei zu sein, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen, also die Freiheit zum eigentlichen Seinkönnen zu haben5: »Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für die Freiheit des Sich-selbst-wählens und -ergreifens. Die Angst bringt das Dasein vor sein Freisein für … (propensio in …) die Eigentlichkeit seines Seins als Möglichkeit, die es immer schon ist. Dieses Sein aber ist es zugleich, dem das Dasein als In-der-Welt-sein überantwortet ist« (Heidegger, 1927/1986, S. 188; Hervorh. i. Original).
In der Angst ist also sein In-der-Welt-Sein dem Dasein ursprünglich, das heißt unverstellt durch Verfallenheit, gegeben. Dem nichtdaseinsmäßig Seienden – Dinge, Pflanzen, Tiere – ist die Welt überhaupt nicht gegeben: Die jeweiligen Tierarten sind eins mit ihrer angepassten Lebensweise in einem bestimmten Biotop.6
Das Dasein ist aufgrund seines Seins immer schon sich selbst überantwortet. In der Verfallenheit, also auch in der Furcht, wird diese existenziale Bestimmung verdeckt und verdrängt. Die Angst offenbart die Selbstverantwortlichkeit im Modus der Befindlichkeit; die Analyse der Angst erfasst diese existenziale Bestimmung begrifflich. Die Freiheit der Selbstwahl ist also jene Seinsmöglichkeit des Daseins, entweder im Modus der Uneigentlichkeit, der Verfallenheit, oder im Modus der Eigentlichkeit zu existieren. Diese Kontravalenz bringt den Gehalt der Gestimmtheit in der Angst auf den Punkt.
Das Verhältnis von Angst und Furcht