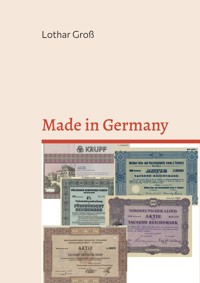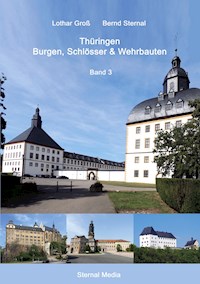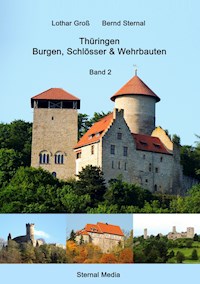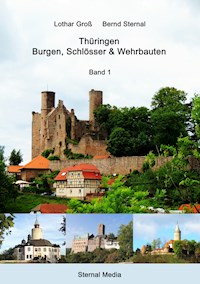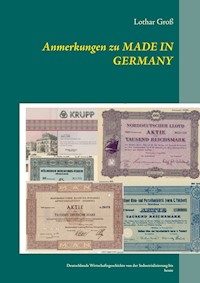
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beinhaltet Anmerkungen und Ergänzungen zu dem 2013 erschienenen Hauptwerk "MADE IN GERMANY - Deutschlands Wirtschaftsgeschichte von der Industrialisierung bis heute." In dieser Ergänzung werden - Anmerkungen und Aktualisierungen zum Hauptwerk - der Begriff "Made in Germany", - Definitionen zu den verwendeten Wertpapieren, - Anmerkungen zu Börsen und Börsenkursen und - eine kurz gefasste Weltwirtschaftsgeschichte seit 1800 dargestellt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies ist der Anhang zum 2013 vom gleichen Autor verfassten Werk „Made in Germany – Deutschlands Wirtschaftsgeschichte von der Industrialisierung bis heute“
In diesem Anhang werden
der Begriff „Made in Germany“ erläutert,
die wichtigsten Wertpapierarten in ihren verschiedenen Varianten sowie ihre Handelsplattform, die Börsen, vorgestellt,
ein kurzer Überblick über die gesamte Weltwirtschaftsgeschichte seit 1800 unter besonderer Berücksichtigung der USA gegeben,
Anmerkungen sowie aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsgeschehen nach Redaktionsschluss dieses Hauptwerks eingefügt.
Der Redaktionsschluss für das Hauptwerk war der Frühling 2013. Es gibt aber immer wieder neue Erkenntnisse, die eine Überarbeitung verschiedener Passagen notwendig machen. Außerdem entwickelt sich die Wirtschaft in rasender Geschwindigkeit weiter. Daher kann ein Buch über wirtschaftliche Entwicklungen immer nur eine Momentaufnahme sein, die einer andauernden Aktualisierung bedarf. Der im Vergleich zum Hauptwerk deutlich erhöhte Anteil an Abbildungen von Wertpapieren ausländischer Unternehmen spiegelt dabei die zunehmende Globalisierung wieder.
Sowohl für das Hauptwerk als auch für diesen Anhang gilt: Diese Bücher erheben nicht den Anspruch wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen. Alle in diesen Werken angegebenen Daten wurden öffentlich zugänglichen Quellen entnommen. Trotz intensiver Recherche bittet der Autor aber um Verständnis dafür, dass er keine Garantie für die Richtigkeit jeder einzelnen Aussage geben kann.
Die Rechte an allen Bildern in diesen Büchern liegen beim Autor.
Inhalt
Der Begriff „Made in Germany“
Definitionen
Aktien und andere Wertpapiere
Non-Valeurs
Börsen und Börsenkurse
Anmerkungen und Aktualisierungen zum Hauptwerk (seit Redaktionsschluss des Hauptwerkes Juni 2013)
Kurz gefasste Weltwirtschaftsgeschichte seit Endes des 18. Jahrhunderts
Exkurs: Kleine Wirtschaftsgeschichte der USA
1. Der Begriff „Made in Germany“
Die Kennzeichnung „Made in Germany“ auf Gütern ist eine Herkunftsangabe, steht aber auch für hohe Qualität und sogar faire Arbeitsbedingungen. Sie wird oft als ein – allerdings nicht genauer spezifiziertes – Qualitätsversprechen, ja sogar als ein Qualitätssiegel schlechthin angesehen.
1 Aspekte der geschichtlichen Entwicklung
Am 23. August 1887 trat in England der „Merchandise Marks Act“, eine Neuauflage des britischen Handelsmarkengesetzes, in Kraft, das die Angabe des Herkunftslandes auf allen importierten Waren verlangte. Für Waren aus Deutschland wurde damit die Kennzeichnung „Made in Germany“ verbindlich. Mit dieser Maßnahme versuchte der englische Gesetzgeber die Produkte heimischer Hersteller vor preisgünstiger ausländischer Konkurrenz, vor allem aus dem aufstrebenden Industrieland Deutschland, zu schützen. Von Anfang an war die Herkunftsbezeichnung „Made in Germany“ also auch verbunden mit einer Kennzeichnung für Qualität: Die Produkte aus Deutschland galten in England als minderwertig. Die Qualität der deutschen Produkte erhöhte sich aber im ausgehenden 19. Jahrhundert so rasant, dass sich der Begriff „Made in Germany“ schon um die Jahrhundertwende zu einem positiven Qualitätskennzeichen wandelte.
Die Assoziation der Herkunftsangabe mit hoher Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit, Langlebigkeit und hohem technischen Standard der Produkte überdauerte beide Weltkriege und erlebte einen weiteren Höhepunkt in den Jahren des „Wirtschaftswunders“. Die Existenz zweier deutscher Staaten führte dabei zu Besonderheiten:
Verschiedene westdeutsche Unternehmen verwendeten (aufgrund von Importvorschriften anderer Länder, aus Konkurrenzgründen oder aus Sorge vor – angeblich – minderwertigen DDR-Produkten) zur Abgrenzung gegenüber ostdeutschen Waren den Begriff „Made in Western Germany“ (oder „West Germany“ bzw. „W. Germany“). Der Vermerk „Made in FRG“ (Federal Republic of Germany) wurde wenn möglich vermieden, da er schon aufgrund des geringen Bekanntheitsgrads der Abkürzung nicht von dem „guten Ruf“ des herkömmlichen „Made in Germany“-Kennzeichens profitieren konnte. Dieser Mangel betraf auf der anderen Seite auch den Vermerk „Made in GDR“ (German Democratic Republic), welcher aber häufiger verwendet wurde, da die DDR-Staatsführung den Begriff „East Germany“ nicht akzeptierte. In der Bundesrepublik Deutschland durften allerdings nach höchstrichterlichem Urteil auch Produkte aus der DDR das „gefühlte Qualitätssiegel“ „Made in Germany“ tragen [1].
2 Aktuelle rechtliche Vorschriften zur Herkunftsangabe
Die Kennzeichnung von Waren mit „Made in Germany“ ist im internationalen Handel vielfach notwendig, da die Einfuhrbestimmungen verschiedener Staaten außerhalb der EU solche Herkunftsbezeichnungen vorschreiben.
Die EU schreibt bisher im Handel zwischen den Mitgliedsländern keine Herkunftsangabe vor, spezifiziert aber mögliche Herstellungskennzeichnungen in der Verordnung Nr. 2913/92 des Rates vom 12. 10.1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften:
Artikel 24 Zollkodex: „Eine Ware, an deren Herstellung zwei oder mehrere Länder beteiligt waren, ist Ursprungsware des Landes, in dem sie der letzten wesentlichen und wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen worden ist, die in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.“
In Deutschland existiert keine spezielle Vorschrift für die Verwendung des Begriffs „Made in Germany“. Die Verwendung des Begriffs ist in Deutschland bisher freiwillig und erfolgt auf eigene Verantwortung des Herstellers. Eine falsche oder irreführende Kennzeichnung ist aber ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und kann eine Beschlagnahme der entsprechenden Waren durch staatliche Stellen nach sich ziehen (seit dem grundlegenden „Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben“ von 1891, in Deutschland 1994 erneut juristisch kodifiziert durch das „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen“). Dieses „Markengesetz“ steckt insgesamt eine gewissen wettbewerbsrechtlichen (nicht: zollrechtlichen) Rahmen über die Verwendung von geografischen Herkunftsangaben ab:
§ 127 Markengesetz: „(1) Geografische Herkunftsangaben dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geografische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen, Angaben oder Zeichen für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft besteht.“
Gesetzliche Kodifizierungen sind allgemein gehalten und müssen häufig, so auch in Bezug auf die Verwendung der Kennzeichnung „Made in Germany“, durch Gerichte im Einzelfall interpretiert werden. Die deutsche Rechtsprechung hatte dabei bisher vor allem mit der wettbewerbsrechtlichen Frage zu tun, welche Voraussetzungen ein Produkt aufweisen muss, damit es in Deutschland mit dem Kennzeichen „Made in Germany“ angeboten werden darf. Dabei prüften die Gerichte vor allem, ob im geschäftlichen Verkehr, auch in der Werbung, die allgemeine Verkehrsanschauung der beteiligten Verkehrskreise (z. B. Geschäftspartner und Verbraucher) den Gebrauch der Bezeichnung „Made in Germany“ als gerechtfertig erscheinen lässt. In ihren Urteilen gingen die Gerichte dabei deutlich über die für den Export gültigen zollrechtlichen Vorschriften hinaus:
Das Oberlandesgericht Stuttgart bezog sich in einem einschlägigen Fall darauf, dass diejenigen Eigenschaften, die als wesentlich für den Wert des Produkts angesehen würden, in Deutschland erbracht sowie die Produkte in Deutschland konstruiert und zumindest endgefertigt werden müssten [2]. Das Landgericht Frankfurt am Main betonte die Notwendigkeit des Fertigungsbetriebs sowie die Überwachung von Fertigung und Entwicklung des Produkts in Deutschland [3]. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte fest, dass Waren maßgeblich in Deutschland hergestellt sein bzw. ihre wertbestimmenden Eigenschaften aus deutscher Produktion stammen müssten, um das Kennzeichen „Made in Germany“ tragen zu dürfen. Bei Industrieprodukten müssten alle wesentlichen Herstellungsschritte in Deutschland durchgeführt worden sein. Dabei sei es nebensächlich, ob Rohstoffe oder Halbfabrikate aus Deutschland stammten, weil der Wert eines industriellen Erzeugnisses vor allem in der Verarbeitung liege [4]. Bezogen auf die juristische „Bewertung“ spielen somit wertschöpfungs- und wertentstehungsseitige und keine qualitätsorientierten Aspekte eine vorrangige Rolle, was bezogen auf den Herkunftsanspruch durchaus als berechtigt angesehen werden kann.
3 „Made in Germany“ als Bestandteil des Qualitätsmanagements
Schon seit der Einführung des Begriffs wurde mit der Kennzeichnung „Made in Germany“ neben der Herkunftsangabe jedoch auch ein Qualitätsversprechen verbunden. Dieser Gedanke spiegelt sich im o. a. Markengesetz wider:
§ 127, Abs. 2 u. 3 Markengesetz: „(2) Haben die durch eine geografische Herkunftsangabe gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besondere Eigenschaften oder eine besondere Qualität, so darf die geografische Herkunftsangabe im geschäftlichen Verkehr für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen dieser Herkunft nur benutzt werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen diese Eigenschaften oder diese Qualität aufweisen. (3) Genießt eine geografische Herkunftsangabe einen besonderen Ruf, so darf sie im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft auch dann nicht benutzt werden, wenn eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft nicht besteht, sofern die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft geeignet ist, den Ruf der geografischen Herkunftsangabe oder ihre Unterscheidungskraft ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.“
Auch wenn sich die deutsche Gerichtsbarkeit bei ihren Entscheidungen zum Kennzeichen „Made in Germany“ bisher auf den Herkunftsaspekt beschränkte, kann für eine einwandfreie Kennzeichnung „Made in Germany“ aber auch die Frage relevant sein, welche Qualitätsmerkmale das Produkt erfüllen muss. „Besondere Eigenschaften“, „besondere Qualitäten“ und ein „besonderer Ruf“ können zwar nicht für die Gesamtheit aller Produkte eines Landes genau spezifiziert werden, wohl aber für bestimmte Produkte bzw. Produktgruppen (z. B. für „Dresdner Stollen“ oder „bayerisches Bier“) [5]. Weil die Kennzeichnung „Made in Germany“ als eine Art „Qualitätssiegel“ gilt, mit dem nach allgemeiner Verkehrsanschauung der beteiligten Verkehrskreise überdurchschnittlich hohe Qualitätsmerkmale assoziiert werden, können für die Verwendung des „Qualitätssiegels“ für bestimmte Produkte oder Produktgruppen durchaus „besondere Eigenschaften“ und Qualitätsmerkmale spezifiziert werden. Wie solche genauen Spezifizierungen aussehen können, soll an zwei Beispielen erläutert werden:
Verschiedene private Unternehmen operationalisieren den Begriff „Made in Germany“, indem sie relevante Qualitätsmerkmale verschiedener Produkte bzw. Produktgruppen festlegen. Die TÜV Nord Cert GmbH z. B verlangt für eine Zertifizierung, dass die entsprechenden Produkte, Produktgruppen oder Dienstleistungen mindestens zur Hälfte im Herkunftsland erstellt wurden, gemessen am Wertschöpfungsanteil des gesamten Herstellungsprozesses. Weiterhin muss der Produzent Nachweise zur Erfüllung grundlegender Sicherheitsanforderungen erbringen, z. B. nach den Vorschriften des GPSG (Geräte- und Produktionssicherheitsgesetz). Darüber hinaus muss das produzierende Unternehmen nachweisen, dass es zur Stärkung des nationalen Standortes beiträgt, z. B. durch eine entsprechende Investitions- oder Ausbildungsintensität (abhängig von der Größe sowie weiteren Kennzahlen des Unternehmens). [6] Durch eine solche Erfüllung messbarer Qualitätsmerkmale sowie durch eine Bestätigung der Einhaltung dieser Merkmale durch eine neutrale Stelle wird das Kennzeichen „Made in Germany“ tatsächlich zu einem Qualitätsbegriff. Aber anders als etwa bei den gesetzlich regelmäßig vorgeschriebenen Fahrzeuguntersuchungen durch DEKRA oder TÜV, erfüllen die zertifizierenden Unternehmen keine hoheitlichen Aufgaben. Die „Made-in-Germany“-Zertifikate von TÜV NORD Cert GmbH (und von weiteren Unternehmen) bescheinigen lediglich, dass die entsprechenden Güter den Qualitätsforderungen des zertifizierenden Unternehmens entsprechen.
Im Rahmen der Wandlung der deutschen Volkswirtschaft hin zu einer Dienstleistungs- und Kommunikationswirtschaft (und durch das Markengesetz ausdrücklich erlaubt) ist eine Erweiterung des Begriffs „Made in Germany“ auf immaterielle Güter bzw. Dienstleistungen erkennbar: So entschlossen sich z. B. führende deutsche Kommunikationsunternehmen als Antwort auf das massenhafte Mitlesen von E-mails durch amerikanische Nachrichtendienste im April 2014 zu einer gemeinsamen Verbesserung der E-Mail-Sicherheit, z. B. durch die Anwendung einer speziellen Verschlüsselungssoftware, durch die Kennzeichnung sicherer E-Mail-Adressen und durch die ausnahmslose Speicherung von E-mails auf Rechenzentren in Deutschland. Der Name dieser Initiative „E-mail made in Germany“ dient dabei nicht nur als Werbebotschaft, sondern er kennzeichnet darüber hinaus die Garantie für eine erhöhte Datensicherheit durch die angesprochenen konkreten Maßnahmen der Kommunikationsunternehmen und wird somit zu einem zentralen Begriff ihres Qualitätsmanagements. [7].
Welche Bedeutung die Kennzeichnung „Made in Germany“ als „Qualitätssiegel“ genießt, soll mit den folgenden Angaben dargestellt werden:
Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) verwies im Jahre 2013 auf eine eigene repräsentative Umfrage, nach der 70 % der Deutschen darauf vertrauten, dass das Label „Made in Germany“ für hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards stehe. [8]. Nach einer Umfrage der Pricewaterhouse Coopers AG (Frankfurt) verbinden 80 % der Konsumenten in Deutschland mit dem Begriff „Made in Germany“ höchste Qualität, 57 % eine lange Lebensdauer, 55 % höchste Sicherheit und ebenfalls 55 % hohe Funktionalität der entsprechenden Produkte [9].
Ähnliche Ergebnisse aus dem Ausland erbrachte auch eine Erhebung des bundeseigenen Dienstleistungsinstituts Germany Trade & Invest (GTAI), der früheren Bundesagentur für Außenhandelsinformationen: In allen großen Außenhandelspartner-Ländern galten Produkte „Made in Germany“ als qualitativ hochwertig. Dieses Argument sorgt auch nach wie vor zur Durchsetzung höherer Preise im Weltmarkt [10].
Die DGQ spricht von einem Mehrerlös von mehr als 100 Milliarden Euro jährlich, weil die Käufer weltweit sich für höherpreisige Produkte „Made in Germany“ entschlössen und nicht für preiswertere ausländische Konkurrenzprodukte [11]. Eine Kapitalisierung dieses jährlichen Betrags lässt auch den absoluten Wert des „Gütesiegels“ „Made in Germany“ nachvollziehbar erscheinen, der im Jahre 2006 von dem Marktforschungsinstitut Global Market Insite Inc. (Seattle) mithilfe einer repräsentativen internationalen Umfrage auf 3.836 MRD EURO geschätzt wurde [12].
4 Zukünftige Entwicklungstendenzen in der EU
Die EU-Kommission kündigte am 13. 2. 2013 eine Rechtsveränderung an, nach der in Zukunft alle Produkte eine Angabe des Ursprungslandes tragen müssen. Für die Angabe des Ursprungslands soll – abweichend von der bisherigen zollrechtlichen Regelung – der größte wertsteigernde Teil des Herstellungsprozesses entscheidend sein. Auch die Angabe „EU“ als Ursprungsland soll weiterhin möglich sein [13] (Die Bezeichnung „Made in EU“ wird aber von einigen Staaten nicht anerkannt.).
Mit dieser Reform würden Zoll- und Wettbewerbsrecht erheblich modifiziert. Der Grund für diese EU-Initiative ist die Hoffnung auf eine bessere Identifizierung und Rückverfolgbarkeit unsicherer Produkte ( Produktsicherheit). Sollte der Vorschlag der EU-Kommission rechtsgültig werden, wird die bisher freiwillige Kennzeichnung von Produkten mit „Made in Germany“ verbindlich.
5 Ausblick
Ob der Reformvorschlag der EU tatsächlich wie geplant umgesetzt wird, ist fraglich: Im April 2014 votierte das EU-Parlament zwar für die Reform; die Regierungen von 16 Mitgliedsstaaten (darunter auch Deutschland) sperren sich jedoch gegen den Gesetzesvorschlag (Stand Juli 2014). Aus Sorge um das „Qualitätssiegel“ Made in Germany wird die EU-Initiative auch von namhaften Stimmen aus der deutschen Wirtschaft, z. B. dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert. Ob durch diese Veränderung (nicht: Abschaffung) der Vorschriften bezüglich der Verwendung des Kennzeichens „Made in Germany“ eine Gefahr für das „Qualitätssiegel“ der deutschen Volkswirtschaft tatsächlich besteht, das ist heute noch nicht abzusehen. Letztlich wird diese Frage nach dem Fortbestehen des Kennzeichens „Made in Germany“ durch Qualitätsmanagement-Grundsatzentscheidung der in Deutschland produzierenden Unternehmen geklärt werden.
Unabhängig von den zu erwartenden Änderungen im EU-Recht sind es die folgenden fünf Entwicklungen und Trends, die den Standortfaktor „Qualität in Deutschland” gefährden könnten:
„Robustheit und Lebensdauer als Attribute von Qualität verlieren durch immer kürzere Produktlebenszyklen an Bedeutung.
Die Komplexität von Produkten nimmt zu. Nur noch wenige Experten können ihre Qualität erkennen und bewerten.
Das Image von Qualität ersetzt oft die de facto Qualität.
Wir werden auf niedrige Einkaufspreise dressiert, d. h., Total Cost of Ownership-Betrachtungen fehlen.
Die anderen Länder holen in ihrer Qualitätsfähigkeit auf.” [
14
]
Langfristig spricht die zunehmende Globalisierung trotzdem für einen Bedeutungsverlust der „Made in…“-Kennzeichen. Schon heute wird insbesondere von globalen Konzernen der Begriff „Made in Germany“ nur noch sparsam verwendet. Viele hoch technisierte Produkte weisen Bestandteile auf, die in unterschiedlichsten Ländern entwickelt und produziert wurden. Der „gute Ruf“ des Kennzeichens „Made in Germany“ wird dabei durch den „guten Ruf“ des Herstellers oder der Marke ersetzt. [15]
Daraus ist aber nicht abzuleiten, dass das Kennzeichen „Made in Germany“ schon kurz- oder mittelfristig rasant an Bedeutung verlieren wird: Unternehmen wie Trigema [16] und Liqui Moli [17] verweisen auch und gerade in ihrer Werbung auf ihre Produktion in Deutschland. Dass es sich dabei um mittelständische Unternehmen handelt, kann in der – nach wie vor sehr mittelständisch dominierten – Produktionslandschaft in Deutschland nicht als Zeichen geringerer Bedeutung gewertet werden. Und auch von Dienstleistungsunternehmen (selbst von Großunternehmen wie der Deutsche Telekom AG) wird der Begriff „Made in Germany“ publikumswirksam verwendet. Die in Deutschland produzierenden Unternehmen werden bei der Verwendung des Kennzeichens aber wegen der zunehmenden Komplexität der Produkte und wegen der hohen Produktionskosten in Deutschland verstärkt auch die Dienstleistungsqualität (Kundenorientierung, Angebot intelligenter ganzheitlicher Lösungsansätze, technischer und kaufmännischer Service, Termintreue etc.) berücksichtigen und sich zunehmend auch auf Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Sozialkompetenz (z. B. faire Arbeitsbedingungen) sowie Wissensproduktion und -vermittlung beziehen müssen.
Bestätigt werden die genannten Zukunftstendenzen auch durch die Initiative der DGQ, die nach vorne schaut und gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft ein Qualitätsleitbild für Deutschland erarbeitet, das 2014 auf seine Veröffentlichung wartet. [18] Darin muss die Möglichkeit gesehen werden, das Qualitätsbewusstsein und damit letztlich auch die Qualitätsfähigkeit in Deutschland zu stärken- auch unabhängig von dem altehrwürdigen Kennzeichen „Made in Germany“.
Literatur
[1] vgl. Bundesgerichtshof, Urteil v. 23.3.1973, I ZR 33/72
[2] vgl. Oberlandesgericht Stuttgart v. 10.11.1995, 2 U 124/95
[3] vgl. Landgericht Frankfurt v. 7.11.2008, 3-12 O 55/08
[4] vgl. Oberlandesgericht Düsseldorf v. 5.5.2011, I-20 U 110/10
[5] vgl. Eisenmann, Hartmut/ Jautz, Ulrich: Grundriss. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Heidelberg, 6. Aufl. 2006, S. 137
[6] vgl. TÜV Nord Cert GmbH: TÜV NOORD – zertifizierter Herkunftsnachweis „Made in…“. Kriterienkatalog, 2010, http://www.tuev-nord.de/cps/rde/xbcr/SID-0D25FB2E-CEF2B2C1/tng_de/Zertifizierter_Herkunftsnachweis_Kriterienkatalog.pdf
[7] vgl. Deutsche Telekom: E-MAIL MADE IN GERMANY, 2014, http://e-mail-made-in-germa-ny.telekom.de/germany.telekom.de/?mlid=2039.14.1018296.810e00236af8e75bc064831e89a6b8ee...0.1405433054.1.1408025054#xtor=SEC-1078-GOO-[]-[]-S-[e-mail%20made%20in%20germany]
[8] vgl. Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V, Frankfurt (Main), 4.11.2013, http://www.dgq.de/aktuelles/news/made-germany-ist-mehr-als-nur-eine-herkunftsbezeichnung/
[9] zitiert nach „Made in Germany“-Verordnung verunsichert Unternehmen und Verbraucher, ohne Verfasser in: Layer, Frank (Hrsg.): MittelstandsCafe, Online-Zeitung der LayerMedia Inc, Boston (USA), Niederlassung Deutschland: Filderstatt, 18.5.2014, http://www.mittelstandcafe.de/made-in-germany-verordnung-verunsichert-unternehmen-und-verbraucher-1044077.html/
[10] zitiert nach Wenkel, Rolf: Gütesiegel: Ausruhen gilt nicht, Deutsche Welle (dw), Bonn, 18.1.2014, http://www.dw.de/gütesiegel-ausruhen-gilt-nicht/a-17369364
[11] vgl. Koch, Martin: Gütesiegel auf dem Prüfstand, Deutsche Welle (dw), Bonn, 15.8.2013, http://www.dw.de/gütesiegel-auf-dem-prüfstand/a-17016788
[12] zitiert nach Deutsche Gesellschaft für Qualität e.v., Frankfurt (Main), 4.11.2013, a.a.O.
[13] vgl. European Commission: Sichere Produkte und gleiche Ausgangsbedingungen im Binnenmarkt, Pressemitteilung IP/13/111, Brüssel, 13/02/2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-111_de.htm
[14] Sommerhoff, Benedikt: Ein Qualitätsleitbild für Deutschland. In: Pfeifer, T. u. R. Schmitt (Hrsg.): Masing Handbuch Qualitätsmanagement. 6. Auflage. München (Hanser) 2014, S. 43
[15] vgl. Wenkel, Rolf: Sturm im Wasserglas, Deutsche Welle (dw), Bonn, 16.4.2014, http://www.dw.de/kommentar-sturm-im-wasserglas/a-17572408
[16] vgl. TRIGEMA Inh. W. Gruppe. K.: Das Unternehmen TRIGEMA. TRIGEMA – 100% Made in Germany. Burladingen, o. J. http://www.trigema.de/Unternehmen/UEber-uns/
[17] vgl. Liqui Moly GmbH: Presseinformation: Liqui Moly in Zahlen. Ulm 2013
[18] Varwig, Jürgen (Präsident der DGQ), Kaerkes, Wolfgang (geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DGQ: Ein Impuls für Qualität in Deutschland, Frankfurt (Main), Juni 2012, http://www.qualitaetsleitbild.de/grussworte/impuls-fuer-qualitaet-in-deutschland/
Anmerkung:
Der vorliegende Text folgt dem Stichwort „Made in Germany“ (Autor: Lothar Groß) auf S. 647 ff, in: Zollondz, H.-D., Ketting, M, Pfundtner, R (Hrsg.): „Lexikon Qualitätsmanagement. Handbuch des modernen Managements auf Basis des Qualitätsmanagements“, Verlag: de Gruyter/ Oldenbourg (Berlin/ Boston), 2. Aufl. 2016.
2. Definitionen
a) Aktien und andere Wertpapiere
Die Aktie ist eine Urkunde, die ein Miteigentum verbrieft an einer Aktiengesellschaft oder an einer vergleichbaren ausländischen Unternehmens-Rechtsform (z. B. der „Corporation“ in den USA oder der „plc“ in Großbritannien). Die europäische Weiterentwicklung der AG ist die SE (Europäische Aktiengesellschaft). Eine Sonderform im deutschen Recht ist die KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien), in der es einen oder mehrere voll haftende Teilhaber (Komplementäre, gleichzeitig „geborene“ Geschäftsführer der Gesellschaft) und Teilhafter (Kommanditisten) gibt. Das Kommanditkapital wird bei einer KGaA in Aktien aufgeteilt (vgl. Aktie der Henkel KGaA hier im Anhang).
Ein Bogen der Condomi AG mit 19 von 20 Dividendenscheinen. Der erste Coupon (Dividendenschein) wurde verbraucht, der Talon befindet sich unten.
Der Vorläufer der Aktie wurde im österreichischen Erzbergbau erfunden. 1415 entstand in Leoben die erste Kapitalgesellschaft („Gewerkschaft“ bzw. „Genossenschaft“), die durch Eigenkapitalanteile, sogenannte „Kuxe“, finanziert wurde. Bald folgten ähnliche Gesellschaften im ganzen deutschen Sprachraum. Die Kuxe wurden von Kaufleuten, aber auch von kirchlichen Einrichtungen (insbesondere Klöstern) und von Adeligen gekauft und schwankten in ihrem Wert.
Eine Aktie besteht aus einem „Mantel“, der eigentlichen Urkunde, und aus dem „Bogen“, welche die „Dividendenscheine“ (als Nachweis für die Berechtigung zur Auszahlung der „Dividende“, des auszuschüttenden Gewinns pro Aktie) und einen „Talon“ (Erneuerungsschein für einen neuen Bogen, wenn alle Dividendenscheine verbraucht sind) enthält.
Die meisten Aktionäre von heute haben noch nie eine Aktie gesehen. Die Wertpapiere („Effekten“) werden von den Kreditinstituten verwahrt und verwaltet, normalerweise in Form der Sammelverwahrung durch das dafür spezialisierte Institut in Frankfurt, das der Frankfurter Börse, der größten Börse in Deutschland, angeschlossen ist. Es werden häufig nur noch Sammelurkunden gedruckt, die mehrere Aktien in einer Urkunde verbriefen. Häufig wird nur eine einzige „Globalaktie“ pro AG gedruckt. Beispiele für Sammelaktien in dieser Zusammenstellung sind die Aktien der BASF AG (S.208), der Dresdner Bank AG (S. 265) und der Volkswagenwerk AG (S.213) sowie der Taciak AG (unten). Bei Schuldverschreibungen bzw. Anleihen besteht überhaupt keine Pflicht zur Herstellung eines Dokuments mehr; diese „Wertpapiere“ bestehen in der Regel nur noch als sogenannte „Wertrechte“ in den relevanten Buchführungen (analog zum „Buchgeld“ auf den Konten der Kreditinstitute). In den Wertpapier-Depots, die die Banken für Ihre Kunden führen, werden also in den allermeisten Fällen keine „effektiven“ Stücke, sondern nur noch Datensätze verwaltet.
Deutsche Aktien sind traditionell Inhaberaktien, die durch einfache Einigung und Übergabe übertragen werden können. Die Namensaktien hingegen müssen darüber hinaus indossiert werden, und ihre Inhaber werden im Aktienbuch der AG eingetragen. Da diese Form international (auch in den USA) üblich ist, steigt die Anzahl der Namensaktien in Deutschland. Eine besondere Form stellt die vinkulierte Namensaktie dar, deren Übertragung zusätzlich von der Zustimmung der AG abhängig ist. Eine Namensaktie ist zum Beispiel die der unten abgebildeten Odenkirchener Aktienbaugesellschaft, eine vinkulierte Namensaktie die im Hauptwerk abgedruckte STADA-Aktie (S.211) oder der DBV Holding AG (S. 274). Im Gegensatz zur Inhaberaktie ist die AG bei einer Namensaktie genau über die Zusammensetzung ihrer Aktionäre informiert.
Die Aktien der 1898 gegründeten Odenkirchener Aktienbaugesellschaft Rheydt-Odenkirchen waren Namensaktien. Ca. hundert Jahre später wurde die Gesellschaft in den WCM-Konzern eingegliedert. Die ehemalige IG-Farben-Tochter WCM erwarb – ebenfalls in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts – einen Großteil der Anteile der im Liquidationsverfahren stehenden IG Farben.. Aufgrund finanzieller Probleme der nunmehrigen Muttergesellschaft WCM meldete die IG Farben liqu. 2003 Insolvenz an. 2012 wurden die IG Farben aufgelöst.
Jede AG hat Stammaktien, die alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte verbriefen. Außerdem können Vorzugsaktien ausgegeben („emittiert“) werden, die neben irgendeinem Vorzug (häufig im Zusammenhang mit den Dividenden) auch einen Nachteil aufweisen – im Allgemeinen den Nachteil der Stimmrechtslosigkeit in der mindestens einmal jährlich stattfindenden Aktionärsversammlung, der Hauptversammlung. In diesem Buch sind z. B. die abgedruckten Effekten der RWE (S.198), der Allgemeinen Baugesellschaft Lenz & Co (S. 36) und der Sächsischen Leinenindustrie Gesellschaft (S.53) Vorzugsaktien.
Unter „jungen Aktien“ versteht man Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung neu ausgegeben werden und damit den bisherigen Aktienbestand einer AG erweitern. Manchmal geschieht eine Kapitalerhöhung auch über den Weg einer Options- oder einer Wandelanleihe (vgl. unten).
Bis 1998 waren in Deutschland nur Nennwertaktien erlaubt, wobei der aufgedruckte Nennwert nur den Anteil am gesamten Aktienkapital bezeichnete, nicht aber den tatsächlichen Börsenwert (den Kurswert). Der Mindest-Nennwert deutscher Aktien wurde in den 90er Jahren sukzessive von 50,00 DM auf 5,00 DM herab gesetzt. Heute sind Nennwertaktien von 1 EURO oder einem Mehrfachen davon erlaubt. Mit der Umstellung auf den EURO ging aber bei den meisten AG die Umstellung ihrer Aktien auf Stückaktien einher. Der Aufdruck auf den Wertpapieren lautet jetzt nur noch „1 Aktie“ (oder ein Mehrfaches davon, vgl. die abgebildeten Aktien von Condomi, Sunlive und Mannesmann).
Die Entwicklungen hin zur Verwahrung und Verwaltung in Depots der Kreditinstitute, zum Computer-Börsenhandel, zur Stückaktie sowie die Umstellung der Währung von der DM auf den EURO haben auch zu einer Tendenz hin zur Sammel- oder Globalaktie geführt. In Deutschland sind daher Aktien-Urkunden seit der Jahrtausendwende sehr selten geworden.
Schon daher ist die abgebildete Aktie der Taciak AG aus Nordkirchen eine Seltenheit: Es handelt sich um eine Nennwertaktie mit EURO-Währung (Nennwert 1 EURO) aus dem Jahr 2000. Das Familienunternehmen Taciak AG, das elektrotechnischer Spezialapparaturen herstellt, wurde 1980 als GmbH gegründet und 1990 in eine AG umgewandelt. Im Jahre 2004 wurden auch die Taciak-Aktien auf Stückaktien umgestellt.
Weitere Effekten (an Börsen gehandelte Kapital-Wertpapiere) sind z. B:
1. aktienähnliche Teilhaberpapiere, z. B. Kuxe von bergrechtlichen Gewerkschaften, (vgl. Gewerkschaft Burbach, S.79);
2. Urkunden über Kredite an die Aktiengesellschaft (Gläubigerpapiere) in Form von
a. Schuldverschreibungen, (im Buch z. B. von der Braunkohlen-Benzin AG, S. 104), Anleihen mit in der Regel festem Zinssatz,
b. Optionsscheine, (im Buch z. B. von den Vereinigte Stahlwerken, S. 76, oder der Kaufhof AG, S.238), die weitere – sehr unterschiedliche Rechte verbriefen, z. B. Rechte auf junge Aktien der AG,
c. Wandel- und Optionsanleihen, die anfänglich Schuldverschreibungen sind, später aber in Aktien umgewandelt werden können (Wandelanleihen) oder zusätzlich mit eigenständigen Rechten zum Kauf junger Aktien verbunden sind (Optionsanleihen),
d. Genussscheine,
(im Buch z. B. von der Deutsch-Atlantischen Telegraphengesellschaft, S.31, der Audi NSU Auto Union AG, S.136 oder der Bertelsmann AG, S.258),
die in der Regel keinen festen Zinssatz, sondern einen Anteil am Unternehmensgewinn verbriefen,
3. Investmentanteilscheinen,
(im Buch z. B. von der IOS, S. 160, oder von Berenberg, hier im Anhang), die einen Anteil an einem „Investmentfonds“ (Sondervermögen einer Investmentgesellschaft) verbriefen. Dieses Sondervermögen besteht aus dem eingezahlten Geld der Anleger, für das die Manager der Investmentfonds dann Aktien, Schuldverschreibungen, aber auch Immobilien und andere Arten von Vermögen kaufen.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Laut Wertpapierhandelsgesetz sind die „Derivate“ (Optionen, Swaps und Futures) den oben angegebenen Effekten gleich gesetzt; diese sind im engeren Sinne aber gar keine Wertpapiere, sondern Verträge, in der Regel Termingeschäfte.
b) Non-Valeurs
„Non-Valeurs“ sind Wertpapiere, die nicht mehr gültig sind. Gründe dafür gibt es genug: Die Aktiengesellschaft existiert nicht mehr, die Währung wird geändert, die Aktienart wird geändert etc. Non-Valeurs sind reine Sammelgegenstände.
Jede Effektenart hat auch ihre Unterart. Links abgebildet ist eine besondere Form der Anleihe, ein Pfandbrief von 1940, der üblicherweise von speziellen Hypothekenbanken (hier: von der Deutschen Centralbodenkredit- AG in Berlin) herausgegeben wird und der – als Besonderheit – durch Grundpfandrechte gesichert ist.
c) Börsen und Börsenkurse
Die ersten Börsen der Welt entstanden im 15. Jahrhundert im heutigen Belgien. Der Name „Börse“ geht wahrscheinlich auf die flämische Patrizierfamilie „van der Beurs“ zurück.
Die genannten Wertpapiere können an Börsen gehandelt werden, ohne dort tatsächlich vorhanden zu sein. Die Deutsche Börse AG in Frankfurt (gegründet 1990; die Vorgängerbetriebe gehen bis auf das Jahr 1585 zurück) ist das größte deutsche Unternehmen dieser Branche. Sie betreibt unter anderem die – immer noch öffentlichrechtlich organisierte - Frankfurter Wertpapierbörse. Neben dem Betrieb von Kassa- und Terminbörsen ist die Deutsche Börse AG durch ihre Tochtergesellschaft Clearstream auch an dem Geschäft mit der der Abwicklung von Börsengeschäften sowie an der Verwaltung und Verwahrung von Wertpapieren beteiligt.
Seit einigen Jahren haben sich die Börsen gewandelt: weg von den traditionellen Präsenzbörsen, in denen Börsenhändler und –makler die Kurse durch das Parkett riefen, hin zu Computerbörsen, z. B. der „Xetra“ in Frankfurt. An den Börsen entwickeln sich die Preise (früher: Kurse) allein durch Angebot und Nachfrage. Ein „Kursbarometer“ bilden dabei die Kursindizes. Die bekanntesten sind der Dow-Jones-Index in New York, der EURO STOXX 50, der die 50 wichtigsten Aktien des EURO-Gebiets umfasst, und der DAX in Frankfurt.
Der DAX-30 beinhaltet die 30 wichtigsten deutschen Aktien, gemessen an dem Börsenumsatz und der Marktkapitalisierung der Aktien. Der „darunter“ angesiedelte MDAX ist ein Aktienindex mit den 50 (ab September 2018: 60) deutschen Aktiengesellschaften, die ihrer Kapitalmarktgröße nach hinter den DAX-30-Unternehmen liegen. Der S-DAX schließlich beinhaltet die dann anschließenden 50 (ab September 2018: 70) Aktiengesellschaften an der Frankfurter Börse. Der sogenannte HDAX beinhaltet DAX-30 und MDAX; der C-DAX besteht aus allen Aktienwerten, die in Frankfurt gehandelt werden. Daneben bestehen noch spezielle Indizes, z. B. der TecDAX mit den 30 größten deutschen Technologiewerten (die ab September 2018 auch im DAX-30 und im MDAX gelistet sind) oder der ÖkoDAX für Unternehmen aus der Branche der erneuerbaren Energien. Werte in diesen Spezial-DAXen werden ab September 2018 auch in den „allgemeinen“ DAX-Indizes gelistet.
Die Anlage in Aktien ist eine Anlage in Sachwerten, anders als z. B. eine Anlage in Schuldverschreibungen. Langfristig haben sich Aktienanlagen im Durchschnitt rentabler entwickelt als Anlagen in Schuldverschreibungen, aber Aktienanlagen sind und bleiben spekulativ.
Die Aktienkurse haben sich in der Vergangenheit immer als Frühindikator von Konjunkturentwicklungen dargestellt. Einen Wirtschafts-Abschwung nehmen die Börsenkurse in der Regel ebenso vorweg wie einen Aufschwung.
Neben Kursverlusten einzelner Aktien kommt es immer wieder auch zu dramatischen Kurseinbrüchen auf der ganzen Linie, wenn eine „Börsenblase“ platzt. Die Geschichte der „Spekulationsblasen“ geht weit in die Vergangenheit zurück. Die erste urkundlich belegte Spekulationsblase war der „Tulpenwahn“ im 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Die bekanntesten Börsencrashs von Wertpapierbörsen aus neuerer Zeit sind ursächlich verbunden mit dem „Schwarzen Freitag“ zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929, der „Telekommunikationsblase“ zu Beginn des 21. Jahrhunderts und der „Subprime-Finanzkrise“ 2008. Bei diesen Kursstürzen handelte es sich immer um Konsequenzen aus fehlerhaften wirtschaftlichen Handlungen: 1929 hatten vor allem amerikanische Aktienspekulanten viel zu sehr mit Fremdkapital spekuliert, das sie nach den Kursverlusten nicht zurückzahlen konnten, während der Telekommunikationsblase hatten die Aktien der entsprechenden Unternehmen einen viel zu hohen Preis, der – wie durch realistische Unternehmensanalysen bestätigt wurde - durch nichts berechtigt war, 2008 rächte sich die viel zu leichtsinnige Vergabe von Hypothekenkrediten amerikanischer Banken - auch an Kunden mit zweifelhafter Bonität.
3. Anmerkungen und Aktualisierungen seit dem Erscheinen des Hauptwerks
3.0. Zum Vorwort
In diesem Werk ist vergleichsweise viel von Großunternehmen, weniger vom Mittelstand und von Kleinunternehmen sowie von Handwerksbetrieben und Freiberuflern zu lesen, obwohl die letztgenannten Betriebe eine unabdingbare Stütze der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. Dies liegt keineswegs an einer Geringschätzung dieser Unternehmen, sondern an dem Ansatz dieses Werks, das eine deutsche Wirtschaftsgeschichte vor allem anhand von Effekten darstellen will. Solche Wertpapiere sind aber eine Domäne von Großunternehmen.
3.1. Vorgeschichte: Die deutsche Wirtschaft bis zur Zeit Napoleons
S. 8 f: Wirtschaftsgeschichte Mitteleuropas bis zur frühen Neuzeit
Die Geschichte der Menschheit ist auch immer eine Geschichte ihrer Wirtschaft. In grauer Vorzeit versorgten sich die Mitglieder einer Familie oder eines Clans nahezu ausschließlich selbst. Diese Autarkie wird von der Wirtschaftswissenschaft als „geschlossene Hauswirtschaft“ bezeichnet. Daneben existierte aber schon der Anfang der „Tauschwirtschaft“ zwischen benachbarten Familien.
Erste Hochkulturen waren ohne diese Tauschwirtschaft nicht vorstellbar. Die beginnende Metallverarbeitung in der Bronzezeit (in Mitteleuropa von ca. 2000 – 450 v. Chr.) verstärkte zudem die Arbeitsteilung, und spätestens seit dieser Bronzezeit ist auch schon der Fernhandel mit damaligen Luxusgütern in Mitteleuropa nachweisbar: In dieser Zeit entstand z. B. die „Bernsteinstraße“, welche die „Bernsteinküste“ an der Ostsee mit der mykenischen Hochkultur, wahrscheinlich sogar mit dem pharaonischen Ägypten verband. In der folgenden Eisenzeit (bis zur Zeitenwende) wurde der Fernhandel noch ausgebaut. Verschiedene Quellen aus dem römischen Reich bestätigen einen umfangreichen Handel mit germanischen Bewohnern der Grenzlande. Wirtschaft und Handel florierten auch im Mittelalter: So entwickelte sich die Wikingersiedlung Haithabu an der Schlei seit dem 8. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren Nordeuropas. Die kulturellen Höhepunkte des Mittelalters (zum Beispiel die Zeit Karls des Großen um 800 und die Zeit der Stauffer 400 Jahre später) korrespondierten mit Höhepunkten in Produktion und Handel.
Trotzdem bildet eigentlich der Beginn der Neuzeit den Ausgangspunkt zur Entwicklung der heutigen Wirtschaft. Ausgehend von Norditalien, entwickelte sich eine Wirtschaftsordnung, die schon damals alle relevanten Züge des bis heute dominierenden Kapitalismus bzw. der modernen Marktwirtschaft aufwies. International bedeutende frühe Vertreter dieser Wirtschaftsordnung in Deutschland waren im Norden der Handelsverbund der Hanse (12. – 17. Jahrhundert), im Süden Deutschlands die Große Ravensburger Handelsgesellschaft (ca. 1380 – 1530) und die Handelshäuser Fugger und Welser (sowie weitere Handelsfamilien, welche vor allem im 16. und 17. Jahrhundert von großer Bedeutung waren). Einige dieser Handelshäuser waren nicht nur Händler, sondern – um einen Ausdruck aus der heutigen Zeit zu verwenden – Mischkonzerne. Fugger beispielsweise war auch (Staats-) Bankier. Seine Erzgruben, vor allem in Tirol, Schlesien, Ungarn und Böhmen machten ihn außerdem zum mächtigsten Metallkaufmann seiner Zeit.
Entwicklungen vollziehen sich selten kontinuierlich: Der einflussreiche Kirchenlehrer Thomas von Aquin, der einerseits Philosophie, Theologie und Staatswissenschaft reformierte, bekräftigte andererseits das alte Zinsverbot der katholischen Kirche. Wegen der damals überragenden Bedeutung der klerikalen Vorschriften war er zwar auch hier richtungsweisend, aber nicht im Sinne des wirtschaftlichen Fortschritts. Zumindest im Geschäftsleben war eine Verzinsung von geliehenem Geld auch zu seiner Zeit schon unumgänglich, wenn man größere Geschäfte abschließen wollte. Das kirchliche Zinsverbot war sowohl eine Ursache für den Bedeutungszuwachs jüdischer Bankhäuser im Wirtschaftsleben als auch für die sich ausbildenden Handelsgesellschaften. (Überdies wurde das kirchliche Zinsverbot auch von christlichen Unternehmern häufig genug umgangen oder sogar ignoriert.)
Sowohl die Hanse als auch Kaufmannsunternehmen wie Fugger waren zu ihrer Zeit sehr modern: Während ansonsten im Mittelalter die Einzelunternehmen (das Unternehmen gehörte einer einzigen Person) für Wirtschaftsunternehmen typisch waren, gestaltete sich die Hanse zumindest in ihrer Frühzeit als „Personenhandelsgesellschaft“, weil sich in der Regel mehrere Kaufleute für einen begrenzten Zeitraum zusammen fanden, um eine Handelsfahrt zu unternehmen (seltener auch mit einem gemeinsamen Handelsgeschäft). Später wandelte sich die „Kaufmannshanse“ in die „Städtehanse“, wurde also mehr zu einer Gemeinschaft selbstständiger Städte. (Die Hanse war nicht der erste Städtebund Deutschlands; im 13. Jahrhundert existierte schon der „Mittelrheinische Städtebund (Mainz, Worms, Bingen, Frankfurt am Main, Gelnhausen, Friedberg), ein Jahrhundert später fanden sich eine Vielzahl süddeutscher Städte unter der Führung von Ulm zum „Schwäbischen Städtebund“ zusammen.
Jakob Fugger der Ältere (ca. 1399 – 1469) schuf das erste deutsche Unternehmen mit Weltgeltung. Er war nicht nur Kaufmann in verschiedensten Waren, sondern auch Bergwerksbesitzer und Großbankier. Bekannt ist sein Kredit an den späteren Kaiser Karl V, mit dem dieser seinen erfolgreichen Kaiser-Wahlkampf betreiben konnte. Fugger schuf damit einen „multinationalen“ Familienkonzern fast schon moderner Prägung, den er auch vererben konnte. Aber schon Ende des 15. Jahrhunderts ging das Unternehmen bankrott, weil der größte Schuldner, Erzherzog Maximilian I, seinen Kredit nicht zurückzahlen konnte. Da das Haus Fugger zur damaligen Zeit sicherlich „systemrelevant“ war, folgten mehrere Konkurse weiterer deutscher Handels- und Finanzhäuser, auch in anderen Städten. Nicht zuletzt war es dieser Zusammenbruch des Finanzsystems, das den Abstieg der Städte und den Aufstieg der Fürsten zu Beginn der Neuzeit in Deutschland besiegelte (neben anderen historischen Umwälzungen, vor allem dem Dreißigjährigen Krieg).
S. 8: frühe Börsen und Aktiengesellschaften
Die Börsen in Brügge (1409) und Antwerpen (1460) entstanden weit vor den ersten deutschen Börsen in Augsburg und Nürnberg (beide 1540).
S. 9: Rammelsberg – UNESCO-Weltkulturerbe
Die Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen lassen vermuten, dass am Rammelsberg im Harz wahrscheinlich schon im 3. Jahrhundert Erze gefördert wurden; urkundlich erwähnt wurde das Bergwerk erstmals im Jahre 936. Zwei Jahre nach seiner Schließung 1988 wurde Rammelsberg zum Bergbaumuseum und 2010 erhielt es als erstes Industriedenkmal Deutschlands den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes.
1994 wurde auch die Völklinger Hütte zum UNESCO-Weltkulturerbe. Diesen internationalen Denkmals-Status erhielten auch 2001 die Zeche Zollverein in Essen und 2010 das Fagus-Werk in Alsdorf. Letzteres war 99 Jahre zuvor von dem Gründer des Bauhauses, Walter Gropius, entworfen worden. Das Fagus-Werk ist das einzige der angegebenen Industriewerke, in dem nach wie vor produziert wird (Herstellung von Schuhleisten). Die drei anderen von der UNESCO ausgezeichneten Betriebe haben sich inzwischen allesamt zu Industriemuseen gewandelt.
S. 9: Montanindustrie: Frühe Hütten, Rasselsteiner Eisenwerksgesellschaft
Seit 1451 ist eine Eisenhütte in Buschhütten bei Siegen nachweisbar.
Ein Innovationsträger in der deutschen Stahlherstellung war die Rasselsteiner Eisenwerksgesellschaft, und zwar schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, als das Hüttenwerk noch im Besitz der frühen Montanunternehmensfamilie Remy war. Zu dem Remy-„Konzern“ (den Begriff gab es damals noch nicht) gehörte auch eine der ältesten und heute noch als Museum existierenden Hochofenanlage, die Wendener Hütte (vgl. S.9). Das Rasselsteiner Blechwalzwerk in den 1770er Jahren, das Puddelverfahren im Jahre 1824 und die Bessemerbirne 1883 waren jeweils die ersten ihrer Art in Deutschland. (Diese Verfahren wurden allerdings in England schon Jahrzehnte früher eingesetzt.) 1835 lieferte Rasselstein die Gleise für die erste deutsche Eisenbahnlinie zwischen Nürnberg und Fürth. (Der Rasselsteiner Betrieb existierte bis zum Jahr 2016, wobei der neue Eigentümer KruppThyssen auch gleichzeitig den Begriff „Rasselstein“ aus seinem Markenportefeuille tilgte.)
S. 9: Dinnendahl – WEDAG
Aus den ersten Betrieben der Brüder Dinnendahl (zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Essen) entwickelte sich später die Maschinenfabrik Westfalia Dinnendahl Gröppel AG („WEDAG“) in Bochum. Neben den Dinnendahl-Brüdern gab es weitere Wurzeln der WEDAG, nämlich die 1872 in Bochum gegründete Eisenhütte Westfalia und die Maschinenfabrik Gröppel, die sich aus einem 1857 im schlesischen Waldenburg entstandenen Ingenieursbüro entwickelt hatte. Seit den 1930er Jahren verlegte sich die WEDAG vor allem auf die Produktion und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen für Erz- und Kohleabbau. 1969 wurde das Unternehmen in den Klöckner-Humboldt-Deutz-Konzern eingegliedert, 1979 in KHD Humboldt Wedag AG umbenannt und 2001 wieder aus dem Deutz-Konzern herausgelöst. Unter dem Namen KHD Humboldt Wedag International GmbH konzentrierte sich das Unternehmen auf das Anlagenmanagement im Bereich der Zementherstellung.
S. 10 Finanzwesen: Pfandbriefe
Mit den Pfandbriefen begann die moderne Finanzierung großer Vorhaben mittels (Teil-) Schuldverschreibungen. Pfandbriefe sind Schuldverschreibungen, die (mittels Hypotheken oder Grundschulden) durch Immobilien gesichert sind.
Die 1769 erstmals (in Preußen) ausgestellten Pfandbriefe ermöglichten zuerst nur die Rekapitalisierung der schlesischen Gutsbesitzer, die somit nach dem Siebenjährigen Krieg“ ihre zerstörten Höfe wieder aufbauen konnten. Der Erfolg der Pfandbriefe führte aber anschließend zur Institutionalisierung dieser Bodenkredite bei den Großgrundbesitzern in ganz Preußen: Im Jahre 1800 bestanden in Preußen bereits 11 „Landschaften“ (Pfandbriefanstalten). Wenige Jahre später erweiterte sich das Pfandbriefsystem mit Hilfe von privaten Hypothekenbanken nicht nur auf ganz Deutschland, sondern auch auf die Städte.
Der abgebildete Pfandbrief der Schlesischen Landschaft aus dem Jahre 1940 ist ein später „Nachfahre“ der ersten Pfandbriefe aus dem Preußen Friedrichs des Zweiten (des „Großen“).
S. 10: Aufbrechen der traditionellen Wirtschaftsordnung
Die Wirtschaftspolitik in den einzelnen deutschen Staaten war vom Merkantilismus geprägt, einer Wirtschaftstheorie, deren Ziele darin bestanden, den absolutistisch regierenden Fürsten den höchstmöglichen Reichtum und Einfluss zu garantieren. Zu diesem Zweck wurden neben einer Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität vor allem Außenhandelsüberschüsse angestrebt. Daher wurde die Wirtschaft üblicherweise sehr stark durch die Regierungen reglementiert. Einige Wirtschaftsbranchen wurden überdies von der öffentlichen Verwaltung selber wahrgenommen oder als staatlich geschütztes Monopol von einem einzigen Unternehmer bearbeitet (vgl. z. B. das Jahrhunderte lang bestehende Postmonopol der Fürsten von Thurn und Taxis).
Die dominierende Branche, die Landwirtschaft, war nach wie vor feudalplanwirtschaftlich organisiert, in der Regel beruhend auf uralte, tradierte Rechte der Grundherren.
In den Städten verhinderten Kaufmannsgilden und Handwerkszünfte praktisch jeden Wettbewerbsgedanken und regelten die meisten Wirtschaftstätigkeiten bis ins Kleinste: Preise, Auftragsvergaben, Lohnhöhen, selbst die Kleiderordnung lagen nicht in der Entscheidungsgewalt der einzelnen Gewerbetreibenden. Lediglich im Handel waren ansatzweise marktwirtschaftliche Strukturen vorhanden, und zwar im Fernhandel und auf den Wochenmärkten, auf denen die heimischen Kleinbauern und Handwerker ihre Waren feilboten.
Der internationale Fernhandel der deutschen Staaten war zum Ende des 18. Jahrhunderts im Vergleich zu einigen Nachbarn (und auch im Vergleich zu den früheren Zeiten der Fugger, der Welser und der Hanse) eher unbedeutend. Die Ausfuhr aus den deutschen Ländern bestand größtenteils aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Getreide, Hülsenfrüchte u. ä.) sowie aus Verarbeitungsprodukten der Landwirtschaft (Leinwand, Wollwaren). Beim Import lagen Rohrzucker und Baumwollgewebe an der Spitze der Liste, gefolgt von diversen Luxusgütern er damaligen Zeit.
Frühe Versuche zum Aufbrechen der starren, aus dem Mittelalter tradierten Handwerks- und Kaufmanns-Regeln der Zünfte und Gilden gab es schon vor 1800. Als Beispiel dafür kann die „Fabrikstadt“ Frankenthal in der Kurpfalz gelten. Seit 1768 wurden durch die Regierung systematisch Manufakturen angesiedelt, deren Anzahl über die früher durch die Zünfte festgesetzten Grenzen hinausging. Die Betriebe in der Modell-Manufakturstadt führten schon frühe Formen der Arbeitsteilung und der Serienproduktion ein; trotz der kurfürstlichen Privilegien blieben aber die Betriebseinheiten regelmäßig sehr klein. Selbst das größte und bis heute bekannteste Frankenthaler Unternehmen zu jener Zeit, die Porzellanmanufaktur, hatte nie mehr als 200 Beschäftigte. Das „Fabrikstadt-Experiment“, das noch nicht der Marktwirtschaft, sondern dem obrigkeitsstaatlichen Merkantilismus verpflichtet war, endete mit dem Einmarsch der französischen Revolutionsgruppen zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Der Siegeszug der Marktwirtschaft und der damit verbundene wirtschaftliche Aufstieg begannen in Deutschland erst mit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, beginnend mit den französischen Rechtsreformen und mit den Stein-Hardenberg’schen Reformen in Preußen zum Ende der Napoleonischen Besetzung.
3.2. Von 1800 bis zum Ende des Kaiserreichs
S. 11: Das moderne französische Recht
Ein weiterer nachhaltiger Ansatz zur Modernisierung der Gesellschaft noch zur Zeit Napoleons war die Einführung des modernen französischen Rechts (Cinq codes). Dabei war insbesondere der Code civil (das französische Gesetzbuch zum Zivilrecht) maßgebend für die nachfolgenden Zeiten.
S. 11: Bauernbefreiung: Landesrentenbank
Die Stein-Hardenberg’schen Reformen (und die ähnlichen anschließenden Reformen in den anderen deutschen Ländern) waren aber nicht nur die notwendige Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland, sie führten andererseits auch zu verschiedenen Problemen. So entstanden nach der „Bauernbefreiung“ zwar viele neue, kleine Landwirtschaftsbetriebe; die nun selbstständig gewordenen Bauern gerieten aber häufig in eine neue Abhängigkeit von den ehemaligen Großgrundbesitzern. Diese wurden zwar für die Ablösung“ ihrer ehemaligen Flächen grundsätzlich vom Staat entschädigt, die „Neu-Bauern“ mussten sich aber an dieser Entschädigung in Form einer „Rente“ beteiligen. Fehlte ihnen dieses Geld, dann nahmen sie häufig einen Kredit bei den ehemaligen Großgrundbesitzern auf, die aber teilweise überhöhte Zinsen forderten.
1850 reagierte der preußische Staat darauf durch die Errichtung von „Provinzial-Rentenbanken“. Die „Neu-Bauern“ zahlten die jährliche Rente (oder einmalig das 18-fache des jährlichen Rentenbetrags) in die Rentenbanken ein; diese wiederum gaben an die ehemaligen Großgrundbesitzer verzinsliche „Rentenbriefe“ aus. Eine direkte Geschäftsverbindung zwischen den „alten“ und den „neuen“ Besitzern der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke war damit nicht mehr vorhanden. Die Rentenbriefe garantierten die Auszahlung der gesamten „Ablöseforderung“ (mit einem 20%igen Abschlag), bis sie schließlich (bis 1890) mit Zinsen komplett ausgezahlt wurden. Danach wendeten sich die Provinzial-Rentenbanken anderen Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft zu. 1928 wurden sie zu Gunsten der „Preußischen Landesrentenbank“ aufgelöst, deren Aufgaben ihrerseits 1939 auf das gesamte Reichsgebiet ausgeweitet wurde und die folglich in „Deutsche Landesrentenbank“ umfirmierte.
1966 wurde aus der „Deutschen Landesrentenbank“ durch eine Fusion die „Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank („DSL-Bank“).Die DSL-Bank wurde 1999 privatisiert und an die Postbank verkauft. Die Postbank benutzte die „DSL-Bank“ aber nicht mehr als (rechtlich selbstständiger) Konzernbetrieb, sondern nur noch als Marke für ihre Immobilienfinanzierung weiter.
S. 11: Friedrich von List: Erziehungszoll
Friedrich von List war überzeugt davon, dass eine wirtschaftliche Weiterentwicklung Deutschland nur durch die Industrialisierung möglich war. Um diese zu erreichen, empfahl er – in Abkehrung von der klassisch-liberalen Idee des Freihandels – einen sogenannten „Erziehungszoll“ auf ausländische Industriewaren, damit die deutsche Industrie sich für eine gewisse Zeit lang vor ausländischer Konkurrenz aus höher entwickelten Ländern wie England geschützt war. Dieser „Erziehungszoll“ konnte seiner Meinung nach dann wieder abgeschafft werden, wenn die deutsche Industrie international konkurrenzfähig geworden war.
S. 12: Auswanderungen
Der Vulkanausbruch des Tambora war einer von vielen Gründen für die Aussiedlerwellen aus Deutschland im 19. Jahrhundert. Zu mindestens 20 % waren diese Emigrationswellen klimatisch bedingt, beispielsweise eben durch das „Jahr ohne Sommer“ 1806, das durch den Tambora verursacht worden war. Insgesamt wanderten im 19. Jahrhundert mehr als fünf Millionen Deutsche aus, vor allem nach Nordamerika. (Dies war nach der „Ostkolonisation“ im 12. – 14. Jahrhundert die zweite Auswanderungswelle in Deutschland.)
S. 13: Volkswirtschaftliche Entwicklung 1900 – 1914:
Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands setzte sich auch nach der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg fort: Von 1900 bis 1913 erhöhte sich die Wirtschaftsleistung Deutschlands um ca. 44% auf 52 MRD Mark. Diese Erhöhung der Wirtschaftsleistung um jährlich ca. 2,8 % war vor allem auf die hohe Investitionsneigung der deutschen Unternehmen zurückzuführen. Dazu passt die Information, dass im gleichen Zeitraum in Deutschland 1551 Aktiengesellschaften gegründet wurden. Im Jahr 1913 z. B. betrugen die Netto-Investitionen 8 MRD Mark, das waren ca. 16 % der gesamten Wirtschaftsleistung. (Zum Vergleich: 100 Jahre später betrug dieser Satz nur noch knapp 3 %.) Direktinvestitionen aus dem Ausland spielten kaum eine Rolle (im Gegensatz zu den „Schwellenländern“ von heute, deren Wachstum zu einem nennenswerten Teil auf Investitionen aus den Industrieländern basiert.) Zu Direktinvestitionen im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts wäre lediglich Großbritannien technisch und wirtschaftlich in der Lage gewesen: Die Briten investierten aber vorrangig im eigenen Land, in den USA oder in ihren Kolonien. Daher war Großbritannien 1913 mit einem Anteil von 14,2 % im Welthandel führend; dahinter kam aber schon Deutschland mit 12,3 %, noch vor den aufstrebenden USA mit 11 %.
Zum dominierenden Wirtschaftssektor in Deutschland wurde die Industrie. Zwar arbeitete 1913 noch ein Drittel der deutschen Bevölkerung in der Landwirtschaft, die immerhin noch mit 23 % zur Entstehung des Sozialprodukts beitrug (in Großbritannien betrug dieser Satz im gleichen Jahr nur noch 6 %), der Anteil der Industrie an der deutschen Wirtschaftsleistung betrug hingegen 44 %. Von besonderer Bedeutung dabei war die Eisen- und Stahlindustrie Deutschlands; diese war fast doppelt so groß wie diejenige Großbritanniens. Der „tertiäre“ Wirtschaftssektor (Handel und Dienstleistungen incl. Transport und Kommunikation) hatte in Deutschland auch schon einen Anteil von 33 % am deutschen Sozialprodukt erreicht. (Eine „postmoderne“ Volkswirtschaft ist durch einen besonders hohen Anteil dieses Sektors gekennzeichnet. Den weltweit größten Anteil dieses Sektors an der Wirtschaftsleistung hatte 1913 Großbritannien mit ca. 56 %. Insofern galt die britische Volkswirtschaft auch in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg als die fortschrittlichste.)
1913 gehörte Deutschland auch schon längst zu den größten Handelsnationen der Welt. Ca. 20% der deutschen Wirtschaftsleistung ging in den Export, was Deutschland zur drittgrößten Exportnation weltweit werden ließ (übertroffen nur von Großbritannien und den USA). Exportiert wurden vor allem Erzeugnisse der Metall- und Elektroindustrie und des Maschinenbaus, also Eisenwaren, Stahl, Röhren und Fahrzeuge, aber auch Rohstoffe wie Steinkohle. Die Ausfuhren wurden vor allem in europäische Länder geliefert, allen voran nach Großbritannien (Waren im Wert von ca. 1,4 MRD Mark) und Österreich-Ungarn (ca. 1,1 MRD Mark Umsatz). Die wichtigsten Importgüter waren Rohstoffe und Nahrungsmittel, vor allem Baumwolle (wertmäßig 6 % aller Importe), aber auch Wolle, Weizen und Gerste (jeweils 4 %). Ölimporte spielten noch keine besondere Rolle. Der wichtigste Lieferant für das deutsche Kaiserreich waren die USA mit Handelsgütern im Wert von mehr als 1,7 MRD Mark und Russland, das Waren im Wert von mehr als 1,4 MRD Mark lieferte. Erst danach folgten auch bei den Einfuhren Großbritannien und Österreich-Ungarn.
S. 13: Konsumvereine
Überall in Europa entwickelten sich im 19. Jahrhundert Konsumgenossenschaften. 1893 gründete sich in Deutschland die „Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Consumvereine“ in Hamburg, die auch politisch (sozialdemokratisch) tätig war und seit 1910 sogar eigene Produktionsstätten betrieb. 1913 wurde (als christlichkonservative Gegenbewegung) der Reichsverband deutscher Consumvereine in Köln gegründet.
S.14: „Gründerkrise“ 1873 ff:
Überzogene Zukunftshoffnungen in der Wirtschaft führten Anfang der 1870er Jahre (in Deutschland vor allem nach dem militärischen Sieg über Frankreich und nach der Neugründung des Kaiserreichs) zu Kapazitätsüberschüssen. Die „Wirtschaftsblase“ platzte 1873 mit starken Kursverlusten an der Aktienbörse und ebenso starken Produktionsrückgängen. Allein im Jahre 1876 wurden in Deutschland 61 Banken, vier Eisenbahngesellschaften und mehr als 100 Industrieunternehmen zahlungsunfähig.
Die Victoria-Hütte ist ein typisches Beispiel für die Gründerjahre und die anschließende Rezession: Das Unternehmen wurde 1871 als AG für Fabrikation von Nickel und Kupfervitriol in Berlin gegründet und 1873 in Victoria-Hütte umbenannt. Schon 1879 konnte keine Dividende mehr gezahlt werden (sonst würde der oben abgebildete Dividendenschein heute nicht mehr existieren), spätestens 1887 existierte das Unternehmen nicht mehr.
Da die Eisenbahn ebenso wie das Post- und Finanzwesen sowie die Gas- und Elektrizitätsversorgung zur unverzichtbaren „Infrastruktur“ einer modernen arbeitsteiligen Wirtschaftswelt zählen, wurden sie in den Krisenjahren vielfach von der „öffentlichen Hand“ übernommen, wenn der Konkurs drohte. Daraufhin galten mehr als ein Jahrhundert lang der Ausbau und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur als typische Staatsaufgaben, auch weil dadurch in der Regel sogenannte „Kollektivbedürfnisse“ gedeckt werden, also Bedürfnisse von Menschen, die in der Regel nicht individuell, sondern aus Kostengründen nur kollektiv befriedigt werden können.
Die wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert zeigte insbesondere in den Krisenzeiten auf, dass die mangelhafte Deckung von Kollektivbedürfnissen ebenso wie die Verelendung der Arbeiterschaft und die zunehmende Monopolisierung zu den Schwächen einer weitgehend ungezähmten „freien Marktwirtschaft“ zählten. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist schließlich auch der Vertrauensverlust in das Wirtschaftssystem.
Die Rezession in den 1870er Jahren erschütterte aber nicht nur nachhaltig das Vertrauen in die Wirtschaft, sondern war auch ein Grund für die sich verstärkende antisemitische Haltung in weiten Teilen des Reichs. Der einflussreichste Vertreter dieser Strömung war der preußische Journalist Otto Glagau, der selber ein Opfer des „Gründerkrachs“ 1873 geworden war und der die Schuld an dieser Rezession „den Juden“ zuschrieb. Glagau war später (1883) Leiter des zweiten „Internationalen Antijüdischen Kongresses“ in Chemnitz.
S. 14: Wirtschaftswissenschaft:
Der Engländer John Stuart Mill forderte einen starken Staat zur Verhinderung von langfristigen Monopolen, zum Schutz gegen den Missbrauch wirtschaftlicher Macht sowie bei der Bewirtschaftung verschiedener Infrastrukturbranchen (Eisenbahnwesen, Wasser, Gas).
Zu den bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftlern zu Anfang des 20. Jahrhunderts gehört auch der Österreicher Joseph Schumpeter, der zur später sehr einflussreichen „Österreichischen Schule“ innerhalb des Neoliberalismus gehörte. Schumpeter betonte als erster die Rolle des innovativen „Pionierunternehmers“, der durch seine Neuerungen eine Zeit lang einen Monopolgewinn erreichen kann, bevor sein Vorsprung durch Nachahmer wieder ausgeglichen wird. Diese Theorie entspricht dem Patentwesen in der Praxis.
Die Wirtschaftstheorie, die an den Universitäten des deutschen Kaiserreichs am häufigsten vertreten war, war aber nicht der Neoliberalismus, sondern die „Historische Schule“ mit ihrem Hauptvertreter Gustav Schmoller. Schmoller kritisierte den ungehinderten Wettbewerb und war durchaus ein Befürworter staatlicher Eingriffe zur Verbesserung der sozialen Lage der Arbeitnehmerschaft. Das abstrahierende Modelldenken der österreichischen Schule lehnte er ab, stattdessen betrieb er empirische Forschungen, um mit einer großen Menge von Faktenwissen in der Lage zu sein, ökonomische Entwicklungen zu begreifen. Er war der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Entwicklung immer nur im Kontext von Raum und Zeit zu verstehen sei und es daher keine allgemeinen, zeitlos gültigen volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten geben könne. Die „Historische Schule“ war daher der Wirtschaftspolitik daher keine große Hilfe.
Aber nicht nur wegen der in Deutschland führenden Historischen Schule hatte die Nationalökonomie kaum Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der deutschen Monarchien. Wichtige staatliche Entscheidungen in Wirtschaftsfragen waren vor allem Reaktionen auf die ökonomischen Entwicklungen (z. B. die Verstaatlichungen nach der „Gründerzeit-Krise“) oder hatten machtpolitische Gründe: Die Verbote von Sozialdemokratie und Gewerkschaften sollten die Macht dieser Monarchie-Kritiker eindämmen; die Einführung der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung sollte den gleichen Organisationen „den Wind aus den Segeln nehmen“.
S. 15: Weberei im frühen 19. Jahrhundert: