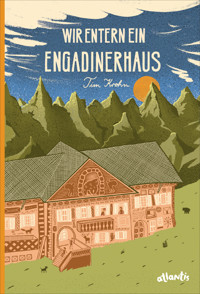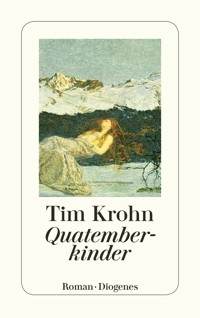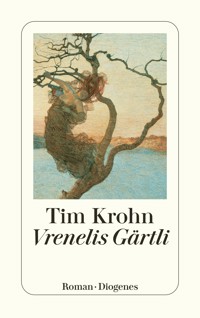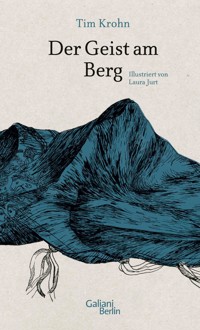11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ans Meer - eine Geschichte über Schuld, Vergebung und die Sehnsucht nach einem Zuhause Anna, eine warmherzige junge Frau aus Kiel, träumt von einer eigenen Familie. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein: Vor zwölf Jahren zerstörte sie durch einen Fehler die Familie ihrer besten Freundin Josefa. Nun, nach Josefas unerwartetem Tod, will Anna deren elfjährigen Sohn Jens adoptieren, um ihre Schuld zu tilgen. Doch auch Jens' Vater Livio taucht auf - ein sympathischer, aber unzuverlässiger Mann, der seinem Sohn bisher ein Fremder war. Während Anna und Livio um das Sorgerecht für den überforderten Jungen kämpfen, wird klar: Ohne die Aufarbeitung der Vergangenheit, von Schuld und Sühne, Verzeihen und Vergessen, kann die Zukunft nicht beginnen. In Ans Meer blitzen wie in einem Kaleidoskop immer neue Facetten der schicksalhaften Ereignisse auf, die Josefas und Annas Familien für immer veränderten. Tim Krohn erweist sich als meisterhafter Erzähler existenzieller Fragen. Ans Meer ist ein dramatischer Roman über die schwierige Kunst des Verzeihens und die Schönheit menschlicher Fehlbarkeit - berührend, tiefgründig und voller Sehnsucht nach einem Zuhause.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tim Krohn
Ans Meer
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tim Krohn
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tim Krohn
Tim Krohn, geboren 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Seine Romane Quatemberkinder und Vrenelis Gärtli machten ihn berühmt. 2015 veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband Nachts in Vals. Der Auftaktband des ›Menschliche Regungen‹-Projekts Herr Brechbühl sucht eine Katze war wochenlang in den Schweizer Bestsellerlisten. Zuletzt erschien der zweite Band, Erich Wyss übt den freien Fall.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Anna – eine junge Frau aus Kiel voll Charme und Wärme – wünscht sich nichts sehnlicher als eine eigene Familie. In ihrer frühen Jugend hat sie während der Sommerferien durch eine Dummheit die Familie ihrer besten Freundin Josefa zerstört, und mehr noch: jetzt, zwölf Jahre später, hätte sie vielleicht Josefas unerwarteten Tod verhindern können. Deshalb will sie Josefas elfjährigen Sohn Jens adoptieren und so ihre Schuld zumindest teilweise tilgen. Doch auch Jens’ Vater Livio taucht auf, ein nicht unsympathischer, aber offensichtlich ziemlich unzuverlässiger Mensch, der Jens noch nie zuvor gesehen und der eigenen Familie dessen Existenz verschwiegen hatte. Während Anna und Livio um die Vormundschaft für den überforderten Jungen ringen, der selbst gar nicht zum Trauern kommt, wird eines klar: ohne Aufarbeitung des Vergangenen, der Frage von Schuld und Sühne, Verzeihen und Vergessen, kann die Zukunft nicht beginnen. Verschiedene der damals Beteiligten erinnern sich an jenes schicksalsschwere Unglück im Haus am Meer, das Josefas und Annas Familien völlig veränderte und das bis heute auch auf Jens nachwirkt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2009, 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Frank von Groen
Lektorat: Wolfgang Hörner/Angelika Winnen
ISBN978-3-462-31851-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Anna
Jens
Josefa
Anna
Josefa
Jens
Anna
Rüdiger
Anna
Jens
Anna
Jens
Anna
Am Meer
Danksagung
Anna
Während Anna darauf wartete, dass die Gynäkologin ins Behandlungszimmer zurückkam, schloss sie für einen Augenblick die Augen. Erst jetzt nahm sie wahr, wie Kalle vor der Tür mit dem kleinen Jungen spielte, der schon mit seinem Spielzeugboot den blauen Spannteppich befahren hatte, als sie das Wartezimmer betraten. Kalle kommentierte lauthals, als wäre er ein Sportmoderator: »Und eben erreicht das Boot die erste Boje und wendet, immer noch liegt es vorn – doch hoppla, was ist das? Die Crew steuert die Meerenge an, das Boot verlässt die Lagune und segelt aufs offene Meer hinaus, erreicht das Kap der Guten Hoffnung …« Der kleine Junge kreischte vor Vergnügen, zweifellos war das Kap der Guten Hoffnung seine schwangere Mutter.
Anna lachte, obwohl ihr überhaupt nicht danach war, dann hörte sie die Kreppsohlen der Gynäkologin auf dem Linoleum im Flur quietschen und öffnete wieder die Augen. Ihr Blick fiel auf das Maiblatt eines medizinischen Monatskalenders, das gegenüber dem Patientenstuhl an der Wand hing und den schematischen Aufriss einer schwangeren Frau zeigte, dann war Frau Dr. Meyer bei ihr und reichte ihr zwei Packungen eines Schwangerschaftstests.
»Der hier sollte etwas zuverlässiger sein«, sagte sie. »Allerdings sind diese Tests absichtlich so konzipiert, dass sie eher mal eine Schwangerschaft zu viel anzeigen als eine zu wenig.«
»Das ist ja auch vernünftig«, sagte Anna, doch die Enttäuschung saß zu tief. Seit Kalle und sie das Studium beendet hatten, versuchte sie schwanger zu werden. Nun endlich, erstmals seit zwei Jahren, war ihre Periode ausgeblieben, und auch den Selbsttest aus der Apotheke hatte man positiv interpretieren können. Das hatte gereicht, um bei ihr ungezügelte Euphorie auszulösen. Kalle hatte vergeblich versucht, sie zu beschwichtigen, doch natürlich hatte er recht gehabt: Die Testergebnisse hier, bei der Gynäkologin, waren klar negativ.
»Wenn Sie möchten, testen wir noch Ihre Fruchtbarkeit«, bot Frau Meyer an, während sie die Abgabe der Testsets in der Akte vermerkte.
Anna schüttelte den Kopf. »Schon geschehen«, sagte sie müde. »Kalle hat sich auch schon testen lassen.«
»Vielleicht bilden Sie auch Antikörper gegen seine Spermien«, erklärte Frau Meyer, »es gibt tausend Gründe für eine ausbleibende Schwangerschaft. Manche davon lassen sich beheben, andere nicht.« Sie schloss die Akte. »Ich schlage vor«, sagte sie und stand auf, »Sie versuchen es noch ein paar Monate, und wenn Sie feststellen, dass das Ganze Sie zu sehr stresst, melden Sie sich wieder, und wir gehen die Sache von Grund auf an.«
Und ob sie gestresst war – selbst während der unfruchtbaren Tage konnte sie nicht mehr mit Kalle schlafen, ohne sich unauffällig in eine der Positionen zu hieven, die den Ratgebern zufolge die größte Chance versprachen, schwanger zu werden. Doch sie nickte stumm, steckte die Schwangerschaftstests ein und verließ das Zimmer.
»Und wieder stranden wir am Kap der Guten Hoffnung«, kommentierte Kalle gerade, »der Weg scheint versperrt, doch da tut sich etwas auf …« Gemeinsam mit dem kleinen Jungen kniete er vor dessen Mutter, die stoisch wie ein Buddha im Wartesessel saß und Kaugummiblasen blies, das Segelboot war zwischen ihrem Knöchel und dem Stuhlbein eingekeilt, seufzend hob sie den Fuß und gab den Weg frei. Anna stellte fest, dass die drei das Bild einer perfekten Familie abgaben, und nicht zum ersten Mal schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass Kalle mit einer anderen Frau vielleicht glücklicher wäre, dass sie nicht das Recht hatte, ihn an sich zu binden, wenn sie mit ihren Familienplänen scheiterten. Doch gleich erhob er sich und strahlte sie an, als sei sie ein völlig unerwartetes Geschenk.
»Fehlanzeige«, sagte sie eilig, damit er sich keine falschen Hoffnungen machte. »Und ich hatte schon gehofft, ich könnte mich um die Doktorarbeit drücken«, fügte sie mit einem knappen Lächeln hinzu.
Kalle umarmte sie, doch sie ließ nicht zu, dass er sie tröstete, stattdessen strich sie ihm übers Haar und flüsterte: »Sei nicht zu enttäuscht, ja?« Während sie sich umarmten, sah sie mit leichtem Ekel und doch fasziniert über seine Schulter hinweg zu, wie die Mutter des Jungen eine große Kaugummiblase platzen ließ.
»Ich bin nicht enttäuscht«, stellte Kalle klar, während sie sich voneinander lösten und ihre Jacken anzogen.
»Wie spät ist es?«, fragte Anna.
»Zwölf«, antwortete er, »und du brauchst endlich eine Uhr.«
»Nicht, solange ich dich habe«, sagte sie und zog seinen verwurstelten Kragen aus dem Ausschnitt. »Wir müssen übrigens noch einkaufen gehen, ich habe Golombiewski versprochen, etwas Leckeres zur Sitzung mitzubringen.«
»Ich fasse es nicht«, sagte Kalle. »Erst kümmern wir uns mal um dich.«
Anna sah ihn befremdet an. »Ich bin okay«, versicherte sie ihm. »Mit mir muss niemand Mitleid haben.«
Also besorgten sie zuerst in der Konditorei Fiedler Kuchen für den Lehrstuhl, dann bekam Kalle seinen Willen und entführte sie zur Mittagsvorstellung ins kommunale Kino. Gezeigt wurde ein leicht bizarres Frühwerk von Massimiliano Torra in Schwarz-Weiß, Perdono, Giulietta! war sein Titel. Während der Vorspann lief, hatte Kalle Popcorn und Cola besorgt, und Anna war in sich gegangen und hatte beschlossen, seine Fürsorge zu genießen, so gut es ging. Sie lehnte sich an seine Schulter und fühlte seine Wärme – jetzt erst bemerkte sie, wie verloren sie sich fühlte. Sie vergoss sogar ein paar Tränen und brauchte eine Weile, bis sie dem Film Beachtung schenken konnte. Er spielte in einer sonderbaren Unzeit, halb heute, halb Novecento. Ein hoffnungsfroher Student versuchte die mandeläugige Giulietta zu erobern, die sich kokett in einem Olivenhain versteckte, an dessen Ende sich die Treppe zu einem wunderbaren toskanischen Palazzo emporschwang. »Warte auf mich, Giulietta«, rief der Student, während er ihr nacheilte, und schwenkte seine Mütze, »so warte doch und renn nicht weg!« Doch kaum hatte er Giulietta hinter einem Baumstamm erspäht und war ihr nachgeeilt, verschwand sie wieder, nur ihre Armbanduhr schimmerte noch kurz in der hitzeflirrenden Luft. Das Pathos der Szene, das so gar nichts mit dem wirklichen Leben gemein hatte, brachte Anna zum Lachen, sie küsste Kalle auf die Backe und flüsterte: »Es war doch gut, hierherzukommen.«
»Hör zu«, sagte Kalle, anstatt zu antworten, »jetzt kommt’s.«
Denn mittlerweile hatte der Student im Geäst eines Olivenbaumes eine Ukulele gefunden. Er angelte sie sich, stützte den Fuß in eine Windung des knorrigen Stammes, legte das Instrument an und brachte Giulietta ein Ständchen.
»Ach, wäre ich deine Longines«, sang er mit heller Stimme, »du trügest mich am Arm, ich sagte nicht mehr als: ›Giulietta, es ist Zeit!‹, und du gäbest mir warm …«
Und tatsächlich lockte das eigenartige Lied das mandeläugige Mädchen, das mittlerweile hinter die Säulen des Palastportals geflohen war, aus dem Versteck. Kalle bot ihr Popcorn an, gleichzeitig fühlte Anna eine sonderbare Rührung. »Wären die Gefühle im wirklichen Leben doch auch so klar und einfach«, dachte sie. Verträumt lauschte sie dem Gesang des Studenten, gleichzeitig ärgerte sie sich etwas über Kalle, der so hartnäckig darauf bestand, dass sie vom Popcorn nahm.
»Jeder Galan würde dir sagen: ›Giulietta, Sie haben da aber eine sehr nette Uhr!‹ Und gingst du auch ins Bett mit ihm, umfasst hielt ich dich nur …«, sang der Student, als Anna endlich in den Eimer griff, um Kalle zufriedenzustellen, und im Popcorn etwas ertastete, das dort nicht hingehörte, etwas Kälteres, Hartes. Eine Sekunde verging, bevor sie begriff, dass sie eine Uhr in den Fingern hielt, und eine zweite, bis ihr dämmerte, dass Kalle gerade eine ausgeklügelte Liebeserklärung inszenierte. Sie lachte schallend, die Wirklichkeit stand dem Film in Sachen Kitsch mit einem Mal um nichts mehr nach. Im Halbdunkel musterte sie die Armbanduhr, es war eine Herrenuhr. Sie entzifferte die Marke, natürlich handelte es sich um eine Longines.
»Geschenkt?«, fragte sie – noch schwankte sie zwischen peinlicher Berührtheit (das hier war wirklich zu pathetisch) und ehrlicher Rührung darüber, dass Kalle sie auch nach vier Jahren noch immer mit Liebesbeweisen überraschte, als müsste er sie täglich neu gewinnen. »Du Spinner!«, raunte sie, »die ist …«
›Wunderschön‹ wäre das passende Wort gewesen, doch das Licht im Saal reichte nicht aus, um ihr Aussehen einzuschätzen, und da Anna Heuchelei so wenig ertrug wie Mitleid, sagte sie nur: »… gewiss sehr schön.«
Kalle lachte. »Die Uhr ist, sagen wir mal, halbschön«, antwortete er, »doch wenn man dem Internet glauben darf, hat Einstein dieselbe getragen, es ist also eine Uhr für die Allerbesten. Eigentlich solltest du sie bekommen, wenn du den Doktor gemacht hast. Und keine Sorge, ich habe sie nicht gekauft, sie ist ein Erbstück von Tante Lissi, beziehungsweise von ihrem Papa.«
Anna stutzte, Tante Lissi war seit zwei Jahren tot. Sie wusste, wie schwer es ihm fiel, Geheimnisse für sich zu behalten. »Wo hattet du sie die ganze Zeit versteckt, du Bastard?«, fragte sie und kitzelte ihn aus.
Kalle wehrte sich verzweifelt, während er sich bemühte, die Cola nicht zu verschütten. Anna ließ erst von ihm ab, als die wenigen anderen Kinobesucher sich nach ihnen umdrehten. Mit einem Auge sah sie wieder auf die Leinwand, während sie sich die Uhr umband. Giulietta wagte sich soeben aus dem Schatten des Palasts, um sich Stufe um Stufe dem Studenten zu nähern, dessen Musik sie sichtlich umgarnte.
»Und trüge man schließlich uns zu Grabe«, sang der Student versunken, »in Schottland oder in Sachsen, so schlüge ich weiter als dein Herz und ließe aus dir die Gräser wachsen.«
Die Schlusskadenz erklang, zweifellos würde ihm Giulietta gleich um den Hals fallen, doch zuvor schoss Anna hoch.
»Geht die richtig?«, fragte sie. »Dann nichts wie los.« Sie raffte ihre Sachen zusammen, nahm Kalles Hand und zog ihn hinter sich her aus dem Kino.
Sie arbeiteten am Lehrstuhl für angewandte Psychologie der Christian-Albrechts-Universität. Als sie das Institut in der OS 75 (das Kürzel OS stand für Olshausenstraße) erreichten, warteten die anderen Assistenten schon, das heißt, Kerstin half Horst Golombiewski, ihrem Professor, die Literaturstapel zu ordnen, während Henner, der nicht nur Assistent, sondern seit gut einem Jahr auch Kerstins Mann war, im Nebenzimmer noch ihrer beider Neugeborenes in den Schlaf schaukelte, ein, wie selbst die Eltern fanden, hässliches, faltiges Bündel mit Namen Eloïse. Das psychologische Institut war ein kleiner Club, alle waren irgendwie miteinander verbandelt, und so waren auch Kerstin und Kalle einmal ein Paar gewesen, ehe Anna sie auseinandergebracht hatte. Bis heute hatte sie deshalb ein schlechtes Gewissen und hielt zu Kerstin etwas Distanz.
Kaum war sie in Golombiewskis Büro eingetreten, schob er ihr einen Stapel Bücher zu. »Neuerscheinungen zur Sozialpsychologie kritischer Lebensereignisse«, sagte er. »Kannst du mir dazu Beurteilungen schreiben? Ich brauche sie für den Vortrag in Sankt Petersburg.«
Krisenpsychologie war Annas Spezialgebiet, sie nickte und trug den Stapel nach nebenan in ihr Zimmer. Als sie wiederkam, hatte Golombiewski bereits den Kuchen ausgepackt.
»Wie war der Umzug?«, fragte sie. Er war am Wochenende mit seiner klein gewachsenen asiatischen Frau von einer Wohnung im Zentrum Kiels in ein Häuschen in Strande gezogen.
»Ein Spaziergang«, sagte er kauend, »die Möbelpacker haben alles erledigt, wir brauchten nur Bier zu verteilen und herumzustehen.«
Kerstin unterbrach ihr Gespräch. »Du hast eine Uhr?«, fragte sie. »Es geschehen noch Zeichen und Wunder.« Kerstin hatte einen untrüglichen Blick selbst für die kleinsten Veränderungen der Menschen, die sie umgaben, und eine ausgesprochen unzimperliche Art, sie anzusprechen.
Normalerweise hätte Anna sie mit einem Scherz ins Leere laufen lassen, doch heute war sie seltsam ungewappnet. »Von Kalle«, sagte sie, »ein Trostpflästerchen.«
»Ein Trostpflästerchen wofür?«, bohrte Kerstin.
Anna zögerte, doch sie sah keinen Grund, nicht darüber zu sprechen. »Ich hatte irrtümlich geglaubt, ich sei schwanger«, sagte sie.
»Schwanger von Kalle?«, fragte Kerstin weiter.
Allmählich wurde Anna die Unterhaltung zu absurd, sie lachte befremdet auf. »Von wem sonst?«, fragte sie zurück.
In jenem Augenblick kam Henner mit dem Babyfon, Eloïse schlief, die Besprechung konnte beginnen, und es wäre Kerstin ein Leichtes gewesen, das Gespräch hier abzubrechen. »Augenblick noch«, sagte sie stattdessen. Sie hatte sich von Anna abgewandt und musterte Kalle so eindringlich, als sehe sie ihn zum ersten Mal, und fragte ihn: »Sag bloß, du hast es ihr nie gesagt?«
Anna glaubte noch an einen Scherz, doch als sie Kalle ansah, stellte sie fest, dass ihm das Blut ins Gesicht geschossen war, er stützte sich mit beiden Armen auf eine Stuhllehne und rang nach Worten.
»Verratet ihr mir, worum es geht?«, bat sie.
Kalle fasste sie beim Arm und wollte sie mit sich ziehen. »Entschuldigt ihr uns einen Augenblick?«, sagte er, doch Anna hatte sich gleich wieder befreit und stellte sich so, dass sich der Tisch zwischen ihnen befand.
»Was hättest du mir sagen sollen?«, fragte sie. Sie hatte keinerlei Vorstellung davon, was er ihr verschwieg, doch sie fühlte, dass es nichts Geringfügiges sein konnte. Sie wartete vergeblich, Kalle war zu keinem Wort imstande.
»Er ist nicht zeugungsfähig«, sagte Kerstin. »Deshalb haben wir uns damals getrennt. Mir war immer klar, dass ich Kinder will.«
Anna starrte Kerstin an, sie war sich sicher, dass sie log, und fand nur sonderbar, dass Kalle sich nicht wehrte. Dann fiel ihr Blick auf das Päckchen der Konditorei. »Golombiewski hat schon den halben Kuchen aufgegessen«, dachte sie, und für einen Augenblick galt diesem Sachverhalt ihre ganze Bestürzung. Dann erst begriff sie wirklich, was Kerstin soeben enthüllt hatte, und stürzte aus dem Büro.
Im Korridor lehnte sie sich kurz gegen die Wand, dann ließen die Knie sie im Stich, sie sackte zusammen und verbarg das Gesicht in den Händen.
»Das war keine Meisterleistung«, hörte sie Henner durch die offene Glastür sagen, und offensichtlich sagte er es nicht zu Kalle, sondern zu Kerstin, denn die entgegnete ihm trocken: »Männer!« Dann bat Golombiewski darum, endlich mit der Besprechung beginnen zu dürfen. Sie hörte Schritte, jemand schloss die Tür, sie brauchte nicht aufzusehen, um zu wissen, dass Kalle bei ihr stand.
»Du hast mich angelogen«, sagte sie.
»Habe ich nicht«, antwortete er, seine Stimme klang so jungenhaft unschuldig wie immer.
Sie brauste auf. »Du hast gesagt, alles sei in Ordnung«, rief sie und sah erstmals auf.
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe nur gesagt, ich habe mich testen lassen.«
Er stand ihr gegenüber an die Treppenbrüstung gelehnt, sein Gesicht war nass von Tränen oder von Schweiß, denn er schluchzte nicht, sondern zitterte nur am ganzen Körper.
Sie versuchte vergeblich zu begreifen. »Du hast den ganzen Wahnsinn mit Eisprungtabellen und postkoitaler Gymnastik und Vitamindrinks mit angesehen und nie ein Wort gesagt? Warum nicht, um Himmels willen?«
Er sah sie so hilflos an, dass sie den Blick abwenden musste, um nicht zu vergessen, dass sie die Betrogene war. »Ich wollte dich nicht verlieren«, sagte er fast flüsternd.
Vergeblich versuchte sie zu begreifen, was er meinte, sie verstand ihn nicht, sie verstand die ganze Situation nicht. Sie begriff nur, dass ihr ganzes Leben auf einer Lüge aufgebaut war, alles war falsch, Betrug, sie musste fort, so rasch wie möglich. Ohne zu überlegen, sprang sie auf und rannte die Treppen hinab dem Ausgang zu.
»Anna, ich liebe dich«, hörte sie ihn noch sagen, der Satz traf sie wie eine Ohrfeige. Wie konnte er sie so belügen und dennoch behaupten, dass er sie liebe? »Anna«, rief er durchs Gebäude, als sie schon die Tür nach draußen öffnete, »du steigerst dich in was rein, jetzt warte doch, und lass uns reden.«
Sie fuhr nach Hause und packte, so gründlich es in der Eile ging. Kalle musste ihr zu Fuß nachgehen, das ließ ihr eine Viertelstunde Zeit. Vergeblich suchte sie einen Parkplatz, auf dem Blücherplatz war Wochenmarkt und alles verstellt, doch schließlich parkte sie mitten auf dem Gehsteig. Innerhalb von zehn Minuten hatte sie die Wohnung geräumt, die Kalle und sie anderthalb Jahre lang geteilt hatten (zum Glück hatte sie ihr Herz nie an viele Dinge gehängt), mit einem Koffer und zwei Taschen rannte sie zum Auto zurück und fuhr aus der Stadt hinaus.
Schon am Straßenkreuz hinter Rastorf verließ sie allerdings die Straße wieder, auf dem Parkplatz des Rasthuus an’t Krüz parkte sie den alten Audi, den ihr Vater ihr zum Studienabschluss überlassen hatte, zwischen zwei Lastwagen und starrte für einige Stunden wie gelähmt in den blühenden Ginster, der die Parkfelder säumte. Allmählich machten ihre anfängliche Verwirrung und das Entsetzen einer Leere Platz, die kaum leichter zu ertragen war, doch immerhin traute sie sich jetzt wieder zu, anderen Menschen zu begegnen, ohne unkontrolliert in Tränen auszubrechen. Als sie mit dem Gepäck das Haus ihrer Eltern an der Plöner Straße in Lütjenburg betrat, war es fünf Uhr nachmittags. Rüdiger und Pauline saßen bei einem Glas Wein im Wohnzimmer und sahen sich eine Kochshow an.
Rüdiger trug noch den Laborkittel. »Was für eine Überraschung«, sagte er, als sie eintrat, und küsste sie, auch Pauline erhob sich und wollte sie umarmen, doch Anna hatte sich bereits neben ihren Vater auf die Lehne gesetzt, sie ertrug den Kuss, den Pauline ihr auf den Scheitel drückte, mit einer Grimasse und trank das Glas ihres Vaters leer. »Ich habe gerade Kalle verlassen«, sagte sie umstandslos. »Kann ich mein Zimmer wiederhaben?«
»Kind«, sagte Pauline und stellte den Fernseher ab, »das tut mir aber leid. Hatte er eine Affäre?«
Anna schüttelte den Kopf. »Das Arschloch ist unfruchtbar und sagt kein Wort«, sagte sie und erwartete Bekundungen des Entsetzens.
Doch ihre Eltern schwiegen nur, dann fragte Rüdiger zögernd: »Wusste er es denn?«
»Seine Ex wusste es«, stellte Anna klar. Sie füllte das Glas ein zweites Mal. »Wenigstens darf ich jetzt wieder trinken«, stellte sie trotzig fest.
»Aber er liebt dich doch«, wandte Pauline ein.
Anna starrte sie entgeistert an. »Was willst du damit sagen? Dass ich ihn nicht verlassen soll? Bin ich jetzt die Böse? Er hat mich belogen, wo bitte bleibt da die Liebe?« Sie hatte keinen Augenblick daran gezweifelt, dass es das einzig Richtige war, Kalle zu verlassen. Umso mehr verwirrte es sie, dass selbst ihr Vater in dieselbe Kerbe hieb.
»Womöglich hatte er nur Angst, dich zu verlieren«, wandte er zaghaft ein.
Anna lachte vor Empörung auf. »Wo verdammt noch mal ist eure Solidarität?«, rief sie und rannte die Treppe hinauf zu ihrem früheren Zimmer. Ein Bügelbrett versperrte den Weg, auf ihrem Bett stand eine volle Wäschewanne, sie stieß sie wütend zu Boden, ließ sich auf die nackte Matratze fallen und schlug mit dem Fuß die Tür zu. Danach lag sie lange Zeit nur da. Sie war zu keinem geordneten Gedanken imstande, sie wusste nicht mehr, war sie die Betrogene oder die Betrügerin, es war ein Zwiespalt, der sie vollkommen lähmte. Sie überhörte Paulines und Rüdigers Rufe zum Abendessen ebenso wie später ihre Gute-Nacht-Wünsche. Erst als im Garten Kalles Stimme erklang, horchte sie auf.
»Anna«, rief er, »rede mit mir. Du kannst so nicht gehen.«
Sie rührte sich nicht und hoffte, er würde verschwinden, doch er rief immer wieder nach ihr. Ihr kam die Szene zwischen Giulietta und dem Studenten in den Sinn, und sie hoffte inständig, dass er nicht auch noch anfing zu singen.
»Du kannst hier nicht so herumbrüllen«, erklärte sie, als sie endlich das Fenster öffnete. »Wie spät ist es?« Im selben Augenblick fiel ihr ein, dass sie noch immer die Longines trug, doch sie beschloss es zu ignorieren.
»Elf Uhr.« sagte Kalle unerwartet ruhig.
»Hau ab«, sagte sie.
»Anna«, bat er.
»Hau ab!« Sie meinte es sehr ernst, doch er blieb hartnäckig.
»Lass es mich wiedergutmachen«, flehte er.
»Wiedergutmachen?«, wiederholte sie fassungslos. Was du getan hast, kann man nicht wiedergutmachen, Kalle.«
Er zögerte. »Zugegeben«, sagte er, »in den ersten Monaten unserer Beziehung habe ich einfach geschwindelt, da hatte ich noch nicht begriffen, wie wichtig dir eine Familie ist.«
»Man darf so etwas keinem Menschen antun«, sagte sie mehr zu sich als zu ihm, noch ehe er ausgeredet hatte, »niemals.«
»Hör zu«, bat er. »Dann, nachdem ich begriffen hatte … ich konnte doch nicht anders.« Er suchte eine Weile nach passenden Worten. »Erinnerst du dich, wie du im Institut unseren Hausmeister schikaniert hast?«, fragte er dann.
Anna geriet ins Stottern. Was sollte das jetzt? »Ich … er hatte Geld gestohlen«, stellte sie klar, »und er hat es abgestritten.«
»Erst, hat er es abgestritten«, erinnerte sie Kalle, »dann hat er es zurückgegeben. Du hast trotzdem nicht aufgehört, ihn zu schikanieren.«
Anna fühlte sich in die Enge getrieben. »Ich war eben wütend«, rechtfertigte sie sich.
»Du warst drei Monate lang wütend«, sagte Kalle. Es klang nicht vorwurfsvoll, sondern so, als spreche er von etwas Unabänderlichem, einer Springflut oder einer Dürrekatastrophe. »Du hast deine Wut an ihm ausgelassen, bis er kündigte«, stellte er fest. »Du kannst nicht verzeihen, Anna, und deshalb konnte ich dir auch nicht sagen, dass ich keine Kinder zeugen kann.« Er ließ ihr Gelegenheit zu antworten, doch sie war viel zu verwirrt, um es auch nur zu bemerken. »Ich weiß, ich habe Mist gebaut«, fuhr er daher fort, »und es tut mir leid, glaub mir, schrecklich leid. Aber nicht alle Menschen sind so perfekt wie du. Du bist immer aufrichtig, du verschenkst, was du hast, du bist für andere da.« Er sagte es ohne jeden Zynismus, und sie wusste, so sahen sie all ihre Mitmenschen – zumindest jene, denen sie nichts zu verzeihen hatte. Allein ihre riesengroßen dunklen Augen, das breite, herzförmige Gesicht und die Grübchen in den Winkeln eines Mundes, der geschwungen war wie die Silhouette einer gleitenden Möwe, öffneten die Herzen. Dazu kam, dass sie in handwerklichen Dingen oft etwas linkisch war, kaum ein Fettnäpfchen ausließ und gleichzeitig all die Pannen, die ihr zustießen, mit einer Fröhlichkeit trug, die sie nur noch reizender, noch perfekter erscheinen ließ. »Du bist ein derart guter Mensch, Anna, ich bewundere dich so sehr«, erklärte ihr Kalle, »und gleichzeitig macht es mich rasend.« Er versuchte zu lachen, doch es war unübersehbar, wie verzweifelt er war.
»Es ist auch für mich nicht leicht«, sagte sie so zaghaft, dass Kalle sie nicht verstand und nachfragen musste.
»Ich sagte, es ist auch für mich nicht leicht«, schrie sie, dann knallte sie das Fenster zu und riss den Vorhang davor. Gleich darauf brach sie in Tränen aus. Sie weinte bitterlich, ohne zu begreifen, weshalb Kalles Worte sie so sehr in die Enge getrieben hatten. Sie setzte sich mit angezogenen Beinen auf das Bett, in die Ecke gelehnt, starrte mit tränennassen Augen vor sich hin, und allmählich dämmerte ihr die Erinnerung, dass sie genau so in jener furchtbaren Nacht gesessen hatte, nachdem alles zusammengebrochen war, nachdem sie ihre Freundschaft zu Josefa verraten hatte und schuld daran gewesen war, dass deren Mutter in der Hohwachter Bucht starb. Vergeblich versuchte sie die Bilder wieder zu verdrängen.
Am anderen Morgen, als sie die Küche betrat, war Pauline eben dabei, den Frühstückstisch zu decken. »Isst Kalle mit?«, fragte sie, als sei nichts geschehen – seit Anna denken konnte, hatte ihre Mutter die Angewohnheit, unangenehme Entwicklungen einfach zu übersehen, Anna hasste das, und auch diesmal brauste sie auf.
»Es ist vorbei, Mama«, sagte sie giftig, »kannst du das nicht akzeptieren?«
Pauline sah sie irritiert an. »Entschuldige, wir hörten euch letzte Nacht sprechen und hofften, ihr hättet euch ausgesprochen.«
Schweigend setzte sich Anna zu ihrem Vater, der damit beschäftigt war, die Post durchzusehen. Wie meist hielt er sich aus ihren Streitereien heraus.
»Übrigens«, sagte Pauline schließlich, um das Schweigen zu brechen, »wurde der Grabstein von Lars Bergström doch letzten November im Sturm von einer umgestürzten Trauerlinde zerschlagen, ja? Weil niemand für die Reparatur aufkommen wollte, wurde er jetzt durch eines dieser Standardkreuze ersetzt.«
Nun sah Rüdiger doch auf. »Du hattest mir nicht erzählt, dass der Grabstein kaputt war.«
»Entschuldige«, sagte Pauline wieder, ehe sie lächelnd nach dem Krug griff. »Wer möchte Kaffee?«
Rüdiger überhörte sie. »Was ist mit Margots Grab?«, fragte er besorgt.
Pauline schenkte ihm erst ein, dann sagte sie: »Der Baum hat nur Lars’ Stein getroffen, mit Margots Grab ist alles in Ordnung. Ich habe ihr übrigens ein Weidenröschen gepflanzt.«
Rüdiger nickte, doch er blieb nachdenklich und fragte endlich: »Wer hatte denn damals seinen Grabstein bezahlt?«
»Ich glaube, die Gemeinde«, sagte Pauline. »Damals war noch Geld da.«
»Meinst du, wir hätten die Reparatur übernehmen sollen?«
»Wir sind nicht für sein Grab verantwortlich«, gab Pauline erstaunlich entschieden zurück.
Anna gab es einen Stich. Sie schwieg, doch fragte sie sich, ob Josefa inzwischen die Gräber ihrer Eltern oder das Haus am Meer besucht haben mochte. All die Jahre hatte sie jeden Gedanken an Josefa – an Joe, ihre Joe! – vermieden, nun war sie ihr mit einem Mal wieder so nah wie damals, so nah, als seien sie Schwestern, und die Frage, ob Joe ihr verzeihen konnte, wenn sie erfuhr, was damals geschehen war, quälte sie plötzlich so sehr, dass Kalles Verrat daneben bedeutungslos wurde. Den Morgen verbrachte sie damit, ihr Zimmer nach Fotos von damals zu durchforsten, Tagebücher und Schulhefte sah sie sich an, selbst ihre alten Kleider durchsuchte sie nach Spuren von Joe und erschrak immer wieder, wie viele kleine Erinnerungen sie überfielen und wie wenig Zeit doch seit jenem Unglück vergangen war.
Die Verwirrung wurde nicht kleiner, als sie im Labor ihres Vaters, das sich ebenfalls im Erdgeschoss des Hauses befand, in einigen Internetverzeichnissen Joes Namen eingab und so auf eine Josefa Bergström in Zürich stieß, die sich mit einem Jens Bergström eine Wohnung an der Dufourstraße teilte. Sie konnte sich an keinen Verwandten der Bergströms mit Namen Jens erinnern (sie glaubte nicht, dass Joe nach dem Tod ihrer Eltern überhaupt noch Verwandte gehabt hatte) und redete sich ein, es müsse sich um andere Bergströms handeln, dennoch brach ihr der Schweiß aus, als sie zum Hörer griff. Sie überwand sich, die Nummer zu wählen, und ein Junge kam an den Apparat, der vielleicht zehn Jahre alt sein mochte und perfektes Hochdeutsch sprach. Sie unterhielten sich nur kurz, doch es bestand kein Zweifel, dass sie die richtige Nummer gewählt hatte, denn das Erste, was der Junge fragte, war: »Bist du die Anna aus Lütjenburg mit den Zöpfen?« Tatsächlich hatten Joe und sie mehrere Phasen durchlebt, in denen sie mit Leidenschaft Zöpfe trugen, die letzte mit etwa vierzehn, und als sie sich an diesem Morgen die alten Fotos angesehen hatte, hatte sie sich beim Gedanken ertappt, das Haar wieder lang genug wachsen zu lassen, damit sie sich welche flechten konnte. Der Junge sagte ihr, dass Josefa bei einem Autoverleih arbeitete und nicht vor halb sieben nach Hause käme, darauf bat Anna ihn, ihr auszurichten, dass sie wieder anrufen würde.
Als sie zur Universität fuhr, fühlte sie sich beschwingt wie lange nicht mehr – dass Joe so einfach in ihr Leben zurückgekehrt war, machte sie dermaßen froh, dass sie nicht mehr begriff, warum sie diesem Moment so lange Jahre ausgewichen war.
In ihrer blendenden Laune sorgte sie sich nicht einmal darum, was geschehen mochte, falls sie im Institut Kalle über den Weg lief. Dann fiel ihr auch ein, dass er auf der anderen Seite der Stadt in Ellerbek in der Karatestunde war, und so holte sie nicht nur die Bücher, die sie für Golombiewski rezensieren sollte, sondern erledigte, obwohl ihre Gedanken weit von allen akademischen Belangen waren, gleich noch mit fliegender Leichtigkeit allen anstehenden Papierkram. Erst als sie sich gegen sechs ins Auto setzte, um zurück nach Lütjenburg zu fahren, zu einem Spielplatz, an dem sie und Joe sich als Teenager abends oft getroffen hatten, um heimlich zu rauchen und über die Jungs herzuziehen, wuchs ihre Angst wieder. Was, wenn sie mit ihrem Geständnis endgültig alles ruinierte? Dann lachte sie wieder über ihre Befürchtungen und sagte sich, dass keine Wirklichkeit, wie immer sie aussehen mochte, so schlimm sein konnte wie die Selbstvorwürfe, die sie seit Joes Abreise vor zwölf Jahren quälten.
Der Spielplatz des Soldatenheims unterhalb ihrer ehemaligen Schule war nicht frei zugänglich, früher hatten sie sich immer über den Zaun geschwungen, das versuchte sie auch diesmal, dabei zerriss sie ihr Kleid (sie trug eines der alten Sommerkleider, die sie am Morgen ausgegraben hatte). Außerdem fröstelte sie, seit die Sonne untergegangen war. Dennoch setzte sie sich wie früher auf die Schaukel, ließ die Beine baumeln, fasste sich ein Herz und wählte Josefas Nummer. Noch ehe Joe sich meldete, hörte sie im Hintergrund Jens’ Stimme.
»Wo ist meine Zahnbürste?«, rief er.
»Nimm eine neue«, sagte Josefa – es war eindeutig Josefa! –, »sie sind noch in meiner Handtasche.«
Anna fühlte einen Kloß im Hals, erst jetzt begriff sie, wie sehr sie diese Stimme vermisst hatte.
»Ja?«, sagte Joe – das galt wohl ihr.
»Hallo, Joe«, antwortete sie heiser.
»Wo ist die Tasche?«, rief Jens dazwischen, kurz raschelte und knackste es, Joe ging wohl mit dem Hörer durch die Wohnung. »Moment«, sagte sie leicht gereizt, doch es war Anna unmöglich herauszuhören, ob die Gereiztheit ihr galt oder Jens.
»Ist es Anna?«, erkundigte sich Jens mit vollem Mund, plötzlich war er ganz nah am Hörer.
»Wo hast du die jetzt her?«, fragte Josefa. »Hier.«
»Ich nehme nur grüne, das weißt du doch«, erklärte Jens und bürstete lautstark die Zähne.
»Hast du die etwa wieder aus dem Müll geholt?«, fragte Josefa mit Ekel in der Stimme.
Jens kicherte und rannte weg, vermutlich zurück ins Bad.
Anna lauschte ihnen etwas verschüchtert, doch auch verzückt, während einige Möwen über ihrem Kopf stritten. Das also war Joes Leben? So leise es ging, balancierte sie auf der Schaukel, die bei jeder Bewegung quietschte, sie wollte nichts verpassen.
»Jens hatte mich vorgewarnt«, sagte Josefa – obwohl sie den Hörer nun wieder an den Mund hielt, klang sie ferner als noch eben. »Warum rufst du an?«
Anna fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. »Ich weiß, ich hätte dich damals nicht allein lassen dürfen«, sagte sie eilig, »aber Joe, ich konnte mit all dem nicht umgehen. Es ging uns allen schlecht, du hättest Papa sehen sollen … Ich war siebzehn, Joe«, sagte sie scheu.
»Bist du fertig?«, fragte Josefa.
Anna erschrak, sie hatte noch gar nicht wirklich angefangen, dann begriff sie, dass Joe wieder mit Jens sprach. »Geh schon ins Bett«, befahl sie ihm, »ich komme gleich und sage dir gute Nacht.«
»Darf ich nicht zuhören?«, fragte Jens.
Joe blieb eisern. »Ins Bett, habe ich gesagt, du kannst noch lesen.«
Jens maulte, doch er ging, und Anna bedauerte es so sehr wie er. Sie liebte seine Stimme und seinen Witz und zweifelte nicht daran, dass sie sich blendend verstehen würden.
»Bist du noch da?«, fragte Josefa sie. »Wenn du schon anrufst, könntest du mir einen Gefallen tun.«
Anna erglühte wieder, diesmal vor Erleichterung. »Natürlich, jeden«, rief sie.
Josefa ging auf ihren Überschwang nicht ein. »Hör zu«, sagte sie – sie sprach jetzt leiser, ganz als wolle sie vermeiden, dass Jens sie hörte –, »ich brauche in Kiel ein Bett zum Übernachten, und zwar bereits morgen.«
Anna erschrak etwas. »Willst du dich um das Grab deines Vaters kümmern?«, fragte sie besorgt. »Ich glaube, der kaputte Grabstein wurde schon entsorgt.«
»Das Grab ist mir egal«, gab Joe zurück. »Ich brauche eine billige Unterkunft für zwei, drei Nächte, kriegst du das hin?«
»Brauchst du Geld?«, fragte Anna eifrig. »Ich kann dir …« Sie unterbrach sich, ihre Gedanken jagten durcheinander. »Wieso wohnst du nicht bei uns in Lütjenburg«, fragte sie, glücklich über ihren Einfall, »Mama und Paps werden sich freuen.«
»Ein Zimmer in Kiel«, wiederholte Joe. Fast klang es, als bereue sie schon, sie um Hilfe gebeten zu haben.
Anna begriff, dass jeder Einwand zwecklos war. »Ab morgen?«, versicherte sie sich nochmals.
»Wenn es geht.«
»Natürlich geht das, alles geht! Fliegst du? Wann kommst du an? Ich hole dich ab.«
Joe zögerte. »Das brauchst du nicht. Gib mir deine Handynummer, ich melde mich, sobald ich in Kiel bin.« Anna diktierte sie ihr: »0171–97 61 99.«
»Das ist dein Geburtsdatum«, stellte Joe fest, erstmals war ihre Stimme etwas weicher.
Anna lachte. »Ich habe …« Sie korrigierte sich. »Ich hatte einen sonderbaren Freund, Kalle, der macht andauernd solche Sachen.« Es machte sie etwas verlegen, dass Joe ihren Geburtstag noch wusste, sie sah zu Boden und scharrte mit dem Fuß im Sand, dabei stieß sie auf etwas, das sie im Dunkeln nicht gleich erkannte. Sie bückte sich und hob einen Haargummi auf, ein Büschel blonder Haare war darin verknotet. Eine Sekunde lang bildete sie sich ein, Joe habe ihn damals hier verloren, eine neue Welle von Glück ergriff sie, und es schien ihr ganz selbstverständlich, dass sie nun ausgiebig über Kalle und andere aktuelle und verflossene Liebschaften herziehen würden. Sie hatte ganz vergessen, dass Joe keinen Grund hatte, sich für ihr Leben zu interessieren.
»Also«, sagte Joe, und als Anna nicht gleich begriff, dass sie sich verabschieden sollte, hängte Joe einfach auf.
Noch eine Weile saß Anna etwas verloren auf der Schaukel und spielte mit dem Haargummi. Sie hatte es nicht über sich gebracht, von damals zu sprechen. »Doch immerhin«, sagte sie sich endlich und atmete tief durch, »es geht ihr gut, und sie kommt her!« Kurz musste sie sich zwingen, das bange Gefühl in der Magengrube zu ignorieren, danach wurde sie von Sekunde zu Sekunde fröhlicher. Sie schaukelte einige Schwünge, sprang ab und fing das Schaukelbrett ein, um den Haargummi darauf zu deponieren, danach kletterte sie über den Zaun und rannte zum Auto. Sie fuhr noch eine Kurve über Land, unterwegs fiel ihr das Lied von der Longines wieder ein, trotz der kalten Abendluft kurbelte sie das Fenster hinunter und trällerte es lauthals, so gut sie es erinnerte. »Nun warte doch, Giulietta, renn nicht weg«, rief sie endlich übermütig in die Nacht hinaus und fuchtelte theatralisch mit dem Arm. Wie schön alles werden konnte, wenn sie sich erst ausgesprochen hatten!
Jens
Annas Anruf machte Jens so euphorisch wie Anna selbst. Sein Traum, mit seiner Mutter an die Ostsee zu ziehen – ein Traum, der ihn erst seit ein paar Wochen beherrschte (seit den Frühlingsferien, um genau zu sein), doch umso heftiger –, schien ihm mit einem Mal zum Greifen nah.
Dieser neue Traum passte gut zu den zwei Wünschen, die sein Leben bestimmten, seit er denken konnte: Er wollte Ordnung, und er wollte segeln. Ab und zu kamen andere Wünsche hinzu, wie sie die meisten Zehnjährigen haben, so hätte er gern einen Vater gehabt, einen eigenen Gameboy und bessere Noten. Doch solche Wünsche tauchten auf und verschwanden wieder, während seine Mutter, die chaotisch und unzuverlässig und alles andere als eine ideale Mutter war, Jens’ Sehnsucht nach Ordnung täglich neu schürte. Denn so ähnlich sie sich in ihrem Äußeren waren – beide hatten sie aschblondes, schulterlanges Haar, das sie sich gegenseitig schnitten, ein breites, ausuferndes Lachen, bei dem sie etwas Zahnfleisch zeigten, und einen schmalen, feingliedrigen Körper –, so unterschiedlich waren ihre Bedürfnisse. Josefa verabscheute alles, was nach geregeltem Leben aussah, Vereinbarungen aller Art waren ihr ein Gräuel, ja, selbst eine eingerichtete Wohnung oder eine solide Freundschaft fand sie unausstehlich, sie bevorzugte das Provisorische. Jens hingegen liebte Rituale und sich wiederholende Spiele aller Art, er reihte seine Bücher in alphabetischer Folge ein und schätzte Tage, die ohne Überraschung waren.
So blieb das Einzige, was er und Joe uneingeschränkt teilten, ihre Liebe zum Segeln. Sobald etwas Wind blies, waren sie draußen auf dem See – es sei denn, Josefa hatte einmal mehr versäumt, das Boot zu reservieren, oder das Geld war ihr ausgegangen, oder sie hatte in dem Chaos, zu dem ihr jeder Tag geriet, ganz einfach wieder einmal vergessen, dass sie einen Sohn hatte, der am Pier auf sie wartete.
Die Tendenz dazu hatte sie schon gehabt, seit Jens denken konnte, doch es war mit den Jahren schlimmer geworden. Früher hatten sie viele kleine Spiele geteilt, in denen es strenge Regeln gab, die Jens glücklich machten: Vor dem Lichterlöschen spielten sie Länderraten (Jens suchte auf der Weltkarte ein möglichst klein gedrucktes Wort, das alles Mögliche bezeichnen konnte, und Joe musste es finden), sie spielten Schrittefangen auf dem Gehsteig (die Regeln hierzu waren kompliziert: Nie durften sie gleichzeitig denselben Fuß auf die Erde setzen, bei jedem neunten Schritt galt es zu hüpfen, dazu musste jede Ritze auf dem Weg betreten werden), gelegentlich – Jens’ Lieblingsspiel – verkleideten sie sich auch als Geschwister, einmal als Jungs, dann wieder als Mädchen. In solchen Momenten waren sie einander so nah, dass es sich anfühlte, als wären sie nicht zwei, sondern eins.
Daneben gab es aber auch in früheren Zeiten schon Tage, an denen sie nicht wahrnahm, wenn er mit ihr sprach, in denen sie in ihrer ganz eigenen Welt lebte, und wagte er sie darin zu stören, fuhr sie ihn an, als sei er ein Fremder. Diese Phasen häuften sich, ihre Spiele wurden seltener, und schließlich schien sie selbst beim Gutenachtkuss an etwas anderes zu denken.
Nur wenn sie segelten, konnte sich Jens darauf verlassen, dass alles funktionierte, wie es sollte. Josefa hatte das Segeln im Blut, ihr Vater hatte es ihr beigebracht, noch ehe sie zur Schule ging, auch Jens hatte mit sechs schon die Kommandos gekannt und das Vorsegel geführt. Im Boot waren sie ein eingespieltes Team, und auf dem Wasser hielt sogar Josefa sich an die Regeln.
Zumindest bis zu jenem verhängnisvollen Montagmittag sechs Wochen früher, Anfang April, als alles seinen Anfang genommen hatte. Ein überaus heftiger Föhn wehte, daher waren auch kaum Boote auf dem Wasser. Sie segelten hart am Wind, und Jens schien, sie hätten den Hafen eben erst verlassen, als Joe bereits wieder rief: »Wir müssen rein, Matthias bringt mich sonst um. Klar zur Wende!«
»Wir sind doch eben erst raus«, schrie er in den Wind und brach damit eine der wichtigsten Regeln beim Segeln: Widersprich nie dem Steuermann. Joe zog mit einer Grimasse das Handy aus der Tasche und streckte es ihm entgegen, damit er sah, wie spät es war, gleich darauf wies sie energisch zum Hafen. Mit einem Handgriff machte sie das Großsegel etwas auf, Jens trotzte noch immer, also belegte sie die Pinne, stand auf und machte selbst die Fockschot los. Doch im selben Augenblick schoss ein mächtiger Katamaran wie aus dem Nichts an ihnen vorbei, Joe fuhr zurück und starrte auf das riesige Segel, das sich mit einem Mal zwischen sie und die Welt schob, dann verlor sie das Gleichgewicht und fiel über Bord. Sie hatte keine Anstalten gemacht, sich irgendwo zu halten, sie schrie auch nicht, fast reglos ließ sie sich fallen, und selbst im Wasser blieb sie träge. Für einige Sekunden, die Jens allerdings unendlich lang vorkamen, ließ sie sich treiben, als wäre sie bewusstlos, dann endlich hob sie doch noch den Kopf, schüttelte sich das Haar aus dem Gesicht und holte Luft.
Jens wusste, er musste ein Mann-über-Bord-Manöver segeln und das Boot aufschießen lassen. Doch in der Aufregung misslang das Manöver, und der Aufschießer geriet zu kurz, sodass das Boot von Joe wegtrieb. Hilflos sah er zu, wie sie sich Mühe gab, ihm nachzuschwimmen, sie trug allerdings eine windfeste Segeljacke, die sich unter der Schwimmweste plusterte und sie behinderte, vielleicht lähmte sie auch bereits die Kälte. »Mami!«, schrie er und warf ihr ein Tau zu, er war nahe daran, in Panik zu geraten. Inzwischen hatte sie aufgehört zu schwimmen, und kurz glaubte er, sie sinke trotz der Schwimmweste, doch dann rief sie nur: »Lass mal, ich schwimme an Land«, änderte die Richtung und begann zu kraulen, so gut es ging. Und dann lachte sie gar. »Scheiße, ist das kalt«, rief sie ihm zu.
»Das ist nicht zum Lachen«, brüllte Jens ihr nach, während ihm Tränen in die Augen schossen, doch sie hörte ihn nicht, denn inzwischen hatte Alex, der Bootsmeister, das Rettungsboot angeworfen, steuerte mit Vollgas auf sie zu und fischte Joe aus dem See.
Jens segelte das Boot allein in den Hafen, Alex half ihm, es festzumachen. Als sie das Bootshaus betraten, stand Joe nackt beim Waschbecken und versuchte, ihr Handy mit einem Föhn zu trocknen, sie hatte es offensichtlich selbst beim Schwimmen nicht losgelassen. Jens’ Schreck verwandelte sich in Wut, ihr blödes Handy schien ihr wichtiger zu sein als er, und er fragte sich, ob sie während des Unfalls auch nur einen Augenblick an ihn gedacht hatte. Als Alex ihr trockene Kleider aus seinem Spind brachte, nahm sie sie entgegen, ohne sich auch nur mit dem Handtuch zu bedecken, sie legte sie zur Seite und pulte erst eine durchnässte Tablettenschachtel aus der Tasche ihrer eigenen Jacke, nahm eine Pille und spülte sie mit Tee aus Alex’ Thermosbecher hinunter. Sie hatte dicke Gänsehaut und sah wie ein kleines Mädchen aus, nicht wie eine Mutter, aber das tat sie meist. Alex hatte sich verlegen abgewendet und setzte nochmals Wasser auf.
»Der war so was von schnell«, sagte sie bewundernd, während sie in seine Trainingshosen schlüpfte. »Ich dachte, ein Engel kommt geflogen.« Sie sprach vom Katamaran. »Dein Vater hat mir damals so einen versprochen«, sagte sie zu Jens, »so fing es überhaupt zwischen uns an.«
Für einen Moment vergaß Jens seine Wut. »Einen richtigen Katamaran?«, fragte er nach.
»Als er dann allerdings erfuhr, dass ich schwanger bin …« Sie zog die Brauen hoch und machte eine Geste, die eigentlich zwischen ihnen verboten war.
Sie schwiegen. Joe zog sich fertig an, Jens versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bekommen. Inzwischen rief Alex die Seepolizei an, um Entwarnung zu geben, für den Fall, dass jemand den Unfall beobachtet und Alarm geschlagen hatte.
»Ich habe geglaubt, du ertrinkst«, sagte Jens leise.
Josefa verdrehte nur die Augen. »Nun mach mal daraus kein Drama«, forderte sie, »wie du siehst, lebe ich noch.«
Sie versuchte nochmals, das Handy anzustellen – Jens bemerkte jetzt erst, wie sehr sie zitterte –, dann drückte sie ihm einen Kuss auf den Scheitel. »Ich müsste längst bei der Arbeit sein«, sagte sie zu Alex, dann ging sie zu ihrem Rad, das sie vor dem Bootshaus abgestellt hatte, und fuhr los.
»Wir wollten für morgen wieder ein Boot reservieren«, rief Jens ihr nach.
»Ich muss erst Matthias fragen, wann ich wegkann, ich mach’s telefonisch.«
»Versprochen?«
Er sah ihr nach, wie sie über den Parkplatz fuhr, einen Schlenker machte, als sie den Gang wechseln wollte, und fast von einem Auto gestreift worden wäre.
»Iss was«, rief er ihr nach, »du hast noch nichts gegessen.«
Sie winkte, ohne sich umzudrehen, und fuhr um die Ecke.
Alex machte inzwischen das Boot klar Schiff. »Das war ein schöner Schreck«, sagte er, als Jens zu ihm an den Steg kam.
Jens nickte. »Scheißferien sind das«, stellte er fest, während er sich endlich aus der Schwimmweste schälte. »Dabei hatte sie versprochen, sie nimmt sich frei und wir fahren endlich mal ans Meer.«
Alex nickte anerkennend. »Im Mittelmeer kann man gut segeln.«
»Ich will ja am liebsten an die Ostsee«, erwiderte Jens, »dort stammen wir her. Aber Mami dreht durch, wenn ich nur davon anfange. Sie will nach Cannes. Egal, sie kriegt sowieso nichts auf die Reihe.«
Alex lachte und ging zurück zum Bootshaus, während Jens das Gesicht in den Föhnwind hielt, die Augen schloss und sich vorstellte, er stehe am Meer.
Als er gegen Abend nach Hause kam – er war noch auf der Geburtstagsfeier seiner Schulkameradin Silvie gewesen, die in einer Konfettischlacht bei McDonald’s geendet hatte –, hängte er als Erstes Joes nasse Kleider in die Dusche. Sie hatte sie im Bootshaus liegen lassen, als gingen sie sie nichts an, und er hatte sie den ganzen Nachmittag über mit sich geschleppt. Danach las er die Post – sonderbare Post – und hörte den Anrufbeantworter ab. Joe hatte angerufen, und obwohl es jetzt bereits kurz nach sechs war, zu dieser Zeit in der Autovermietung Hochbetrieb herrschte und private Telefonate verboten waren, rief er zurück, um sich zu vergewissern, dass sie das Boot reserviert hatte.
»Hör zu, mein Schatz«, sagte sie allerdings, noch ehe er fragen konnte, »ich bin zum Essen eingeladen. Kommst du allein klar?«
»Klar komme ich allein klar«, sagte Jens. »Aber heute kommt Bonanza.« Joe liebte die Serie so sehr wie er, und üblicherweise aßen sie vor dem Fernseher zu Abend, um mit vollem Mund über die Cartwrights herzuziehen.
»Du kannst mir dann erzählen«, sagte Joe, die gleichzeitig etwas zu tippen schien.
»Mit wem gehst du aus?«, fragte er.
Sie tippte erst zu Ende, dann sagte sie: »Mit Kurt.«
»Welchem Kurt?«
»Welchem Kurt«, äffte sie ihn nach. »Du weißt, welchem Kurt, demselben wie letztes Mal, unserem Hausarzt.«
Natürlich hatte Jens gewusst, welchen Kurt sie meinte, nur war der verheiratet und eine jener halben Sachen, die er bei seiner Mutter nicht ausstehen konnte.
»Kauf dir etwas Feines zu essen«, sagte sie, »sieh dir Bonanza an, und danach verschwinde ins Bett, klar?«
»Gehst du in Alex’ Trainingsanzug essen?«, fragte er. Damit lieferte er ihr das Stichwort, um ihm mitzuteilen, dass sie das Boot reserviert hatte.
Einen Augenblick stutzte sie, doch sie schien nicht ans Boot zu denken, sondern sich zu überlegen, ob sie es Kurt tatsächlich antun wollte, in einem ausgeleierten Trainingsanzug zu seiner Einladung zu erscheinen. »Muss ich wohl«, sagte sie schließlich, »Matthias hat mir den Schließdienst aufgebrummt.«
Kurz überlegte Jens, das Boot selbst anzusprechen, doch das war nicht dasselbe – einmal wenigstens sollte sie von selbst daran denken. Also hielt er sie hin. »Da ist ein Brief aus Lütjenburg«, verkündete er.
Wieder zögerte sie. »Schmeiß ihn weg«, sagte sie dann.
»Es ist aber etwas Offizielles«, erklärte er, ehe er sich den Brief angelte und das Fettgedruckte vorlas: »Macht eine Grabstelle infolge anhaltender Verabsäumung der Pflegepflicht einen verwahrlosten Eindruck, so erlischt das …«
»Unwichtig«, unterbrach Joe ihn.
»Lars Friedrich Bergström, das war dein Papa, oder?«
»Ja«, sagte sie gereizt, »aber er war ein Arschloch, und wenn ich nicht aufhänge, hackt Matthias mir den Kopf ab.«
»Was heißt Pflegepflicht?«, fragte Jens, als hätte er sie nicht gehört. »Und Verabsäumung?«
Sie stöhnte. »Sie wollen wissen, ob ich ihnen Kohle in den Rachen schmeiße, damit sie das Grab nett aussehen lassen, der Brief kam schon mal.«
»Und schmeißt du?«
»Ich weiß es nicht.«
»Und was passiert mit dem Grab, wenn nicht?«
Er hörte im Hintergrund Matthias reden.
»Jens, können wir das morgen abhandeln?«, fragte Joe ungewohnt freundlich, wahrscheinlich stand Matthias in Hörweite.
»Klar«, sagte er. »Mit welchem Geld?«
Joe stieß einen kleinen Schrei aus. »Was heißt ›mit welchem Geld‹?«
»Kaufe ich mir was zu essen?«
»Sieh in meinem Necessaire nach, in der Außentasche.«