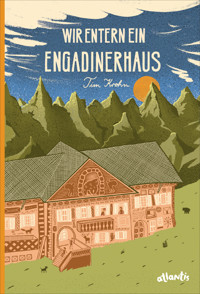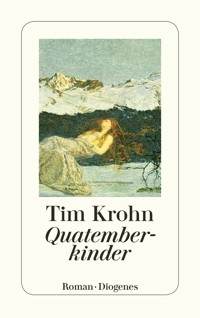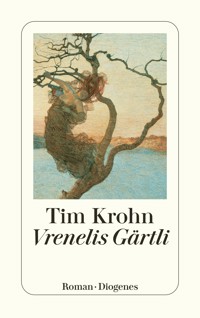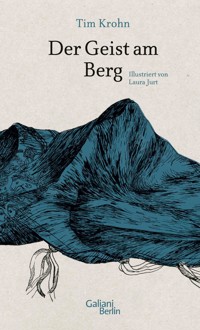9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Menschliche Regungen
- Sprache: Deutsch
Die große (Gefühls-)Welt, gespiegelt in der kleinen Welt eines Mehrfamilienhauses in Zürich. Es geht um Neuaufbau und das Arbeiten an Utopien: Die Schauspielerin Selina May träumt davon, zu ihrer Jugendliebe nach Berlin zu ziehen, und der Forscherdrang des risikofreudigen Studenten Moritz Schneuwly treibt ihn zu immer neuen Experimenten. Seine geliebte Mary ist aus New York zurück, reist aber gleich nach Amsterdam weiter, um dort ein neues Leben als Studentin zu beginnen. Pit aus dem zweiten Stock hat sein Studium abgebrochen und ist fasziniert von der lebensfrohen Mutter seiner Freundin Petzi, die gerade ihr Leben noch einmal neu entwirft und ihn auf eine Reise nach Griechenland mitnimmt. Beim alten Erich Wyss treibt der Frühling bisweilen seltsame Blüten, und Julia Sommer muss nicht nur sehr um ihr "Gärtlein" kämpfen, sondern plötzlich sogar um ihr Leben. Auch diesmal lässt Tim Krohn seine Figuren und Leser Gefühle aller Couleur durchleben. Und natürlich gärtnert nicht nur Julia Sommer – es wird viel gesät, gejätet, gestutzt und gepflegt in diesem Band: Pflanzen auf Fenstersimsen, Balkonen und in Garten – und Gedanken und Lebensentwürfe in den Köpfen vieler Figuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tim Krohn
Julia Sommer sät aus
Menschliche Regungen ~ Band 3
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tim Krohn
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tim Krohn
Tim Krohn, geboren 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Seine Romane Quatemberkinder und Vrenelis Gärtli machten ihn berühmt. 2015 veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband Nachts in Vals. Der Auftaktband des ›Menschliche Regungen‹-Projekts, Herr Brechbühl sucht eine Katze, war wochenlang in den Schweizer Bestsellerlisten. Zuletzt erschien der zweite Band, Erich Wyss übt den freien Fall.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die große (Gefühls-)Welt, gespiegelt in der kleinen Welt eines Mehrfamilienhauses in Zürich: im dritten Band der Reihe ›Menschliche Regungen‹ nehmen die großen Züge von Tim Krohns Romanserie sichtbar Gestalt an; es geht um Neuaufbau und das Arbeiten an Utopien.
Die Schauspielerin Selina May träumt davon, zu ihrer Jugendliebe nach Berlin zu ziehen, und der Forscherdrang des risikofreudigen Studenten Moritz Schneuwly treibt ihn zu immer neuen Experimenten. Seine geliebte Mary ist aus New York zurück, reist aber gleich nach Amsterdam weiter, um dort ein neues Leben als Studentin zu beginnen. Pit aus dem zweiten Stock hat sein Studium abgebrochen und ist fasziniert von der lebensfrohen Mutter seiner Freundin Petzi, die gerade ihr Leben noch einmal neu entwirft und ihn auf eine Reise nach Griechenland mitnimmt. Beim alten Erich Wyss treibt der Frühling bisweilen seltsame Blüten, und Julia Sommer muss nicht nur sehr um ihr »Gärtlein« kämpfen, sondern plötzlich sogar um ihr Leben.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Christina Hucke, Frankfurt/Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Christina Hucke, Frankfurt
Lektorat: Angelika Winnen
ISBN978-3-462-31841-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Begriffe
Fröhlichkeit
Respekt
Großmut
Wissbegierde
Beherztheit
Unternehmungslust
Überschwang
Déjà-vu
Eigenliebe
Geselligkeit
Wahnwitz
Leichtigkeit
Behaglichkeit
Grenzüberschreitung
Resolutheit
Nörgelei
Liebenswürdigkeit
Adrettheit
Intuition
Charme
Bescheidenheit
Verfressenheit
Auffallen
Atemlosigkeit
Unaufgeräumtheit
Zähheit
Kribbeligsein
Verträumtheit
Nostalgie
Melancholie
Selbstbewusstsein
Humor
Gelassenheit
Begehren
Zuverlässigkeit
Skandal
Sensibilität
Fantasie
Natürlichkeit
Reiselust
Zauder
Erschrecken
Verlust
Synästhetik
Romantik
Heißsporn
Naivität
Knorrigkeit
Naturverbundenheit
Einfühlungsvermögen
Subtilität
Verführung
Verbundenheit
Redelust
Dekadenz
Forscherdrang
Edelmut
Kühnheit
Betörtheit
Zerstreutheit
Galanterie
Takt
Glaube
Ehrlichkeit
Nachbemerkung
Liste der in diesem Band beschriebenen menschlichen Regungen und ihrer Unterstützer
Anhang
Im Anhang finden Sie sämtliche Begriffe, die im Lauf des ›Menschliche-Regungen‹-Projekts mit Leben gefüllt werden sollen. Alle Begriffe, die in diesem Band und den bisher erschienenen Bänden der Serie bereits eine Geschichte bekamen, wurden gefettet.
Fröhlichkeit
Eigentlich hatte Julia Sommer nicht vorgehabt, bis Mitternacht aufzubleiben. Doch dann hatte sie sich im Bad vertrödelt – mit lackierten Zehennägeln das neue Jahr zu beginnen, schien ihr plötzlich ein eleganter Ausweg, um die ungeputzte Wohnung wettzumachen, außerdem war es dort am wärmsten –, und danach führte eines zum anderen: Fersenpeeling, Beinwachs, Achsel- und Intimrasur. Zweimal wurde sie weggerufen, weil im Hof Jugendliche Böller in die Müllcontainer warfen und Mona davon wach wurde, zudem sandte ihre Mutter eine SMS – nicht um einen guten Rutsch zu wünschen, sondern um sie daran zu erinnern, dass Mona Ersatzwäsche brauchte, wenn Julia sie ihr am nächsten Morgen wie verabredet zum Schlittenfahren brachte.
Und schon war es zwölf Uhr. Julia schlich ins Zimmer und küsste ihr schlafendes Kind auf die Stirn. Dann stellte sie sich ans Fenster, malte sich aus, wie Moritz Schneuwly, der Student aus dem zweiten Stock, auf irgendeiner Party ausgelassen mit dieser Mary tanzen mochte, die über die Feiertage bei ihm zu Besuch war, und tröstete sich damit, dass sie sich in Erinnerung rief, was sie im vergangenen Jahr alles geleistet hatte. Dieses Jahr, nahm sie sich vor, würde sie sich ab und zu einfach mal zurücklehnen und durchatmen. Obwohl sie keine Ahnung hatte, wie sie das anstellen sollte. Dann klopfte es überraschend an den Türrahmen, Moritz hatte sich in die Wohnung geschlichen, deren Tür sie oft erst abschloss, ehe sie zu Bett ging, trat hinter sie und umarmte sie von hinten, wobei er flüsterte: »Frohes neues Jahr.«
Sie hätte ihn gern darauf aufmerksam gemacht, dass sie unterm Bademantel nichts anhatte, stattdessen fragte sie: »Wo ist Mary?«
»Sitzt in der Badewanne«, sagte er, »seit einer Stunde. Wir waren in der Semper-Sternwarte. Am Himmel gab es nicht viel zu sehen, aber Mary hat sich auch vor allem für das alte Zeiss-Teleskop interessiert. Allerdings war sie viel zu leicht angezogen und kam völlig durchfroren nach Hause. Um Mitternacht habe ich in der Küche gestanden und ihr Punsch gekocht, danach habe ich auf dem Klodeckel gesessen und ihr Horoskope vorgelesen. In meinem stand etwas wie: ›Suchen Sie nicht zu weit, und vor allem: hören Sie auf Kinder.‹ Daraufhin hat Mary gesagt: ›Geh und sieh nach, ob bei Julia und Mona Licht brennt. Wir müssen unbedingt noch hoch.‹«
»Warum?«, wollte Julia wissen.
»Keine Ahnung«, sagte Moritz. »So ist sie eben.«
Julia setzte Teewasser auf, zog Unterwäsche und warme Socken an, und dann stand Mary schon in der Tür, rotwangig vom Bad, in einem bezaubernden, afrikanisch anmutenden Wollkleid und nach Moritz’ Aftershave duftend. Sie umarmte Julia und sagte: »Heute in der Sternwarte dachte ich die ganze Zeit: Es ist falsch, dass die beiden nicht dabei sind.«
»Wir sind nie irgendwo dabei«, sagte Julia. »Mona geht um acht Uhr ins Bett. Wobei der Plan heute nicht ganz aufgegangen ist.« Mona hatte nämlich gerade einen Wachstumsschub, und ihr Sternchenpyjama war zu klein geworden. Zu Weihnachten hatte sie einen neuen bekommen, den sie, quasi zu Ehren des neuen Jahres, an diesem Abend einweihen sollte. Sie hatte sich aber geweigert, sie wollte ihren Sternchenpyjama haben und keinen anderen, »und zwar nie, bis ich groß bin.« Dabei konnte sie, da er Füßlinge hatte, nicht einmal mehr die Beine darin strecken, was dazu führte, dass sie im Schlaf strampelte und dauernd Julia weckte. Sie hatte Julia schließlich sogar ihren momentan größten Schatz, ihre beiden Münzen, angeboten, nur damit Julia ihr den Pyjama ließ. Schließlich hatten sie sich auf eine regelrechte Transaktion geeinigt: Mona behielt ihr Geld, dafür schnitten sie vom Sternchenpyjama die Füßlinge ab, und von nun an würde Mona abwechselnd ihren alten Pyjama ohne Füßlinge tragen und den neuen, über den sie aber die abgeschnittenen Füßlinge des Sternchenschlafanzugs ziehen durfte, und zwar so lange, bis der neue Pyjama auch ein alter war und Mona gerade so lieb wie der mit den Sternchen.
Über diesem Handel war es neun Uhr geworden. Danach war Mona eingefallen, dass sie ja Moritz hatte anrufen wollen, und als der nicht abgenommen hatte, hatte sie dafür auf dem Spieltelefon mit Friedel Fertig, einem ihrer unsichtbaren Freunde, telefoniert, der ihr stets die sonderbarsten Witze verriet, die Mona anschließend einen nach dem anderen Julia erzählte, obwohl sie sie oft selbst nicht lustig fand. »Immerhin ging über alldem die Flasche Kindersekt vergessen«, sagte Julia schließlich zu Mary und Moritz, »die können wir jetzt köpfen.«
Und da der Plastikkorken knallte wie ein echter, war damit auch Mona wieder wach. Als sie hörte, dass es ein Uhr nachts war und das neue Jahr begonnen hatte, sprang sie gleich auf, setzte sich fröstelnd an den Küchentisch und erklärte: »Jetzt gießen wir Blei.«
»Ich habe kein Blei«, sagte Julia und holte ihr ein Strickjäckchen. »Außerdem gießt du morgen bei Oma schon Blei.«
»Ich will aber jetzt«, beharrte Mona, »und Moritz hat bestimmt Blei.«
Moritz hatte ebenfalls keines. Doch Julia hatte inzwischen ein paar Teelichter angezündet, und Mary sagte: »Man kann genauso gut Wachs gießen. Wir müssen nur warten, bis die Kerzen in den Töpfchen geschmolzen sind.«
So lange spielten sie ein Spiel, von dem Mona behauptete, Friedel Fertig habe es ihr beigebracht. »Jeder sagt einen Satz, und das ergibt dann eine Geschichte«, verkündete sie. »Der, bei dem die Geschichte fertig ist, hat verloren.« Sie fing gleich an: »Mama hat sonst nie rote Zehennägel.«
Darauf fiel so schnell keinem etwas ein.
»Hurra, ihr habt alle verloren und müsst mir etwas geben«, rief sie.
»Moment«, bremste Julia. »Mama hat sonst nie rote Zehennägel, aber ein altes Sprichwort sagt: ›Rote Nägel im neuen Jahr geben Kraft für Seele und Haar.‹«
»Ganz so, wie, wer die Wimpern tuscht«, fuhr Moritz fort, »beschwingter durch den Winter huscht.«
Damit war das Spiel sofort wieder vergessen, Mona klatschte in die Hände, rannte ins Bad und brachte Julias Schminke, um Moritz anzumalen. Mary half ihr erst dabei, danach schminkte sie Mona als Glücksfee.
Inzwischen war das Kerzenwachs flüssig, Julia stellte ein Becken Wasser auf den Tisch, und Mary goss als Erste ihre Glücksfigur.
»Oje«, sagte sie und drehte sie zwischen den Fingern. »Das sieht aus wie ein Engerling.«
»Was ist ein Engerling?«, fragte Mona.
»Daraus schlüpfen Maikäfer«, erklärte ihr Moritz.
Das gefiel Mona. »Maikäfer flieg«, sang sie, und Moritz und Julia sangen mit.
»Nicht dieses Lied, mich macht das traurig«, bat Mary, deren Eltern gerade in Trennung lebten.
»Aber fliegen ist doch schön«, rief Mona. »Ich wäre jedenfalls gern ein Maikäfer.« Dann goss sie selbst, das heißt, Moritz hielt das heiße Schälchen, sie hielt seine Hand und kippte sie über dem Becken. »Ich habe keinen Engerling, aber einen Engeling«, rief sie, noch ehe sie das Wachs aus dem Wasser gefischt hatte.
»Sieh es dir doch erst an«, schlug Julia vor.
»Muss ich nicht, Mama«, entgegnete sie. »Ich war doch im Krippenspiel ein Engel. Ich weiß genau, daraus schlüpft wieder einer. Jetzt du.«
Julia goss etwas Größeres, das einem Keimling glich, und mehrere Kügelchen, in denen sie Samenkörner sah. »Ich werde definitiv gärtnern«, sagte sie mit leiser Enttäuschung. »Allerdings braucht man dazu keine lackierten Nägel.«
»Kommt darauf an«, sagte Mary. »Ich als Engerling ließe mich jedenfalls lieber von einem schön gepflegten Fuß zertreten als von einem Gummistiefel.«
Julia lachte und stellte fest: »Ich werde von nun an sowieso keine Engerlinge mehr zertreten können.«
»Außerdem hast du die Nägel für Seele und Haar bemalt«, erinnerte sie Moritz, »und zumindest Seele kann auch beim Gärtnern nicht schaden.« Dann goss er seine Glücksfigur, drehte sie lange zwischen den Fingern, ohne dass die anderen sie sehen durften, und sagte schließlich verlegen: »Ich kann mir nicht helfen, ich habe einen Embryo gegossen.«
»Was ist schon wieder ein Embryo?«, fragte Mona.
»Ein ungeborenes Kind«, sagte er.
»Zeig her«, bat Mona, nahm ihm das Figürchen ab und musterte es ebenfalls sehr lange. »Ich sehe noch etwas anderes«, sagte sie schließlich. »Das Kind hat etwas in der Hand. Friedel Fertig sagt, es ist ein Mixer. Ich glaube aber, es ist eine Trompete. Vielleicht ist dein Kind ja auch ein Engel, Moritz, dann fliegen wir zu dritt, wie Schmetterlinge. Und Mama ist unser Gärtchen.«
»Ganz so, wie, wer die Wimpern tuscht, beschwingter durch den Winter huscht«, zitierte Mary und grinste.
»Darauf müssen wir unbedingt anstoßen«, erklärte Mona in einem Ton, als wäre sie Oma Lisbeth, und stieg auf den Stuhl, um den Rest Kindersekt auf die Gläser zu verteilen. Dabei sagte sie: »Das wird ein richtig schönes Jahr.«
Respekt
Als Moritz am nächsten Morgen Julia und Mona an der Tramhaltestelle nicht weit vom Haus begegnete, hatten sie ihren pinkfarbenen Bobschlitten dabei, und Julia erklärte Mona gerade, dass es ein Fehler von ihr, Julia, gewesen war, die Nachbarin unter ihnen, Efgenia Costa, eine dumme Kuh zu nennen.
»Aber ist sie denn keine?«, fragte Mona, während sie Moritz’ Bein umarmte.
Julia zögerte, dann sagte sie ausweichend: »Menschen sind Menschen, und Kühe sind Kühe, also können Menschen keine Kühe sein.«
»Was hat sie denn getan?«, wollte Moritz wissen.
»Sie hat uns angeschnauzt, und zwar für nichts«, erzählte Julia. »Im Keller war eine Pfütze, und als sie uns mit dem Bob sah, schrie sie gleich los, dass Kinder immer Schweinereien machen müssen und Schnee und Matsch reinschleppen.«
»Dabei war ich noch gar nicht schlittenfahren, ich gehe erst«, fügte Mona hinzu.
»Das haben wir ihr auch gesagt, worauf sie aber nur meinte, irgendwoher müsse diese Pfütze schließlich kommen«, erzählte Julia, »und als ich wissen wollte, ob sie damit etwa sagen wolle, dass wir lügen, gab die dumme Kuh doch echt zur Antwort: ›Von dir will ich das nicht sagen, aber Kinder lügen nun mal, wann immer sie können.‹«
»Jetzt hast du es schon wieder gesagt«, rief Mona und hüpfte vor Freude.
»Ja, so was regt mich eben auf«, antwortete Julia.
»Aber ich lüge wirklich manchmal, oder jedenfalls schwindle ich«, sagte Mona treuherzig.
»Ja und, ich auch«, sagte Julia. »Aber Kinder lügen erstens nicht immer, sie lügen vielleicht manchmal, und zweitens weiß ich von dir, dass du nur lügst, wenn es gar nicht anders geht.«
»Also darf man lügen, wenn es gar nicht anders geht?«, fragte Mona.
»Nein«, sagte Julia. »Genauso wenig, wie ich diese dumme Kuh eine dumme Kuh nennen darf.«
»Auch nicht, wenn man so gute Gründe hat wie du?«, fragte Moritz.
»Nein, gute Gründe machen es vielleicht verzeihlich, richtig wird es aber dadurch nicht«, antwortete sie. »Genauso wenig wie das Lügen.«
»Das mit der Pfütze war übrigens ich«, erzählte er. »Ich wollte heute früh schnell mit dem Fahrrad zum Bahnhof, um Brötchen zu holen.«
»Bei dem Schnee?«, rief Julia.
»Ja, das war ein Fehler«, gestand er. »Immerhin bin ich weich gefallen. Aber ich hatte danach keine Lust, noch den Schnee vom Rad zu klopfen. Jedenfalls werde ich bei Costas vorbeigehen und die Sache klären.«
»Danke«, sagte Julia. »Hast du dir wehgetan?«
»Das Schienbein ist ein bisschen lila«, sagte er, »aber gebrochen ist nichts.«
»Du musst Olivenpaste drauftun«, riet ihm Mona.
»Nicht Olivenpaste, Enelbinpaste«, korrigierte Julia. »Willst du welche, Moritz? Ich gebe dir den Schlüssel, sie steht im Kühlschrank.«
»Nicht nötig«, meinte Moritz aber, und dann kam schon Julias und Monas Tram.
Beim Einsteigen fragte Julia wieder: »Wo ist Mary? Ist sie schon abgereist?«
»Nein, sie trifft nur eine Freundin«, sagte Moritz. »Sie bequatschen Frauendinge.«
»Nicht so despektierlich«, lachte Julia. »Sei lieber froh, dass du sie dir nicht anhören musst.«
Er grinste, dann ging er heim in die Röntgenstrasse und gleich als Erstes in den dritten Stock zu Efgenia Costa.
»Ja?«, sagte die nur, als sie öffnete. Sie trug Trainingshosen und ein Top mit Spaghettiträgern, das so ausgeleiert war, dass er die Brüste sah.
»Ich war das mit der Pfütze, und es tut mir leid«, sagte er. »Ich war mit dem Rad draußen.«
Sie starrte ihn kurz an, als wüsste sie nicht, wovon er sprach, dann sagte sie mehr erklärend als entschuldigend: »Bei dieser Kälte meldet sich der Rücken wieder. Und mein Mann ist nicht da.«
»Kann ich irgendwie helfen?«, erkundigte er sich.
Sie überlegte. »Hast du Kaffee im Haus? Meiner ist ausgegangen. Ein Espresso würde mir guttun.«
»Den koche ich dir, komm mit«, schlug er vor.
»Ich ziehe mir noch etwas über«, sagte sie und verschwand in der Wohnung. Als sie nachkam, trug sie ein Sweatshirt mit einem rosa Mäusekopf darauf und hatte das Haar hochgesteckt. »Darf man bei dir rauchen?«, fragte sie als Erstes.
»Du ja«, sagte Moritz.
Doch sie hatte die Zigaretten oben vergessen, und er hatte keine anzubieten. So trank sie den Espresso nur schnell im Stehen.
»Hier«, sagte sie zwischen zwei Schlucken und legte eine große Murmel auf den Tisch. »Die ist dem Mädchen im Sommer vom Balkon gefallen und hat uns eine Delle in den Tisch geschlagen. Gib sie ihr wieder.« Es war eine klare Glasmurmel mit eingeschlossenem Kätzchen.
»Mache ich«, versprach er. »Mona ist übrigens kein Kind, das lügt.«
»Kann sein«, sagte Efgenia. »Ich habe nicht viel Erfahrung mit Kindern. Die meiner Schwester sind die Pest und lügen wie gedruckt.«
»Warum habt ihr keine?«, fragte Moritz so direkt, wie es seine Art war.
Sie schien nichts dabei zu finden. »Wir können keine haben«, sagte sie offen.
»Aber es gibt doch immer Wege, ein Kind zu bekommen, wenn man eines möchte«, wandte er ein.
Und plötzlich wurde ihr Blick wach. Sie musterte ihn interessiert und mit leichtem Spott, dann fragte sie: »Machst du mir da gerade ein Angebot?«
Moritz lachte. »Daran hatte ich gar nicht gedacht«, gestand er. »Aber ich mag deinen Mann.«
»Ja, ich mag ihn auch«, antwortete Efgenia Costa und ging zur Tür. »Außerdem sollte man nicht gleich am ersten Tag des Jahres seine Vorsätze brechen.«
Das erinnerte Moritz daran, dass er seine Eltern anrufen und ein frohes neues Jahr wünschen wollte, und sobald Efgenia die Tür zugezogen hatte, griff er nach dem Telefon. Eigentlich hatte er vorgehabt, sie in Biel zu besuchen, denn seine Schwester Celine kam ebenfalls nicht nach Hause, sondern war mit Freunden in die Berge gefahren, und er fand die Vorstellung etwas trübselig, dass sie ganz allein feierten. Ihnen schien das allerdings nichts auszumachen, und sie verschonten ihn auch mit Fragen. Sein Vater sagte nur: »Überarbeite dich nicht« – was Moritz dazu brachte, sich, nachdem sie aufgelegt hatten, wieder einmal an den Schreibtisch zu setzen, um mit seiner Abschlussarbeit weiterzukommen.
Dort blieb er jedoch nicht lange, denn eher als erwartet kam Mary wieder. »Uff«, rief sie und ließ sich aufs Bett fallen. »Meine Freundin Gisela ist bei Scientology gelandet, was sagt man dazu?«
»Die Backweltmeisterin?«, fragte Moritz. »Oh. Willst du einen Schnaps?«
Sie mochte lieber Tee, und so wechselten sie in die Küche. Während er Wasser aufsetzte, spielte sie mit der Murmel, roch an ihr und sagte: »Die stinkt, diese Murmel. Die stinkt bestialisch nach Möse. Woher hast du sie?« Dann stand sie auf und wusch sich die Hände.
»Wasch die Murmel gleich mit«, bat er.
Stattdessen setzte sie ein zweites Töpfchen Wasser auf, versetzte es mit Essig und legte die Murmel hinein. »Vielleicht springt sie«, sagte sie. »Aber anders kriegst du sie nicht keimfrei.«
»Sie gehört nicht mir«, antwortete er und überlegte, was er preisgeben durfte. »Sie war mal Monas«, sagte er schließlich nur, »jemand hat sie sich geliehen und mich gebeten, sie ihr wiederzugeben.«
Mary fragte nicht nach, sondern sah ihn nur mit einer Mischung aus Amüsement und Ekel an und sagte: »Bekanntschaften hast du!« Dann wechselte sie das Thema: »Jedenfalls will Gisela nach Amerika oder besser gesagt auf ein Schiff, das angeblich außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer kreuzt und auf dem sich das Headquarter der Scientologen befinden soll. Sie will da dienen. ›Dienen‹ – das war ihr Wort.«
»Was hast du ihr darauf gesagt?«, wollte Moritz wissen.
»Was hättest du gesagt?«, fragte sie zurück.
»Dass die Scientologen Hirnwäsche betreiben«, antwortete Moritz, ohne zu zögern. »Dass sie Leute bis auf die Unterwäsche plündern und in den Selbstmord treiben. Dass sie eine Herrenrassen-Ideologie betreiben und wie die Nazis Straflager unterhalten. Es gibt noch andere Parallelen zu den Nazis.«
Mary sah ihn traurig an. »Wirklich?«, fragte sie. »Das wusste ich alles gar nicht. Ich wusste nur, dass es eine Sekte ist. Und ich habe gar nicht viel gesagt, ich habe Gisela umarmt und ihr alles Gute gewünscht. Dann habe ich ihr die Nummer von Shirley gegeben, der Anwältin, für die ich in New York gearbeitet habe, und wir haben noch kurz über 9/11 gesprochen. Shirley geht es übrigens gut, sie hat jetzt ihr Büro in Upper Manhattan. Danach hatten Gisela und ich nicht mehr viel zu reden.« Sie drehte kurz stumm die Tasse in den Händen. »Ich bin es gewohnt, darauf zu vertrauen, dass die Menschen wissen, was sie tun«, sagte sie schließlich, »ich würde nicht wollen, dass jemand mir in meine Pläne hineinredet. Aber glaubst du, es gibt da eine Grenze? Was, wenn jemand nicht bei Verstand ist? Betrunken oder alt oder einfach verwirrt? Wann kommt der Punkt, an dem man einschreiten muss?«
Moritz dachte nach, dann sagte er: »Ich glaube, nie. Einschreiten nie. Die Meinung sagen, ja, das muss man dürfen. Und man sollte bereit sein, die Scherben aufzuwischen, wenn jemand sich verrannt hat – oder ihm rechtzeitig klarmachen, dass man dazu nicht bereit ist. Wir können ja selber nie wissen, ob wir im Recht sind.«
Den letzten Satz verpasste Mary, sie schoss plötzlich hoch und rannte zum Herd. »Das ganze Wasser ist schon verdampft«, sagte sie, und als sie den Topf zur Seite schob, glühte die Platte. »Ich fürchte, ich habe den Topf ruiniert«, sagte sie.
»Bloß nicht abschrecken«, riet Moritz. »Sonst zerspringt die Murmel.«
»Weiß ich doch«, sagte Mary leicht gereizt und hob sie mit einem Geschirrtuch heraus. »Immerhin, die Keime müssten dahin sein.«
Großmut
Es war die blanke Gier, die Efgenia Costa getrieben hatte, Adamo nach St. Moritz zu schicken. Als Frau Wichmann vom Zürichberg, der er nicht nur den Garten pflegte, sondern deren Hund er auch in den letzten Tagen gefüttert hatte, ihn zu Silvester spätnachmittags anrief, bereitete Efgenia eben in der Küche Häppchen zu, denn sie planten, die ganze Nacht lang John-Travolta-Filme zu sehen. Deshalb bekam sie vom Anruf zunächst gar nichts mit. Erst als Adamo in Jacke und Schuhen in der Küchentür erschien, sagte: »Ich gehe noch mal den Hund füttern«, und Efgenia fragte: »Ja, sind denn die Nachbarn noch immer nicht zurück?«, erfuhr sie, dass jene Nachbarn, die eigentlich Frau Wichmanns Hund hätten hüten sollen, sich im Skiurlaub eine Grippe geholt hatten und Frau Wichmann Adamo eigentlich angerufen hatte, um ihn zu bitten, Mister zu ihr zu bringen, weil sie ihn vermisste und befürchtete, das oft recht üppige Silvesterfeuerwerk am Zürichberg werde ihn panisch machen. »Wenn sie in Zürich bleibt, fährt sie sonst extra mit ihm aus und verbringt den Jahreswechsel irgendwo abgeschieden im Wald«, erzählte er. »Aber ich habe ihr gesagt, wir bereiten gerade eine kleine Feier vor.«
»Natürlich bringst du ihr den Hund«, rief sie, denn sie dachte an den Testamentsentwurf mit seinem durchgestrichenen Namen, den sie in Frau Wichmanns Sekretär gefunden hatte, als sie ihn einige Tage zuvor zur Fütterung begleitet hatte. Und als Adamo sagte: »Dann fahren wir aber alle beide«, antwortete sie ebenso entschieden: »Ganz sicher nicht. Erstens hält mein Rücken drei Stunden Zugfahrt nicht aus, zweitens kann es nicht schaden, wenn du mit der Wichmann Silvester feierst.«
Adamo zögerte. »Ich glaube kaum, dass sie allein nach St. Moritz gefahren ist. Und überhaupt – sie ist nicht, wie du denkst.«
»Ich denke überhaupt nichts«, sagte Efgenia. »Ich will nur, dass du dich so nett aufführst, dass sie dich wieder in ihr Testament aufnimmt.«
Also warf er sich in Schale, holte Mister ab und brachte ihn ins Engadin, während sie den Silvesterabend mit drei Flaschen Bier vor dem Fernseher verbrachte. »Du brauchst mich um Mitternacht übrigens nicht anzurufen«, hatte sie beim Abschied gesagt, dennoch kränkte es sie etwas, dass er nur um zehn Uhr eine SMS schrieb: »Gehen mit Mister auf Schneeschuhwanderung. Werde keinen Empfang haben. Denke an dich.«
»Guten Rutsch«, schrieb sie zurück, und gleich hinterher: »Bitte nicht wörtlich nehmen«, was sie recht witzig fand. Doch Adamo reagierte schon nicht mehr.
Trotzdem brachte Efgenia den Jahreswechsel mit Anstand hinter sich. Sie telefonierte mit ihren Eltern, dadurch verschob sich ihr Ärger, denn die planten, Efgenias nimmersatter Schwester Eleni von ihrer Rente einen Minivan zu spendieren. Kurz nach ein Uhr ging sie zu Bett und schlief auch nicht schlecht. Allerdings erwachte sie früh und trauerte dem geplanten Katerfrühstück mit Adamo nach, das sie im Bett hatte servieren wollen. Für sich allein wollte sie nichts zubereiten und aß nur ab und zu einen Happen direkt aus dem Kühlschrank, während sie Haushaltskram erledigte. Adamo hatte sich die ganze Nacht über nicht gemeldet, und allmählich wurde sie sauer. Als sie in die Waschküche ging, stritt sie sich zu allem Überfluss mit Julia Sommer, und als endlich Adamo anrief (es war erst neun Uhr), war Efgenia so verstockt, dass sie ihm nicht einmal ein gutes neues Jahr wünschen wollte.
»Weißt du was, ich nehme den nächsten Zug«, sagte er gutmütig, »und wir machen uns noch einen richtig schönen Tag.«
»Nein, ich will dich hier gar nicht haben«, sagte sie, obwohl das so nicht stimmte. »Wenn wir schon Silvester opfern, sollst du auch das Maximum herausholen. Außerdem würden wir uns sowieso nur streiten. Ich gehe nachher spazieren, das wird mich beruhigen.«
Und er widersprach ihr auch nicht, sondern sagte: »Meinetwegen, dann werde ich noch mit Frau Wichmann frühstücken. Sie ist übrigens tatsächlich allein hier. Aber alles ist ganz harmlos, wir unterhalten uns nur.«
»Worüber?«, fragte sie misstrauisch.
»Es sind philosophische Gespräche«, sagte er, und das brachte sie dann beide zum Lachen.
Nachdem sie gesaugt und sogar gebügelt hatte, zog sie sich dick an, denn die Kälte war weiterhin schneidend, fuhr zum Zoo hoch und wollte eigentlich durch den Wald spazieren. Doch sehr bald stand sie vor Frau Wichmanns Haus. Und da Adamo bei jener Fütterung einige Tage zuvor keine Anstalten gemacht hatte, das Schlüsselversteck geheim zu halten, trat sie auch ein.
Es sollte ihre kleine Revanche dafür sein, dass die Wichmann ihren Mann in Beschlag nahm. Doch bereits als sie die Treppe von der Garage ins Haus hochstieg, wechselte Efgenias Stimmung. Der Duft von Arven und Bienenwachs, dazu das sanfte silbrige Licht, das durch die hohen, unverbauten Fenster drang und selbst den kalten, öden Winternachmittag irgendwie besonders wirken ließ, machte sie von einem Augenblick zum andern weich. Sie fühlte sich wie umarmt, und alle Kampfeslust und Feindseligkeit löste sich einfach auf. Sie ließ die Platte von Ella Fitzgerald laufen, die Adamo bei ihrem ersten Besuch ein paar Tage zuvor abgespielt hatte, und ganz wie damals setzte sie sich zu Boden und lehnte sich an die Chaiselongue, um den Weihnachtsbaum zu betrachten. Ohne brennende Kerzen fand sie ihn irgendwie noch berührender.
Und in dieser Laune schien es ihr plötzlich völlig unbedenklich, dass Adamo bei dieser Wichmann war. Mochten sie sich doch amüsieren, mochten sie sogar miteinander schlafen. Was bedeutete das schon? Das Leben war schwierig genug, es gab wirklich keinen Grund, einander ein bisschen Vergnügen zu neiden. Aus dieser Anwandlung heraus schrieb sie ihm: »Ich genieße das neue Jahr, tu du das bitte auch.« Diesmal schrieb er gleich zurück, allerdings die falschen Worte: »Ich liebe dich.« Sie konnte es sich nicht verkneifen nachzufragen, ob er ein schlechtes Gewissen habe, daraufhin rief er an und sagte: »Ich habe in einer besseren Besenkammer in Pontresina geschlafen, sonst war nichts mehr frei. Und die musste ich bereits räumen. Nun sitze ich am See. Die Landschaft ist bezaubernd, allerdings wimmelt es hier von Menschen. Ich vermisse dich.«
»Was macht ihr denn jetzt?«, fragte sie.
»Sie möchte mir das Segantini-Museum zeigen«, sagte er, »besonders ein bestimmtes Bild. Danach komme ich heim.«
»Was ist auf dem Bild?«, fragte sie, um nicht gleich wieder auflegen zu müssen.
»Eigentlich sind es zwei, über die wir geredet haben, auf einem muss eine Azalee sein, auf dem anderen ein Kind, das ein Wegkreuz küsst, wenn ich das richtig verstanden habe.«
Das berührte sie wieder, und ehe sie das Gespräch beendeten, bat sie: »Grüß diese Frau von mir und sag ihr danke.«
»Danke wofür?«
»Einfach danke«, sagte sie und legte auf. Inzwischen war die Schallplatte abgelaufen. Um sie zu wenden, musste sie aufstehen, und da sie schon einmal stand, beschloss sie, durchs Haus zu gehen. Sie wäre dieser Wichmann nun gern näher gewesen und wollte nach Spuren suchen, aber dann öffnete sie doch als Erstes den Sekretär, um einen neuen Anlauf zu machen, die gestrichene Passage auf dem Testamentsentwurf mit Adamos Namen zu entziffern. Das war zwecklos, dafür entdeckte sie, dass Frau Wichmann mit Vornamen Galatea hieß und fand auch das sonderbar bewegend – obwohl sie von der Sage um Acis und Galatea, die sie im Mittelschulunterricht gelesen hatten, nur erinnerte, dass Galatea ›milchweiß‹ hieß und dass einer dummen Eifersucht wegen Blut geflossen war.
Und gleich war die Sehnsucht wieder da, dieser Galatea nah zu sein. Sie ging hoch ins Schlafzimmer, legte sich aufs Bett und roch an den Kissen, dann ließ sie den Kopf sinken, betrachtete die Zimmerdecke und versuchte, das Gefühl zu begreifen, das sich in ihr breitmachte. Es war eine Sehnsucht, die nichts Konkretem entsprang, schon gar nicht einem Gefühl der Leere oder des Mangels. Tatsächlich fühlte sie vor allem eine Gewissheit (von der sie keine Ahnung hatte, woher sie kam), dass wirkliche Ruhe oder »Lebensfrieden«, wie ihr durch den Kopf schoss, nur aus der Verbindung mit dem Gegenpol, dem ganz Andren entspringen konnte und dass diese Verbindung wiederum so explosiv war, dass sie allenfalls für Augenblicke glückte. »Lady Chatterley«, dachte sie, »vielleicht auch dieser Acis und Galatea«, denn inzwischen dämmerte ihr, dass Acis ein Hirte gewesen war und Galatea eine Nymphe oder Göttin. »Oder aber eine Galatea Wichmann und ein Adamo Costa.«
Das dachte sie inzwischen ganz ohne Eifersucht, eher fühlte sie Trauer. Denn diese Flüchtigkeit einer wahrhaft großen Vereinigung hielt sie in ihrer momentanen Gefühlslage für so grundlegend für das menschliche Empfinden, dass sie sich und Galatea Wichmann überhaupt nicht mehr als getrennte Wesen sah, sondern ihr war – und das hatte wieder etwas fast Wollüstiges –, alles Weibliche sei irgendwie über Raum und Zeit miteinander verbunden, und die Trennung in Einzelne, alle Eifersucht und Rivalität, sei nur einer ärgerlichen und oberflächlichen Mode oder Konvention geschuldet.
Efgenia hatte eine ganze Weile so gelegen (die Platte war längst abgelaufen), als sie sich mit einem Seufzer erhob, der sie für einen Augenblick wie eine Prinzessin oder eben eine Lady Chatterley fühlen ließ, dann nahm sie ein Buch zur Hand, das aufgeschlagen auf dem Nachttisch lag.
Galatea, entdeckte sie, las mit Bleistift und Lineal (einem nur fingerlangen Elfenbeinstäbchen, auch der Bleistift war elfenbeingefasst), und dies, obwohl das Buch eines gewissen Maeterlinck alt und vielleicht wertvoll war. Immer wieder hatte sie ganze Absätze unterstrichen, Zeile um Zeile, ja manchmal ganze Seiten. Zuletzt diese: Die Bevölkerung des Ameisenhügels, des Bienenstocks, des Termitennestes scheint, wie ich schon oben sagte, ein einziges Individuum, ein einziges lebendes Wesen zu sein, dessen Organe, aus unzähligen Zellen gebildet, nur dem Anschein nach verstreut sind … Seit Millionen von Jahren, gleich einem Menschen, der niemals sterben würde, ist es immer dieselbe Termite, die weiterlebt … So würde sich unter vielen Mysterien das eine erklären, dass die Bienenköniginnen, die seit Jahrtausenden nur Eier gelegt, niemals eine Blume besucht, Blütenstaub gesammelt und Nektar geschöpft haben, dennoch Arbeitsbienen das Leben geben können, die bei ihrem Austritt aus der Wachszelle alles wissen, was ihren Müttern seit prähistorischen Zeiten unbekannt war; und die vom ersten Fluge an alle Geheimnisse der Orientierung, des Honigsammelns, der Aufzucht der Nymphen und der verwickelten Chemie des Bienenkorbes kennen. – Und ganz zuletzt: Es ist fast sicher, dass wir ehemals dieser Weltseele, mit der unser Unterbewusstsein noch in Verbindung steht, viel enger verbunden waren als jetzt. Unser Intellekt hat uns von ihr getrennt.
Efgenia wunderte sich nicht einmal, dass sie genau das gefühlt hatte, noch ehe sie das Buch in die Hand genommen hatte, jene Verbundenheit über Zeit und Raum hinweg, die im Grunde der natürliche Zustand der Menschen war. Sie dachte nur, wie sehr sie sich darauf freute, diese Erkenntnis mit Adamo zu teilen, und dass sie jetzt zu dritt waren, sie, Adamo und Lady Chatterley. Sie stellte sich vor, wie sie zu dritt auf der Chaiselongue sitzen und über jene neue, alte Dimension des Daseins und der Ewigkeit des Lebens sinnieren würden, während Mister ihnen die Füße wärmte. Sie lachte über ihren Ärger und ihre Ängstlichkeit in den ersten Stunden des Jahres und sagte sich, dass es nicht schöner hätte beginnen können.
Wissbegierde
Eigentlich hatte Frank König in Solothurn Selinas Silvestervorstellung von Mutter Courage und danach den Theater-Ball besuchen wollen, doch dann rief er an und sagte: »Zum einen kann ich mit meinem Fuß kaum noch gehen, überhaupt nicht Auto fahren und schon gar nicht tanzen. Zum anderen wollen Chris und Vladi unbedingt bis Mitternacht aufbleiben, mein Vater hat Feuerwerk im großen Stil eingekauft. Da kann ich nicht fehlen.«
Das leuchtete ihr ein und betrübte sie zwar etwas, aber sie fand seine Entscheidung zugleich natürlich und richtig. Unruhig wurde sie erst, als er sagte: »Die Jungs wollen dich übrigens kennenlernen. Seit sie wissen, dass es dich gibt, löchern sie mich mit Fragen.«
»Du wolltest ihnen doch gar nicht von mir erzählen«, erinnerte sie ihn. »Es war ja auch nur Sex.«
»Nein, es war nicht nur Sex«, erwiderte er, und das wusste sie genauso gut wie er. »Und nicht ich habe ihnen von dir erzählt, sondern meine Mutter. Nach dem Telefonat im Hotelzimmer vor drei Tagen hat sie zu meinem Vater gesagt: ›Kaum ist Joëlle aus dem Haus, geht er fremd‹, und Chris hat das gehört. Er wusste nicht genau, was ›fremdgehen‹ bedeutet, aber er hat so lange gebohrt, bis offenkundig war, dass eine zweite Frau im Spiel ist.«
Nach dieser Nachricht war Selina nicht mehr in Partylaune. Sie stieß zwar um Mitternacht mit dem Ensemble an und gab im Duo mit der stummen Kattrin die Seeräuber-Jenny, danach rannte sie aber sofort zum Bahnhof und erwischte den letzten Zug nach Zürich.
Auf der Fahrt döste sie ein und träumte von ihrem Fuchs- oder Frettchengeist, vielleicht war es diesmal auch ein Otter, denn es wühlte sich erst durch angeschwemmtes Gehölz, dann – und in einer abstoßenden Gier – durch Matsch und Sand und womöglich gar Fleisch. Offenbar suchte es etwas und wurde nicht fündig. Selina verließ nach dem Erwachen das Gefühl nicht mehr, der Traum sei ein schlechtes Omen, sie blieb aufgewühlt und fand, als sie zu Hause in der Röntgenstrasse in ihrem Bett lag, die ganze Nacht lang nicht richtig in den Schlaf, sondern dämmerte nur so vor sich hin. Als sie gegen zehn Uhr aufstand, fühlte sie sich, als hätte sie die Nacht durchgemacht, und gönnte sich ein Vollbad und ein ausgedehntes Frühstück mit Toast und Lachs, um wieder halbwegs zu sich zu finden.
Denn schon um halb eins wurde sie in Aarau erwartet, Franks Vater Theo holte sie am Bahnhof ab. Sie kannten sich von der Premiere von Franks Erstling her, in dem Selina eine der Hauptrollen gespielt hatte. Vierzehn Jahre war das her, und doch erkannte sie ihn gleich wieder. Frank glich ihm aber auch sehr. Theo König plauderte mit ihr, als wären sie gute Bekannte, und ließ sie nicht fühlen, wie pikant die Lage war – immerhin hatte sie seine Schwiegertochter betrogen. Er erzählte von seinen vier Enkeln, die, wie er fand, unterschiedlicher nicht hätten sein können.
»Rosemaries zwei, ein Junge und ein Mädchen, sind kuschelig und verschmust, sie haben zwei Meerschweinchen, und wenn die Kinder spielen, tun sie es fast stumm. Franks Buben dagegen sind unermüdliche Forscher, sie hinterfragen alles und jeden, und man muss furchtbar aufpassen, was man sagt.«
Das klang nun doch wie eine Warnung, und Selina fragte ihn, ob es eine sei.
»Um Himmels willen, nein«, sagte Theo. »Ihre Art war nur gerade Thema bei uns, weil Silvia, meine Frau, es mit Wahrheit und Genauigkeit oft nicht allzu genau nimmt. Frank hält sie für eine Polemikerin, ich glaube, sie ist einfach nur etwas bequem. Jedenfalls geraten sie und Frank deshalb oft aneinander, und inzwischen auch Chris und Vladi. Vor allem Chris, Vladi ist mehr der stille Knobler.«
Frank hatte sich noch nicht aus dem Sessel hochgestemmt, um Selina zu begrüßen – der Fuß, mit dem er, nachdem Joëlle ihn und die Jungen verlassen hatte, mit aller Wucht gegen einen Baum getreten hatte, war inzwischen bandagiert –, als die Jungen sie schon an den Esstisch führten, um sie ins Verhör zu nehmen.
»Du setzt dich hierhin«, ordnete Chris an, der im Stimmbruch war, und wies ihr den Platz am Tischende zu, dann setzten er und Vladi sich links und rechts von ihr. Als Vladi seinen Stuhl zurückzog, sagte er: »Hier sitzt sonst Mama, und ich sitze dort, wo du sitzt. Aber ich will nicht, dass du an Mamas Platz sitzt.«
»Ich auch nicht«, sagte Selina. »Hat sie euch schon ein frohes neues Jahr gewünscht?«
»Klar«, sagte Chris. »Sie hat um Mitternacht angerufen, und heute früh haben wir sie angerufen.«
»Sie hat mir gewünscht, dass ich immer gut einschlafe und keine schwierigen Träume mehr habe«, erzählte Vladi.
»Ich träume auch oft schwer«, antwortete Selina. »Meine Mama sagte dazu immer: ›Mach dir nichts daraus, das zeugt von Fantasie.‹«
Vladi wollte darauf etwas sagen, aber Chris war schneller. »Hast du mit Papa geschlafen?«, fragte er geradeheraus.
Gleich kam Franks Mutter aus der Küche. »Ihr wisst sehr wohl, dass euch das nichts angeht«, wies sie ihn zurecht und gab Selina die Hand.
»Mama, misch dich nicht ein«, rief Frank gereizt aus seinem Sessel heraus, und sie sagte spitz: »Du brauchst mich vor deiner neuen Freundin nicht zu maßregeln, Frank.«
»›Neue Freundin‹ – das ist ihre Art, die Dinge aus einem rauszukitzeln«, erklärte er Selina. »Sie erwartet jetzt eine Richtigstellung, dann weiß sie Bescheid. Aber den Gefallen werde ich ihr nicht tun.« Stattdessen sagte er zu seiner Mutter: »Mische dich einfach kurz nicht ein, ja?«
»Ich wollte nur helfen«, antwortete Silvia beleidigt, während sie die Gedecke auf dem Tisch zurechtrückte, dann ging sie in die Küche zurück.
»Danke«, sagte Selina zu ihr, dann wandte sie sich wieder den Jungen zu. »Eure Mutter und ich kennen euren Vater ziemlich genau gleich lange, wir haben damals beide an seinem Abschlussfilm gearbeitet, sie als Kamerafrau, ich als Schauspielerin. Ich war damals in euren Vater sehr verliebt, aber die beiden waren es auch und wurden schnell ein Paar. Deshalb kam es nie dazu, dass wir miteinander geschlafen hätten, obwohl ich nichts dagegen gehabt hätte.«
»Ich meine nicht damals, ich meine jetzt«, präzisierte Chris.
»Ich weiß«, sagte Selina, »das war nur der erste Teil meiner Antwort. Seither haben wir uns oft gesehen, euer Vater und ich, wir wurden gute Freunde, richtig gute, und das sind wir noch immer. Ihr vier seid eine Familie, und eine wunderschöne, das weiß ich, und daran will ich nicht rütteln. Denn ja, inzwischen haben wir miteinander geschlafen. Doch das hat nichts daran geändert, dass wir einfach gute Freunde sind.«
»Warum sagst du das?«, wollte Chris wissen.
»Warum sage ich was?«, fragte sie verwirrt zurück.
»Ich meine, willst du uns beruhigen?«, fragte er. »Wenn es zwischen Mama und Papa auseinandergeht, dann hat das sowieso nichts mit dir zu tun. Du bist nur … eine Gelegenheit«, sagte er, nachdem er kurz nach dem richtigen Wort gesucht hatte.
Selina zuckte innerlich zusammen. »Kann sein«, sagte sie dennoch. »Und womit, glaubst du, hat es zu tun?«
»Ich würde jetzt gern das Essen servieren«, sagte Franks Mutter, »der Braten wird mir sonst trocken.«
»Wir essen auch einen trockenen Braten«, entgegnete Frank nüchtern, und nachdem in der Küche auch Theo etwas gesagt hatte, das Selina nicht verstand, schloss sich die Küchentür.
»Womit, glaubt ihr, hat es zu tun?«, fragte sie nochmals.
Diesmal antwortete Vladi. »Zwei Jungen großzuziehen ist sehr anstrengend, hat Mama uns gesagt. Weil sie und Papa manchmal davon so erschöpft waren, haben sie beide Dinge gesagt, die wehtaten, und diese Dinge gehen nicht wieder weg. Das ist wie schlecht träumen, nur wacht man nach einem Traum wieder auf, und alles ist gut, und Mama würde auch gern wieder aufwachen. Aber dazu musste sie eben weg.«
»Sie wird trotzdem immer unsere Mama sein«, fügte Chris hinzu. »Das hat sie uns versprochen.«
»Und ich werde niemals aufhören, euer Vater zu sein«, sagte Frank.
»Du sowieso nicht, du würdest aber auch nicht weggehen«, antwortete Chris.
Auch diese Bemerkung gab Selina einen kleinen Stich, gleichzeitig musste sie lächeln, so schön fand sie das Vertrauen von Chris in seinen Vater.
»Nein, das würde ich wirklich nie«, sagte Frank.
»Aber wenn nun Mama wegbleibt und du mit uns allein bist, heißt das, du schläfst dann weiter mit Selina?«, fragte ihn Chris.
Frank zögerte. »Ich weiß es nicht«, sagte er dann offen.
»Ihr werdet bald nach Berlin zurückkehren«, sagte Selina, »ich wohne in Zürich, das ist doch ein rechtes Stück auseinander.«
»Vielleicht wohnen wir ja nicht immer in Berlin«, sagte Chris – und plötzlich klang es gar nicht mehr, als wollte er ihr Nein. »Ich glaube, wir sind vor allem Mamas wegen dort«, fuhr er fort. »Wir könnten auch nach Aarau ziehen, oder nach Lausanne.«
»Dort leben Joëlles Eltern«, erklärte Frank.
»Hast du denn auch Kinder, Selina?«, fragte Vladi.
»Oder einen Mann?«, fragte Chris.
»Nein, weder noch«, sagte Selina. »Ich glaube, dazu war ich nie genug verliebt.«
»Außer in Papa«, erinnerte sie Vladi.
»Das ist Ewigkeiten her«, stellte Chris etwas herablassend fest. »Jetzt sind sie nur noch Freunde, das hast du doch gehört.«
»Ja, aber sie hat ›nie‹ gesagt, und ›nie‹ stimmt nicht«, rechtfertigte sich Vladi.
»Da hat er schon recht«, sagte Selina. »Mit eurem Vater hätte ich gern Kinder gehabt. Vielleicht aber auch nur, weil er schon vergeben war, das kann man nicht wissen.«
»Wieso kann man das nicht wissen?«, hakte Chris nach.
»Weil ich ihn nun mal nur so kenne«, erläuterte sie. »Er war immer vergeben. Ich kann nicht ehrlich sagen, ob ich mich in ihn verliebt hätte, wenn er frei gewesen wäre.«
»Aber falls Mama nicht wiederkommt …«, setzte Chris an.
»Ich bin sicher, sie kommt wieder«, unterbrach ihn Selina – und nicht nur deshalb, weil sie sah, dass Vladi nahe dran war, in Tränen auszubrechen.
»Ich auch«, sagte Frank, stemmte sich endlich aus dem Sessel hoch und kam an den Tisch. Kurz legte er Selina die Hand auf die Schulter, dann setzte er sich ihr gegenüber.
Doch Chris war noch nicht fertig. »Warum sagst du das, Papa?«, erkundigte er sich. »Willst du bloß nicht, dass Vladi losheult, oder glaubst du es wirklich?«
Frank zögerte kurz. »Ich wünschte es mir«, sagte er – und hatte nun selbst Tränen in den Augen. »Ob ich es glaube, weiß ich nicht. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass eure Mutter gemeinsam mit mir, mit uns, glücklich wird.«
Chris dachte nach, dann fragte er: »Hast du sie überhaupt schon glücklich erlebt?«
Darüber musste nun wieder Frank nachdenken. »Keine Ahnung«, sagte er schließlich. »Vielleicht, als ihr ganz klein wart. Nein, selbst da nicht. Oder doch, aber nur für Momente.«
»Und dich selbst?«, fragte Chris weiter. »Auch nur für Momente?«
»Nein, mit euch war ich immer glücklich«, antwortete Frank ohne zu zögern. »Mit eurer Mama nicht immer, aber immer wieder.«
Chris wandte sich triumphierend Vladi zu und sagte: »Siehst du, ich habe es doch gesagt!«
»Was?«, fragte Frank.
Doch sie überhörten ihn. Vladi hatte sich wieder gefasst und war ganz fröhlich, als er sagte: »Ich weiß schon, was wir tun werden. Wir ziehen alle nach Norderney, wir drei und Selina und vielleicht sogar Oma und Opa. Dann ist Mama dort, wo sie glücklich sein kann, und wir sind es alle auch.«
»Hm«, sagte Chris aber nur. »Erst sollten wir uns dieses Norderney mal ansehen.«
Das war für Vladi schon zu viel. »Du begreifst gar nichts«, schrie er los, sprang auf und warf dabei den Stuhl um. Dann rannte er ins Zimmer und schlug die Tür zu.
»Ich meine, Norderney klingt irgendwie affig«, fuhr Chris ungerührt fort. »Und Opa sagt, da wohnen gerade mal fünftausend Nasen.«
»Immerhin kann man dort im Meer angeln«, sagte Frank, »das wolltest du doch immer.«
»Sag bloß, du willst nach Norderney«, sagte Chris.
Frank dachte nach. »Für euch ziehe ich sogar nach Norderney«, sagte er. »Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da mein Geld verdienen soll.«
Beherztheit
»Hubert, dies wird unser Jahr«, sagte Edith-Samyra, als er am Neujahrsmorgen die Augen aufschlug.
»Wieso?«, fragte er sie. Er war erst halb wach und wohl auch nicht ganz nüchtern.
»Na, die Sternschnuppe«, sagte sie. »Ich darf ja nicht verraten, was ich mir gewünscht habe – aber Junge, Junge, in der Neujahrsnacht eine Sternschnuppe zu sehen, das ist schon ein Ding.«
Hubert Brechbühl wusste von keiner Sternschnuppe, er hatte überhaupt Mühe, die vergangene Nacht zu erinnern. Er wusste nur noch, dass er mit der Tuba auf dem eingeseiften Tanzboden hingeschlagen war, und irgendetwas war mit einem Pferd gewesen. »Ich glaube, ich brauche noch Schlaf«, meinte er, während ihm durch den Kopf schoss, dass er sich während seiner Dienstzeit als Tramchauffeur nie so hatte gehen lassen, und er sich ermahnte, den Lebensabend nicht zu ›verschludern‹, wie seine Mutter es genannt hätte. Es war auch das erste Mal in seinem Leben, dass er am Neujahrsmorgen neben einer Frau erwachte.
»Gut, ich mache Frühstück und bringe es dir«, erklärte sie fröhlich, hüpfte aus dem Bett und brachte den Fußboden zum Erzittern.
Hubert sorgte sich um seine Tuba und hoffte, dass sie irgendwo im Zimmer lag, doch da war sie nicht. Daher ließ er den Kopf wieder sinken, schloss die Augen und rollte die Augäpfel, um so den Kopfschmerz zu bändigen. Das gelang nur im Ansatz, und dennoch breitete sich in den nächsten Minuten ein Glücksgefühl in ihm aus, das ihn laut seufzen ließ.
»Tust du es da gerade ohne mich?«, rief Edith-Samyra drohend, und als er erschreckt die Augen aufriss, stand sie nackt am Fußende des Bettes, riss die Decke weg und kletterte auf ihn. »Nun kannst du zeigen, wer der Hengst ist«, rief sie.
Doch er war kein Hengst und schämte sich nicht nur dafür, dass er keine Erektion hatte, noch schlimmer war die Vorstellung, er könnte im Silvesterrausch Dinge versprochen haben, die ihn überforderten. »Mir brummt ganz furchtbar der Schädel«, murmelte er.
»Gleich gibt’s Kaffee«, sagte sie und ging wieder in die Küche. »Übrigens«, rief sie von dort her, »beginnt das Jahr des Pferdes erst im Februar. Du hast also noch Zeit zu üben.«
Dann kam sie mit dem Tablett wieder, setzte sich nackt neben ihn und begann zu essen. Hubert bewunderte ihre elfenbeinfarbene Haut und das feuerrote Haar und genoss es durchaus, dass sie ihm Häppchen strich und Kaffee einflößte. Nur wollte die Tuba ihm nicht aus dem Sinn, und als Edith-Samyra sich – immerhin noch halb scherzhaft – beschwerte: »Allmählich könntest du etwas fröhlicher werden, Hubert, immerhin beginnt gerade unser erstes gemeinsames Jahr«, fragte er: »Was war gestern mit der Tuba? Ist sie kaputt?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Edith-Samyra, »und wenn, kaufen wir dir eine neue. Es ist nur eine Tuba, Hubert.« Doch sie stand dann sogar auf und holte sie ihm aus dem Flur. Er entdeckte keinen Schaden, auch nicht, als er ein paar Töne spielte, außer einer kleinen Delle.
»Du gefällst mir übrigens sehr, wenn du die Tuba spielst«, sagte sie. »Und doppelt, wenn du nackt spielst.« Das machte ihn stolz. Dazu kam die Erleichterung, dass die Tuba heil war, und so regte sein Fleisch sich doch noch.
Als sie danach weiteraßen, fiel ihm Stück für Stück der Abend wieder ein – und plötzlich auch die sonderbare Zeremonie nachmittags in Edith-Samyras Wohnung, auf die sie die ganze Zeit angespielt haben musste. »Jesses, wir sind ja nun so gut wie verheiratet«, rief er.
»Wir sind Weggefährten«, sagte sie, »und was uns das bedeutet, sollten wir in Behutsamkeit und Achtsamkeit entwickeln.«
»Ich hatte noch nie eine Weggefährtin«, stellte er fest. »Außer der Tuba. Und natürlich meinen Trams – dem Kurbeli und dem Pedaler jedenfalls. Ja, und vielleicht den Läusen auf den Begonien.« Das bewegte ihn so sehr, dass er Edith-Samyra unbedingt umarmen musste, dabei verschüttete er den Kaffee und sprang im Reflex auf, um einen Lappen zu holen. Das wäre nicht nötig gewesen, ja, es war nicht einmal sinnvoll. Edith-Samyra hatte, als er wiederkam, das Laken bereits abgezogen, tupfte mit dem trockenen Ende die Matratze ab und hängte es anschließend über die Schranktür. »Ein Zeugnis unserer ersten Nacht als Mann und Frau«, sagte sie feierlich, und weil Hubert nicht recht wusste, ob sie einen Scherz machte, deutete er ein Lächeln nur an. Durch sein überhastetes Aufspringen war außerdem der Kopfschmerz zurückgekehrt, am liebsten hätte er heiß gebadet.
Doch Edith-Samyra fand: »Du brauchst Bewegung.«
So spazierten sie, sobald sie angezogen waren, Hand in Hand zum Café Sphères, das leider geschlossen war. Die Kälte war sogar für die heißblütige Edith-Samyra heftig.
Dann trafen sie aber das Studentenpärchen aus dem zweiten Stock. Laut Klingelschild hießen sie Patrizia Barth und Peter Schmid, aber alle nannten sie nur Pit und Petzi. Sie sahen noch jünger als sonst aus und wunderschön, mit roten Wangen, dampfendem Atem, wirrem Haar, hochgestelltem Kragen und tief in die Manteltaschen vergrabenen Händen.
»Kommt mit«, sagte Pit und führte sie in die Schiffbauhalle, deren Bar zwar ebenfalls geschlossen war, doch von einer Führung durchs Theater, die er noch als Schüler mitgemacht hatte, kannte er einen Schleichweg zu den Probenräumen und holte dort für alle Automatenkaffee. Danach saßen sie auf der Theke der Garderobe wie Hühner auf der Stange und ließen die Beine baumeln.
Kurz plauderten sie über die Silvesterparty bei Ruth und Axel, dann sagte Petzi zu Edith-Samyra: »Wir hätten da übrigens eine Frage an die Krankenschwester.«
»Ich höre.«
Petzi drehte eine Weile den Becher zwischen den Fingern, bevor sie erklärte: »Ich wüsste gern, ob ich schwanger bin. Ich glaube, normalerweise könnte ich noch ein paar Tage warten, es ist nur so, dass meine Mutter heute notfallmäßig bei uns einzieht. Sie ist ganz durcheinander, und ich müsste eigentlich für sie da sein, gleichzeitig bin ich aber im Kopf völlig woanders.«
»Und natürlich wollen wir ihr nichts sagen, bevor es nicht sicher ist«, fügte Pit hinzu.
»Das ist wohl auch vernünftig«, meinte Edith-Samyra. »Was sind denn die Symptome?«, fragte sie Petzi. »Hast du Heißhunger, Krämpfe, verfärben sich die Brustwarzen?«
»Heißhunger nein, Krämpfe nein, Brustwarzen weiß ich gar nicht«, sagte Petzi. »Ich muss oft pinkeln und bin schnell müde, aber vor allem ist es so eine Ahnung.«
»Und Petzi hat nicht von vielem eine Ahnung«, stellte Pit übermütig fest und fing sich einen Knuff ein.
»Und seit wann hast du die?«, erkundigte sich Edith-Samyra.
»Seit drei Tagen«, sagte Petzi. »Der Eisprung muss vor etwa einer Woche gewesen sein. Das ist zu früh, um zu testen, oder?«
»Na ja, früher gab es diesen Froschtest, der funktionierte sehr früh«, sagte Edith-Samyra. »Injiziert man einem Apothekerfrosch-Weibchen den Urin einer Schwangeren oder setzt es in den Urin, wird es innerhalb von vierundzwanzig Stunden laichen. Ich habe nur keine Ahnung, wo man heutzutage Apothekerfrösche bekommt. Außerdem stellt sich die Frage, was man danach mit dem Frosch anstellt. Man kann ihn ja schlecht wegwerfen.«
Danach entstand eine kleine Pause, die Hubert nutzte, um zu bemerken: »Also ich stelle mir euch sehr schön vor mit einem Kind.«
»Würdet ihr es überhaupt behalten wollen?«, fragte Edith-Samyra. »Ihr seid so jung.«
»Unbedingt«, sagte Petzi, ehe sie ausgeredet hatte, und Pit erklärte: »Ein Mann braucht einen Karren, den er zu ziehen hat, um in Schwung zu kommen. Das hat Dürrenmatt gesagt.«
Hubert fand das wunderbar und malte sich gleich allerlei dazu aus. »Wenn wir für das Kind musizieren, Pit, muss ich aber ein anderes Instrument lernen«, sagte er. »Die Tuba ist kein Instrument für Neugeborene.«
»Wir könnten sie stopfen«, schlug Pit scherzhaft vor.
Hubert hatte dagegen an den Kammbläser gedacht, den er im Fernsehen den Hummelflug hatte spielen hören. »Ich kann mir gut vorstellen, dass Babys das lieben«, sagte er.
»Bevor wir unser ganzes Repertoire umkrempeln, Hubert«, sagte Pit, »lass uns abwarten, ob wir überhaupt schwanger sind.«
»Und dann muss noch alles gutgehen«, sagte Petzi und sprang von der Theke. »Übrigens hatten wir vor, uns zu Hause heiße Schokolade zu machen, mit richtiger, echter Schokolade. Die will ich jetzt. Möchtet ihr eine Tasse?«
»Deine Mutter kommt in einer Stunde«, erinnerte sie Pit.
»Stimmt, dann reicht die Milch nicht«, sagte Petzi.
»Oh, wir haben ganz viel Milch«, rief Hubert und freute sich kindlich, dass er an alldem teilhaben durfte. »Wir hätten auch Kardamom.«
»Den sollte Petzi meiden«, erklärte Edith-Samyra jedoch, »Kardamom enthält Kampfer. Zimt, Fenchel, Muskatnuss und Anis sind ebenfalls nicht gut. Selbst wenn das Ei sich noch nicht eingenistet haben sollte – wir wollen nichts provozieren.«
Petzi zog eine Schnute und fragte: »Schokolade darf ich aber?«
»Ja, allerdings keine dunkle«, antwortete Edith-Samyra. »Du musst Verstopfung meiden. Zucker nur dann, wenn du zu Schwangerschafts-Diabetes neigst. Und pass auf dein Gebiss auf, es heißt, jedes Kind kostet die Mutter einen Zahn.«
»Ach, das klingt alles nicht schön!«, rief Petzi. »Ich dachte, als Schwangere lebt man so richtig maßlos.«
»Tut man auch«, sagte Pit grinsend und umarmte sie, »man fragt nur vorher keine Krankenschwester.«
»Richtig«, sagte Edith-Samyra. »Eigentlich ist alles Nebensache, solange man sich auf das Kind freut.«
Unternehmungslust
Petzi hatte sich darauf eingestellt, ihre Mutter trösten und aufpäppeln zu müssen, doch es war ganz anders. »Ich werde für euch kochen«, kündigte Rosa schon in der Tür an, »ich habe alles dabei für eine wunderbare Neujahrspastete.« Und gleich steuerte sie die Küche an und packte aus.
»Mama, wir sitzen gerade mit Nachbarn gemütlich bei einer Tasse heißer Schokolade«, sagte Petzi. »Setz dich wenigstens einen Augenblick dazu. Außerdem hast du Pit noch nicht hallo gesagt.«
»Na schön«, sagte Rosa, »aber nenn mich nicht Mama. Ich nenne dich ja auch nicht Tochter.« Sie ging ins Wohnzimmer, während Petzi ihr eine Tasse holte.
Als sie eine Minute später nachkam, war Rosa bereits wieder in Fahrt. Pit und Petzi hatten im Brockenhaus Seemannskisten gekauft, die als Schränke, aber auch als Sitzbänke dienten, und darauf saßen alle. Nur Rosa hatte sich Marx’ Kapital geschnappt – vermutlich, weil es das dickste Buch war –, saß im Schneidersitz darauf wie auf einem Yogakissen, und offenbar hatte Pit zuvor einen Spruch gemacht, denn Rosa sprach ihn direkt an. »Was kann daran falsch sein?«, fragte sie. »Bücher sind aus Papier gemacht, und Papier ist Holz. Auch Stühle sind aus Holz, ebenso eure Kisten. Wo bitte ist der Unterschied? Zudem ist Marx Teil eines rein männlichen Machtdiskurses: Links oder rechts, was spielt das für eine Rolle? Machistisch sind sie allesamt.« Danach nahm sie Petzi die Tasse ab und kippte achtlos die schöne dickflüssige, mit etwas Vanillesamen verfeinerte Schokolade.
»Ich glaubte, dir ginge es schlecht«, sagte Petzi, während sie ihr dabei zusah. »Ich dachte, wir müssten dich aufpäppeln.«
»Aufpäppeln, nein«, sagte Rosa. »Aber natürlich geht es mir schlecht. Dein Vater sitzt es aus. Er provoziert unsere Trennung. Was immer ich ihm anbiete, ist ihm zu viel, zu umständlich, zu unsicher. Zu Weihnachten habe ich ihm eine Kreuzfahrt geschenkt«, erzählte sie nun mehr den anderen, denn Petzi war dabei gewesen, »keinen Billigkram, zehn Tage Peloponnes mit einem ausgesuchten Rahmenprogramm, sogar Musiker des Bolschoi-Orchesters treten auf. Und Robert hat weiß Gott genügend Überstunden abzufeiern. Doch was tut er? Gestern um Mitternacht, nachdem wir vom Balkon aus das Feuerwerk der Nachbarn angesehen, uns geküsst und ein gutes Jahr gewünscht hatten, sagte er: ›Auf diese Reise, Rosa, kann ich leider nicht mitkommen, ich schlage vor, du gehst mit Patricia. Wir haben eine neue Praktikantin eingestellt, und es ist niemand da, um sie einzuarbeiten. Außerdem müsstest du eigentlich wissen, wie leicht ich seekrank werde.‹«
»Ach, und ich hatte mich so für euch gefreut«, rief Petzi.
»Ja, so lässt er eines nach dem anderen platzen«, sagte Rosa. »Und für eine Praktikantin, ich bitte dich! So wird mein Leben immer leerer.«
»Nun ja, die schönsten Dinge entstehen aus der Leere«, warf Edith-Samyra ein. »Man muss sie nur zulassen.«
»Papperlapapp«, sagte Rosa brüsk. »Haben Sie ein Kind großgezogen und ziehen lassen? Haben Sie fünfundzwanzig Jahre Ehe hinter sich? Haben Sie die besten Jahre Ihres Lebens für Haushaltsarbeit hergegeben, die Ihnen nie jemand gedankt hat?«
»Nein, das habe ich alles nicht«, gab Edith-Samyra zu.
»Dann wissen Sie auch nicht, wovon ich rede«, stellte Rosa fest.
»Mama, das sind meine Freunde«, erinnerte sie Petzi.
»Doch, es stimmt, ich weiß es wirklich nicht«, gab Edith-Samyra zu.
»Was ist denn mit diesem Zen-Resort im Schwarzwald, Rosa?«, fragte Pit. »Das klang doch interessant.«
»Ja, das ist es auch«, sagte Rosa. »Nur habe ich für ein Leben im Zazen noch zu viel Feuer unterm Arsch. Ich will noch etwas reißen im Leben. Und – wer will es mir verdenken – am liebsten mit meinem Mann.«
Darauf wusste niemand etwas zu sagen, bis Hubert bemerkte: »Ich bin nun wirklich niemand, der Ihnen raten kann. Doch das Gefühl, dass da noch etwas kommen muss, kenne ich sehr gut.«
»Ja, und?«, fragte Rosa, als er nicht gleich weitersprach.
»Also, ich denke, wenn mir so was passieren würde«, sagte er, »wenn ich Edith-Samyra auf eine Reise eingeladen hätte und sie würde mir einen Korb geben, wäre ich sicherlich zuerst enttäuscht. Doch dann würde ich mir sagen, dass es dafür einen Grund geben muss. Vielleicht darf Edith-Samyra ganz einfach nicht mitkommen, weil mir sonst etwas ganz Wichtiges eben nicht widerfahren würde. Vielleicht muss ich diese Reise allein machen, oder eben mit jemand anderem. Und vielleicht ist es für Edith-Samyra ein noch größerer Schmerz als für mich, dass sie sich zurückziehen muss, um mir diese Erfahrung nicht zu verbauen.«
Rosa stutzte, dann sagte sie: »Ich rede von zehn Tagen unbeschwertem Urlaub auf der MS Pallas Athena II, nicht von einem Himalaja-Trek oder so.«
Darauf entgegnete Hubert: »Ich hatte eines meiner einschneidendsten Erlebnisse, als ich eines Abends am Hauptbahnhof noch schnell Milch holen wollte.«
Rosa wandte sich Petzi zu: »Lustige Freunde hast du, Patrizia.«
»Mama«, rief Petzi entrüstet.
Doch Rosa überhörte sie. »Also was ist«, fragte sie, »kommst du mit? Am Elften geht’s los.«
»Ich kann nicht, ich habe Semester«, sagte Petzi. »Und ich muss vorwärtsmachen. Außerdem ist noch lange nicht der Elfte. Willst du bis dahin etwa hierbleiben?«
»Ich habe dich zwanzig Jahre lang beherbergt«, sagte Rosa. »Da wirst du mich wohl ein paar Wochen lang aushalten. Ich werde für euch kochen. Deine Schokolade war ja nicht schlecht, aber etwas Chili und Kardamom würden sie aufpeppen.«
Das war der Augenblick, in dem Edith-Samyra einfiel, dass sie noch mit Freunden verabredet waren, um das neue Jahr einzusummen – Ombuki nannte sich das –, und sie und Hubert sich verabschiedeten.
»Ich werde euch auf dem Laufenden halten«, versprach Petzi. »Ihr wisst schon.«
»Warten Sie, ich habe noch ein Problem«, sagte aber Rosa, »vielleicht können Sie mir dabei helfen. Je mehr Hirne, desto besser. Im Zug habe ich über einem Kreuzworträtsel gebrütet, der Hauptgewinn ist eine Reise nach Alaska. ›Sommervogel.‹«
»Schmetterling«, sagte Petzi, »das weiß doch jedes Kind.«
»Ja, aber es passt nicht«, erwiderte Rosa. »Es fängt zwar mit s-c-h an, aber es hat nur acht Buchstaben.«
»Schwalbe«, sagte Hubert. »Im Kirchgemeindehaus finden regelmäßig Diaabende über Tiere und Pflanzen statt. Es gibt Ganzjahresvögel und Sommervögel. Sommervögel sind Zugvögel, die Schwalbe ist ein Zugvogel.«
»Siehst du, es hat sich gelohnt«, sagte Rosa zu Petzi. Und Hubert versprach sie: »Wenn ich die Reise gewinne, nehme ich Sie mit.«
»Das ist lieb, nur bin ich selbst kein Zugvogel«, antwortete Hubert verlegen, »Reisen bedeutet mir nicht viel. Und zudem bin ich liiert.«
»Es war auch mehr ein Scherz«, sagte Rosa. »Ich habe noch nie etwas gewonnen.« Dann bat sie Pit, ihr zu zeigen, wo sie schlafen würde – sie hatten dafür das kleine Büro geräumt, und Petzi arbeitete im Wohnzimmer.
Währenddessen machte Petzi den Abwasch. »Sie hat sich etwas hingelegt«, sagte Pit, als er zu ihr in die Küche kam. »Ich habe Rosa so noch nicht erlebt, die blüht ja richtig.«
»Die blüht? Die spinnt!«, rief Petzi. »Wie kann man sich so aufführen? Ich weiß nicht, wie lange ich sie so aushalte.«
»Also, mir gefällt das«, sagte Pit, »die fackelt nicht lange. Wie hat sie es ausgedrückt? ›Ich will noch etwas reißen.‹ Ist doch klasse! Ich meine, wenn man dagegen meine Eltern ansieht … Und was sie über Marx und die Linke gesagt hat, war auch nicht doof.«
»Was? Oberdoof!«, rief Petzi entsetzt. »Man muss so was im historischen Kontext sehen, sonst wird man der Sache doch nicht gerecht.«
Pit lachte und sagte: »Dass du mal Marx verteidigen würdest …«
»Warum soll ich nicht Marx verteidigen?«, fragte sie, jetzt war sie richtig wütend. »Bist du denn der Einzige, der etwas auf dem Kasten hat? Genau, und was war das eigentlich für eine Bemerkung heute im Schiffbau?«
»Was? Wovon redest du?«, fragte er.
»Dass ich keine Ahnung von nichts habe«, erinnerte sie ihn. »Wenn das mal nicht machistisch war!«
»Aber ich wollte dich nur foppen«, sagte er. »Logisch hast du von ganz vielem eine Ahnung.«
»Mehr als nur eine Ahnung«, sagte sie. »Und ganz sicher tausendmal mehr als du – jedenfalls, was meine Ziele im Leben angeht.«
»Na ja, vielleicht bin ich einfach komplexer gestrickt«, entgegnete er. Er war nun ebenfalls gereizt.
»Ja, ›Komplex‹ kannst du großschreiben«, sagte Petzi giftig.