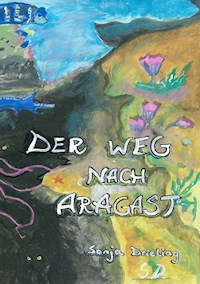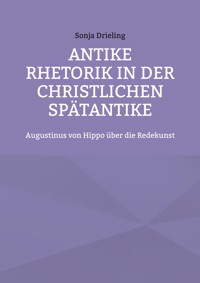
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Augustinus von Hippo ist einer der bekanntesten Kirchenväter der Spätantike und beschäftigte sich zu Lebzeiten auch mit der Form der antiken Redekunst. Basierend auf seinen Haupt- und Nebenwerken bietet dieses Buch eine komplette Analyse seiner Aussagen und Haltung zur Redekunst und unterlegt diese anschaulich mit originalen Textausschnitten. Das Niveau entspricht dem einer wissenschaftlichen Arbeit auf Universitätsebene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vorwort
Dieses vorliegende Werk basiert auf der von mir im Jahr 2019 verfassten Masterarbeit im Fach Klassischer Philologie am Lehrstuhl für Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität zu Berlin und wurde basierend auf den Werken „de doctrina christiana“, „confessiones“ und „de ordine“ (in origine) im Schwerpunkt behandelt, wobei kleinere Nebenschriften des Kirchenlehrers aus Thagaste ebenso berücksichtigt wurden.
Die Arbeit ist von mir formuliert und erarbeitet worden und unterliegt nunmehr dem Originalrecht. Zitationen aus dem Inhalt sind mit Verweisen auf meine Arbeit rechtlich zu versehen.
Berlin, 2023
Inhaltsverzeichnis
I.
Einleitung
II.
Biographisches
II.I Allgemein
II.II Die wichtigsten Lebensstationen von Augustinus
II.III Selbstdarstellung in den „confessiones“ und „retractationes“
II.IV Die „Vita Augustini“ von Possidius
III.
Forschungsüberblick zur kulturellen Identität von Augustinus
IV.
Das traditionelle Bildungssystem zu Augustinus‘ Lebenszeit
V.
Renovatio der heidnischen Kultur und christliche Bildungsfeindlichkeit
VI.
Augustinus‘ theoretische Schriften und seine Haltungen gegenüber der Rhetorik darin
VI.I Allgemein
VI.II „De ordine“ (Frühschrift)
VI.III „De doctrina christiana“ Buch 1-3
VI.III.I Allgemein
VI.III.II Prolog
VI.III.III Buch 1
VI.III.IV Buch 2 - Unbekannte Zeichen
VI.III.V Buch 3 – Doppeldeutige Zeichen
VI.IV „De doctrina christiana“ Buch 4
VI.IV.I Das theoretische System von Augustinus
VI.IV.II Fazit zu “De doctrina christiana“
VI.V „confessiones“
VI.V.I Allgemeines
VI.V.II Die Darstellung der Redekunst in den Bekenntnissen
VII.
Ausgewählte Briefe und
sermones
VII.I Die Vielfalt des Adressatenkreises
VII.II Sprachstil innerhalb der Briefe
VII.III Beispiel eines augustinischen Briefwechsels
VII.III.I Briefwechsel mit Maximus
VII.IV Sprachstil innerhalb der Predigten
VII.V Rhetorische Aussagen in den augustinischen Predigten
VIII.
Fazit
IX.
Literatur
I Einleitung
Augustinus von Hippo bietet als christlicher Vertreter der Spätantike vielerlei Möglichkeiten der Erforschung und Beschäftigung. Zum einen sind viele seiner theoretischen Schriften und Dialoge überliefert und zum anderen liegen uns ein recht umfangreicher Briefcorpus und von ihm gehaltene Predigten vor. Der Kirchenvater aus Thagaste hat verschiedene theologische, philosophische und gesellschaftskritische Themen zu Lebzeiten behandelt und sie teils in die Diskussion mit anderen gegeben. So konnte er sich nicht nur bei seinen Zeitgenossen, sondern auch bei der Nachwelt einen Kreis von Interessierten aufbauen.
Blickpunkt dieser Arbeit soll seine Haltung gegenüber der Rhetorik als einer der artes liberales sein, wobei ebenso seine geistige Fortentwicklung bezüglich dieser Disziplin beleuchtet werden soll. Für einen besonders dezidierten Eindruck werden daher nicht nur die biographischen und autobiographischen Angaben zu ihm herangezogen werden, sondern einige seiner theoretischen und praktischen Arbeiten. Außerdem wird es einen Einblick in die zu seiner Lebenszeit gängigen soziokulturellen Begebenheiten geben.
Während Augustinus selbst mit seinen „confessiones“ viele autobiographische und mit den „retractationes“ zeitliche Angaben liefert, rundet die Biographie von Possidius das Bild über ihn weitestgehend ab. Um seine praktische und theoretische Stellung zur Rhetorik innerhalb einer zeitlichen Entwicklung überblicksmäßig zu beurteilen, soll zunächst eine seiner Frühschriften, nämlich „De ordine“, untersucht werden, woran sich schließlich sein bekanntestes rhetorik-theoretisches Werk „De doctrina christiana“ und die „confessiones“ anschließen werden. Eine dritte Gruppe von Quellen werden seine bis dato überlieferten Predigten und Briefwechsel sein, welche auf inhaltliche und stilistische Gesichtspunkte hin betrachtet werden sollen.
II Biographisches
II.I Allgemein
Gemessen an der bis heute überlieferten Vielzahl an Schriften von Augustinus von Hippo und an der zahlreichen Beschäftigung mit ihm innerhalb von Artikeln, Monographien sowie weiteren Veröffentlichungs- bzw. Lehr- und Diskussionsmodellen sind die biographischen Umstände und Zeitangaben zu dem in Thagaste geborenen Kirchenvater noch immer nicht in Gänze gesichert. So müssen vereinzelte Zeitangaben spekulativ gesetzt werden. Prof. Dr. Fuhrer durch ihre mannigfachen Veröffentlichungen zu Augustinus sowie Wilhelm Geerlings innerhalb seiner Schaubilder und Torsten Krämer in der Ausarbeitung seiner Dissertationsschrift sollen dem allgemeinen biographischen Abschnitt dieser Arbeit ihre Stütze geben. Hierbei sei anzumerken, dass jeder der hier aufgeführten Forscher seinen eigenen Schwerpunkt in der Lebensbetrachtung von Augustinus gesetzt hat. Während Prof. Dr. Fuhrer den Fokus auf den sozialgeschichtlichen Hintergrund gelegt hat, hat sich Wilhelm Geerlings vor allem um die Erforschung der Zahlenangaben bemüht, weshalb auch Prof. Dr. Fuhrer in ihrer Kompaktübersicht zu Augustinus auf seine Tabellen als Ergänzung zurückgegriffen hat.1 Torsten Krämer stammt aus dem Bereich der Literaturwissenschaft und hat sich vor allem dem kulturwissenschaftlichen Aspekt der augustinischen Zeit gewidmet. Alle Ansichten zusammengefasst ergeben ein weitreichendes Bild zu dem Mann, dessen Haltung zur Rhetorik in ihrem Verlauf untersucht werden soll. Diese Angaben scheinen unerlässlich, um zu verstehen, wie sich Augustinus‘ Denken und sein Stil im Laufe der Zeit modifizieren konnten.
Neben den von Augustinus verfassten Bekenntnissen („confessiones“) bieten seine später durchgeführten Korrekturen („retractationes“) sowie die „vita Augustini“ von Possidius ein biographisches Bild von Augustinus von Hippo. Zum größten Teil stammen die Informationen zu seiner Lebensbeschreibung aus eigenen Schriften, d.h. aus Selbstzeugnissen. Alleine die „confessiones“ bieten einen Reichtum an Material bezüglich seiner Herkunft, Ausbildung und seinem intellektuellem und beruflichen Werdegang bis zu einem Lebensalter von zweiunddreißig Jahren. Ein enger Schüler von Augustinus war Possidius. Er schrieb nach dem Tod seines Lehrers eine biographische Schrift, welche im Wesentlichen die „confessiones“ fortsetzt. Chronologische Einordnungen werden vor allem mit Hilfe der „retractationes“ unterstützt und ergänzt. Inwieweit diese Zeugnisse aufgrund von Stilisierungen und Redaktionen einen historischen Augustinus hervorzubringen vermögen, ist eine Frage, auf die teilweise im Laufe dieser Arbeit eingegangen werden soll.2
Im Jahr 1975 hat Johannes Divjak siebenundzwanzig neue Briefe von/an Augustinus entdeckt. Sechsundzwanzig weitere folgten durch den Historiker Francois Dolbeau 1990. Vor allem die letztgenannten liefern ein Bild von Augustinus, wie es in den viel abgeschriebenen und später gedruckten Varianten nicht vermittelt wird. Eine nicht unumstrittene Autorität kommt hierbei zum Vorschein. Peter Brown vermutet in seiner Biographie, dass genau aus diesem Grund die Dokumente im Mittelalter selten kopiert worden sind.3
II.II Die wichtigsten Lebensstationen von Augustinus
Augustinus4 wurde im Jahr 354 im nordafrikanischen Thagaste als Sohn des städtischen Beamten Patricius und der Monnica geboren. Er besuchte entsprechend dem traditionellen Bildungswesen zunächst den Elementarschul- und Grammatikunterricht in Thagaste, worauf ein Grammatik- und Rhetorikunterricht in Madauros (ehem. Numidien) folgte. Es ist belegt, dass durch Geldmangel innerhalb der Familie die Ausbildung für ein Jahr unterbrochen werden musste.5
Eine erste intensive Beschäftigung mit der Rhetorik hat Augustinus, als er sein Rhetorikstudium in Karthago beginnt. In diese Zeit fällt auch seine in den „confessiones“ als so prägend dargestellte Lektüre von Ciceros „Hortensius“ („Liebe zur Philosophie“) und seine Zuwendung zu der aufströmenden Bewegung der Machinäer, auf die im Kapitel zu den „confessiones“ näher eingegangen werden soll.6 Auf Grund seiner erkannten Begabung in der Rhetorik wird er Rhetoriklehrer in Karthago und beschreitet nicht die Beamtenlaufbahn, die sich seine Eltern für ihn vorgestellt hatten. Sein Beruf führt ihn auch nach Rom und schließlich wird er 384 Rhetorikprofessor am kaiserlichen Hof in Mailand, d.h. im Alter von 30 Jahren hatte er bereits eine äußerst prestigereiche Position inne. Dort trifft er auch auf eine Person, die in den Mailänder Jahren das politische Geschehen am Hof mitprägte: Ambrosius. Diesem weist Augustinus im Prozess seiner Bekehrung eine zentrale Rolle zu. Bereits im Proömium seines Dialogs „De beata vita“ nennt er ihn den „Polarstern“, dessen Predigten ihm das ‚richtige‘ Gottesverständnis vermittelt hätten: „…hic septentrionem cui me crederem didici…“7
Nach seinem durch die „confessiones“ berühmt gewordenen Konversionserlebnis zog Augustinus sich zusammen mit einigen Freunden und Schülern auf ein Landgut in Cassiciacum zurück in der Umgebung von Mailand. Dort entstanden seine Frühschriften, die als Cassiciacum-Dialoge bekannt sind. 387 lässt er sich dann noch in Mailand taufen und beendet zum Herbst desselben Jahres seine Professur am Hof. Mit dem Ziel ein Zönobium in Afrika zu gründen kehrt er nach einigen Zwischenstationen nach Thagaste zurück. In der Zwischenzeit sind bereits einige antimanichäische Schriften von ihm entstanden.
Sein Versuch sich völlig aus dem öffentlichen Amtsleben zurückzuziehen endet mit seiner spontanen Weihe zum Priester durch Bischof Valerius, als er 391 nach Hippo Regius reist und dort erkannt wird. In den Folgejahren etabliert er sich als Bischof von Hippo. Gleichzeitig kann er in Hippo seine eigene kleine kontemplative Lebensgemeinschaft in einem Kloster gründen, wo er bis zu seinem Lebensende auch forscht und schreibt. Außerdem beginnt er ab 393 mit seiner Predigtarbeit und seinem schriftlichen und verbalen Kampf vor allem gegen häretische Gruppierungen. In diesen Jahren entstehen Schriften wie die „confessiones“, „de civitate die“ als Antwort auf die antichristliche Polemik nach der Eroberung Roms durch Alarich, seine „retractationes“ (Revision seiner eigenen bis dato publizierten Schriften) und Vieles mehr.
Als im Jahr 430 die Vandalen nach Nordafrika vordringen und auch die Stadt Hippo belagern, verstirbt Augustinus noch im selben Jahr im Alter von fünfundsiebzig Jahren.
II.III Selbstdarstellung in den „confessiones“ und „retractationes“
Die ersten neun Bücher der „confessiones“ berichten in Form einer Ich-Erzählung von den religiösen, intellektuellen und emotionalen Erfahrungen des Protagonisten Augustinus. Die übrigen Bücher sind vor allem seinen Überlegungen und Theorien zur intelligiblen Welt wie der sog. Memoria-Lehre, der Erbsündenlehre, der Zeit, der Wahrheit und Weiterem gewidmet. Dennoch tauchen im autobiographischen Anteil des Werkes auch mehrere philosophische Themen auf. Sie sind wie Einschübe in zuvor geführte Erzählungen eingebettet und zerreißen hier und da den Lesefluss. So wird die Gartenszene, in der Augustinus‘ Bekehrung stattfindet, jäh unterbrochen und stattdessen ein Exkurs über den Willen und das Wollen gemacht.8
Der Stil lässt sich als analytisch und reflektierend charakterisieren, denn Augustinus versuchte –im Gegensatz zu seinem Schüler Possidius, der unangenehme Themen aus Augustinus‘ Leben gemäß einer hagiologischen Darstellung zu vermeiden suchte- sich seine eigenen menschlichen Fehler einzugestehen und sie vor Gott zu bekennen. Zur Zweideutigkeit des titelgebenden Wortes „confessiones“ schreibt Prof. Dr. Fuhrer, dass die Vokabel sowohl den Prozess des Schuldeingeständnisses meinen kann als auch den der nach Vergebung suchenden Bekenntnis vor Gott.9 Beides jedenfalls betreibt Augustinus hier. Es finden sich Details über die Liebschaften in seiner Jugend, über einzelne Diebstähle und vor allem über seinen Hochmut (superbia)10, welcher ihn neben den fleischlichen Begierden zunächst davon abgehalten habe, den Weg Gottes vollends zu gehen. Augustinus schildert, wie viel ihm die Ehrbekundungen anderer bedeutet hätten, die ihm ob seiner Redefähigkeiten gelobt hätten. Auch zeigt er auf, dass er den weltlichen Begierden nicht so einfach hatte entsagen können, trotzdem ihm irgendwann die Wahrheit und der rechte Weg eines Christen bewusst gewesen seien:
„Et mirabar, quod iam te amabam, non pro te phantasma, et non stabam frui deo meo, sed rapiebar ad te decore tuo moxque diripiebar abs te pondere meo et ruebam in ista cum gemitu; et pondus hoc consuetudo carnalis. Sed mecum erat memoria tui, neque ullo modo dubitabam esse, cui cohaererem, sed nondum me esse, qui cohaererem, quoniam corpus, quod corrumpitur, adgravat animam…”11
Interessant ist, dass Augustinus als Begründung für seine noch nicht erfolgte Konversion den Kampf der Seele gegen den Leib anführt. Seine Eltern, welche für ihn ein gutbürgerliches Leben wünschten und damit eine Ehe zu einem jungen Mädchen arrangierten, das noch nicht im heiratsfähigen Alter war und daher noch einige Jahre warten musste bis zur Eheschließung, suchten ihn in ein sittlicheres Leben zu führen. Zu der Zeit hatte Augustinus jedoch eine Konkubine, mit der er regelmäßig verkehrte. Auch als die Ehe schon geplant war, widmete er sich weiterhin seinen sexuellen Begierden, die er selbst als Grund angibt für seine noch nicht durchgeführte Konversion. Die Ehe zögerte er weitestgehend heraus, wünschte er doch insgeheim, sich irgendwann dem Christentum anzuschließen. Eine interessante andere Sicht auf diese Phase bietet Prof. Dr. Fuhrer: Sie sieht den sozialen Druck als entscheidenden Punkt, der Augustinus noch von der Konversion abgehalten habe: Zum einen war er beruflich am Mailänder Hof verbandelt. Zum anderen war ein Teil der höfischen Rädelsführer der renovatio der heidnischen Bildung verschrieben und hätte wohl kaum einen Christen als magister rhetoricae gerne gesehen.12 Auch die Tatsache, dass Victorinus ihm als Konvertit ein Vorbild gewesen sei soll, nachdem dieser ob des Rhetorenedikts durch Kaiser Julian 362, welches Christen die Lehrtätigkeit untersagte, sein Amt als Rhetorikprofessor aufgegeben und sich für ein Leben der stillen Forschung entschieden hatte, habe ihm nicht den entscheidenden Mut zum Wandel bringen können.
Daher inszeniert Augustinus seinen Ausstieg als eine höhere Fügung mittels eines stilisierten Konversionserlebnisses. Zuvor werden zwei andere Konversionen proleptisch eingeflochten, welche nach einem ähnlichen Schema wie seine eigene abgelaufen seien: Zwei kaiserliche Beamte hätten sich vom Text der „Vita Antonii“, den sie zufällig in einem Haus gefunden hätten, dazu bringen lassen, asketisch zu leben. Eine zufällig aufgeschlagene Seite habe im Sinne einer göttlichen Botschaft fungiert. Der Augustinusforscher Pieree Courcelle geht davon aus, dass die parallel aufgebaute Gartenszene bei Augustinus‘ Erlebnis nicht als reales Erlebnis, sondern als stilisierte Darstellung der Wirkung der Pauluslektüre verstanden werden sollte.13 Dennoch habe erst die Bekehrung ihm den letzten Anstoß gegeben allem Körperlichen zu entsagen. Augustinus bricht mit seiner Biographie an der Stelle ab, als er die Bekehrung bereits erlebt hatte und mit seiner Mutter eine Überfahrt mit dem Schiff gen Thagaste machen wollte. Buch Neun schließt mit dem Ableben der Mutter. In Buch Zehn bis Dreizehn wird klar, dass das Bild von Possidius, sein Freund Augustinus habe mit großer Würde den weltlichen Genüssen wie fleischlicher Begierde entsagt, nicht dessen Innenleben widerspiegelte. Augustinus schildert ganz klar, dass es schwer für ihn sei und dass er des Nachts lüsterne Träume habe.14 Es sei eine Schwierigkeit bei Speisen das richtige Maß zu halten und zu entscheiden, ab wann es nicht mehr notwendiges Speisen, sondern begieriges Essen sei:
„…infirmitas mea tibi nota est. […] Sed adhuc vivunt in memoria mea, de qua multa locutus sum, talium rerum imagines, quas ibi consuetudo mea fixit, et occursantur mihi vigilanti quidem carentes viribus, in somnis autem non solum usque ad consensionem factumque simillimum. Et tantum valet imaginis inlusio in anima mea in carne mea. […] Nunc autem suavis est mihi necessitas edendi.[…] Hoc me docuisti, ut quemadmodum medicamenta sic alimenta sumpturus accedam. Sed dum ad quietem satietatis ex indigentiae molestia transeo, in ipso transitu mihi insidiatur laqueus concupiscentiae.“15
Erich Feldmann sieht in den „confessiones“ keine Autobiographie und auch keine exegetische oder philosophische Schrift. Für ihn handelt es sich um ein Protreptikos, ergo eine Werbeschrift für die christliche Lehre.16 Andere Forschermeinungen gehen mit der Einordnung differenzierter um. Sicherlich mag das Werk an gewissen Stellen einer christlichen Werbeschrift entsprechen, doch zeigen sich auch autobiographische und philosophische Abschnitte. Erneut sei auch noch einmal die Wahl des Titels zu bedenken, welchen Augustinus nicht ohne Intention gewählt haben wird. Er begibt sich auf eine selbstreflektierende Reise in seine Vergangenheit und bekennt sich seiner bisherigen Makel. Er befindet sich zu der Zeit, als er die „confessiones“ verfasst hat, in Hippo und soll die Nächte mit Forschungen zugebracht haben. Daher nehmen auch Forschungsthemen im Text immer wieder ihren Platz ein. Sie wirken wie dem Schreiber Augustinus plötzlich aufkeimende Gedanken, die er kurzerhand mit notiert hat. Und nicht zuletzt entspricht diese reflektorische, selbstkritische Arbeitsweise wahrscheinlich seiner Fähigkeit seine eigenen Tätigkeiten objektiv zu beurteilen, denn die „retractationes“, auf die im nächsten Abschnitt kurz eingegangen werden soll, sind Kommentare und Redaktionen, die er kurz vor seinem Lebensende rückblickend auf seine bisher publizierten Werke gemacht hat.
Seine Korrekturen von zuvor verfassten Schriften, Predigten und Briefen vollführt Augustinus in seinen „retractationes“. Er ist sich des dynamischen Elements im Erschaffen von theologischen Gedanken mit der entsprechenden Vorläufigkeit und Notwendigkeit zur Revision bewusst und widmet sich diesem Projekt in einer kritischen Rückschau –gegliedert entsprechend den Werken und der Chronologie der Erstellung.17 Seine autobiographischen Angaben, die hier und da im Kontext der Betrachtungen eingeworfen werden, können allerdings nur als Ergänzung der „Bekenntnisse“ und auch der Vita von Possidius angesehen werden. So liefert Augustinus lebenszeitliche Angaben zu sich, indem er über sein Werk „De beata vita“ schreibt, dass er es an seinem Geburtstag begonnen habe aufzuzeichnen.18 Außerdem macht er hierbei auch klar, dass seine Arbeit „Über die Akademiker“ im selben Jahr entstanden sei. Zu den fünfzehn Büchern „Über die Dreieinigkeit“ sagt er, dass er sechzehn Jahre gebraucht habe, um sie zu verfassen und dass die noch nicht vollendeten Anfänge davon unter dem Druck seiner Anhänger und ihr eigeninitiatives Streben gegen seinen Willen veröffentlicht worden seien.19 Es sind vorwiegend chronologische und einzelne persönliche Details, die den Korrekturen einen gewissen Platz als Autobiographie einräumen, jedoch nicht genug Inhaltliches bieten, um dieses Werk tatsächlich in dieses Genre einordnen zu müssen, was jedoch vielerorts geschieht. In seinem Prolog macht Augustinus deutlich, worum es ihm der Hauptsache nach hierbei geht: „Lange schon habe ich den Plan überlegt, den ich nun mit der Hilfe des Herrn in Angriff nehme, da ich meine, ihn nicht länger aufschieben zu dürfen: ich will meine Werke, Bücher, Briefe und Abhandlungen mit einer Art richterlicher Strenge durchsehen und, woran ich Anstoß nehme, gleichsam mit dem Griffel eines Zensors anmerken.“20
II.IV Die „Vita Augustini“ von Possidius
Für die Biographie von Possidius über seinen Lehrer Augustinus sind über zweihundert Handschriften nachzuweisen, wobei Zusatzausgaben für die liturgische Nutzung nicht in diese Angabe mit eingeflossen sind. Das Werk, dessen Entstehung in die Jahre zwischen 431 und 437 eingeordnet wird, erfreute sich großer Beliebtheit und somit erklärt sich die breite Überlieferung.21 Für die Ausarbeitung dieses Kapitels soll die kritische Ausgabe von Weiskotten –mit den Verbesserungen von Bastiaensen- als Basis dienen, welcher post Maurinos unter Berücksichtigung von etwa hundert Handschriften seine Ausgabe erstellt hat und bis heute maßgeblich ist.
Possidius von Calama war lange Zeit Schüler und auch Wegbegleiter von Augustinus von Hippo. Beide haben im Zönobium miteinander gelebt und daher wird Possidius den Privatmann und Bischof Augustinus tiefgehend gekannt haben, wobei er ihn noch nicht zuvor kannte und Details aus der Zeit vor der Bekehrung u.a. aus den augustinischen Bekenntnissen entnehmen musste bzw. konnte. Dass er diesem gegenüber voller Bewunderung war, zeigt sich an den rege eingesetzten rühmenden Wendungen und Optativen, mit denen er seine Vita Augustini verfasst hat und Augustinus unter allen Christen hervorhebt: („…optimi Augustini…“, „…beatissimus Augustinus…“).22 Wohlan sei jedoch zu bedenken, dass ob jener lobesträchtigen Schreibweise dem Rezipienten ein eher einseitiges Bild von Augustinus vermittelt wird. Es scheint, dass die besten Leistungen von Augustinus hier erwähnt wurden, jedoch die Begebenheiten vor dessen Bekehrung, welche den noch unentschlossenen und im Leben noch nicht sittlich gefestigten Augustinus gezeichnet hätten, gar nicht oder nur marginal: „Nec adtingam ea omnia insinuare, quae idem beatissimus Augustinus in suis Confessionum libris de semetipso, qualis ante perceptam gratiam fuerit qualisque iam sumpta viveret, designavit“.23 Trotzdem könne man hier nicht von einer klassischen Hagiografie sprechen, sondern mehr von einer Hagiologie, da „zu viele, nebensächliche Züge des Alltagslebens in die Vita eingetragen“ worden seien.24 So lautet das Urteil einer Münchener Forschungsgruppe um die opera Augustini, was sich mitunter in erschöpfend beschrieben Tischszenen zeige.25 Adressaten für die Vita sind für Possidius die „fideles“. In 31,1 schreibt er: „Es sind Anwesende und Abwesende gegenwärtiger und zukünftiger Zeit.“26 Die Anordnung des Werkes besteht aus diversen Einzelepisoden und scheint chronologisch keiner bestimmten Anordnung zu folgen. Temporale Verknüpfungen nimmt Possidius nur lose vor mittels Wendungen wie „iam“, „mox“, „eodem tempore“ usw.
„Deshalb kann ich auch nicht vom Leben und Lebenswandel des von Gott erwählten und zu seiner Zeit herausgehobenen alles überragenden Bischofs Augustinus schweigen.“27 So lautet einer der ersten Sätze, mit denen Possidius die Praefatio der Vita beginnt. Während er sich gleich darauf kontrastierend als den Geringsten bezeichnet, hat er doch die Inspiration durch den Hl. Geist erfahren sowie die Redeweise erhalten, um die Vita zu vollführen, was Augustinus‘ Lehre der Eingebung durch den Hl. Geist entspricht.28
Über Augustinus‘ Eltern schreibt Possidius, dass beide Christen gewesen seien. Dies scheint ein typisches Merkmal von Stilisierung zu sein. Augustinus deckt in seinen „confessiones“ selbst auf, dass die Mutter zwar eine streng gläubige Christin gewesen sei, die ihn schon „mit dem Salz des Kreuzes gewürzt hatte, kaum hatte er den Mutterschoß verlassen“29, der Vater aber erst kurz vor seinem Tod getauft worden sei.30
Des Weiteren berichtet Possidius davon, wie Augustinus zunächst in seiner Heimat Grammatik lehrte, später dann jedoch in Karthago ein magister rhetoricae gewesen sei, wo er sich auch den Manichäern anschloss –einer Gruppierung, die von der catholica fides abgespalten teils gewaltsam agierte. Dieses Tun bezeichnet Possidius als Irrglauben (error)31, dem Augustinus in der Phase verfangen gewesen sei. Dass Augustinus mit mehreren Frauen in einer konkubinaten Beziehung gestanden hat und auch ein Sohn, Adeodatus, daraus entstanden ist, wird wieder aus Gründen der Stilisierung verschwiegen bzw. verschleiert. Nur die große Freude seiner christlichen Mutter, dass ihr Sohn sich später zum Christentum bekehrte, sei größer gewesen als die Freude über einen fleischlichen Enkel, was als Hinweis auf Augustinus‘ Kind anzusehen ist.32
Die Verbannung der Irrelehre aus Augustinus‘ Herz solle die Güte von Ambrosius erreicht haben am Mailänder Hof, aber auch das Interesse am Neuplatonismus entfacht haben. In seiner eigenen Darstellung kam das Verwerfen der falschen Ansichten nicht unbedingt durch Ambrosius zustande, so Augustinus, sondern habe durch Gottes Fügung und Führung und durch die Lektüre von Ciceros „Hortensius“ stattgefunden, welches eine Aufforderung zur Philosophie enthalten habe: „Es war dieses Buch, das meinen Sinn veränderte, gerade dir, Herr, meine Gebete zukehrte und mein Wünschen und Verlangen andere werden ließ“.33 Augustinus habe daraufhin der fleischlichen Lust entsagt und den weltlichen Ehren den Rücken zugekehrt, nachdem er die Bekehrung unter dem Feigenbaum erlebt habe.34 In seinem dreißigsten Lebensjahr habe er auch nicht mehr als Rhetoriklehrer tätig sein wollen, da er die Rhetorik zur Nutzung von Lügen, von Geschwätzigkeit und Selbstdarstellung fortan abgelehnt habe: „Et placuit mihi in conspectu tuo non tumultuose abripere, sed leniter subtrahere ministerium linguae meae nundinis loquacitatis, ne ulterius pueri meditantes non legem tuam, non pacem tuam, sed insanias mendaces et bella forensia mercarentur ex ore meo arma furori suo.“35
Die weiteren Taten und Geschehnisse stellt Possidius recht ausführlich dar, doch an dieser Stelle mag ein kurzer Überblick genügen, da Vieles bereits im allgemein biographischen Kapitel dieser Arbeit genannt wurde. Einer Zeit des Rückzugs und Forschung in der Heimat folgend habe Augustinus‘ guter Ruf als Gelehrter ihm in Hippo, wo Bischof Valerius ein Priesteramt zu vergeben hatte, das nächste öffentliche Arrangement beschert. Alle biografischen Angaben stimmen darin überein, dass Augustinus sich in der Volksmenge befunden haben soll und die Menschen ihn, obwohl er sich wehrte, nach vorne zu Valerius gebracht hätten, um ihn weihen zu lassen, was dann auch geschah.36 Mit einer kleinen Anhängerschaft habe Augustinus auf dem Kirchengrundstück ein Kloster eingerichtet, wo man zusammen ein kontemplatives Leben gemäß den Aposteln hatte führen können ohne persönliches Eigentum und nur mit den nötigsten Gütern ausgestattet.
Entgegen der bisherigen Tradition habe Valerius ihm die Aufgabe des Predigens überlassen, was sich daraufhin in Africa auch in anderen Kirchen ereignet haben soll. Später sei Augustinus zum Bischof von Hippo ernannt worden und dies bis zu seinem Ableben geblieben sein. Seine glänzenden Fähigkeiten zur Disputation nutzend soll Augustinus sowohl schriftlich als auch persönlich Zweiflern oder Gegnern der katholischen Kirche entgegen getreten sein. Er soll gegen die Manichäer, die Presbyter, die Donatisten, die Arianer, die Pelagianer und die Circumcellionen mit Worten aufgestanden sein und soll dabei auch den Gerichts- und Staatsweg genutzt haben. Wenn es angebracht gewesen sein soll, habe er Fürsprache für Sünder gehalten, er habe als Richter fungiert und den Armen soll er aus der Kollekte Almosen dargereicht haben. Possidius stellt Augustinus‘ Wirken so breit gefächert dar, dass es nicht verwundert, dass er ebenfalls davon spricht, dass dieser auch des Nachts wach geblieben sei, um noch Zeit für seine Forschungen zu haben.37
1 Fuhrer, Augustinus, S. 57-63.
2 Für ausführliche Betrachtungen hierzu siehe: Fuhrer, Augustinus, S. 14.
3 Brown, Augustinus von Hippo, S. 81.
4 Durch den Historiker Orosius ist noch das Gentilnomen Aurelius belegt (apol. 1,4), konnte allerdings in seinem Wahrheitsgehalt bisher nicht verifiziert werden.
5 Augustinus, confessiones, Lib.2, III,6.
6 Hinsichtlich des Werkes “Hortensius” beschäftigt sich Augustinus vor allem mit der Eschatologie des “Hortenius”. Dieses Wirken steht im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zur Weisheit und dem Intellekt in „De trinitate“, 14,12. Dort nämlich gibt Augustinus eine Stelle aus der ciceronianischen Arbeit wieder, gemäß der im Jenseits die Beredsamkeit als auch die Tugenden nicht mehr benötigt würden, sondern das Glück einzig mittels Erkenntnis und Wissen bestehe: „Si nobis, inquit, cum ex hac vita migraverimus, in beatorum insulis immortale aevum, ut fabulae ferunt, degere liceret, quid opus esset eloquentia, cum iudicia nulla fierent; aut ipsis etiam virtutibus? Una igitur essemus beati cognitione naturae et scientia.“ Die Wiedergabe entspricht dem in Fragment 110 G geführten „Hortensius“-Ausschnitten. Im weiteren Kontext sagt er dann jedoch einschränkend, dass die vier Kardinaltugenden durchaus im Jenseits fortbestünden und auch erst dort vollkommen seien.
7 Augustinus, De beata vita, 5,13,23.
8 Flasch, S. 212-216.
9 Fuhrer, Augustinus, S.8.
10 Skutella S.91.
11 Idem, S.145.
12 Fuhrer, Augustinus, S.28.
13 Courcelle, Recherches, S.191.
14 Die „confessiones“ schrieb Augustinus in seiner Zeit in Hippo, als er sich im Zönobium befand.
15 Skutella S.237; 239-241.
16 Siehe Andreas Hoffmann: Feldmann, Erich. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Band 30, S. 391.
17 “Und wer meine Werke in der Reihenfolge lesen wird, wie sie geschrieben sind, wird vielleicht in der Tat finden, wie ich ihm Schreiben vorangekommen bin.“ Siehe hierzu J. C. Perl, Augustinus, Die Retractationen in zwei Büchern, S.5.
18 „Librum de beata vita non post libros de Academicis, sed inter illos ut scriberem contigit. Ex occasione quippe ortus est diei natalis mei et tridua disputatione completus, sicut satis ipse indicat.” Siehe hierzu C. J. Perl, Augustinus, Die Retractationen in zwei Büchern“, S. 13-14.
19 Idem, ibidem, S.169.
20 Idem, ibidem, S.3.
21 Man weiß, dass Possidius im Jahre 437 von dem Vandalenkönig Geiserich ins Exil verbannt worden ist. Da die Vita allerdings keinerlei Hinweise auf eine Verbannung bietet, konnte die zuvor angenommene Entstehungszeit von 431 bis 439 korrigiert werden bzw. der terminus ante quem noch präzisiert werden.
22 Skutella, S.15 u. S.17.
23 Idem, ibidem.
24 Geerlings, S.23.
25 Dennoch stellt er den heiligen Augustinus absolut in den Mittel- und Vordergrund seines Werkes, wie Wilhelm Geerlings folgendermaßen konstatiert: „Possidius tritt ohne jede Eitelkeit ganz hinter seinen Helden zurück. Selbst Episoden, in denen er Hauptakteur war und Augustinus nur Nebenfigur –wie etwa in der Auseinandersetzung mit dem Donatisten Crispinus- werden so dargestellt, als sei der eigentlich Handelnde Augustin, während er, Possidius, sich mit der Rolle des Protokollanten begnügt.“ Siehe hierzu W. Geerlings, Augustinus Opera, Possidius Vita Augustini, S. 8.
26 Harnack urteilte über Possidius als Schüler des Augustinus: „Possidius lebte und webte in den Werken des Augustinus.“ Siehe hierzu Harnack, Possidius, 10. Er meinte damit, dass Possidius dem Augustinus nicht nur im Lebensstil und seiner Art zu schreiben nacheiferte, sondern, dass er im Kontext der Adressaten eine afrikaweite und noch darüber hinausgehende Wirkung seiner Arbeit erhoffte. Mehrfach schreibt er in seiner Vita, dass Augustinus der Kirche zur Blüte verholfen habe, die sogar noch über Afrika hinausgegangen sei.
27 Geerlings S.27.
28 Pollmann, S.47.
29 Augustinus, confessiones, 1,17.
30 Kurt Flasch, S.47.
31 Geerlings, S.25.
32 Idem, S.27.
33 Flasch, S.76.
34 Idem, S.211-220.
35 Skutella, S.180-181.
36 Fuhrer schreibt, dass eine spontane Ernennung in ein Amt durchaus nicht unüblich gewesen sei in jener Zeit. Siehe hierzu: Fuhrer, Augustinus, S.55.
37 Possidius, Vita Augustini