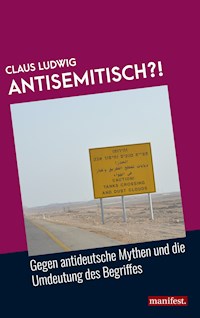
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gegen jeden Antisemitismus. Und die Umdeutung des Begriffes. Antisemitismus bleibt ein ernstes Problem und eine Gefahr für jüdische Menschen. Fast überall in Europa sind rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Bewegungen gewachsen. Insofern scheint es angebracht, dass auch die EU, Regierungen und jüdische Gemeinden »Alarm« schlagen und auf das Problem hinweisen. Doch diese Aktivitäten sind oftmals nicht, was sie scheinen. Sie warnen eben nicht vor den neuen Faschisten. Für sie sind die Gegner*innen der israelischen Regierung das Hauptproblem. Wir erleben gerade, wie auf breiter Front eine Neudefinition des Begriffes »Antisemitismus« vorgenommen, wie dieser von den bürgerlichen Regierungen und neurechten Kräften sowohl gegen die politische Linke als auch gegen Geflüchtete aus dem Mittleren Osten verwendet wird. Nicht die Verleumdung, mit der Linke überzogen werden, nicht einmal die Vorurteile gegen die Menschen aus dem arabischen Raum sind das Schlimmste in dieser Diskussion, sondern die Verharmlosung faschistischer und rassistischer Ideologien und die Begünstigung der Akzeptanz der angeblich »philosemitischen« neuen Rechten. Wir wollen dazu beitragen, die Diskussion auf die Füße zu stellen. Dabei beschäftigen wir uns sowohl mit der Geschichte des Antisemitismus als auch mit der Geschichte und der aktuellen Situation in Israel und Palästina und entwickeln eine internationalistische, sozialistische Herangehensweise an die Nahost-Frage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vom mittelalterlichen Judenhass zu Auschwitz
Ein Begriff wird verbogen
Die alte Feindschaft?
Israel in Gefahr?
Die sozialistische Haltung – damals und heute
Der palästinensische Widerstand
Rammbock gegen die Linke
Unter falscher Flagge – Die »Antideutschen«
Gegen jeden Antisemitismus. Und die Umdeutung des Begriffes.
Gegen jeden Antisemitismus. Und die Umdeutung des Begriffes.
Autor
Impressum
Einleitung
Am 27. Januar 2019, dem Gedenktag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die sowjetische Armee, marschierte eine Gruppe von fünfzig polnischen Faschisten an der Gedenkstätte auf, angeführt von dem bekannten Antisemiten Piotr Rybak. Er rief:
»Wir sind die Herren hier im Land! Das ist der Anfang des Kampfes um das Polentum in Polen … Die jüdische Nation und Israel tun alles, um die Geschichte der polnischen Nation zu verändern.«1
Der polnische Innenminister nannte die Gruppe »verrückt«, die Regierung sei nicht dafür verantwortlich. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Unter der Regierung der rechtskonservativen PiS (»Recht und Gerechtigkeit«) gedeihen nationalistische, faschistische und antisemitische Gruppen. Egal wie verrückt diese im Einzelnen sind: Dies waren die Ideen in Hitlers »Mein Kampf« auch. Für die Faschisten ist jedoch jeder Wahnsinn bitterer Ernst.
Antisemitismus bleibt ein ernstes Problem und eine Gefahr für die jüdischen Menschen. Fast überall in Europa sind rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Bewegungen gewachsen. An der Basis dieser Bewegungen wuchern die dumpfen Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden. Die neurechten Führer*innen geben sich gerne pro-israelisch. Das ist die ideale Deckung, um ihren Hass auf Muslime konzentriert vorzutragen. Die meisten ihrer Anhänger*innen machen diesen feinen Unterschied nicht, sie haben kein Problem damit, Juden und Muslime gleichermaßen abzulehnen.
In Deutschland konnte die Nazi-Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) jahrelang unbehelligt von staatlichen Stellen agieren und Morde planen. In der Bundeswehr und der Polizei existieren faschistische Netzwerke.
Auch im Mittleren Osten gibt es Hass gegen Jüdinnen und Juden. Dieser unterscheidet sich vom Antisemitismus europäischer Prägung, der die Grundlage für den Völkermord durch das Nazi-Reich bildete. Ohne Zweifel beinhaltet auch der mittelöstliche Judenhass rassistische Elemente. Kriege und Krisen in der Region haben brutale reaktionäre Bewegungen wie Daesh (»Islamischer Staat«) hervorgebracht, die ihren Willen zur Versklavung und Vernichtung von Minderheiten bei ihrem Vorgehen gegen die jezidische Bevölkerung des Irak bewiesen haben.
Insofern scheint es angebracht, dass die EU, die europäischen Regierungen, jüdische Gemeinden und viele lokale Politiker*innen »Alarm« schlagen und auf das Problem hinweisen. Auf vielen Ebenen werden Verhaltenskodizes beschlossen, oft angelehnt an die Antisemitismus-Definition der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Die EU hat Ende 2018 eine umfassende Studie zum Antisemitismus vorgelegt.
Doch diese Aktivitäten sind nicht, was sie scheinen. Die staatlichen Institutionen, die bürgerlichen Politiker*innen und Medien warnen eben nicht vor den neuen Faschisten. Für sie sind die politischen Gegner*innen der israelischen Regierung das Hauptproblem. Dem linken Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn wird seit mehreren Jahren Antisemitismus unterstellt, weil er die Forderung nach einem Ende der Besatzung unterstützt. Die Boykott-Kampagne BDS (Boycott, Desinvestment, Sanctions) richtet sich gegen die Unterdrückung der Palästinenser*innen durch den Staat Israel. Sie wird in vielen Medien unhinterfragt als antisemitisch bezeichnet. BDS-Veranstaltungen werden verboten, Künstler*innen ausgeladen.
Fast in jedem Bericht in den deutschen Medien, in dem vom Antisemitismus die Rede ist, wird vor dem Antisemitismus »auch von links« gewarnt, als wäre es selbstverständlich, dass dieser existiere; als müsse es nicht einmal erklärt werden, warum es eine linke Variante überhaupt geben kann; als sei es völlig klar, dass die politischen Erben der Sozialist*innen und Kommunist*innen der 1930er Jahre, die vor der jüdischen Bevölkerung und mit ihnen die Konzentrations- und Vernichtungslager durchlitten, auch antisemitisch seien.
Der Begriff »Antisemitismus« wird ausgedehnt auf jede polemische oder kämpferisch vorgetragene Kritik am israelischen Staat. Es ist angeblich antisemitisch, wenn Palästinenser*innen auf einer Demo »Kindermörder Israel« rufen, nachdem Kampfflieger der Israeli Defence Forces (IDF) in Gaza Zivilist*innen, darunter Kinder, getötet haben. Es zeuge angeblich von antisemitischen Vorstellungen, wenn die israelische Fahne auf Demos verbrannt wird.
Wir erleben gerade, wie auf breiter Front eine Neudefinition des Begriffes »Antisemitismus« vorgenommen, wie dieser von den bürgerlichen Regierungen und neurechten Kräften sowohl gegen die politische Linke als auch gegen Geflüchtete aus dem Mittleren Osten gewendet wird.
»… deutsche Antisemitenjäger und Israelfreunde haben andere Sorgen. Nicht etwa der Antisemitismus als ein traditioneller Erbteil rechter und rechtsextremer Ideologien, nicht der Faschismus und seine Ausformung als Nazismus in Deutschland, der die unsägliche Katastrophe über die Juden Europas gebracht hat, sind Ziel ihrer ideologischen Agitation, sondern der ‚linke Antisemitismus‘.«2
Die Realität wird dabei komplett verfälscht. Der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolfssohn, bekannt geworden durch seine den Krieg bejahenden Auftritte im Fernsehen während des Golfkrieges 1991, hält den »muslimischen Antisemitismus«3 für gefährlich, dieser sei »liquidatorisch«. Dieser hätte Verbündete bei den Linken, auch dort gäbe es diese »liquidatorischen« Tendenzen. Die Rechten hingegen seien harmlos, ihre Art des Antisemitismus sei in der Defensive. Gestalten wie Höcke wären »zutiefst unsympathisch«, doch die Partei AfD hätte ihre »Schattierungen«, immerhin würden keine Israel-Fahnen auf deren Demos verbrannt.
Wolfssohn radikalisiert Argumente, die nicht nur von rechtsaußen, sondern aus dem Mainstream bürgerlicher Parteien kommen. Seine Äußerungen machen deutlich, wohin die Debatte zur Neudefinition des Antisemitismus führt.
Nicht die Verleumdung, mit der Linke überzogen werden, nicht einmal die Vorurteile gegen die Menschen aus dem arabischen Raum sind das Schlimmste in dieser Diskussion, sondern die Verharmlosung faschistischer und rassistischer Ideologien und die Begünstigung der Akzeptanz der angeblich »philosemitischen« neuen Rechten.
Wer ohne jeden Beweis Muslimen und Linken vernichtenden Judenhass unterstellt, der relativiert die tatsächliche Vernichtung, die Shoah, den Mord an sechs Millionen europäischen Jüdinnen und Juden durch das Nazi-Regime. Der Vorwurf der Verharmlosung von Auschwitz wird häufig genutzt, wenn die israelische Besatzung mit scharfen Worten kritisiert wird, doch nie war er angebrachter als in dieser Debatte.
Vor lauter Eifer, Israels Regierung den Rücken freizuhalten, wird die Gefahr von rechts klein geredet und ein angeblicher linker Antisemitismus konstruiert; eine Politik, die Premier Netanyahu auch selbst betreibt, indem er zu Rassisten wie Orbán in Ungarn oder Bolsonaro in Brasilien ein gutes Verhältnis hat.
Für Leute wie Wolfssohn ist das Verharmlosen von Rechtsextremen die eigentliche Agenda, doch viele jüdische Gemeinden können kein Interesse daran haben. Sie tappen in die Falle der Gleichsetzung jüdischer Interessen mit der des Staates Israel, eine Gleichsetzung, die so sehr im Interesse der wirklichen Judenhasser*innen liegt.
Diese Debatte wird vielen Aktivist*innen der Arbeiterbewegung, der antifaschistischen, der Mieter*innen-, Frauen- und Klimabewegung absurd vorkommen. Natürlich sind die Rechten gefährlich, natürlich sind Linke keine Rassisten oder Antisemiten, das dürfte den meisten Menschen klar sein.
Und doch können wir diese Debatte nicht ignorieren. Mit der Parole »Antisemitismus bekämpfen« werden in vielen Ländern demokratische Rechte eingeschränkt, Auftrittsverbote verhängt, Rufmordkampagnen gestartet. Sämtliche Gruppen, die sich in der Palästina-Solidarität engagieren, die meist links gerichteten palästinensischen Gemeinden sowie jüdische Gegner*innen des Besatzungsregimes werden beschimpft und diskriminiert.
Die Wirkung der Umdefinition des Antisemitismus-Begriffes ist jedoch nicht auf die politische Lage in und um den Nahen Osten begrenzt. Im Kern geht es in dieser Kampagne darum, die radikale Linke insgesamt und jegliche Alternative zum Kapitalismus zu diskreditieren und in den Schmutz zu ziehen.
Die Verwirrung innerhalb der Linken selbst ist groß. Sogenannte »antideutsche« oder »israelsolidarische« Gruppen haben sich der Kampagne angeschlossen, gebärden sich teilweise als deren extremer Flügel. Auch bei Gruppen, die noch Reste eines linken Selbstverständnis und eine Zehenspitze in der Realität haben, herrscht Konfusion. Das Rheinische Antifaschistische Bündnis gegen Antisemitismus (RABA), das auch im breiten linken Bündnis Köln gegen Rechts (KgR) vertreten ist, begründete die Teilnahme an einer Kundgebung unter dem Motto »Cologne Kippa« folgendermaßen:
»Unabhängig von den Anmelder*innen der Veranstaltung, deren politische Agenda wir in vielen, u.a. rechtsoffenen Punkten nicht teilen, möchten wir (…) dazu aufrufen, an diesem Termin solidarisch mit den Betroffenen dort zu stehen.«4
Anlass für diese Veranstaltung war der Fall eines aus den USA stammenden jüdischen Professors in Bonn, der überfallen wurde, aber von den herbei gerufenen Polizisten als Täter behandelt wurde. Im Verlauf dieser Kundgebung ging es jedoch nicht um den Fall des Professors oder um antisemitische Hetze und Gewalt in Deutschland, sondern um die Kritik der LINKE-Landesvorsitzenden Inge Höger an der israelischen Besatzung und den Angriffen gegen Gaza. Höger wurde auf der Kundgebung von Redner*innen als »Antisemitin« diffamiert. RABA war allerdings zufrieden, denn die dort anwesenden Rechtspopulisten gaben sich nicht allzu offensiv, man konnte sich als Konsens auf den politischen Kurs des Anmelders, einen FDPlers vom rechten Parteiflügel einigen.
Gerade »israelsolidarische« Gruppen belassen es nicht bei Propaganda, sondern bedrohen Aktivist*innen und schlagen auch schon mal zu, wie zu Silvester in Hamburg5. Sie betätigen sich als verlängerter Arm des deutschen und des mit ihm verbündeten israelischen Staates zur Unterdrückung von Meinungsäußerungen. Eines ihrer Ziele scheint zu sein, die Linke weiter zu verwirren und zu spalten und durch die Polarisierung der Nahost-Frage Menschen abzuschrecken, überhaupt aktiv zu werden, weil sie nicht bereit sind, sich zu einer der scheinbar unversöhnlichen Seiten zu bekennen.
Diese Diskussion muss explizit geführt werden. Es gibt in der deutschen Linken auch Gruppen, zum Beispiel im »antinationalen« Spektrum, die nicht »antideutsch« oder fanatisch an dieser Frage sind, die aber immer wie mit der Nadel gepiekst wirken, wenn von der Solidarität mit den Palästinenser*innen die Rede ist oder der israelische Staat eindeutig kritisiert wird.
»Man darf doch nicht …«, »Wir als Deutsche haben doch …« beginnt deren Schnappatmung, wenn Besatzung, Mauerbau oder Bomben auf Gaza kritisiert werden. Tatsächlich haben Linke in Deutschland eine besondere geschichtliche Verantwortung. Doch die kann nicht darin bestehen, die Unterdrückung der Palästinenser*innen wegen der historischen Bedeutung der Shoa zu relativieren. Die Mitglieder der SAV definieren sich politisch nicht in nationalen Kategorien. Wir sind Marxist*innen, Internationalist*innen. Wir leben in Deutschland. Doch wir sehen es als unsere Pflicht, Unterdrückung und Diskriminierung in jeder Form und überall zu bekämpfen, mit unseren Genoss*innen in der ganzen Welt, auch in Israel und Palästina.
Die Verwirrung zieht sich bis hinein in die Partei die LINKE. Neben offen kriegshetzerischen neokonservativen Gruppen wie dem Bundesarbeitskreis Shalom (BAK Shalom) in der Jugendorganisation linksjugend[‘solid] gibt es eine ganze Reihe von LINKE-Abgeordneten, die sich an der Umdeutung des Antisemitismus-Begriffes beteiligen.
In diesen Kreisen werden wir uns durch diesen Text nicht beliebt machen. Wir könnten es auch ruhiger angehen. Die SAV, das Committee for a Workers International (CWI) und dessen Sektion in Israel/Palästina, Tnu`at Maavak Sozialisti / Harakat Nidal Eshtaraki (Bewegung Sozialistischer Kampf), haben eine durchaus eigene Tradition des Umgangs mit der Nahost-Frage. Wir haben nie unkritisch die Methoden der palästinensischen Linken wie der PFLP oder der DFLP bejubelt. Wir haben immer auf die Notwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse hingewiesen und dass die Befreiung Palästinas nur gelingen kann, wenn die jüdisch-israelischen Arbeiter*innen erreicht werden. Wir haben die Strategie des individuellen Terrors klar abgelehnt, haben nicht die Linie der PLO schön geredet oder gar Illusionen in die reaktionären Organisationen wie Hamas, Islamischer Dschihad oder Hisbollah geschürt.
Wir stürzen uns in diese schmutzige Debatte, um den Kampf gegen den »Rammbock Antisemitismus« mit marxistischen Argumenten zu stärken. Äquidistanz und ein unsicheres »ja aber« helfen nicht weiter. Wir verteidigen die Legitimität des palästinensischen Befreiungskampfes inklusive der militärischen Selbstverteidigung – trotz der Führung der Bewegung. Wir verteidigen das Recht auf die BDS-Kampagne – obwohl wir diese nicht für den besten Weg halten, das israelische Besatzungsregime zu bekämpfen. Wir verteidigen das Recht von Palästinenser*innen und linken Jüdinnen und Juden weltweit, wütend zu sein, den Staat Israel zu beschimpfen und bei Vergleichen über das Ziel hinaus zu schießen. Es sind ihre Leute, ihre Freundinnen und Freunde, ihre Familien, arabisch und jüdisch, die unter der Lage im Nahen Osten leiden, unter Bomben, Ängsten und permanenter Mobilmachung.
Die Linke und die Arbeiterbewegung müssen den ideologischen Kampf gegen die falsche Nutzung des Antisemitismus-Begriffes führen, um der Verharmlosung der rassistischen Rechten entgegen zu treten, Spielräume für Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf zu verteidigen und um zu verhindern, dass Auschwitz umgedeutet und die Verantwortung der Kapitalistenklasse Deutschlands für dieses größte Verbrechen der Menschheit in der Unbestimmtheit einer deutschen »Kollektivschuld« vergraben wird.
https://www.welt.de/politik/ausland/article187813534/Holocaust-Gedenktag-Polnische-Nationalisten-marschieren-in-Auschwitz-auf.html
↩
Zuckermann, Moshe: »Der allgegenwärtige Antisemit: oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit«, Westend-Verlag, Frankfurt 2018; E-Book-Version, ISBN 978-3864892271, Position 2373
↩
https://www.nzz.ch/international/der-gefaehrlichste-antisemitismus-ist-der-muslimische-ld.1439950. Wolfssohn kann sich in einem »NZZ-Standpunkt« äußern. Die Neue Zürcher Zeitung scheint sich gerade nach massiv nach rechts zu orientieren, Kritiker*innen sprechen von einer »Säuberung« gegen liberale Redakteure und Redakteurinnen.
↩
https://www.facebook.com/RABAkoeln/
↩
https://de.indymedia.org/node/27635
↩
Vom mittelalterlichen Judenhass zu Auschwitz
Eine »Rassentheorie«, eine »wissenschaftliche« Einteilung der Menschen gab es im Feudalismus nicht. Die »gottgegebene« Ordnung war Rechtfertigung genug für die Ausplünderung und Versklavung anderer Völker. Aber die Feudalgesellschaft stieß immer mehr mit den Interessen des aufkommenden Kapitalismus zusammen. Kapitalisten gründeten Manufakturen und Fabriken, in denen eine große Zahl von Lohnabhängigen arbeiteten.
Damit sich die kapitalistische Wirtschaft überhaupt entwickeln konnte, musste die übrige Welt ausgeplündert werden. Die Reichtümer Indiens, das Gold und Silber der Inka, die riesigen Profite aus dem Sklavenhandel waren das Fundament, auf dem die Fabriken errichtet wurden. Die Baumwolle, auf der die Textilindustrie beruhte, wurde von afrikanischen Sklaven gepflückt. Die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und mit ihr die enorme Weiterentwicklung der Naturwissenschaften führten zum Entstehen des Rassismus als geschlossenes Weltbild.
Es klingt seltsam, dass ausgerechnet das Zeitalter der Aufklärung, eine Epoche großen Fortschritts für die Menschheit, den systematischen Rassismus hervorgebracht hat. Doch gerade weil mit dem Siegeszug des Bürgertums und der kapitalistischen Produktionsweise auch die Aufklärung Einzug hielt, gerade weil Wissenschaft und Vernunft Religion und Obskurantismus herausforderten, war eine quasi-wissenschaftliche Rechtfertigung für die Ausbeutung und Versklavung der indigenen Völker der »neuen Welt« und der afrikanischen Sklaven nötig. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre erklärte dies so:
»Weil keiner seinesgleichen ausplündern, unterjochen und töten kann, ohne ein Verbrechen zu begehen, erheben sie es zum Prinzip, dass der Kolonisierte kein Mensch ist.«1
In dieser Zeit wurden die Naturwissenschaften systematisiert. Elemente, Pflanzen, Tiere und der Mensch wurden erfasst, in Kategorien eingeteilt. Die Wissenschaft drückte die Interessen der Kapitalisten aus wie vorher die Kirche die der Feudalherren. Statt der Rechtfertigung durch Gottes Gnaden wurde die soziale Ungleichheit mit der »wissenschaftlichen Analyse« von den angeborenen Unterschieden begründet. Sowohl die Situation der arbeitenden Klasse als auch der Kolonialismus und Imperialismus gegenüber Asien, Afrika und Lateinamerika wurden damit gerechtfertigt.
Die Einteilungen in »Rassen« waren sämtlich willkürlich. So teilte der Rassentheoretiker Carl von Lenné im Jahr 1758 die Menschen so ein:
»Europaeus albus: (…) einfallsreich, erfinderisch (…) weiß, sanguinisch (…) Er lässt sich durch Gesetze lenken. Americanus rubescus: mit seinem Los zufrieden, liebt die Freiheit (…) gebräunt, jähzornig (…) Er lässt sich durch die Sitte lenken. Asiaticus luridus: habsüchtig (…) gelblich, melancholisch (…) Er lässt sich durch die allgemeine Meinung lenken. Afer niger: verschlagen, faul, nachlässig (…) schwarz, phlegmatisch (…) Er lässt sich durch die Willkür seiner Herrscher lenken.«2
Die Einteilung der Menschen gemäß ihrer Hautfarbe ist genauso sinnvoll wie die gemäss ihrer Körpergröße oder Ohrform. Die Menschen, gleich welcher Herkunft, haben gleiche Fähigkeiten wie Sinneswahrnehmungen, Sprache Denkvermögen. Eine klare Abgrenzung verschiedener Gruppen ist unmöglich. Immer wieder in der Geschichte kam es zu Völkerwanderungen und Kriegszügen. Staaten und Völker entstanden als Überschichtungs- und Überlagerungsgesellschaften.
Die Nutzung der »Rassenkunde« wurde durch die politischen und wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Die Menschen in China und Japan, die jahrhundertelang als hell wie die Europäer gegolten hatten, wurden um 1800 immer häufiger für gelb erklärt – Ostasien war als Kolonialgebiet interessant geworden. Ein großer Teil der »Rassentheorien« wurde von aktiven Kolonialisten verfasst. Je nach politischer Konjunktur zerfielen auch »die Weißen« in verschiedene Rassen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs passten deutsche Autoren die Bewertungen der vorhandenen Kriegskoalition an. Die mit dem Reich verbündeten Tschechen, Kroaten oder Polen wurden zu »lateinischen Slawen«, dafür wurden die gegnerischen Russen zu »Mongolen« und die Engländer zu »Kelten« umdefiniert.
Der Rassismus konzentrierte sich zunächst auf die Begründung der »Minderwertigkeit der farbigen Rassen«. Doch schon ab 1750 entstanden die ersten Theorien vom Ariertum. Sie behaupteten, die nordischen, germanischen Völker seien höherstehende, »unvermischte Rassen«. Dieser Mythos von den Germanen als reine Nachkommen der Hochkulturen Indiens (»Indogermanen«) war blödsinnig, wurde aber weiterentwickelt. Erst vom Franzosen Gobineau, dann vom antisemitisch geprägten Kreis um Richard Wagner. Schließlich wurde der Wahn vom Ariertum mit der Lehre der Minderwertigkeit der Juden und der Schwarzen von Wagners Schwiegersohn Chamberlain (1855-1927) systematisiert. Dessen »Erkenntnisse« bildeten die Grundlage für Hitlers »Mein Kampf«.
Der moderne Antisemitismus ist demnach ein Produkt des Zeitalters von Nationalismus und Imperialismus und damit auch ein Ergebnis der Aufklärung. Der mittelalterliche Hass auf die Juden weist viele Unterschiede zum Antisemitismus des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts auf, letzterer knüpft aber an diesem an. Die Theoretiker dieser Ideologie sahen sich auf dem Wege der »Wissenschaft«, sie systematisierten den Hass. Im Unterschied dazu war der mittelalterliche Judenhass eine eher »pragmatische« Erscheinung.
Der Begriff Antisemitismus wurde 1879 geprägt von Wilhelm Marr, einem der Pioniere dieses modernen Antisemitismus. Er wollte sich dadurch von der früheren religiösen Judenfeindschaft, der »Judenfresserei«, abgrenzen, die für ihn nicht mehr in das aufgeklärte, fortschritts- und wissenschaftsgläubige 19. Jahrhundert passte.
Juden als »Volksklasse«
Vor der Entstehung des modernen Rassismus hatte es keine länger anhaltende systematische Verfolgung einer ethnischen oder religiösen Minderheit gegeben – mit Ausnahme der Jüd*innen. Wie kam es dazu, was machte diese Gruppe so besonders?
Allein die christlichen Legenden darüber, dass »die Juden« Jesus ermordet hätten, reichen nicht zur Erklärung aus. Auch andere religiöse oder ethnischen Gruppen hätten über Abgrenzung und Vorurteile zu Sündenböcken gemacht werden können. Der jüdische belgische Marxist Abraham Léon, am 7. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet, sieht die Gründe für die besondere Geschichte des jüdischen Volkes nicht in der Ideologie, sondern in den ökonomischen und sozialen Verhältnissen, konkret in der spezifischen Stellung der Jüd*innen in der Wirtschaft.
Nach Léon ist die Diaspora, der Auszug aus Palästina, nicht Ergebnis eines einzigen gewaltsamen Ereignisses, sondern eher der kargen Landschaft geschuldet, die nicht zur Ernährung ihrer Bewohner*innen ausreichte. Spätestens im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung begann eine massenhafte Emigration aus Palästina, deren Katalysator die römische Gewaltherrschaft war, deren Ursache jedoch in den ökonomischen Verhältnissen liegen dürfte.
Die Juden nahmen überwiegend die Rolle des Händlers ein. Dieser war weder in der Antike noch im Mittelalter besonders wohlgelitten. In beiden Zeitaltern basiert die Gesellschaft überwiegend auf der Produktion von Gebrauchswerten, die notwendige Vermittlung durch Handel wurde als schmutziges Geschäft gesehen. Léon schrieb, »der Landbesitzer hasst und verachtet den Händler, ohne auf ihn verzichten zu können.«3
Im frühen Mittelalter waren die Juden ein Brückenkopf der Kultur des östlichen Mittelmeerraums im nach der Römerzeit in Naturalwirtschaft zurück gefallenen Europa. In der Naturalwirtschaft des frühen Mittelalters war Geld ein Fremdkörper. Später in der einfachen Warenproduktion der Bauern und Handwerker galt dasselbe für das Kapital. Es war ein Fremdkörper, aber ein notwendiger Fremdkörper, weil die Wirtschaft sonst zu starr und unflexibel gewesen wäre. Deshalb wurden Handel und Geldgeschäfte an eine Gruppe delegiert, die selbst ein Fremdkörper war und ständig als Fremdkörper reproduziert wurde.
Der Zusammenhalt in der Diaspora erklärt sich demnach auch nicht aus den Besonderheiten der jüdischen Religion, sondern aus der gemeinsamen gesellschaftlichen Stellung, die sie dazu brachte, eine gemeinsame Kultur und damit auch Religion zu pflegen. Léon verwendete dafür den Begriff »Volksklasse«. Die abgesonderte Stellung der Jüd*innen brachte es mit sich, dass sie gehasst, beneidet, verfolgt, aber doch benötigt wurden. Sie waren nicht die einzige Gruppe mit dieser speziellen Funktion. Händler gehörten in vorkapitalistischen Gesellschaften oft einer ethnischen oder religiösen Minderheit an. So erfüllten in Ostasien oft Chinesen diese Funktion, christliche Armenier und Griechen im Osmanischen Reich, Inder in Ostafrika. Allerdings verfügten diese Ethnien im Unterschied zu den Jüd*innen auch über eine territoriale Basis, die sich früher oder später nationalstaatlich organisierte.
Die vergleichsweise gute Lage der Jüd*innen in Frühmittelalter wird durch den Erlass Papst Gregor des Großen um das Jahr 600 symbolisiert, der die Juden als »schutzwürdige Fremde« einstufte und festschrieb, dass sie nicht zwangsweise getauft werden dürften.
Für die Juden in Westeuropa verschlechterte sich die Lage spätestens ab dem 12. Jahrhundert. In den wachsenden Städten entwickelte sich eine eigene, heimische Handels- und Handwerkerklasse, die zunehmend für den Markt produzierte und diesen organisierte. Es kam zur Judenverfolgung und zur Vertreibung der Jüd*innen aus Westeuropa. Schon 1012 wurden sie aus Mainz vertrieben, 1084 entstand in Speyer das erste urkundlich belegte Ghetto. Ende des 12. Jahrhunderts wurden zu Beginn eines Kreuzzuges viele englische Juden getötet. 1348-1351 wurden in ganz Europa bis zu eine Million Juden, ein Drittel der Bevölkerung, ermordet, weil sie für die Pest verantwortlich gemacht wurden. Nach Jahrzehnten von blutigen Pogromen mit Zehntausenden Toten wurden 1492 sämtliche Juden aus Spanien vertrieben, 300.000 Menschen mussten am Vorabend von Columbus‘ Reise Richtung Westen das Land verlassen. Schon 1394 waren sie aus Frankreich ausgewiesen worden. Eine erneute Diaspora begann, dieses Mal in Richtung Osten, wo die kapitalistischen Elemente noch nicht soweit entwickelt waren.
Dort, wo sie nicht vollständig vertrieben waren, änderte sich ihre soziale Stellung. Aus dem Handel waren sie verdrängt worden. Viele wurden zu Wucherern, die Geld an Adlige und Königshäuser verliehen. Doch diese Phase währte nur kurz:
»Der relative Überfluss an Geld erlaubt es dem Adel, das Joch der Wucherer abzuschütteln. Die Juden werden nach und nach aus allen Ländern vertrieben.«4
Auswirkungen des Kapitalismus
»Eben weil die Juden den primitiven (Kaufmanns- und Wucher-)Kapitalismus repräsentierten, konnte die Entwicklung des modernen Kapitalismus ihrer gesellschaftlichen Stellung nur schaden. Diese Tatsache schließt nun keineswegs die individuelle Beteiligung von Juden an der Schaffung des modernen Kapitalismus aus. Aber wo immer sich die Juden in die Kapitalistenklasse integrieren, erfolgt auch ihre Assimilierung.«5
Sie verloren ihre Stellung als spezielle »Volksklasse«. Vor allem die Jüd*innen, die an der allgemeinen Emigration nach Nordamerika teilnahmen, hatten dort keine spezifische ökonomische Funktion, sie differenzierten sich in Klassen wie alle anderen Emigranten-Gruppen auch.
Es begann ein Prozess der Integration in die kapitalistische Gesellschaft. Nach und nach erschlossen sich die Jüd*innen viele Berufsgruppen. In Europa bildete sich ein jüdisches Proletariat, allerdings konzentriert in den eher handwerklich organisierten Sektoren der Konsumgüterindustrie, welches relativ früh der Ausweitung der Großindustrie zum Opfer fallen sollte. Die Zahl der gemischten Ehen nahm zu, in Deutschland stieg sie um die Jahrhundertwende auf rund 50 Prozent der rein-jüdischen Ehen, in Dänemark sogar auf 80 Prozent. Die Zahl der Konvertit*innen stieg, der Gebrauch des Jiddischen ging rasch zurück. Die Dynamik des Kapitalismus schien die jüdische Frage zu lösen und die jahrhundertelang diskriminierte »Volksklasse« in die Gesellschaft zu integrieren. In Osteuropa hingegen blieben die Juden eine spezielle Gruppe, hier ging der Prozess nie so weit.
Doch mit dem Aufstieg des Kapitalismus ging dessen Krisenhaftigkeit einher. Während er in Osteuropa noch in seinen mittelalterlichen Wurzeln steckte, begann im Westen schon der Niedergang der imperialistischen Phase. Dazu Abraham Léon:
»Die Juden werden zwischen zwei Systemen zerrieben: Dem Feudalismus und dem Kapitalismus, von denen jeder den Fäulnisprozesse des anderen vorantreibt.«6
»Der Kapitalismus verschließt denjenigen Völkern, deren traditionelle Existenzgrundlage er zerstört hat, den Weg in die Zukunft, nachdem er den Weg in die Vergangenheit abgeschnitten hat (…) Die extreme und tragische Situation des Judentums in unserer Zeit erklärt sich durch die außerordentliche Unsicherheit seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung.«7
Die Lage in Osteuropa wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts dramatisch. Aus dem Handel waren die Juden verdrängt worden. Chronische Krise und Arbeitslosigkeit machten es schwer, andere Berufe zu finden. Der Antisemitismus hatte sich zu einer starken Ideologie entwickelt und erfasste breitere Massen, die sich auch mit Juden in der Konkurrenz um Arbeitsplätze befanden. In Westeuropa wuchs der Antisemitismus vor allem im Kleinbürgertum.
Rassenideologie
Léon weist daraufhin, dass zum Zeitpunkt der Arbeit an seinem Buch, 1942, die Frage der Konkurrenz keine Rolle mehr in der Hitlerschen Propaganda spielte. Stattdessen stand das mystische Element im Vordergrund des Antisemitismus, die Verschwörungstheorien aus den »Protokollen der Weisen von Zion«, die in Wahrheit von der Geheimpolizei des russischen Zaren verfasst worden waren oder andere Theorien über angebliche »jüdische Weltherrschaftspläne«.





























