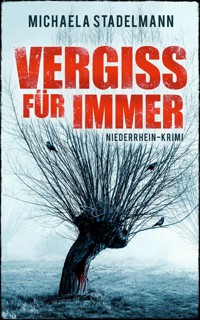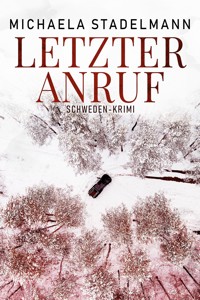Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
August 1991. Ich heiße Luca und schulde meiner Kollegin Cindy einen Besuch drüben im Osten, in ihrer alten Heimat. Cindy ist ein guter Kumpel, aber leider auch wahnsinnig anstrengend. Zum Glück sind ihre Nachbarn Ursula und Detlef vorbeigekommen, um mit uns ein paar Flaschen Wein zu köpfen. Während wir fröhlich Rosenthaler Kadarka in uns hineinschütten, verstärkt sich das ungute Gefühl, dass ich den Satz über Cindy und ihre Bekannten hinter dem Wort "wahnsinnig" beenden sollte. Und als der Sowjetsoldat Semjon auftaucht, nimmt meine Ost-Reise für alle Anwesenden eine "urst" ungesunde Wendung...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michaela Stadelmann wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und lebt in Mittelfranken. Seit 2007 veröffentlicht sie Romane in unterschiedlichen Genres, u.a. Krimis bei Ullstein. Sie ist freie Übersetzerin und Lektorin. Im Internet findet man sie unter dem Namen Textflash.
Weitere Titel der Autorin
Schweden-Krimis Schweig still — Im Rausch — Letzter Anruf
Niederrhein-Krimis Tod am Niederrhein — Vergiss für immer
Liebesromane Die Liebe meines Lebens — Coppelia in Love
Daliborka: Das Geheimnis der Freiheit Der Nachtmahr — Die Hexen — Die Zwerge
Inhaltsverzeichnis
Prolog
DDR-Souvenirs
Nachbarn
Keller
Grabesstille
Kissenschlacht
Schacht
Große Beerbergstraße
Roulette
Im Nichts
Leningrader Lebensgewohnheiten
Perlentaucher
Die Stille tiefer Wasser
Mondlandschaft
Wiederauferstehung
Epilog
Prolog
Hallo. Mein Name ist Luca.
Derzeit kauere ich auf solidem Permafrostboden. Über mir: ein kreisender Hubschrauber. Der Sturm der Rotorblätter drückt mich in die steinharte Erde wie das Artefakt eines Mosaiks. Ich soll diesen Ort nicht mehr verlassen. Das widerspricht den Plänen, mit denen ich mich am Freitag in den Zug gesetzt hatte. Da befand ich mich noch 3000 Kilometer südwestlich von hier. Zwischen mir und dem Sommer liegen nun mehrere gut bewachte Landesgrenzen und die Reste der sowjetischen Armee.
Um nicht weggeweht zu werden, lege ich mich flach hin und drücke die ausgestreckten Arme und Beine so fest wie möglich auf den Boden. Binnen Sekunden werde ich selbst zu Tundraeis. Vielleicht friere ich fest.
Der Hubschrauber – ein Modell aus Sowjetarmeebeständen – steht jetzt über mir. Die Wucht des Abwinds presst meinen Körper auf die Unebenheiten des Permabodens. Es sticht in der Lunge wie bei einer nahen Explosion, nur dass der Schmerz langsamer kommt. Ich öffne den Mund, um den Innendruck auszugleichen. Geplatzte Lungenbläschen wären jetzt, nun, nicht gut.
Wenn ich den Kopf heben könnte, würde ich dem Piloten in die Augen schauen. Aber auch so, fast mit der Erde verschmolzen, habe ich eine genaue Vorstellung seines Gesichts. Er wägt ab, ob es sich nicht doch lohnt, mich mitzunehmen. Wir beide wissen, dass jede Sekunde zählt. Hier ist außerdem der beste Ort der Welt, um mich loszuwerden.
Die Rotorblätter heulen auf. Sekundenlang werde ich noch tiefer in den Boden gepresst. Dann, fast schon gemächlich, dreht der Hubschrauber ab und fliegt dem letzten Streifen des Abendrots entgegen.
Ein letztes Mal bäumt sich der Sturm auf, schiebt sich unter meine Arme und Beine, hebt mich hoch. Fast liebevoll entlässt mich die Tundra aus ihrer tödlichen Umarmung, schubst mich sogar an, als ich davonrolle. Als wäre ich plötzlich wieder ein Kind rolle seitlich wie beim »Rollerfässchen« einen Hügel hinunter, bis ich unten ankomme und vor lauter Lachen keine Luft mehr bekomme. Nur dass ich hier über den glatten Boden schlittere, rolle, stürze, meine Hände keine Grasbüschel greifen, sondern blankes Nichts. Nach der letzten Umdrehung löst sich der Boden auf. Mein schreiender Körper fügt sich nahtlos ein in die Welt aus wirbelnd-eisigen Aufwinden, unterirdischer Hitze und dem Kreischen der verdammten Seelen der Hölle, als ich in das tiefste Bohrloch der Welt stürze, dem Jüngsten Gericht entgegen.
DDR-Souvenirs
Der Augusttag dämmerte so sonnig und heiß herauf wie alle Sommertage des Jahres 1991. Seit den Feierlichkeiten zum 3. Oktober 1990 waren zehn Monate vergangen. Allzu viel hatte ich, damals 21, von der Wiedervereinigung noch nicht mitbekommen. (Bis auf den Umstand, dass die nationale Freude nach kurzer Zeit der Ernüchterung gewichen war.) Tief im Westen hatte ich mich im Frühsommer auf meine Prüfung in irgendeinem Büroberuf vorbereitet und war nach deren Bestehen in meinen Ausbildungsbetrieb übernommen worden. Meine Mit-Azubine Cindy, zweites Lehrjahr, lud mich daraufhin für ein Wochenende zu sich in ihre »alte Heimat« nach Thüringen ein. Ich sollte echte Ost-Luft schnuppern, während sie die Gelegenheit nutzen würde, mich näher kennenzulernen. Aus mir unbegreiflichen Gründen hatte sich Cindy in einer unserer durchgemachten Disco-Nächte unsterblich in mich verschossen. Aber schon die Ehe meiner Eltern fand ich so anstrengend, dass ich keine Lust hatte, für sie mein Single-Dasein aufzugeben.
Weil mich weder der Osten noch Cindy interessierten, hielt ich sie mehr oder weniger geschickt zwei Wochen hin. Dann, in der zweiten Augustwoche erhielt ich die Zusage für eine besser bezahlte und vor allem interessantere Stelle in der Nachbarstadt, um die ich mich schon vor Längerem beworben hatte. Anfang September würde ich in die Buchhaltung eines mittelständischen Antiquariatsgroßhändlers wechseln. Mit dem Wechsel tauschte ich zwar einen sicheren Arbeitsplatz in einem Handwerksbetrieb gegen die wackelige Kulturbranche ein. Aber wir lebten in den 1990ern, von überall her schallte die Aufforderung zur Selbstverwirklichung. Und wenn sogar ganze Staatssysteme innerhalb weniger Wochen zusammenbrechen und neu aufgezogen werden konnten, sollte es mir doch möglich sein, meinen Lebensunterhalt mit Kultur zu verdienen, nicht wahr?
Blieben noch zwei Hürden: der Chef und Cindy.
Wie erwartet schaute mein Chef finster, als ich ihm knapp drei Wochen nach meiner Übernahme die Kündigung auf den Tisch legte. »Verräter!«, zischte er und unterschrieb meinen Antrag auf Resturlaub. Der war wegen der neu angelaufenen Probezeit mickrig, was mich aber nicht juckte. Dann drückte er mir noch die Einarbeitung meiner Stellennachfolgerin Frau Fahnke auf, die in einer Woche aus dem Urlaub zurückkehren würde, wünschte mir trotzdem alles Gute und warf mich aus seinem Büro.
Blieb noch Cindy. Ja, ich weiß, ich war ihr keine Rechenschaft schuldig. Außerdem war sie die ganze Woche in der Berufsschule und wollte anschließend für zwei Wochen nach Thüringen. Sie würde erst wieder im Büro auftauchen, wenn ich nicht mehr da war. Es wäre also ein Leichtes gewesen, ihrem emotionalen Zusammenbruch auszuweichen, indem ich mich klammheimlich verdrückte. Aber das brachte ich nicht übers Herz. Wir waren stets die Sonderlinge im Betrieb gewesen, das schweißte zusammen. Sie kam »von drüben« und ich, nun. Die Fahnke hatte es in der Frühstückspause zwischen zwei Bissen mal so formuliert: »Es ist schwierig, Sie der richtigen Seite zuzuordnen, Luca.« Ich wusste natürlich, worauf diese Bemerkung abzielte, dennoch schwieg ich. Das war meine private Angelegenheit. Aber Cindy hatte dazu mal wieder nicht schweigen wollen. In einer flammenden Rede verteidigte sie mich und den Rest der Menschheit gegen das beschränkte Schubladendenken der Fahnke. Nur durch die Stigmatisierung einzelner Gesellschaftsgruppen wäre zum Beispiel die weltweite Verbreitung des HI-Virus erst möglich gemacht worden! – Als die Fahnke sie darauf hinwies, dass sie demnächst ihre Beurteilung über den Abteilungseinsatz zu verfassen hatte, schwieg Cindy dann doch. Die Beurteilungen waren immens wichtig für die Übernahme nach der Ausbildung. Bei der Fahnke hatte Cindy trotzdem einen Nerv getroffen. Entsprechende Anspielungen unterblieben künftig, was mein schlechtes Gewissen gegenüber Cindy verstärkte.
Am Abend rief ich also schweren Herzens Cindy am zentralen Telefon ihres Wohnheims an, um mich mit ihr für den nächsten Tag, einen Donnerstag, zu verabreden. In ihrem Lieblingscafé wollte ich ihr bei Kaffee und Kuchen ganz ruhig darlegen, was sie nach ihrem Urlaub in der Firma erwartete, beziehungsweise wer sie nicht mehr erwartete. In der Öffentlichkeit hatte sie mir bisher ihre peinlichen Ausraster erspart. – Immer wieder ging ich die zurechtgelegten Sätze durch. Ich bin einfach nicht gut im Abschiednehmen. Doch als sie sich endlich im Hörer meldete, war alles wie weggeblasen. Mein Gehirn sprang zur zweiten Sache, die ich mit ihr besprechen wollte: den Besuch in Thüringen. Das sollte meine Vorschusswiedergutmachtung sein. Wie setzte mich Cindys geballte Freude fast außer Gefecht. Völlig überfahren stimmte ich zu, gleich am kommenden Wochenende bei ihr aufzutauchen. Bis auf diesen Samstag und Sonntag hatte sie ihren Heimaturlaub bereits verplant mit Besuchen und dem Umzug einer Verwandten von Rohr nach Gräfinau-Angstedt (wo immer das sein mochte). Eigentlich mochte ich es nicht, so spontan zu verreisen. Aber auch hier ließen mich mein schlechtes Gewissen und meine Angst, dass sie bei Widerspruch überreagieren könnte, schweigen. Ich stimmte also zu und legte auf. Nun gut. Dann würde ich sie eben in Thüringen ins Café einladen.
Dachte ich.
An einem immer noch heißen Freitagnachmittag rumpelte ich Mitte August mit dem Zug von Bochum gen Osten. Ich hatte extra eine Fahrkarte für einen späteren Zug gekauft, damit Cindy nicht auf die Idee kam, die Berufsschule zu schwänzen und mit mir zusammen nach Hause zu fahren. Auf ihre unnachahmliche Art hätte sie schon im Zug aus mir herausgekitzelt, dass ich die Firma verlassen würde, eine unaussprechlich anstrengende Vorstellung.
Je weiter der Zug in den Osten vordrang, desto trostloser erschien mir die Gegend. Jahrzehnte des Verfalls hatten die Städte geprägt, durch die ich fuhr. Die meisten heruntergekommenen Bahnhöfe schienen nicht größer zu sein als Bushaltestellen. Mit einem einzigen Blick auf die Häuser glaubte ich zu begreifen, warum es den DDR-Bürgern mit dem Sozialismus gereicht hatte. Aus dieser Erkenntnis entwickelte ich nach und nach ein ungesundes Überlegenheitsgefühl, das mir heute, 30 Jahre später, immer noch peinlich ist. Immerhin hatte ich genug Grips, mit einem älteren Herrn, der kurz hinter der ehemaligen Grenze zustieg und sich als linientreuer Parteiaktivist outete, nicht über Politik zu diskutieren. Ich hätte auf seine Argumentation nichts zu erwidern gewusst, außer dass ich Sozialismus, Kommunismus und überhaupt alle Ostblock-Ismen bescheuert fand, Schule sei dank. Deshalb heuchelte ich Interesse an seinem Monolog über die gute alte Zeit. Er wusste es halt nicht besser, genau wie ich. Vielleicht bereitet es dem Lesenden Genugtuung, wenn ich verrate, dass eine höhere Macht mein reichlich arrogantes Desinteresse an allem, was die Bürger der Ex-DDR betraf, ziemlich daneben fand.
Schließlich stolperte ich mit meinem Rucksack auf den Bahnsteig einer ehemaligen südthüringischen Kreisstadt. Cindy war nirgends zu sehen. Sie hätte eigentlich hier auf mich warten sollen. Dabei hatte sie am Telefon ein riesiges Getue darum gemacht, dass sie mich unbedingt abholen wollte. Und jetzt war sie nicht da.
Sollte ich mich an eine von Cindys blumigen Schilderungen über die Kreisstadt halten, in der jeder jeden kannte »wie auf dem Dorf«? Demnach brauchte ich nur einen Bus- oder Taxifahrer zu fragen, wo Cindy wohnte und im Handumdrehen würde er mich zu ihr bringen. Aber erstens gab es vor dem Bahnhof weder Taxistand noch Bushaltestelle. Und zweitens war meine Kollegin bestimmt nicht die einzige Cindy, die hier lebte. Ich hätte sie beim Telefonat nach ihrer Adresse fragen sollen. Aber die konnte ich bestimmt im nächsten Postamt nachschlagen. Und wo befand sich das nächste Postamt? – Ich sah mich bereits die nicht sehr vertrauenerweckende Unterführung am Bahnhof Richtung Stadtzentrum hinuntergehen.
Just in diesem Moment spurtete Cindy fröhlich winkend aus der Unterführung. »Luca! Hier bin ich!«, rief sie so laut, dass auch ein paar Jugendliche, die sich vor einem Nebeneingang des Bahnhofs herumdrückten, auf uns aufmerksam wurden. Stark gekürztes Haupthaar, Hosenträger und Springerstiefel bestätigten auf ungute Weise, was ich bisher über den Osten gehört hatte. Doch Cindys plötzliches Auftauchen löschte mein Unbehagen aus und schuf Raum für einen Flashback: Cindy wurde zur Unbekannten in den Abendnachrichten, die sich mit anderen Figuren an einem Schlagbaum vorbei auf die Westseite der Stadt drängte. Was natürlich eine Überlagerung verschiedener Erinnerungen aus dem Fernsehen und an Begebenheiten mit der echten Cindy darstellte.
»Da staunste, was?«, sagte sie, sehr zufrieden mit meiner Reaktion. »Nur für dich habe ich noch mal meine DDR-Kollektion rausgekramt. Ich hätte das Zeug längst weggeworfen, aber meine Mutter hatte es im Keller aufgehoben und da konnte ich nicht widerstehen und tadaaa! So sind wir damals rumgelaufen!«
Vorsichtig musterte ich ihre stonewashed Jeansweste, das weiße T-Shirt, dessen Ärmel sie über die muskulösen Schultern hinaufgerollt hatte und die längs gestreifte Stretch-Jeans. Ihre unförmigen Joggingschuhe, die bei uns vielleicht Anfang der 1980er der letzte Schrei gewesen waren, rundeten ihre Reminiszenz an den vermeintlich schöneren Westen ab. Die Schweißperlen auf ihrer Stirn verrieten jedoch, das diese Aufmachung für den heißen Augusttag ungeeignet war.
Bizarr fiel das Happening auf ihrem Kopf aus. »Hatte dein Friseur einen schlechten Tag?«, witzelte ich schwach.
Neckisch zupfte sie an ihrer Final-Countdown-Europe-Wuschelmähne. »Wieso?«
»Ich fand deine Haare auch ohne Dauerwelle hübsch.«
»Das ist meine Urlaubsfrise.« Cindy hakte sich bei mir unter und kurbelte damit meine Schweißproduktion an. »Da spare ich mir das Glattföhnen am Morgen.« Sie dirigierte mich weg von der Unterführung.
»Wie? Du siehst immer so aus?«, entfuhr es mir entgeistert.
»Gefällt‘s dir nicht?«, fragte sie gekränkt.
Upsi. Das war kein guter Auftakt für ein gemeinsames Wochenende.
»Was heißt hier gefallen?«, versuchte ich, mich herauszureden. »Du siehst so aus, wie du es möchtest. Schließlich sollst du in erster Linie dir gefallen.«
Das ließ sie kurz den nächsten Schritt verzögern, bevor sie mich entschieden weiterzog. »Ist der Rucksack dein ganzes Gepäck?« Diesmal schaute sie mich nicht an. Ich sie aber auch nicht, denn zum beleidigten Unterton gesellte sich Verletztheit. Verständlich, aber auch ärgerlich, weil ich nicht wusste, wie ich das wieder gutmachen sollte. Und zwar, bevor ich mit meinen Zukunftsplänen herausrückte.
Mit der freien Hand deutete ich auf meinen Rücken. »Da passt alles rein, was ich brauche.«
»Gut. Leg mal ’nen Schritt zu, damit wir den nächsten Bus erwischen.« Der hochgerollte Ärmel ihres T-Shirts rutschte etwas hinunter und verdeckte die Sommersprossen auf ihren Schultern. Die fielen mir zum ersten Mal auf. Und noch etwas wurde aufgrund der ungewohnten Nähe deutlich: In Cindys linkem Augenwinkel glänzten verstohlene Fältchen, als wäre sie nicht Anfang, sondern bereits Mitte zwanzig.
»Steht dir übrigens gut, so ohne Schminke«, sagte ich versöhnlich. Sie schnaubte bloß.
Wir überquerten die Straße zum Busbahnhof. »Ich bin erst vor einer Stunde zu Hause angekommen«, fuhr sie fort, »da war noch keine Zeit zum richtigen Aufbrezeln. Ich find’s ehrlich gesagt urst peinlich, dich in diesem Klamotten abzuholen. Aber meine Haare föhne ich mir im Urlaub wirklich nie glatt. Und in der Berufsschule schon gar nicht. Sonst haben die Besserwessis in der Reihe hinter mir noch freie Sicht auf die Tafel!« Endlich schmunzelte sie wieder. Und ich schmunzelte trotz des Besserwessis mit. Vorsichtshalber.
Gedankenverloren stolperte ich neben ihr her über das Kopfsteinpflaster, das in den Rissen des Straßenbanketts wieder sichtbar geworden war. Hinter dem Busbahnhof ging es eine Böschung hinunter in den nächsten Stadtteil Neundorf. Zwischen den ausladenden Kronen der Laubbäume versammelten sich lauter putzige Fachwerkhäuschen, teilweise mit neuen blauen Schindeln gedeckt, neben denen die zahlreichen eingestürzten Dachstühle ungenutzter Gebäude ziemlich trostlos wirkten. Vor meinem inneren Auge tauchte eine Fernsehdokumentation über komplett verfallene Stadtteile in den fünf neuen Ländern auf, in die ich nachts mal hineingezappt hatte.
Ich rang mir ein »Schön hier« ab.
»Warte mal, bis wir auf dem Ziegenberg sind. Dort hast du einen gigantischen Blick über den Rennsteig«, schwärmte Cindy. »Das war und ist hier im Osten das Beste: die Aussicht!«
Etwas später erklomm ich zum ersten Mal in meinem Leben die steilen Stufen eines Ikarusbusses. Im Inneren stank es nach Schweiß, Diesel und alten braunen Plastikledersitzen. Die Lehnen waren exakt im 90-Grad-Winkel an die Sitzflächen geschraubt, der Abstand zum Vordermann betrug gefühlte 30 Zentimeter. Ich musste sehr gerade sitzen und brachte meine langen Beine kaum unter. Meinen Rucksack nahm ich auf den Schoß, um ihn nicht auf das abgenutzte, graubraune Linoleum stellen zu müssen. Das Innere des Busses gab einen hervorragenden Resonanzraum für den röhrenden Motor ab, eine Unterhaltung mit Cindy war unmöglich. Dass sie sich trotzdem angeregt mit einem Pärchen austauschte, das nach uns einstieg, führte ich auf die jahrelange Übung zurück. Die beiden schwitzten auch nicht so stark wie ich.
Cindys Gesten entnahm ich, dass sie mich zwischendurch vorstellte. Ich nickte und lächelte schwach und fragte mich, ob mein Vokuhila früher auch so scheiße ausgesehen hatte wie an dem dürren Typ mit dem noch dürreren Schnurrbart. Oder ob sich im Westen jemand mit einem kurzen blondierten Bob und Dauerwelle auf die Straße trauen würde wie die Frau, die im Stadtzentrum zustieg. Und erst ihr hochtoupierter Pony! Meine Güte. Und alle trugen Jeanshosen und T-Shirts mit schrillen Neon-Grafiken. Zwei Bubis, die es sich anscheinend leisten konnten, führten ihre Nikes Air spazieren, die man aufpumpen konnte und die einen echt fetten Fuß machten. – So gab ich mich meinen stummen Lästereien über die bizarre neue Ost-Kultur hin. Und das Schicksal schrieb eifrig mit, bis das Maß voll war, es sein Notizbuch zuklappte und beschloss: Ab jetzt wird gemaßregelt.
Nach einer schier endlosen Kurve, die sich einen noch endloseren Berg hinaufzog – »Das ist der Große Beerberg! Und übrigens, wir müssen noch einkaufen!«, brüllte Cindy mir ins Ohr–, stiegen wir am sogenannten Konsum aus. Das anachronistische, heruntergekommene Gebäude wurde vom aufdringlich rot-gelben Schild der Handelskette (mit Hauptsitz im Westen) überstrahlt. Es nahm das komplette Gesichtsfeld ein, sodass man wie ferngesteuert darauf zulaufen musste. Willenlos ließ ich mich mit Cindy quasi in den Eingang hineinsaugen. War das bei uns im Westen auch so? – Drinnen empfing mich die gewohnte, neonfarbige Sterilität inklusive Easy-Listening-Gedudel und angenehm heruntergekühlter Luft: Die Fiftys und Sixtys feierten ihr musikalisches Revival zwischen Bananen und Blumenkohl. Und hätten nicht Tomaten, Gurken, Zitronen und Äpfel in den Auslagen auf die Käufer gewartet, hätte ich mich suchend nach einem Blumenkind in gebatikten Regenbogenklamotten umgeschaut, das die Crack-Pfeife mit seinen Brüdern und Schwestern teilte.
Obwohl hier alles auf Westen gestylt war, hielt sich das Gefühl hartnäckig, in der DDR einzukaufen. Sie schien wie Patina auf Küchenschränken an allem zu kleben. Flower-Power und Fahrstuhlmusik zum Trotz zeigte sich Cindy besorgt, dass morgen alles wieder vorbei sein konnte. Sie wog die Dosen mit den Ananasscheiben einen Augenblick länger in der Hand, als sie es in Bochum tat, bevor sie sie in den Einkaufswagen legte. Das Gemüse befühlte sie sorgfältiger, atmete den Geruch tiefer ein, biss sich sogar auf die Lippen, als rechnete sie nach, ob das Geld reichte. Der Einkauf, den sie in Bochum in zehn Minuten absolvierte, dauerte hier mindestens doppelt so lang. Warum? Weil hier alles ein paar Pfennige mehr kostete als »drüben«.
Und dann passierte es. Mal wieder.
»Junger Mann, wo stehn denn hier die Bohn‘? Wissen Sie des? Seit die den Konsum umgeräumt ham, find‘ man ja nüscht mehr.«
Die alte Frau im Haushaltskittel kam näher, als es mir behagte. Ihre Haare hingen ihr in Strähnen vom Kopf, sie schwitzte stark.
»Sorry, nein, leider nicht«, antwortete ich abwehrend.
Die Alte machte große Augen. »Sorry? Sacht man das jetze so? Müsst ihr jungen Leute wirklich so redn wie die Wessis?«
»Hallo, Emilia«, mischte Cindy sich ein. »Das ist mein Bekannter aus Bochum. Er bleibt übers Wochenende.«
»So?« Emilia legte den Kopf in den Nacken und musterte mich kritisch. »Gebürtich aus Bochum?«
Zaghaft nickte ich.
»Komisch. Du siehs‘ aus wie eener von uns.«
Nach einem peinlichen Moment erklärte Cindy ihr, wo die Bohnen standen. »Die wohnt bei uns im Haus«, sagte sie, als die Alte weg war. »Sie ist ein bisschen vergesslich.«
Ich machte mir eine gedankliche Notiz, dass ich mit Cindy neben meinem Jobwechsel noch eine weitere Sache besprechen musste, und zwar dringend. Das war ich ihr nach der langen gemeinsamen Zeit einfach schuldig.
Wir teilten uns die Kosten für den Einkauf und schleppten drei Dederonbeutel in Cindys Zweieinhalbraumwohnung im vierten Stock. Bis vor ein paar Monaten hatten hier noch ihre Eltern gewohnt. Beiläufig hatte Cindy mal erwähnt, dass sie kurz vor Beginn ihrer Ausbildung »in ihre letzte Ruhestätte umgezogen waren«. Dort besuchte Cindy sie an jedem ihrer Heimatwochenenden, spätestens alle vier Wochen. Hoffentlich forderte sie mich nicht auf, sie ans Grab ihrer Eltern zu begleiten.
Oben riss Cindy als Erstes die Balkontür auf. Die Hitze von draußen vermischte sich mit der staubigen, abgestandenen Wärme im Wohnzimmer. Dann wuchtete sie in der Küche die drei Beutel auf das zerkratzte Furnier der Arbeitsplatte und begann, die Lebensmittel auszuräumen.