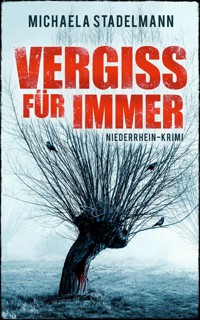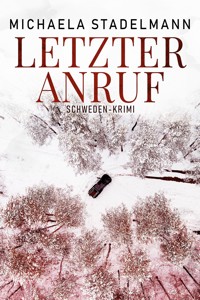Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Daliborka. Das Geheimnis der Freiheit
- Sprache: Deutsch
1885, Berlin-Wedding: Während der Beratung zur Auffindung der gestohlenen Urkunde erkrankt Sir Elliot of Waterford tödlich. Er wurde bei der Explosion der drei Steine unwissentlich schwer verstrahlt. Nicht einmal Frau Daliborkas medizinisches Wissen kann ihn retten. Sein letzter Wunsch ist, noch einmal mit der Meerjungfrau Mariella zu sprechen, die er einst liebte. Weil sie ihn vor Jahren mit seinem besten Freund Julio betrog, hetzte er die Inquisition auf sie. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Auch Sahir kann sich nicht mehr an sein Leben als Graveur erinnern und verschwindet spurlos. Kurz darauf überfallen die Hexen die Dependance der Elben. Anscheinend haben sie den Raub der Eigentumsurkunde veranlasst und holen nun zum letzten Schlag aus. Doch während der Verhandlung um Freiheit um Leben muss Frau Daliborka feststellen, dass es den Hexen um mehr geht als um die Vorherrschaft im Kiez. Die Wirtinnen Barbara und Sibylle wurden indes in die Charité eingeliefert. Während Sibylle die Behandlungskosten im Krankenhaus abarbeiten muss, wird Barbara vom Oberarzt hofiert. Er findet Gefallen an ihr und ihrem Fall. Sie ahnt nicht, was er wirklich mit ihr vorhat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Was bisher geschah
Band 1: Der Nachtmahr
Barbara und Sibylle betreiben eine Wirtschaft in Berlin-Gesundbrunnen. Während Sibylle ein gottgefälliges Leben mit regelmäßigen Kirchgängen führt, ist Barbara glühende Anhängerin der Esoterik. Sie vereinbaren, bei einer Séance zu erörtern, wer von den beiden Frauen richtig liegt: Gibt es die Geisterwelt? Oder ist nur das, was in der Bibel steht, richtig? Doch am nächsten Morgen kann sich keine der beiden Frauen an die Séance erinnern. Und auch der geheimnisvolle Orell, der ihnen von der Kolonialwarenhändlerin Klara vermittelt wurde, ist wie vom Erdboden verschluckt.
Parallel zur Séance wird der Statthalter der Zwerge Sahir Altın von einem Nachtmahr überfallen, der die Territorialurkunde der Zwerge aus Sahirs Graveur-Werkstatt raubt. Daraufhin bricht ein Kampf um die Vorherrschaft der Gattungen der Drachen, Elben und Zwerge im Kiez Gesundbrunnen aus:
Nacheinander tauchen der Drache Sir Arthur Carpenter, Agent der kanadischen SFERA, und Sir Elliot of Waterford aus London in Berlin auf. Sie sollen zusammen mit einer weiteren Gesandten der Zwerge herausbekommen, wer die Urkunde gestohlen hat. Nach den ersten Untersuchungen weist alles darauf hin, dass der Diebstahl von einem beschworenen Nachtmahr ausgeführt wurde, der Teil einer Chimäre gewesen sein muss. Diese Wesen bestehen aus verschiedenen Gattungen und können jede Form annehmen, die ihnen beliebt. Kurz darauf verfallen Sir Arthur und der Zwerg Sahir Altın fast gleichzeitig einem Liebeswahn, ausgelöst von drei mit Steinmagie versetzten Edelsteinen. Solche Zauber können nur von Hexen gewirkt werden. Offiziell gibt es in Gesundbrunnen aber keine Hexen. Oder doch?
Sir Elliot of Waterford kann Vergangenheit und Zukunft spüren. Auf diese Weise erfährt er von der zarten Liebesgeschichte zwischen Sahir Altın und der Montanwissenschaftlerin Baronka Daliborka, die noch nicht eingetroffen ist. Vor 100 Jahren hatte Frau Daliborka darauf gehofft, dass Sahir, der Prinz des Königreichs unter dem Djebel Toubkal, um ihre Hand anhält, was jedoch nie geschah. Bevor Sir Elliot den Prinz dazu befragen kann, überfällt ein Drache den Kiez, um eine Jungfrau zu rauben. Es ist Lady Alanys, Sir Arthurs Ehegattin, die weiß, dass ihr notorisch fremdgehender Gatte ihr in Berlin untreu geworden ist, und zwar mit der Wirtin Sibylle. Nun fordert sie nicht nur deren Leben, sondern zerstört auch die Straße, in der die Bierstube von Sibylle und Barbara steht.
Parallel dazu kommt auch endlich Baronka Daliborka an. Ihre Reise vom tschechischen Johannisbad nach Berlin ist gespickt mit Explosionen, Schlägereien und dem verfressenen Gnom Ragnor. Ihn hat sie versehentlich aus den Händen eines zwielichten Wirtes befreit und beauftragt ihn mit kleineren Arbeiten. Unter anderem soll er dafür sorgen, dass ihr bei einer Explosion zerstörter Terrakotta-Leibsoldat Huang wieder zusammengesetzt und nach Berlin gebracht wird. Aufgrund der Reiseverzögerungen kommen Huang und Ragnor jedoch vor Frau Daliborka an. Ragnor landet zufällig wieder in einem Brunnen und findet dort einen der drei verzauberten Steine, den Sahir hineinbefördert hat. Bei der ersten Begegnung händigt der Gnom ihn Sir Elliot aus. Den zweiten Stein findet Sahir kurz darauf in einem Körbchen, in dem er sich seine Jause aus Sibylles und Barbaras Wirtshaus geholt hat.
Huang marschiert durch den Kiez und versetzt alles in Angst und Schrecken. Zusammen mit dem Drachen kreiert er das perfekte Chaos. Aus Rache für seine Untreue sperrt Lady Alanys ihren Mann mit einem magischen Feuerstoß in einen Kristallkokon ein. Sahir wird von der Überschlagsspannung getroffen und in erkalteter Lava eingeschlossen.
Kurz darauf kommt Frau Daliborka in Berlin an. Das Wiedersehen mit Sahir hat sie sich ein bisschen anders vorgestellt. Während sie mit Sir Elliot überlegt, wie man Sahir und Sir Arthur aus den Kokons befreien kann, erscheint die Küchenhilfe Anna im Hinterhof zu Sahirs Werkstatt. Mit ihr erlebte Sahir den magischen Liebesrausch. Anna hat ein Stück Schlacke dabei, das sie zufällig in der Nähe des Friedhofs St. Sophien fand. Sie möchte wissen, wie es Sahir geht, doch als sie den Kokon berührt, erkennt Ragnor, der Gnom, dass sie den Nachtmahr in sich trägt. In rasender Wut will er seine Herrin Frau Daliborka vor Anna beschützen. Kaum berührt Anna mit der Schlacke den Kokon, kommt es zu einem neuerlichen Überschlagsblitz zwischen der Schlacke, dem Stein, den der Elb Sir Elliot verwahrte, und dem Stein, den Sahir zufällig in Händen hielt, als er vom Überschlagsblitz getroffen wurde. Seine Werkstatt wird völlig zerstört, Anna, Huang und Ragnor vergehen im Feuer.
Sahir kommt erst wieder in der Dependance der Elben zu sich, die ihm von dieser Gattung zur Verfügung gestellt wird. Doch er hat das Gedächtnis verloren und erkennt weder Sir Elliot noch Frau Daliborka. Auch an sein Leben als Graveur in Gesundbrunnen kann er sich nicht erinnern. Trotzdem muss der Diebstahl aufgeklärt werden, bevor eine von Zwergen und Elben ungeliebte Gattung ihre Ansprüche auf den Kiez Gesundbrunnen stellt: die Hexen, die anscheinend längst hier sind. Doch woran kann man sie erkennen?
Ausgerechnet Anna, die scheinbar im Feuer der Explosion vergangen ist und vielleicht auch gar nicht Anna heißt, könnte das Geheimnis lüften. Doch sie ist schon weit weg von Berlin, als die Sonne aufgeht, denn es zieht sie gen Westen.
In der Charité
»Sibylle …«
Nur mühsam bekam die Gerufene die Augen auf, erst das eine, dann das andere. Dunkelheit herrschte im Frauensaal der Charité. Leises Schnarchen und gleichmäßiges Atmen verwirrten sich zu einer maroden Melodie aus Schmerz und Siechtum.
»Sibylle!«
Langsam wandte sie den Kopf. Gegen die hellen Laken konnte sie die unförmigen Umrisse ihrer ehemaligen Geschäftspartnerin Barbara erkennen. Wäre Tag gewesen, hätte sie gewusst, welche Ausbuchtung der Kopf und welche ihre lädierte Schulter waren. So flehte ein unförmiger Klumpen zu ihr, sie zu erhören.
»Sibylle.«
»Was denn?« Ihr Kopf schmerzte von dem Deckenbalken, der beim Einsturz des Hauses auf ihr gelandet war. Auch der Nacken schien in Mitleidenschaft gezogen, er war steif wie ein Brett.
»Ich muss kotzen«, blubberte Barbara, da war es schon geschehen.
»Schockschwerenot.« Erschöpft schloss Sibylle die Augen. »Barbara. Kannst du dich nicht endlich ein wenig zusammenreißen?« Mit einem Ruck hob sie den Kopf, knurrte: »Vor all den Leuten!«, und ließ sich wieder ins Kissen fallen. Der Schmerz war zu heftig.
»Wer hat gerufen?«, fragte die ärgerliche Stimme der Nachtschwester.
Kraftlos deutete Sibylle zu Barbara hinüber, wo der saure Geruch sich einmal mehr anschickte, zügig den Schlafsaal zu erfüllen. Leise schimpfend trat die Nachtschwester an das Bett der mit Übelkeit Geschlagenen. »Wo nimmst du all die Kuddelei her? In dir kann ja nichts mehr drin sein. Liegenbleiben, ich hole frische Wäsche!«
Sie rauschte davon.
»Mir ist so schlecht«, flüsterte Barbara erstickt. »Ich glaube, ich muss sterben.«
»Stell dich nicht so an«, kam es schwach von der anderen Seite. Dort lag Rosi, Arbeiterin in der Kammgarnspinnerei. Sie trug wie Sibylle einen dicken Verband um den Kopf. »Das wird von dem Feuer kommen, aus dem sie dich gerettet haben!« Sie röchelte wie eine alte Katze. Wenn man sich konzentrierte, konnte man darin ein leises Lachen erkennen. »Meinen Alten haben sie auch aus einer brennenden Halle geholt. Der hat sich danach schier die Gedärme ausgekotzt. Wie du!«
»Wie lang hat es gedauert«, stieß Barbara hervor, »bis es ihm wieder besserging?«
»Drei Tage«, röchelte Rosi schwach. »Dann war er tot.« In ihrer Schicht vor zwei Tagen hatte etwas Weiches zwischen den Zahnrädern der Spinnereimaschine die ganze Produktionsstraße zum Anhalten gebracht. Als die eilig herbei gerufenen Schlosser neben einem blutigen Hautlappen einen von Rosis langen schwarzen Zopf herauszogen, war die Ohnmächtige längst in einer Rot-Kreuz-Kutsche unterwegs zur Charité.
»Und ich bin auch bald dran«, flüsterte sie und begann vor Schmerz zu schreien.
Wie der Blitz war die Nachtschwester wieder da. Sie hatte sogar die Wäsche für Barbara mitgebracht. Aber Rosis Schmerzensschreie raubten allen den Schlaf, und so musste sich die Nachtschwester erst um die Arbeiterin kümmern. Sibylle ahnte, dass die Morphiumspritze, die Rosi in den Arm bekam, eine der letzten für die arme Frau sein würde.
Barbara würgte.
»Reiß dich endlich zusammen!«, herrschte die Nachtschwester sie an, noch mit der Spritze in Rosis Arm.
Doch auch Barbara schien alle Contenance verloren zu haben. Erneut erbrach sie sich, wie sie es schon den ganzen Tag über getan hatte. Sibylle hätte ihr helfen mögen, wenn ihr nicht so schwindelig gewesen wäre. So blieb ihr nur, Barbaras anhaltendes Würgen zu ertragen und zu hoffen, dass sie nicht auch ihr Herz ausspuckte.
»Sie da! Sie hat doch mit dieser Person eine Bierstube in Kooperation betrieben, oder?«
Verwundert blinzelte Sibylle in die Dunkelheit. Ihr Kopfverband saß immer noch recht stramm. »So ist es«, antwortete sie, bevor sie überhaupt wusste, wer die Frage gestellt hatte.
Neben ihrem Bett ragte eine kleine, dunkle Frau auf. Der teuren Fellstola nach zu urteilen, die um ihren Hals lag, gehörte sie keinesfalls zu den Pflegerinnen. Sibylle hätte fragen müssen, was die fremde Dame um diese Zeit hier tat. Aber sie traute sich nicht.
Die Frau trat näher an Sibylles Bett heran, als müsste sie trotz des Lärms neugierigen Ohren im Saal zuvorzukommen. »Dann muss Sie mir sagen, was aus der Küchenhilfe geworden ist!« Drohend schob sie das Gesicht ganz nah an Sibylles heran.
»Aus Anna?« Sibylle wurde mulmig zumute. Hatte Anna etwas ausgefressen, bevor sie zu Sibylle und Barbara in den Dienst gekommen war? Forderte diese Dame nun mitten in der Nacht Genugtuung und Wiedergutmachung von etwas, auf das Sibylle keinen Einfluss hatte? Trotz der Dunkelheit funkelten die Augen dieser Frau irgendwie gemein. Unterirdisch. Dämonisch …
Sibylle musste die Augenlider zusammenpressen, um überhaupt nachdenken zu können. »Das weiß ich leider nicht. Sie hat das Haus verlassen, bevor der Dachstuhl einstürzte. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen.«
»Und die da?« Die Frau deutete mit dem Daumen über die Schulter zu Barbara. Die würgte immer noch. »Weiß sie etwas?«
»Keine Ahnung.« Zur Bekräftigung zog Sibylle die Schultern hoch und bereute es sofort. Brennender Schmerz rannte durch ihren Nacken und ließ sie die Augen wieder öffnen.
Das Gesicht der Dame schien noch näher herangekommen zu sein. Unzählige Falten gruben sich zwischen ihren dichten Augenbrauen in die Stirn. Die Nase wölbte sich vor wie ein Rammbock, bereit zum Angriff. Die Hände schienen nach einer imaginären Axt zu greifen, um unter schaurigem Gelächter Sibylles Schädel zu spalten …
»Ist Sie ganz sicher?«. Jedes Wort der Dame grollte wie eine Felslawine zu Tal.
»Ja«, piepste Sibylle verwirrt. Was war das schon wieder? Eine weitere Nachwirkung der Séance mit dem schönen Monsieur Orell?
Langsam wich die Dame zurück und richtete sich stolz auf. Es änderte nichts an ihrer Kleinheit. »Gut«, sagte sie, als hätte sie nicht gerade wie ein zorniger Berggeist gesprochen. »Dann möge Sie bald genesen.«
Obwohl ihr Kopf schwerer zu werden schien, konnte Sibylle den Blick nicht von dem fliehenden Schemen abwenden, bis es den Saal verlassen hatte. Und wären die Grillen in ihrem Kopf so groß gewesen wie die in Barbaras, hätte Sibylle jeden Eid geschworen, gerade einer wütenden Zwergin begegnet zu sein.
*
Beschwörung der Toten
Die Kontaktaufnahme mit dem Jenseits war ein interessanter, aber auch gefährlicher Zeitvertreib. Beschloss ein Lebender, dort die Antwort auf seine Fragen zu suchen, war er gut damit beraten, genug Zeit für die Séance einzuplanen. Bestenfalls geriet er an einen mitteilsamen Duhovior. Dieser kredenzte ihm mit größter Wahrscheinlichkeit nicht nur die passende Antwort, sondern auch seine Lebensgeschichte.
Tat man dagegen ein Fantom auf, war ein starkes Nervenkostüm unabdingbar. Zu Fantomen wurden Wesen der Zwischenwelt, wenn sie die Umstände ihres Todes nicht hatten verwinden können. Statt wie ein Duhovior den Beschwörenden mit einem melancholischen Rückblick auf bessere Zeiten zu langweilen, versetzte das Fantom ihn in Trance. Wie im Rausch durchlebte der Beschwörende jede Sekunde des Ablebens des Zwischenweltwesens bis zum Eintritt des Todes. Auch die Beisitzenden konnten von diesem Taumel mitgerissen werden. Nervöseren Gemütern riet man deshalb von der Teilnahme an Séancen ab. Denn eine spezielle Kur für Nervenzusammenbrüche nach dem Kontakt mit dem Jenseits gab es nicht.
Das waren nur zwei Gründe, warum Wesen wie Zwerge und Elben aus Prinzip alles mieden, was sich nicht mit den Händen bearbeiten oder eindeutig mit Worten definieren ließ. Nur in außerordentlich verzwickten Fällen erwog das Oberhaupt einer Sippe den Kontakt zur Geisterwelt.
So rief Prinz Sahirs Vorhaben starken Widerwillen bei Sir Elliot of Waterford hervor. »Es erscheint mir durchaus im Rahmen des Möglichen, dass die Chimäre, die sich Anna nennt, bald wieder unversehrt in dieser Welt auftaucht«, gab er zum x-ten Mal zu bedenken. »Dann können wir sie mit Hilfe des Rates der Drei aufspüren und nach ihrem Auftraggeber befragen, der Hoheits Vermutungen nach eine diesseitige Hexe ist.«
Frau Daliborka nickte dazu ernst. Auch ihr behagte der Gedanke an die Séance nicht.
»Außerdem«, fuhr Sir Elliot ermutigt fort, »zeigte die Chimäre sich uns in menschlicher Gestalt. Sie könnte demnach auch in den sogenannten Himmel der Menschen aufgefahren sein. Dann bekämen wir nicht einmal mit einer Séance Zugang zu ihrer Seele. So steht es auch in den Jenseitsschriften des Gelehrten Dougherty.«
Doch auf diesem Ohr war Prinz Sahir nach wie vor taub. »Wir glauben nicht an die Schriften Eures Elben Dougherty. Wir haben sie brennen und vergehen sehen wie ein Dunkelwesen«, widersprach Prinz Sahir von Marokko uneinsichtig. »Somit ist sie in die Ätherwelt übergegangen, entstofflicht und unlebendig. Dort hat der Rat der Drei keine Macht über sie. Ein Gespräch kann nur mittels einer Séance eingefädelt werden. Und ein Mensch ...« Ungeduldig schüttelte er den Kopf. »Dann hätte man ihre sterblichen Überreste in der Ruine der Werkstatt finden müssen. Oder sie läge schwer verletzt in der Charité. Nicht wahr?«
»Eine Séance ist und bleibt gefährlich«, wiederholte Frau Daliborka die Worte des Elben mit einer Geduld, wie man sie nur menschlichen Engeln nachsagte. »Lasst uns etwas anderes ersinnen, um an den Auftraggeber der Chimäre zu gelangen, Hoheit.«
Sekunden der Stille verstrichen. Irgendwo im Haus fiel eine Tür ins Schloss. Prinz Sahir hätte gern eine Tasse Tee mit diesen beiden Vertretern getrunken. Doch ihre Uneinsichtigkeit machte ihn wütend. Überhaupt kam ihm der Diebstahl der Urkunde und das Schicksal des Graveurs sehr seltsam an. Den gewisperten Unterhaltungen zwischen der Baronka und dem Elb hatte er entnommen, dass er, Prinz Sahir, in Wirklichkeit der Graveur war, der die Territorialurkunde bewacht hatte. Jedoch hatte er nicht die leiseste Erinnerung daran, jemals in Gesundbrunnen gewesen zu sein. Und das war, frei gesprochen, auch nicht sein vordringlichstes Anliegen.
»Wir werden die Chimäre beschwören. Sie muss Uns den Nahmen ihres Auftraggebers nennen. Vor allen Dingen müssen Wir die Urkunde zurückbekommen, die dem Graveur und somit Unserem Volk entwendet wurde.« So entschlossen wie möglich wollte er seine Stimme klingen lassen. Eine Bloßstellung durch Einlenkung konnte sich Prinz Sahir weder als künftiger Regent noch auf privater Basis erlauben.
Ein weiteres Mal nahm er das Konferenzzimmer unter die Lupe, das man ihm, der Montanwissenschaftlerin Frau Daliborka und Sir Elliot of Waterford zur Verfügung gestellt hatte. Die elbische Botschaft ließ sich nicht lumpen, was die Ausstattung mit wertvollen Möbeln, Tapeten, Teppichen und Leuchtmitteln betraf. Trotzdem war Prinz Sahir, Erbe des nordafrikanischen Zwergenthrons, nicht zufrieden.
»Wir sind Uns nicht im Klaren darüber, ob dieser Raum Unseren Vorstellungen von Sicherheit entspricht.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte mit zusammengekniffenen Augen zur Decke. »Zu solchen Zwecken begibt man sich gewöhnlich in mit Blei ausgelegte Berghallen, da Geister dieses Schwermetall nicht durchdringen können. Man lässt zur Sicherheit nur den Kamin für den Eintritt, eine kleine Öffnung im Fels.« Er deutete nach oben. »Dort zum Beispiel, das ist doch nicht mal Metall, sondern lediglich Putz und ein wenig Stuck.«
Sir Elliot von Waterford schwieg resigniert.
»Baronka Daliborka, was ist Eure Meinung dazu?«, herrschte der Prinz die Wissenschaftlerin an.
Frau Daliborka hatte das Gespräch nur mit halbem Sinn verfolgt. Die Enttäuschung über die Zustände, die sie im Frauensaal der Charité erblickt hatte, war groß. Wo waren die medizinischen Errungenschaften geblieben, die die somatisch-interessierten Wasserelben den Menschen bereits vor Jahrzehnten angetragen hatten? Alle Krankheitserreger in einem Raum zu versammeln war nicht nur dramatisch, sondern hochgradig gefährlich! Es genügte eine nicht isolierte Typhus-Erkrankung, um alle lebenden Wesen zu töten. Sobald Frau Daliborka wieder in ihrem Dezernatsbureau im Riesengebirge war, würde sie einen geharnischten Rundbrief an ihre Kollegen im Vereinigten Königreich schicken. Die waren schließlich für die Verbreitung der neuesten Forschungsergebnisse in Europa zuständig.
»Mir behagt der Gedanke auch nicht, dass die Geister in die Menschenwelt entweichen könnten. Aber es wird wohl genügen müssen, Hoheit.« Auch das war eine Sache, die man dringend mit den Vertretern der anderen Wesenheiten besprechen musste: gleiche Ausstattung für alle Botschaften, normierte Abläufe, vielleicht sogar ein Gesetz für alle, auf dem sämtliche individuellen völkerrechtlichen Gesetzgebungen fußten … Sie würde den Gedanken später noch einmal aufgreifen, um sich nicht allzu sehr darüber zu grämen, dass sie sich dem Willen des Prinzen beugen musste.
»So ist es beschlossen, dass Uns nur noch eine Beschwörung hilft«, stellte Prinz Sahir befriedigt fest. »Nun denn. Bringen Wir es hinter uns.«
Natürlich wusste Prinz Sahir, wie man Geister beschwor. Als Prinz und zukünftiger König gehörte dieses Wissen zu seiner Erziehung. Man bekam als erklärter Gott eines Volkes ganz anderen Zugang zu dem, was in seiner Gattung als Ewigkeitsschmiede bekannt war. Normalerweise hätte er diese Aufgabe einem Minister überlassen, weil man sich dabei stets der Gefahr anschließender Besessenheit durch Geister aussetzte. Ein untragbares Risiko! Doch seine ihm unterstellten Minister weilten im fernen Marokko und er hatte in den letzten fünfzig Jahren im freiwilligen Berlin-Exil gern auf sie verzichtet. Also würde Sahir auch heute nicht Demirci Beg, den Diplomaten seines Vaters König Murat XXXVI., im Stollen unter der russischen Gesandtschaft um Hilfe ersuchen. Als ob Prinz Sahir nicht Manns genug war, selbst Entscheidungen zu treffen! Es schien, als zuckten unwillkürlich Falten über seine Stirn, als fragte er sich, wieso er sich an das Exil erinnerte, jedoch nicht an seine Tätigkeit als Graveur.
Dienstbeflissen zog Sir Elliot die dicken Brokatvorhänge vor die großen Fenster und verriegelte die hohen Türen. Ein lächerliches Unterfangen, da jedes Geisterwesen mühelos durch Holz und Glas gehen konnte. Blieb zu hoffen, dass der Prinz die Zeichen, die er nun mit Kreide auf den Ebenholztisch malte, sorgfältig zog und der Himeric den Bannring wirklich nicht verlassen konnte, sollte er sich manifestieren.
»Ich mag die Vorstellung nicht, dass es keinen Geisterkamin gibt«, stellte Frau Daliborka fest. »Ihr wisst schon, Sir Elliot, das ist ein gesicherter Schlot, durch den die Geister in die Kammer eindringen und entweichen, ohne die lebenden Anwesenden angreifen zu können.«
»Mir ist der Aufbau einer zwergischen Bleikammer bekannt«, rief er über die Schulter, weil er gerade zwei Oberlichter mit einem dunklen Tuch abhängte.
»Genug der Worte!«, rief Prinz Sahir ungeduldig. »Baronka Daliborka, Sir Elliot! Bezieht vor dem Kamin Aufstellung. Dann könnt Ihr, sollte der Geist sich auf Euch stürzen, nach einem brennenden Span greifen, um Euch zu verteidigen.«
In Sir Elliot regte sich heftige Ablehnung. Ihm stellte sich die Frage, ob er überhaupt befugt war, einer Séance dieser Art beizuwohnen. Sollte er nicht vorsichtshalber eine Erlaubnis seines direkten Vorgesetzten Sir Morrogoth of Cumbria per Telegramm einholen? Letztlich entschied er sich dagegen, weil sein Herr in Venedig weilte und Prinz Sahir die Wartezeit bis zum Eintreffen der Antwort sicher nicht gebilligt hätte. Aber wohl war ihm nicht dabei.
Die Séance verlief unspektakulär. Prinz Sahir murmelte und malte mit den Händen Zeichen in die Luft, bis ein wenig Nebel aus dem zwergischen Zauberkreis waberte. Gespannt warteten die drei Anwesenden auf die Manifestation einer Gestalt oder das Ertönen einer Stimme. Nichts dergleichen geschah. Schließlich brach der Prinz die Beschwörung enttäuscht ab. Der Nebel löste sich auf.
Sir Elliot zog die Vorhänge wieder von den Fenstern.
»Also ist sie nicht in der Unterwelt«, fasste Frau Daliborka das unbefriedigende Ergebnis zusammen.
»Das sehen Wir«, gestand Prinz Sahir gereizt ein.
Die Baronka fühlte sich genötigt, eine weitere Lösung anzubieten. Auch als junger Prinz war Sahir sehr anstrengend gewesen, wenn etwas nicht so verlief, wie er es sich wünschte. Nicht nur aus diplomatischen Gründen wollte sie ihm das Gefühl geben, dem Elb gegenüber das Gesicht gewahrt zu haben.
»Allgemein ist zu wenig über Chimären bekannt, um eine richtige Aussage treffen zu können, wohin sie nach ihrem Ableben gehen«, dozierte sie einen der wenigen Lehrtexte über die Gattungen der Zwischenwelt. »Es steht lediglich fest, dass Chimären eine Verschmelzung verschiedener Wesenheiten sind und in die Unterwelt, nun ja, hineingeboren werden.«
Ihre Worte wirkten bereits. die verdrossenen Falten im Gesicht des Prinzen wurden kleiner.
Ermutigt fuhr sie fort: »Die Chimäre könnte natürlich auch schon im Elysium der Unterweltwesen sein. Aber das halte ich aufgrund des schwerwiegenden Diebstahls für unmöglich. Davon abgesehen könnten wir sie dort auch nicht erreichen.«
Sir Elliot entfuhr ein unkontrollierter Seufzer. Er erschien Frau Daliborka ungewöhnlich blass. »Seid Ihr in Ordnung?«
Der Elb schüttelte den Kopf. »Hoheit, ich bitte um Vertagung des weiteren Gesprächs, da ich mich unwohl fühle. Der Nebel scheint mir nicht bekommen zu sein.« Fahrig deutete er zum Tisch, auf dem der Kreidekreis noch schwach zu sehen war.
»Stattgegeben.« Sahir rieb sich die Stirn. »Auch Wir fühlen leichte Erschöpfung ob der Ereignisse. Wir werden Uns ebenfalls für eine Weile zurückziehen.«
Das Eingeständnis der Schwäche überraschte Frau Daliborka und Sir Elliot gleichermaßen.
»In der Zeit, in der Wir alle ruhen sollten, wird jeder von uns Gedanken zur weiteren Vorgehensweise zusammentragen. Wir erwarten beim zweiten Imbiss um elf Uhr Ihre Vorschläge.« Nach diesen Worten verließ der Prinz den Raum.
Stumm wandten sich Sir Elliot und Frau Daliborka ihren eigenen Geschäften zu, zu denen im Fall der Baronka weitere dringende Telegramme gehörten, um die zuständigen Zwergendezernate zu informieren und Informationen abzurufen.
Sir Elliot of Waterford dagegen zog sich in Kontemplation in seine Räume zurück, tief in Gedanken an die Vergangenheit versunken.
*
Mariella
»Sir Elliot!«
Lady Alanys trug bereits ihre Reisekleidung, eine erdbraune Kombination, wie sie Drachen normalerweise nicht trugen. In ihrem Fall handelte es sich jedoch um eine besondere Situation. Das gängige Drachenrot war in der Gründerzeitepoche an Anrüchigkeit nicht zu überbieten. Der Zustand ihres Mannes Sir Arthur Carpenter ließ darüber hinaus keine Auffälligkeiten zu. Nach wie vor lag er in seinem Kokon aus glitzerndem Bergkristall wie ein Drachenjunges im Ei. Jeglicher farblicher Überschwang hätte bei den anderen Drachensippen große Verärgerung hervorgerufen. Wenn es noch andere Sippen außer die der Carpenters gegeben hätte.
Drachengesellschaft war dem Elb nie besonders angenehm erschienen. Er musste sich zusammennehmen, um vor der herbeieilenden Drachendame nicht wegzulaufen.
»Ich möchte mich nochmals in aller Form für den Aufruhr entschuldigen, der durch meine Familie entstanden ist.« Lady Alanys stoppte mit einer Bewegung, die die Vorstellung von ausgebreiteten Schwingen und zupackenden Krallen hervorrief. »Solltet Ihr einmal nach Alberta kommen, wird es meinem Mann und mir eine Freude sein, Euch in unserem Hort – in unserem Haus als Gast begrüßen zu dürfen.«
Verwirrt ließ Sir Elliot zu, dass Lady Alanys seine Hand ergriff und sie drückte. Die menschliche Geste zum Ausdruck der Übereinstimmung gefiel ihm noch weniger als die Anwesenheit der Drachin.
»Ganz besonderer Dank gilt Euren Bemühungen unsere Abreise betreffend«, fuhr die Lady fort. »Es ehrt mich, dass Ihr ein Wort bei Seiner Hoheit für uns einlegtet. Damit habt Ihr einen großen Beitrag zur Gesundheit meines Mannes geleistet. Das Klima in Alberta ist für eine Genesung vorteilhafter als hier in Berlin.« Fröstelnd zog sie ihren Seidenschal um die Schultern.
»Die Erlaubnis für Eure Abreise hat Baronka Daliborka eingeholt, nicht ich«, sagte Sir Elliot rasch, bevor sie weitere Lobeshymnen auf ihn ausbrachte. »Somit solltet Ihr Eure Einladung auch für Sie aussprechen, nicht wahr?«
Seine Hand war plötzlich im freien Fall, so abrupt hatte die Lady sie losgelassen. Ihre Mundwinkel zuckten in der Erwägung, nachsichtig zu lächeln oder seinen Fauxpas damit missbilligend zu kommentieren. »Nun. Zwerge überqueren zum Glück nur selten große Meere. Deshalb erübrigt sich die Ausweitung der Einladung wohl.« Sie schob noch ein paar beherrschte Floskeln nach, die Sir Elliot nicht durchweg verstand, und schritt endlich davon. Unten wartete schon die Kutsche auf sie.
Die Wohnräume, die man ihm in der Botschaft zur Verfügung stellte, erschienen Sir Elliot ungewöhnlich kühl. Fröstelnd trat er durch die Tapetentür in den schmalen Flur hinter dem Kachelofen, um in der Glut zu stochern und ein wenig Kohle nachzulegen. Er war es nicht gewöhnt, sich im Februar in einer Stadt wie Berlin aufzuhalten. Die Menschen hatten die spartanische Lebensart des Soldatenkaisers Fritz für seinen Geschmack zu sehr verinnerlicht. Damit die anderen Wesen nicht auffielen, imitierten sie den jeweils aktuellen Lebensstil und verdonnerten sich selbst dazu, in großen, kalten Häusern mit viel zu hohen Decken zu hausen.
Im Gegensatz zu den Elben heizten die meisten Menschen in den ärmeren Vierteln und auf dem Land mit Holz. Sir Elliot hätte um jedes Scheit weinen mögen, das dort von den Flammen verzehrt wurde. Die leichtfertige Vernichtung des heiligen Grüns stieß ihn geradezu ab. Aber noch war in den Augen der Menschen genug Holz vorhanden, das zudem von allein nachwuchs. Warum sollten sie sich also eines Besseren belehren lassen? Selbst Drachen, die einst ihre Lebensenergie aus den Feuern der Hölle gewannen, lehnten diese Verschwendung ab. Denn mit jedem Hektar Wald, das verschwand, hatten sich ihre Rückzugsgebiete in der Menschenwelt verkleinert. Schon vor Jahrhunderten hatten sich die ersten Drachenfürsten gezwungen gesehen, ihr Leben auf anderen Erdteilen weiterzuführen. Doch auch dort war ihr Leben von der Furcht geprägt gewesen, bald wieder vertrieben zu werden.
»Sir of Waterford, lasst mich das machen!«
Raoula, das Dienstmädchen, löste sich aus der Dunkelheit, als wäre sie ein Teil davon.
Verwundert überließ Sir Elliot ihr den Schürhaken und machte einen Schritt nach hinten. »Wieso bist du hier?«, fragte er belustigt. »Stehst du den ganzen Tag im Schatten, damit du mich abpassen kannst?«
Geschäftig drehte und stocherte sie die neuen Kohlen aus den Zechen der verbündeten Zwergensippen in die Glut, damit sie Feuer fingen. »Ich war zufällig in der Nähe, Sir Waterford.« Sie wandte ihm den Rücken zu, während sie sprach. Eigentlich ein Unding, bedachte man seine gehobene Stellung. Aber Sir Elliot legte keinen Wert darauf, Bedienstete wegen solcher Kleinigkeiten zu rügen oder gar zu züchtigen. Er war sich oft nicht sicher, ob diese Bediensteten nicht wichtiger waren als die Lords und Ladys, die sich um die Geschäfte des Elbenreiches kümmerten. Jeder Adlige trug nur einen winzigen Teil zum Ganzen bei, während kleine, fleißige Rädchen für das sorgten, was den Tag gelingen ließ: schmackhafte Mahlzeiten, bequeme Kleidung, saubere Zimmer. Oder die warme Behaglichkeit, um die sich Raoula bemühte.
Zufrieden mit sich und ihrer Arbeit, zog sie den Schürhaken aus der Glut und hängte ihn zum anderen Ofenbesteck. »Nun wird es gleich warm in Euren Räumen, Sir Waterford.« Sie wandte sich ihm zu, den Blick fest auf ihre Fußspitzen gerichtet. »Wünschen Sir noch etwas?«
»Nein, du kannst wieder gehen«, antwortete Sir Elliot aus Gewohnheit. Das Erröten ihrer schlanken, gespitzten Ohren entging ihm nicht. Sie entstammte einer sehr alten Familie der ersten Gattung. Es hieß, dass diese Gattung, Gründer genannt, den Marianengraben verlassen hatte, um sich auf dem Land anzusiedeln. Doch statt sich mit ihrer Weisheit an die Spitze des Landvolkes zu setzen, hatten sie mit den einzigartigen Geschichten der Tiefsee bei ihren Nachkommen die Sehnsucht nach dem Meer geschürt. Das Leben an Land war ihrer Ansicht nach eine Zwischenstation auf dem Weg zu unendlicher Seligkeit. Denn alles Leben war dazu bestimmt, in die Tiefsee zurückzukehren, sobald sie die ihnen zugedachte Lebensaufgabe erfüllt hatten. Und nur dort, im Abyssal der Tiefsee, würden sie von allen irdischen Leiden erlöst.
Die Anhänger der Gründer waren wie alle Angehörigen der elbischen Gattung mit einem sehr langen Leben gesegnet. Man munkelte, dass der erste Gründer noch irgendwo als Einsiedler lebte. Es gab unzählige romantische Gemälde, die einen verschrumpelten, greisen Elben am Tag seiner Erlösung am Steg eines Pazifikhafens zeigten. Mit seinen fast blinden Augen hielt er Ausschau nach der Barke, die ihn zurück in den Marianengraben bringen sollte, gezogen von einem Seepferdchen, einem Hammerhai, einem Delfin und einem Wal.
Eine weitere Überzeugung der Gründer war, dass sie während ihres irdischen Daseins weder nach Besitz noch Macht streben durften. All das galt laut den Überlieferungen des ersten Gründers in der Tiefsee nichts. Demnach begnügten sie sich wie Raoula mit niederen Tätigkeiten, wurden Dienstleute oder gar Tagelöhner und galten gemeinhin als sehr genügsam.
»Läutet nach mir, Sir Waterford, wenn Euch etwas fehlt.« Raoula knickste, immer noch ohne Blickkontakt, und lief davon. Sir Elliot war sich sicher, dass sie einen Blick in seine Augen riskiert hätte, wenn sie nicht so unterwürfig gewesen wäre.
Die kurze Begegnung hatte ihn über Gebühr erschöpft, denn die unbestimmte Schwäche war nun auf seine Schultern gesunken. Müde kehrte er in sein Wohnzimmer zurück und ließ sich in den Lehnstuhl neben dem Kachelofen fallen. Die Hitze drückte bereits in den Raum und zog ihn in einen seltsamen Dämmer. Hoch oben schwebte sein Geist in wolkigen Gedanken an Vergangenes und Zukünftiges, das sich nur in Träumen beschreiben ließ.
Verwundert öffnete Sir Elliot die Augen. Wieder war dieses süße Erschauern auf ihn niedergegangen, das ihn so eindringlich an Mariella erinnerte. Zu den Wimpernbögen, die er am vergangenen Tag nach der Ohnmacht erblickt hatte, gesellte sich brandiger Kohlenrauch und salzige Meeresluft. Einige wunderbare Minuten sah er sich am Kai in der Tejo-Bucht stehen, durfte erneut das Glitzern des Vollmondes in den Wellen schmecken, als eine Hand sich aus dem Wasser hob und ihm zuwinkte. Er winkte zurück, ohne dass es großen Nachdenkens bedurfte.
Gleich darauf stieß ein mit Seetang besetzter Kopf durch die Oberfläche. Zwei dunkelblaue Augen blickten ihn neugierig an.
»Seid Ihr Rui Abreu, den ich hier zu treffen die Ehre habe?« Silbriges Kichern perlte über ihre fein geschwungenen Lippen.
Das Wasserwesen schien ihn necken zu wollen. Sir Elliot ließ sich darauf ein, denn in diesem April des Jahres 1805 gab es nicht viel Anlass zu Scherzen. Ein Mensch mit Namen Napoléon Bonaparte hatte die Welt zu Lande und zu Wasser in Angst und Schrecken versetzt. Vor dem Hintergrund der fürchterlichen Kriege, die er in den letzten Jahren entfesselt hatte, sorgte zusätzlich die Erfindung des Jacquard-Webstuhls in Lyon für heftigen Widerstand. In Straßenkämpfen wehrten sich die Weber gegen die Einführung des neuartigen Webstuhls per Dekret. Sie fürchteten zu Recht um ihren Lohn. Dazu kam die beständige Angst vor Hunger und Not. In der Menschenwelt zerfielen Allianzen zwischen Königreichen derweil fast schneller, als sie gegründet wurden.
Die Wesen der Zwischenwelt wussten allmählich nicht mehr, wie sie sich diesen Schrecknissen entziehen sollten. Denn auch ihre Existenz begründete sich auf den Gütern, die die Erde ihnen schenkte. Konferenzen und Konvente wurden einberufen, in denen man darüber diskutierte, ob ein Eingreifen sinnvoll war. Doch bisher hatten sich die Gemüter mehr erhitzt denn einen Kompromiss gefunden.
In Jahr 1805 hatte Sir Elliot die Gelegenheit genutzt, aus dem langweiligen Edmonton bei London wegzukommen, und hatte sich als Teilnehmer zu einer Konferenz gemeldet. Sein Vorgesetzter Sir Morrogoth of Cumbria hatte ihn nur zu gern hinreisen lassen. Er fuhr lieber nach Italien als Portugal. Außerdem sollte Sir Elliot für ihn nur die Rolle des Zuhörers einnehmen, da Sir Morrogoth nicht mit entscheidenden Abstimmungen rechnete.
Nun, da die Konferenz sich als ziemlich niederdrückend erwiesen hatte, lechzte Sir Elliot nach Erbauung. Er ging ein bisschen näher an die Kante des Kais, um das Wesen besser in Augenschein nehmen zu können. Elben waren zwar auch Nachtwandler, verfügten aber nicht über die gleiche Sehfähigkeit wie etwa Zwerge.
»Nein«, antwortete er. »Ich bin nicht Riu Abreu.«
»Gut«, antwortete das Wesen. Der Kopf verschwand wieder unter der Oberfläche. Noch ehe Sir Elliot sich Gedanken machen konnte, was es mit dieser Episode auf sich haben könnte, teilte sich das Wasser zu seinen Füßen und das Wesen schoss wie ein Schwertfisch in die Luft. Tausend Tropfen regneten auf seinen Gehrock hernieder, als neben ihm ein schillerndes Meerweibchen landete und sich wie ein Hund schüttelte.
»Dann bin ich ja beruhigt!«, rief es. Diesmal brach es in klingendes Gelächter aus.
Sir Elliot streifte die Tropfen ab, so gut es ging. Die Nacht war zum Glück nicht so frisch, dass er fror, aber auch Ende April war es nicht angenehm, durchnässt herumgehen zu müssen. Er verbat sich ein kritisches Wort, weil ihn das Lachen des Meerweibchens seltsam berührte.
»Nun«, sagte er dann doch, als das Wesen sich endlich kichernd davonstehlen wollte. »Wollt Ihr Euch mir nicht wenigstens vorstellen?«
Das Meerweibchen verstummte. Wieder schien es mit seinen großen Augen etwas in Sir Elliots Gesicht zu suchen.
Sir Elliot seufzte. »Ich bin Sir Elliot of Waterford. Und Ihr?«
Da begann das Meerweibchen zu strahlen. Damit war nicht nur das herzliche Lächeln gemeint, das sich über sein Gesicht breitete. Nein, Sir Elliot glaubte, in seinen Augäpfeln ein Licht zu entdecken, das ihm freudig zuwinkte.
»Mein Name ist Mariella. Herzlich willkommen in meinem Land!« Mit diesen Worten verbeugte sich das Meerweibchen, das sich Mariella nannte. Verblüfft nahm Sir Elliot die Wandlung ihres Körpers zur Kenntnis, die nach der Namensnennung eintrat. Dort, wo gerade noch silbrige Schuppen geschillert hatten, bildeten sich auf einmal Beine, und aus dem Seetang auf dem Kopf wurden die herrlichsten Elbenhaare, die er sich vorstellen konnte.
Lächelnd ließ Mariella Sir Elliots Betrachtungen geschehen. »Da staunt Ihr, was? Können das Eure Meerjungfrauen im fernen England auch?«
»Das weiß ich nicht«, gestand Sir Elliot nach einer Weile, die ihm selbst unziemlich lang erschien. Es fiel ihm schwer, die richtigen Worte für das zu finden, was er sagen wollte. »Ihr seid die erste Meerjungfrau, die ich zu Gesicht bekomme.« Er schluckte unsicher. »Und die erste, die ich an Land wandeln sehe.«
Mariella lächelte wie ein Menschenmädchen. »Dann behaltet mich gut im Gedächtnis, Sir Elliot of Waterford. Vielleicht sehen wir uns bald wieder!« Und mit diesen Worten machte sie sich tatsächlich auf zwei Beinen davon.
All das hatte Sir Elliot plötzlich wieder im Kopf gehabt, als der Brandgeruch des Kachelofens in das Zimmer der Botschaft geströmt war. Mariella war bei ihrer ersten Begegnung zu schnell gewesen, als dass er sie wirklich hatte schön finden können. Wie ein Irrwisch war sie davongehüpft, ohne sich noch einmal umzudrehen. Und Sir Elliot hatte noch eine ganze Weile am Kai der Tejo-Bucht gestanden und ihr nachgeschaut, als wäre alles Andere mit einem Mal unwichtig geworden.
*
Visite
Bis Sonnenaufgang hatte Barbara sich nur noch einmal übergeben müssen. Klare Flüssigkeit war aus ihrem schlaffen Mund geronnen, ohne dass sie die Kraft aufgebracht hatte, sich im Krampf aufzubäumen. Seitdem schlief sie wie eine Tote in ihrem Bett. Sie wurde auch nicht wach, als die Herren Doktoren ihre Visite im Frauensaal abhielten.
»Eindeutige Sache.« Unverblümt trat Professor Doktor Schopfloch an Barbaras Bett und schlug die Decke zurück. Neugierig reckten sich die Hälse der anderen Ärzte, seiner Untergebenen. Sibylle meinte, in manchem Augenpaar eine Gier leuchten zu sehen, die ihr das andere Geschlecht verleidete. Aber was wusste sie schon von den honorigen Absichten der studierten Bürger, die ihr Leben der Medizin widmeten! Ehrfurcht war in diesem Falle angebracht, Ehrfurcht vor den Samaritern der Menschheit, und Demut. Verlegen rutschte Sibylle tiefer in ihr Bett und lugte aus dem Kissen wie ein Kind, das verbotenerweise über einen Zaun schaute.
Der Professor machte einen großen Schritt nach hinten und winkte den nächststehenden Arzt heran. »Was sehen Sie, Herr Kollege Winkelmann?«
Doktor Winkelmann mit dem sorgfältig getrimmten Schnurrbart beugte sich über die reglose Barbara. »Gestatten Herr Professor, dass ich die Patientin abtaste?«
»Nur zu«, meinte Professor Schopfloch.
Sibylle fühlte sich unbehaglich unter ihrer dünnen Decke. Sie versuchte, in dem Doktor nicht den Mann zu sehen, der ohne Umstände den Kragen von Barbaras Nachthemd auseinanderzog, um Brust und Schultern abzutasten. Nur kurz öffnete Barbara die Augen. Für mehr war sie zu schwach. Auch versuchte Sibylle, dem Herrn Doktor die Gründlichkeit zugutezuhalten, mit der er vom Schlüsselbein abwärts bis in die Mitte der Brust tastete. Abschließend über die Haut strich, nein, korrigierte Sybille sich, streichelte. Als wollte er sich für die Untersuchung entschuldigen und die roten Pünktchen, mit denen Barbaras Haut übersäht war, wegwischen.
»Da!« Erfreut deutete der Professor auf etwas, das Sibylle nicht sehen konnte. Weil auch in den Gesichtern der Entourage Unverständnis vorherrschte, beugte er sich vor und tupfte spielerisch auf die kleine Erhebung auf Barbaras rechter Brust, die sich bei der Berührung des Kollegen unter dem dünnen Nachthemd gebildet hatte. »Neurologischer Test: positiv. Sehr reaktionsfreudig, diese Unterschichtenfrau«, stellte er zufrieden fest. Die anderen Ärzte lachten dienstbeflissen.
Verwirrt hörte Sibylle die Stimme ihrer Mutter schimpfen, dass er gefälligst die Hände wegnehmen solle, dieser ekelhafte Lustmolch. Unbehaglich suchte sie eine andere Position in ihrem Bett. Vielleicht konnte sie sich noch kleiner machen, damit man sie bei der Visite vergaß.
»Also, lieber Kollege Doktor Winkelmann, wie lautet nun Ihre Diagnose?«, frage der Professor gönnerhaft.
Doktor Winkelmann lächelte so geschmeichelt, dass Sibylle regelrechte Panik bei der Vorstellung entwickelte, er würde sie gleich auch untersuchen. Der ganze Raum schrumpfte auf Barbaras und ihr Bett zusammen. Alles, was rechts von ihr und auf der anderen Seite des Mittelganges geschah, wurde grau und bedeutungslos.
»Ich postuliere Purpura Schönlein-Henoch, Herr Professor«, verkündete Doktor Winkelmann siegessicher. »Eine aggressive Autoimmunerkrankung der Gefäße mit Einblutungen unter der Haut. Sehr unschön, wie wir hier sehen, aber ohne letalen Verlauf.«
Wie das Wetter es hin und wieder tat, schlug die Zufriedenheit des Professors in Ärger um. »Ist Ihnen schon einmal ein derart entstellter Erwachsener begegnet«, knurrte er, »dessen Haut aussah wie die eines mit Pertussis geschlagenen Kindes, das sein Leben in den Mietskasernen der Arbeiter fristet?« Strafend hob er den Zeigefinger. »Anscheinend hätten Sie bei Ihren Studien mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Denn die Purpura ist eine Erkrankung des Kindesalters!«