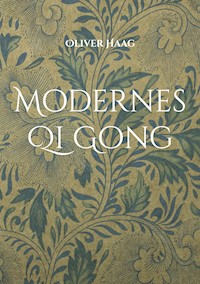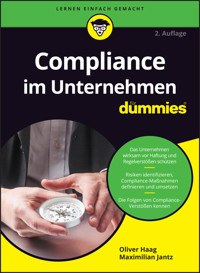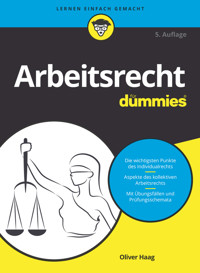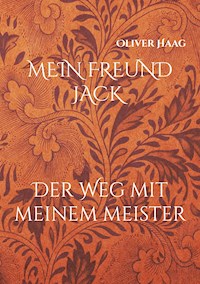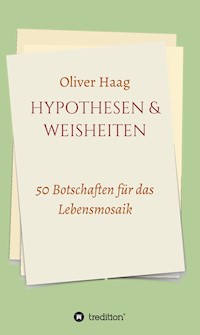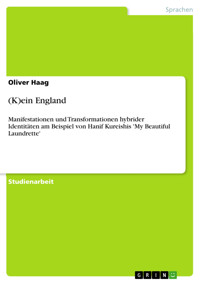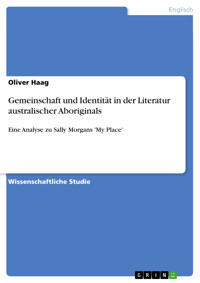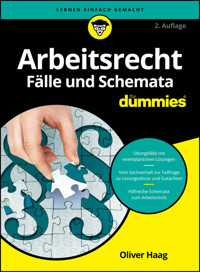
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Schemata und Fallbearbeitung: Die optimale Klausurvorbereitung
Die Fallbearbeitung ist für viele Jura-Neulinge eine harte Nuss. Da hilft nur eines: Üben! Nach einer kurzen Einführung in die Fallbearbeitung bietet Ihnen dieses Buch 20 Übungsfälle mit exemplarischen Lösungen zur Selbstkontrolle. Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt vom Sachverhalt und der Fallfrage zur Lösungsskizze und zum Gutachten vor. Außerdem stellt Ihnen Oliver Haag die wichtigsten Schemata vor, sodass Sie schnell einen Überblick über die besonders prüfungsrelevanten Themen des Arbeitsrechts gewinnen. Illustrationen zu Schemata und Fällen veranschaulichen das schrittweise Vorgehen.
Sie erfahren
- Wie Schemata die wichtigsten Zusammenhänge spiegeln und eine Prüfungsabfolge vorstrukturieren
- Wie Sie die Ansprüche und Informationen des Sachverhalts mithilfe einer Lösungsskizze auf den Punkt bringen
- Was beim Gutachtenstil zu beachten ist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arbeitsrecht Fälle und Schemata für Dummies
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2026
© 2026 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren –in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverillustration: © Ingo Bartussek – stock.adobe.comZeichnungen: Andreas GerhardtKorrektur: Petra Heubach-Erdmann, Düsseldorf
Print ISBN: 978-3-527-72273-0ePub ISBN: 978-3-527-85087-7
Über den Autor
Dr. jur Oliver Haag ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Konstanz mit den Lehr- und Tätigkeitsschwerpunkten Corporate Compliance, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Arbeitsrecht. Zuvor war er mehrere Jahre als Rechtsanwalt und Chefsyndikus in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie vorwiegend mit nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen, Restrukturierungen und Beteiligungsmanagement beschäftigt. Neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer ist er für verschiedene Bildungsträger in der berufsbegleitenden Erwachsenenbildung sowie als Of Counsel einer auf Unternehmensrecht spezialisierten Anwaltskanzlei für nationale und internationale Unternehmen und Verbände tätig. Er verfügt über umfangreiche Praxis- und Lehrerfahrung und hat zahlreiche Beiträge zum Unternehmensrecht veröffentlicht, unter anderem Arbeitsrecht für Dummies.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Was dieses Buch nicht will
Törichte Annahmen über den Leser
Wie Sie dieses Buch lesen
Wie es weitergeht
Teil I: So geht's: Falllösung und Schemata für Jura-Neulinge
Kapitel 1: So lösen Sie Fälle
Allgemeine Hinweise zur Herangehensweise an Klausuraufgaben
Die Fünf-W-Frage: Wer will was von wem woraus
Der Fünf -Punkte-Plan zur Fallbearbeitung
Das Dreigestirn zur Prüfung einzelner Anspruchsgrundlagen
Kapitel 2: Das Arbeiten mit Schemata
Über den Sinn und Unsinn von Schemata
Schemata als Hilfsmittel
Teil II: Schemata
Kapitel 3: Einführende Hinweise
Kapitel 4: Wichtige arbeitsrechtliche Schemata
Prüfungsschema für die Prüfung, ob ein Arbeitsverhältnis oder aber eine selbstständige (»freie«) Mitarbeit besteht
Prüfungsschema für einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Prüfungsschema für einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach § 3 Abs. 1 EFZG
Prüfungsschema für die Berechnung eines Anspruchs auf Urlaub nach dem BUrlG
Prüfungsschema für den Anspruch auf Arbeitslohn trotz Nichterbringung der Arbeitsleistung – Betriebsrisiko und Annahmeverzug des Arbeitgebers
Prüfungsschema für den Anspruch auf Arbeitsvergütung trotz Nichterbringung der Arbeitsleistung – Vorübergehende Verhinderung
Prüfungsschema für einen Anspruch auf Schadensersatz des Arbeitgebers nach § 280 Abs. 1 BGB
Prüfungsschema für die Anfechtung des Arbeitsvertrages
Prüfungsschema für die Wirksamkeit einer Befristung des Arbeitsvertrages - § 14 TzBfG
Prüfungsschema für die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündigung
Prüfungsschema für die Wirksamkeit einer außerordentlichen (fristlosen) Kündigung
Prüfungsschema für die Wirksamkeit einer Verdachtskündigung
Prüfungsschema auf Gewährung einer Sonderzahlung aufgrund betrieblicher Übung
Prüfungsschema für die Geltendmachung eines Anspruchs aus einem Tarifvertrag
Prüfungsschema auf einen Nachteilsausgleich nach § 113 BetrVG
Prüfungsschema auf ein bestehendes Beteiligungsrecht des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen
Prüfungsschema für die Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes (insbesondere Streik/Aussperrung)
Teil III: Fallbearbeitung
Kapitel 5: Fall 1: Ein freier Mitarbeiter
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 6: Fall 2: Die abgelehnte Bewerberin
Sachverhalt (angelehnt an ArbG Stuttgart, 15.04.2010 – 17 Ca 8907/09)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 7: Fall 3: Der Schlucki
Sachverhalt (angelehnt an BAG, 18.03.2015 – 10 AZR 99/14)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 8: Fall 4: Allerlei rund um den Urlaub – 2. Akt
Sachverhalt (frei nach BAG, 07.08.2010 – 9 AZR 353/10)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 9: Fall 5: Die verhinderte Chefköchin
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 10: Fall 6: Kind geht vor
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 11: Fall 7: Die »mitdenkende« Reinigungskraft
Sachverhalt (nach BAG, 28.10.2010 – 8 AZR 418/09)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 12: Fall 8: Die Sünden der Jugend …
Sachverhalt (nach LAG Baden-Württemberg, 13.10.2006 – 31 Ca 11627/05)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 13: Fall 9: Schummeln für Anfänger
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 14: Fall 10: Der Junkie
Sachverhalt (angelehnt an BAG, 20.03.2014 – 2 AZR 565/12)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 15: Fall 11: Eine engagierte Pädagogin
Sachverhalt (angelehnt an BAG, 19.04.2012 – 2 AZR 156/11)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 16: Fall 12: Der ökonomisch denkende Arbeitgeber
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 17: Fall 13: Der »Busengrapscher«
Sachverhalt (nach BAG, 20.11.2014 – 2 AZR 651/13)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 18: Fall 14: Der Drogist
Sachverhalt (angelehnt an BAG, 20.10.2016 – 6 AZR 471/15)
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 19: Fall 15: Trau – Schau – Wem
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 20: Fall 16: Ein großzügiger Arbeitgeber
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 21: Fall 17: Tariflohnerhöhung oder nicht
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 22: Fall 18: Am schönen Bodensee
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 23: Fall 19: Betriebsratsallerlei
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Kapitel 24: Fall 20: Ein Arbeitsk(r)ampf
Sachverhalt
Vorüberlegungen
Lösungsskizze
Ausformulierte Falllösung
Teil IV: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 25: Zehn Tipps zur Klausurbearbeitung
Achten Sie auf Sprache und Form
Der Weg ist das Ziel
Arbeiten Sie mit dem Gesetz
Nie den roten Faden verlieren
Mut zum klaren Ergebnis
Abschreiben bringt keine Punkte
Keine Zeit verschwenden
Schummeln lohnt sich nicht
Auch die Farbe zählt
Machen Sie keine Formfehler
Kapitel 26: Zehn klassische Fragen zur Kündigung
Was verstehen Sie unter einer Kündigung?
Welche Kündigungsarten kennen Sie?
Welcher Form bedarf die Kündigung?
Muss die Kündigung begründet werden?
Welche Rolle spielt ein Betriebsrat bei der Kündigung?
Welche Kündigungsfristen sind einzuhalten?
Wann kann eine fristlose Kündigung erfolgen?
Ist eine fristlose Kündigung fristgebunden?
Wann besteht für den Arbeitnehmer Kündigungsschutz?
Welche Folgen hat das Eingreifen des Kündigungsschutzgesetzes?
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
61
62
63
65
66
67
69
70
71
73
74
75
77
78
79
80
81
83
84
85
87
88
89
91
92
93
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
235
236
237
238
239
240
241
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
Einführung
Am Arbeitsrecht kommt niemand vorbei. Und nun hat es auch Sie »erwischt«, denn Ihre Studien- und Prüfungsordnung oder Ihre Ausbildungsordnung sieht diese Thematik vor. Vielleicht haben Sie sich auch freiwillig im Rahmen eines Wahlangebots für das Arbeitsrecht entschieden. Ob freiwillig gewählt oder aufgrund der Vorgaben Ihres Studienplans unfreiwillig betroffen; seien Sie versichert: Die Materie ist aus Ihrem jetzigen und künftigen (Berufs-)Leben nicht wegzudenken und daher so oder so »unvermeidbar«. Schon die alten Römer haben es auf den Punkt gebracht: Non scholae, sed vitae discimus– Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Für kaum ein anderes Rechtsgebiet gilt dies so sehr wie für das Arbeitsrecht – denn egal ob Sie später als Arbeitnehmer oder als selbstständiger Unternehmer tätig werden: Berührungspunkte mit dem Arbeitsrecht sind unvermeidbar, kurzum, am Arbeitsrecht kommt niemand vorbei.
Arbeitsrecht – Fälle und Schemata für Dummies wird Sie bei der Prüfungsvorbereitung im Rahmen Ihres Studiums oder Ihrer Ausbildung unterstützen und Ihnen das notwendige Handwerkszeug für das erfolgreiche Bestehen Ihrer Prüfungen vermitteln.
Über dieses Buch
Arbeitsrecht – Fälle und Schemata für Dummies wird Ihnen zunächst das notwenige Verständnis für die juristische Prüfungssystematik und Herangehensweise bei der Lösung typischer Prüfungssituationen vermitteln. Zur Unterstützung bedienen wir uns dabei bestimmter Schemata, also vorgefertigter Prüfungsabfolgen, die systematisiert die Abarbeitung der rechtlichen Aufgabenstellung erleichtern. Anschließend haben Sie anhand typischer Klausur- und Prüfungsfälle hinreichend Gelegenheit, das Lösen von rechtlichen Fällen selbstständig zu üben und Ihre eigenen Lösungen anhand der hier enthaltenen Beispielfälle auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.
Dabei werden Sie hoffentlich merken, dass Lernen auch Spaß machen kann. Vor allem dann, wenn das Erlernte auch fürs tägliche Leben von Interesse und von Nutzen ist. Dass dies beim Arbeitsrecht der Fall ist, steht außer Zweifel, denn – und das wissen Sie ja schon – am Arbeitsrecht kommt niemand vorbei.
Bücher mit Fällen oder Schemata zum Arbeitsrecht gibt es viele – übrigens auch einige wirklich gute. Arbeitsrecht – Fälle und Schemata für Dummies wird mit diesen nicht konkurrieren, sich aber klar abgrenzen: Fälle und Schemata werden kombiniert und auf typische Prüfungs- und Klausursituationen konzentriert und sachgerecht dargestellt. Dabei wendet sich dieses Buch vorrangig an Studierende der Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften, kann aber sicher auch für die Studierenden des (Wirtschafts-)Rechts ein wertvoller Begleiter und Ratgeber sein.
Was dieses Buch nicht will
Arbeitsrecht – Fälle und Schemata für Dummies ist kein Lehrbuch zum Arbeitsrecht – wenn Sie ein Lehrbuch suchen, empfehle ich Ihnen Arbeitsrecht für Dummies. Die Darstellung des materiellen Arbeitsrechts im Sinne einer klassischen Lehrbuchvermittlung will und kann hier nicht erfolgen. Auch erhebt dieses Buch keinen Anspruch darauf, mit der fallbezogenen Vorgehensweise eine erschöpfende Darstellung aller möglichen und unmöglichen Klausurfälle zu bieten. Und natürlich kann auch eine individuelle Rechtsberatung durch einen fachlich versierten Fach- oder Rechtsanwalt nicht ersetzt werden. Dafür erhalten Sie aber auf den folgenden Seiten eine komprimierte Anleitung zum Umgang mit juristischen Klausuraufgaben, Prüfungsschemata und zur Lösung typischer Klausur- und Prüfungsaufgaben im betriebswirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen und (wirtschafts-)rechtlichen Studium.
Törichte Annahmen über den Leser
Die Leser dieses Buchs für ungebildet oder ignorant zu halten, wäre töricht. Dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben, belegt vielmehr das Gegenteil: Sie haben eine komprimierte, auf das Wesentliche konzentrierte Darstellung einer Rechtsthematik gewählt, die Ihnen in überschaubarem Umfang und damit überschaubarer Zeit das notwendige Rüstzeug für Ihre anstehenden Prüfungen vermittelt. Dabei soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen – Jura muss nicht zwangsläufig eine trockene Materie sein. Ganz im Gegenteil. Die folgenden Seiten werden Ihnen beweisen, dass Recht, insbesondere Arbeitsrecht, lebendig ist und äußerst unterhaltsame Fälle bereithält. Oder stoßen Sie in Ihren anderen Fächern etwa auch auf »Ossis«, »schwere Alkoholiker«, unglaublich clever mitdenkende Reinigungskräfte, »Junkies«, »wild gewordene Pädagogen« oder gar »Busengrapscher«?
Wie Sie dieses Buch lesen
Wenn Sie bereits Zugang zu der manchmal wundersamen Welt der juristischen Denk- und Arbeitsweise gefunden haben, können Sie direkt mit den Schemata und der Fallbearbeitung in den Teilen II und III durchstarten. Wenn Sie den Zugang zur Juristendenke dagegen noch suchen oder ihn trotz mehr oder weniger intensiver Suche bislang nicht gefunden haben, dann sollten Sie sich zunächst intensiv mit Teil I »So geht's: Falllösungen und Schemata für Jura-Neulinge« beschäftigen. Und wer weiß: Vielleicht finden diejenigen unter Ihnen, die schon »alles« wissen, dort auch noch ein paar nützliche Hinweise.
Organisieren Sie sich unbedingt eine aktuelle Sammlung der wichtigsten arbeitsrechtlichen Gesetze und halten Sie diese immer griffbereit. Regelmäßig ist der (unkommentierte) Gesetzestext das einzige bei den Klausuren zugelassene Hilfsmittel. Dieses Buch werden Sie dagegen in der Klausur nicht dabeihaben können – schade eigentlich.
Teil I: So geht's: Falllösungen und Schemata für Jura-Neulinge
Juristen denken in Ansprüchen – gerne ausgehend von der Fragestellung »wer will was von wem woraus«. Zur Beantwortung und damit zur rechtlichen Lösung eines Lebenssachverhalts (»Fall«) bedienen Sie sich bestimmter Arbeitstechniken. Hilfreich ist dabei die Zuhilfenahme von Prüfungsschemata. Bevor Sie sich mit den Schemata und der Falllösung selbst befassen, wird im ersten Teil Grundsätzliches zur juristischen Denk- und Arbeitsweise, der Falllösung und dem Arbeiten mit Schemata erklärt.
Teil II: Schemata
Im zweiten Teil lernen Sie die wichtigsten Prüfungsschemata im Arbeitsrecht kennen. Gut für Sie ist dabei deren zahlenmäßige Überschaubarkeit. Sie werden sehen, dass man mit einigen grundlegenden systematisierten Prüfungsschritten sehr viele klassische arbeitsrechtliche Fragestellungen klausursicher abarbeiten kann.
Teil III: Fallbearbeitung
Dieser insgesamt 20 Fälle umfassende Teil stellt den Schwerpunkt des Buches dar. Sie werden mit klausur- und prüfungstypischen Sachverhalten befasst und sehen, wie man nach der Erfassung des Sachverhalts und der Aufgabenstellung zunächst eine systematisierte Gliederung im Sinne einer Lösungsskizze erstellt, bevor es anschließend an die Ausformulierung der Falllösung geht.
Die hier abgebildeten Fälle sind häufig an echte Lebenssachverhalte angelehnt oder entsprechen diesen sogar vollständig. Die schönsten Geschichten schreibt nämlich immer das Leben – denken Sie also nicht, dass die manchmal etwas extrem wirkenden Sachverhalte in Rechtsklausuren zwingend das Resultat der (wirren) Gedanken Ihres Professors sind. Die Sachverhalte, die vor den Arbeitsgerichten landen, sind in Teilen unterhaltsamer als alles, was man sich am Schreibtisch ausdenken könnte.
Teil IV: Der Top-Ten-Teil
Entsprechend der Tradition der … für Dummies-Bücher enthält der Top-Ten-Teil einige besonders wichtige Hinweise, die Ihnen als bemitleidenswertem Studierenden das Leben vor und in der Prüfung erleichtern können.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Hier gebe ich Ihnen Tipps, wie Sie etwas besser verstehen oder sich leichter merken können.
Hier stelle ich Ihnen einen Punkt vor, den Sie sich unbedingt merken sollten.
Hier warne ich Sie vor Fehlern und Trugschlüssen, die häufig vorkommen.
Wie es weitergeht
Wir starten mit Teil I »So geht's: Falllösung und Schemata für Jura-Neulinge«. Wenn Sie mit dieser Thematik bereits vertraut sind, können Sie die folgenden Seiten getrost überblättern. Aber wer weiß – vielleicht entdecken Sie in Teil I ja doch noch etwas Neues …
Teil I
So geht's: Falllösung und Schemata für Jura-Neulinge
IN DIESEM TEIL …
Juristische Klausuren und Prüfungen bestehen typischerweise aus einer Mischung aus Falllösung im Gutachtenstil und allgemeinen Wissensfragen. In diesem Teil finden Sie Hinweise zur systematischen Herangehensweise an die Klausuraufgaben, die Zuhilfenahme von Lösungs-Schemata, Tipps zur Falllösung und eine Anleitung zur juristischen Denk- und Arbeitsweise.
Kapitel 1
So lösen Sie Fälle
IN DIESEM KAPITEL
Allgemeine Hinweise zur Herangehensweise an KlausuraufgabenDie Fünf-W-Frage: wer will was von wem worausDer Fünf-Punkte-Plan zur FallbearbeitungDas Dreigestirn zur Prüfung einzelner AnspruchsgrundlagenUm Ihnen die Bearbeitung Ihrer arbeitsrechtlichen Klausuraufgaben zu erleichtern, erläutere ich Ihnen zunächst, wie Sie sinnvollerweise an Prüfungen herangehen und mit welcher Ausgangsfrage Sie Sachverhalt und Aufgabenstellung am besten erfassen. Zur Fallbearbeitung selbst bedienen Sie sich eines Fünf-Punkte-Plans, um das Dreigestirm der Anspruchsgrundlagen zu erfassen.
Allgemeine Hinweise zur Herangehensweise an Klausuraufgaben
Die Klausuren der Rechtsvorlesungen bestehen in der Regel zu etwa der Hälfte bis zu zwei Dritteln aus der Lösung eines oder mehrerer Lebenssachverhalte (Fälle) und nur im Übrigen aus herkömmlichen Wissens- und Verständnisfragen. Die Wissens- und Verständnisfragen können – je nach Aufgabenstellung – stichwortartig, ausformuliert oder im Wege einer Multiple-Choice-Prüfung abgearbeitet werden. Regelmäßig macht Ihnen der jeweilige Dozent hierzu klare Vorgaben – falls er das vergessen sollte, fragen Sie ihn (sinnigerweise vor und nicht während der Prüfung)!
Besteht Ihre Aufgabe in der Lösung eines Falles, wird von Ihnen in der Regel ein sprachlich voll ausformuliertes Gutachten zu allen wesentlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten des Falles erwartet.
Machen Sie sich bewusst, dass grundsätzlich alle im Fall (Sachverhalt) enthaltenen Informationen für die Lösung der Aufgabenstellung einer Rolle spielen – denn sonst wären diese im Sachverhalt nicht enthalten. Wenn Ihre Lösung also etliche Informationen des Sachverhalts nicht abgearbeitet hat, kann etwas nicht stimmen und Sie haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit etwas übersehen.
Meist hat die Lösung des Falles im sogenannten Gutachtenstil zu erfolgen, einer speziellen juristischen Arbeitstechnik. Das Beherrschen dieser Subsumtionstechnik unterscheidet Juristen von anderen Wissenschaftsdisziplinen und darauf sind sie natürlich besonders stolz. Wenn Sie nicht Jura, sondern BWL, VWL oder ein anderes Fach (aus den Wirtschaftswissenschaften) studieren, so sind die Rechtsdozenten mit ihren Anforderungen an Gutachtenstil und Subsumtionstechnik häufig etwas weniger streng. Grundzüge werden aber auch von diesen Studierenden erwartet und Sie werden gleich sehen, dass die Beherrschung des Gutachtenstils und der Subsumtionstechnik das Abarbeiten und Lösen juristischer Aufgabenstellungen ungemein erleichtert.
Die Fünf-W-Frage: Wer will was von wem woraus
Rechtlich denkt man bei der Lösung von Aufgaben in sogenannten Ansprüchen ausgehend von der Frage wer will was von wem woraus.
Eine gesetzliche Definition des Begriffes Anspruch enthält §194 Abs.1 BGB: Ein Anspruch ist das Recht, von einem anderen ein Tun (zum Beispiel Zahlung, Beschäftigung, Urlaubsgewährung) oder Unterlassen (zum Beispiel Diskriminierung) zu verlangen.
Wer
Wer ist die Frage nach dem Anspruchsteller, also der Person, die einen bestimmten Anspruch geltend machen und durchsetzen will.
Was
Was ist die Frage nach dem konkreten Begehren des Anspruchstellers. Hier müssen Sie häufig die erste intellektuelle Hürde nehmen, denn das Was gibt Ihnen der Klausursachverhalt nicht immer eindeutig vor. Wenn dort steht, »Anton will Zahlung seines Arbeitsentgelts«, ist das Was eindeutig. Fehlt eine solche Eindeutigkeit, dann müssen Sie das Was danach bemessen, was den Interessen des Anspruchstellers vernünftigerweise entspricht. Ergibt sich also aus dem Sachverhalt, dass es zwischen den Parteien um die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses geht, dann kann das Was kein Begehren auf Schadensersatz sein.
Wem
Das Wem ist die Frage nach dem Anspruchsgegner, also der Person, von der der Anspruchsteller (Wer) etwas begehrt (Was). Das konkrete Begehren kann in einem Tun oder einem Unterlassen bestehen.
Woraus
Die Frage nach dem Woraus ist der entscheidende und regelmäßig schwierigste Teil der Fünf-W-Frage. Hier geht es um die Anspruchsgrundlage, also um eine gesetzliche Bestimmung oder eine konkrete vertragliche Vereinbarung, nach der der Anspruchsteller (Wer) das Begehrte (Was) vom Anspruchsgegner (Wem) verlangen kann. Die Anspruchsgrundlage (Woraus) kann dabei in einem einzelnen Paragrafen zu finden sein oder aber in der Reihe von Paragrafen, einer sogenannten Paragrafenkette.
Lassen Sie sich nicht entmutigen: Anspruchsgrundlagen sind gar nicht so schwer zu finden und zum Glück auch zahlenmäßig überschaubar. Die wichtigsten für das Lösen arbeitsrechtlicher Fälle erforderlichen Anspruchsgrundlagen werden Sie auf den folgenden Seiten kennenlernen. Zudem sind Anspruchsgrundlagen regelmäßig wie folgt aufgebaut: Wenn bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, dann tritt die begehrte Rechtsfolge ein.
Lassen Sie uns die Fünf-W-Frage sogleich anhand eines konkreten Beispiels üben:
Arbeitnehmer Armin Arm wurde von seinem Arbeitgeber Gerd Gemein zurechtgewiesen, weil er die Abgabe eines wichtigen Angebotes trotz konkreter Terminvorgabe verbummelt hatte. Aus Wut über die Zurechtweisung schlägt Arm den Telefonhörer absichtlich so fest auf das im Eigentum des Gemein stehende Telefon, dass dieses funktionsunfähig ist. Gemein möchte den entstandenen Schaden (Kosten des Telefonapparats) von Arm ersetzt haben.
wer will was von wem woraus?
Gemein (wer) möchte von Arm (wem) Schadensersatz für das zerstörte Telefon (was).
Als Anspruchsgrundlage (woraus) kommt hier zunächst § 280 Abs. 1 BGB in Betracht.
§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung(I) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Die Anspruchsgrundlage enthält explizit die vom Anspruchsteller (Gemein) begehrte Rechtsfolge Schadensersatz. Damit die Rechtsfolge Schadensersatz eintreten kann, müssen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 280 Abs. 1 vorliegen: Aus dem Wortlaut des Paragrafen lassen sich folgende vier Tatbestandsvoraussetzungen ableiten:
Schuldverhältnis
Zwischen dem Anspruchsteller (Gemein) und dem Anspruchsgegner (Arm) muss ein Schuldverhältnis bestehen, aufgrund dessen der Anspruchsteller als Gläubiger vom Anspruchsgegner als Schuldner eine Leistung fordern kann (§ 241 Abs. 1 BGB). Gemein kann aufgrund des bestehenden Arbeitsvertrages von Arm die vereinbarte Arbeitsleistung fordern.
Pflichtverletzung
Arm hat eine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag verletzt. Er hat mit dem Eigentum seines Arbeitgebers und Vertragspartners Gemein sorgsam umzugehen und dieses nicht zu beschädigen oder zu zerstören (§ 241 Abs. 2 BGB).
Verschulden
Dies geschah auch schuldhaft, nämlich mit Absicht und damit vorsätzlich (§ 276 BGB).
Schaden
Schließlich ist dem Gemein dadurch auch ein Schaden entstanden.
Da alle Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, tritt nun die von der Anspruchsgrundlage angeordnete Rechtsfolge ein: Gemein kann von Arm Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.
Sie sehen also, dass mit der Fünf -W-Frage »wer will was von wem woraus« eine systematische Herangehensweise an die Aufgabenstellung gesichert ist.
Gewöhnen Sie es sich von Anfang Ihrer juristischen Veranstaltungen an, rechtliche Probleme und Herausforderungen immer mit dieser Ausgangsfrage anzugehen und damit gezwungenermaßen strukturiert vorzugehen.
Wenn Sie sich zunächst die Fünf-W-Frage korrekt beantworten, müssen Sie »nur« noch eine Anspruchsgrundlage auffinden, die das Begehrte als Rechtsfolge enthält. Ist die Anspruchsgrundlage gefunden, gilt es, deren Tatbestandsvoraussetzungen eine nach der anderen abzuarbeiten. Die Beherrschung dieser Technik ist bereits ein großer Schritt für das erfolgreiche Bestehen juristischer Klausuren.
Der Fünf -Punkte-Plan zur Fallbearbeitung
Da Sie nun mit der Systematik der Herangehensweise an juristische Klausuraufgaben vertraut sind, können wir uns der Hauptanforderung zuwenden, die von Ihnen in den Prüfungen erwartet wird: die Fallbearbeitung.
Um den Klausursachverhalt zu erfassen und einer passablen Lösung zuzuführen, hilft Ihnen der bewährte Fünf-Punkte-Plan zur Fallbearbeitung:
Lesen
Verstehen
Fallfrage(n) erkennen
Anspruchsgrundlage(n) finden und gliedern
Formulieren
Schauen Sie sich diese fünf Punkte im Einzelnen an.
Lesen
Wichtig ist zunächst das genaue Erfassen des Sachverhalts. Lesen Sie daher den Sachverhalt mehrfach (mindestens zweimal) konzentriert durch.
Falls Sie der Meinung sind, dass der Sachverhalt Lücken enthält, verändern oder »verbiegen« Sie ihn nicht, und fangen Sie nicht an, eigene Interpretationen über vermeintlich Unerwähntes anzustellen. Der Sachverhalt ist in der Regel vom Aufgabensteller sorgfältig erstellt und enthält alle für die Lösung erforderlichen Informationen.
Verstehen
Verschaffen Sie sich Klarheit über den Sachverhalt. Nehmen Sie sich die erforderliche Zeit, um den Sachverhalt zu erfassen und zu verstehen. Welche Personen sind beteiligt, in welchem Verhältnis stehen diese zueinander, gibt es Angaben zu Daten oder Zahlen und so weiter. Gegebenenfalls helfen folgende Instrumente, um das Erfassen und Verstehen zu bewerkstelligen:
Sachverhaltsskizze:
Sollten mehrere Personen beteiligt sein, kann es zweckmäßig und hilfreich sein, den Sachverhalt grafisch aufzuzeichnen. So können die Beziehungen zwischen den Personen übersichtlicher dargestellt und folglich auch die Ausgangsfrage »wer will was von wem woraus« leichter erfasst werden.
Datentabelle/Zeitstrang:
Sollte der Sachverhalt mehrere Daten enthalten, so kann es zweckmäßig und hilfreich sein, diese tabellarisch oder mittels eines Zeitstranges systematisiert darzustellen. Daten und Zahlen im Sachverhalt spielen regelmäßig für die Lösung eine erhebliche Rolle.
Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass alle Angaben im Sachverhalt für die Lösung eine Rolle spielen. Trennen Sie dennoch die wichtigen von den unwichtigen Informationen und prüfen Sie stets, ob die wichtigen Informationen auch in Ihrer späteren Lösung verarbeitet wurden. Um das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, fragen Sie sich was ist rechtlich (für die Lösung) von Interesse?
Fallfrage(n) erkennen
Verschaffen Sie sich anschließend Klarheit über die Fallfrage(n). Nur was gefragt wird, müssen Sie auch bearbeiten und beantworten.
Klassischerweise enthält die Klausur entweder eine oder mehrere konkrete Fallfrage(n) oder eine offen gestellte Frage:
Konkrete Fallfrage(n):
Sie erkennen diese Frage(n) aufgrund der sprachlich eindeutigen Formulierung. Beispielsweise: Kann A von B Zahlung des Arbeitsentgeltes fordern? Ist die Kündigung des C wirksam? Hat D gegen E einen Anspruch auf Entschädigung? und so weiter. Es liegt auf der Hand, dass dann »nur« die konkret gestellte(n) Frage(n) zu bearbeiten und zu beantworten sind. Ausführungen zu nicht explizit gefragten Themen werden Ihnen keine Punkte bringen und Sie nur wertvolle Bearbeitungszeit kosten!
Offen gestellte Frage(n):
Diese Frage(n) erkennen Sie ebenfalls anhand der sprachlichen Formulierung. Beispielsweise: Welche Ansprüche hat A gegen B? Prüfen Sie die Ansprüche des C. Wie ist die Rechtslage? und so weiter. Es liegt auf der Hand, dass Sie bei derartigen offenen Fragestellungen alle ernsthaft in Betracht kommenden Ansprüche zwischen den beteiligten Personen bearbeiten und beantworten sollen.
Anspruchsgrundlage(n) finden und gliedern
Nun beginnt die eigentliche rechtliche Arbeit: die Suche nach der oder den einschlägigen Anspruchsgrundlagen. Häufig kommen mehrere Anspruchsgrundlagen ernsthaft in Betracht.
Prüfen Sie diese in der Reihenfolge Ansprüche aus Vertrag vor Ansprüchen aus Gesetz.
Auch wenn sie zum gleichen Ergebnis führen, müssen Sie alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen auffinden und erörtern. Die wichtigsten Anspruchsgrundlagen für die Lösung arbeitsrechtlicher Klausurfälle lernen Sie auf den folgenden Seiten kennen. An dieser Stelle sollten Sie sich aber nochmals klarmachen, dass alle Anspruchsgrundlagen gewisse Tatbestandsvoraussetzungen enthalten, die erfüllt sein müssen, damit ein Anspruch gewährt wird. Diese Voraussetzungen müssen Sie genau untersuchen. Hier ist sauberes und sorgfältiges Arbeiten wichtig, damit Sie nicht die eigentlichen Probleme übersehen. Erstellen Sie sich daher eine Gliederung oder Lösungsskizze, aus der sich die Reihenfolge Ihrer Prüfung logisch und stringent ergibt. Machen Sie sich Notizen zu den einzelnen Gliederungspunkten und insbesondere zu den einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen der zu prüfenden Anspruchsgrundlagen. Eine gute Lösungsskizze ist die »halbe Miete« für die Ausformulierung Ihrer Lösung.