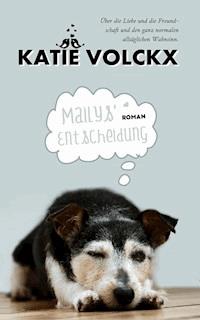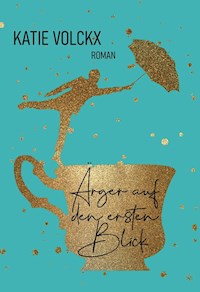
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich will daran glauben, dass es in der Liebe so etwas gibt wie Magie, die Menschen zueinanderführt und für immer bindet." Vielleicht ist Amalie eine Traumtänzerin, vielleicht ist sie auch nur eine unverbesserliche Optimistin. Als eines Nachts der gutaussehende Gustav in ihr Café schneit, glaubt sie jedenfalls an Schicksal, auch dann noch, als sich ihr das erste Hindernis in den Weg stellt: ihre Erzfeindin Marietta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Pünktlich zur Adventszeit fielen die ersten Schneeflocken im Ort nieder. Auf dem Marktplatz liefen alle Vorbereitungen für den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Die Back- und Süßwarenbuden standen schon seit heute Morgen, die beiden Kinderkarussells waren nur halbfertig. Die Laternen, die sich um den Marktplatz säumten, hielten für Tannengirlanden her, an denen man wetterfeste bunte Kugeln befestigt hatte. Dazu verband diesen Kreis eine Lichterkette. Sie schien wie eine Aureole, wenn sie in der Dunkelheit leuchtete.
Im Mittelpunkt stand allerdings der siebzehn Meter hohe und vier Tonnen schwere Tannenbaum. Er war schon sehr protzig, so, als stünde der Ort in Konkurrenz mit anderen, doch mit dem goldig schimmernden Stern auf der Baumkrone und der tanzenden Lichtflut, die sich wie ein Kreisel um den Baum herunterwand, wirkte es trotzdem sehr beeindruckend.
Zu dieser Zeit gab es wohl keinen schöneren Ort als diesen, war Oma Minna überzeugt. Ein Lächeln huschte über ihre bleichen, faltigen Lippen, als sie sich das Lichtermeer vom Schlafzimmerfenster aus ansah. Durch Schneefall war es zwar nur noch geisterhaft zu erkennen, dennoch genoss sie den Ausblick.
Es fiel ihr schwer einzuschlafen, deshalb erhoffte sie sich von dem Treiben schläfrig zu werden. Als ein starker Wind einsetzte und die Flocken durch die Lüfte wirbelte, schnappte sie sich die Wolldecke, die neben ihr auf dem Schaukelstuhl lag, und warf sie sich über die Schultern. Allein der Anblick fröstelte sie, obwohl die Wärme des erloschenen Ofens noch immer angenehm in der Luft hing.
Das wirre Tanzen der Schneeflocken wirkte beinahe hypnotisierend auf die Oma, so dass sie kaum sicher war, ob die Gestalt, die plötzlich aus dem Nichts erschien, auch real war. Sie kniff die Augen zusammen und fixierte den schwarzen Punkt in der Ferne. Doch je mehr sich dieser näherte, desto erleichterter war sie, dass ihre Augen sie noch nicht ganz im Stich ließen. Sie hatte schon befürchtet, sie könnte seit Neuestem an Halluzinationen leiden. Gleichzeitig fragte sie sich verwundert, welcher geistig gesunde Mensch bei solch einem Wetterverhältnis da draußen unterwegs war und darüber hinaus auch noch versuchte, sich mit einem dieser zusammenfaltbaren, instabilen Regenschirme trocken zu halten! In den Händen des Mannes, der nun endlich als solcher von ihr identifiziert worden war, zuckte der Schirm im Sturm nämlich nur auf und ab und hin und her, statt seine Aufgabe zu erfüllen.
Dann schlug sie die Hände glückselig zusammen, als sie erkannte, dass der Mann den Kampf mit dem Schirm aufgegeben hatte, indem er ihn auf den Boden schmetterte und wütend von sich trat. Der Schirm war sowieso halbwegs zerfetzt worden von der mörderischen Kraft des Sturmes. Sie beobachtete, wie der Mann vor sich hin fluchte und dabei ab und zu die Faust erhob. Er sah ganz schön snobistisch aus mit dem granitfarbenen Daunenparka, dessen Kapuze einen Fellrand hatte, und wie er ihn offen trug. Offen! Darum konnte Oma Minna den schwarzen Anzug und die weinrote Krawatte erkennen. Vermutlich stellte er gerade den Plan auf, den Erfinder der Regenschirme mithilfe seines Anwalts zur Rechenschaft zu ziehen.
Oma Minna fühlte sich jedenfalls sehr gut unterhalten von diesem komischen Vogel. Sie dachte an ihre Urenkelin Amalie, mit der sie dieses Ereignis gern gemeinsam erlebt hätte, denn zu erzählen war das nicht. Man musste es mit eigenen Augen gesehen haben!
Doch ihre Urenkelin hielt sich noch immer im Café Minna auf. Sie ahnte, dass Amalie verrückt genug war, sich wieder die ganze Nacht mit dem Geschäft um die Ohren zu schlagen.
Amalie hatte eine Devise: Von nichts kommt nichts!
Sie war nicht der Mensch, der sich nach zehnstündiger Bedienung auf alle vier Buchstaben setzte, um dann vor der Flimmerkiste einzuschlafen. Sie erledigte jede ihrer Aufgaben aufs Gewissenhafteste. Wenn sie es nicht tat, konnte sie des Nachts kein Auge zubekommen und wälzte sich mit tobenden Gedanken im Bett herum.
Nach der regulären Arbeitszeit übernahm sie obendrein auch noch den Job der Putzfrau. Denn als Amalie den Laden übernommen hatte, kündigte die Putzkraft ihre Stelle mit sofortiger Wirkung. Es war ihr nicht entgangen, dass sich der Grund der Kündigung auf Amalie bezog. Schuldig hatte sie sich deshalb jedoch nicht gefühlt. Warum sollte sie sich auch dafür verantwortlich fühlen, wenn irgendwem ihre Nase nicht gefiel? Abgesehen davon wäre es ohnehin schwierig geworden, die Putzkraft langfristig weiter zu beschäftigen. Aus diesem Grund hatte Amalie erst gar nicht nach einer Nachfolgerin Ausschau gehalten. Es war auch schon so schwer genug, mit den Einnahmen über die Runden zu kommen. Da kam ihr das großzügige Trinkgeld der Gäste sehr gelegen, die im gewissen Maße genauso um die Existenz bangten wie die Inhaber selbst, und um Amalie wussten, die ihre junge, wertvolle Zeit zu Tag und zu Nacht für das Café opferte.
Amalie war in dem Dorf aufgewachsen. Für viele junge Menschen war das Leben im Örtchen eine Tortur, denn ungefähr hier wuchs der Pfeffer! Doch Amalie liebte ihre Heimat sehr und ließ nichts darauf kommen. Zugegeben, nachdem sie ihr Abitur abgeschlossen hatte, hatte sie nicht lange überlegen müssen, für ein Psychologiestudium dauerhaft nach Augsburg zu gehen, aber auch nur, weil es schon immer ihr Traum gewesen war, Psychologin zu werden. Allerdings hatten die Dorfbewohner keine Rücksicht darauf genommen, wenn sie sich für den allerneuesten Klatsch und Tratsch am Gartenzaun trafen, schließlich hatten auch schon zwei Generationen vor ihr Oma Minna hängen gelassen. Dabei war doch abzusehen, dass die Alte das Café nicht mehr lange weiterführen hätte können. Sie war für ihr hohes Alter zwar noch recht gut zu Fuß und war durchaus Arbeit gewohnt, doch inzwischen war sie achtundachtzig Jahre alt. Irgendwann musste jeder einmal zur Ruhe kommen.
Dann, vor drei Jahren, hatte das Schicksal hart zugeschlagen: Amalies Eltern und Oma Minnas Gatte Theo waren im Familienkombi auf dem Weg in die nächstgrößere Stadt gewesen, um auf dem Flohmarkt einige Gegenstände aus dessen Haushaltsständen zu verkaufen. Oma Minna war nur zu Hause geblieben, weil ihr Kreislauf sie gänzlich im Stich gelassen hatte. Es war der erste warme, sonnige Tag im Frühling gewesen, als ein entgegenkommender Lkw in einer schwierigen Kurve auf der Bundesstraße ins Schleudern geraten war. Dieser war direkt in den Kombi gerauscht, hatte ihn von der Fahrbahn direkt gegen eine alte Eiche gedrückt und wie ein Akkordion zusammengefaltet. Während der Lkw-Fahrer mit ein paar Prellungen und Schrammen locker davon gekommen war, konnte man Amalies Eltern und Opa Theo nur noch tot bergen.
Zu jener Zeit hatte Amalie schon drei glückliche Semester in Augsburg verbracht, als sie die Nachricht vom Tod der Eltern und dem Urgroßvater erreicht hatte. Anfangs hatte sie nur eine Unterbrechung ihres Studiums geplant, um in ihre Heimat zurückzukehren und Oma Minna im Café zu unterstützen.
Nun ja, Amalie war sich heute bewusst, dass sie das Ereignis verarbeiten und das Studium fortsetzen hätte können, doch sie bereute die Entscheidung nicht, es schon nach einem halben Jahr endgültig an den Nagel gehängt zu haben. Oma Minna hatte zwar noch versucht, sie davon abzuhalten, ihre Zukunft so unüberlegt wegzuwerfen, doch diese Entscheidung war unverrückbar gefallen. Denn was sie nicht wusste, war, dass Amalie sehr wohl darüber nachgedacht hatte, so eindringlich, wie sie es noch nie zuvor tun musste. Es war nicht nur der Schmerz, der ihr Herz zu zerreißen drohte, es war auch ihre Uroma, die sie nicht allein lassen konnte ... wollte. Das erste Mal in ihrem Leben war ihr klar geworden, wie wichtig ihr der Familienbetrieb war.
»Seelenklempner gibt es wie Sand am Meer, aber nicht das Minna, Omili«, hatte sie damals erklärt. Auf einmal wusste sie, was wirklich zählte.
2
Verzweifelt hämmerte der junge Mann gegen die Glastür des Cafés. Er ignorierte das abgeschmirgelte Holzschild, auf dem in großen, breiten Lettern stand: »Geschlossen«. Denn im Innern brannte noch Licht, woraus er schlussfolgerte, dass sich dort noch jemand aufhalten musste. Er versuchte sein Glück einfach.
Amalie hastete an die Tür, im Glauben, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Ihre Gesichtsmuskeln verhärteten sich, als sie erkannte, dass sie durch einen Fremden gestört wurde. Da keine Axt in seinem Schädel steckte und weit und breit kein anderer Schaden erkennbar war, ging sie stark davon aus, dass er wohlauf war und sich bestimmt nur einen nächtlichen Kaffee zum Aufwärmen erhoffte. Frechheit!
Genervt drehte sie alle vier Schlösser auf, um die Tür zu öffnen. Erst hierbei nahm sie den Schneesturm zur Kenntnis, denn sie hatte seit einer geschlagenen Stunde im Hinterzimmer gesessen und war gerade erst mit den Abrechnungen fertig geworden. Ihr Körper krampfte bei der Kälte. Sie zog den Kragen ihres dicken roten Rollkragenpullovers bis zur Nase hoch.
»Sagen Sie mal, spinnen Sie? Können Sie denn nicht lesen? Geschlossen! Sind Sie immer so ignorant?«, polterte sie los.
»Es tut mir wirklich leid«, hetzte der Mann. »Wenn Sie mich kurz hineinlassen, werde ich all Ihre Fragen auch sofort beantworten.«
Amalie zog eine Augenbraue hoch. »Genauso sehe ich aus, was?« Er machte nicht den Eindruck, als wolle er ihr etwas anhaben, andererseits sah sie den Leuten ja nicht an der Nase an, ob sie gut oder schlecht waren. Und nicht nur zu dieser Uhrzeit, sondern auch zur Weihnachtszeit war sie stets besonders vorsichtig.
Genau diese Skepsis las er ihrem Blick ab. »Ich heiße Gustav von Gröben«, stellte er sich vor und reichte ihr verträglich die Hand. Und dann lachte er ein wenig arrogant: »Ich besitze genügend eigenes Geld!«
Doch das Einzige, was weiterhin in ihren Ohren nachklang, war sein Name. »Gustav?« Während sie ihre Hand zögernd in seine schob, begutachtete sie ihn spöttisch von oben bis unten.
»Ja, Gustav! Haben Sie etwa irgendetwas daran auszusetzen?« Natürlich war es babyleicht zu erraten, worauf Amalie hinaus wollte.
Das Flehen in seinen Augen hatte sie, nach dem nur kurzen Anflug von Hysterie, zum Nachgeben bewegt. Mit einem Armschwenk bat sie ihn hinein. Und während sie ihn zur Theke führte, um dort auf einem der Barhocker Platz zu nehmen, erklärte sie: »Ich habe eben mit einem Namen wie Finn oder Tim gerechnet. Aber Gustav? Sind Sie nicht etwas zu jung dafür?«
Vor diesem Schrank von einem Mann wirkte sie wie ein kleines Mädchen, obgleich das nicht nur auf seine stattliche Körpergröße zurückzuführen war. Sie selbst maß gerade einmal bescheidene eins zweiundsechzig und war dabei wirklich zart gebaut. Wenn er jetzt also doch vorhatte, sie zu überfallen, wäre sie dem Drama gänzlich ausgeliefert.
»Also, entschuldigen Sie mal bitte! Ich konnte mir den Namen ja bei meiner Geburt nicht aussuchen«, verteidigte er sich.
Amalie registrierte nur allzu spät, wie unsensibel sie sich dem Fremden gegenüber verhielt. Und das auch noch als Cafébetreiberin, die den Umgang mit Menschen eigentlich gewohnt sein musste.
»Entschuldigen Sie, Herr von Gröben. Ich war nur ein bisschen ... perplex.«
Gustav war erleichtert. Er befürchtete nämlich schon, Amalie würde ihn zum Standesamt zerren, um eine Namensänderung vornehmen zu lassen.
»Ich bin Amalie. - Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin mit dem Auto liegen geblieben.« Die Verzweiflung stand ihm im Gesicht; obwohl Amalies Verhalten das viel größere Übel darstellte für ihn. Eigentlich hatte er mit etwas mehr Gastfreundlichkeit gerechnet. »Um nicht zu sagen, dass ich durch den starken Schneefall leider die Straße nicht mehr erkennen konnte und den Wagen dann versehentlich in einen Graben gelenkt habe.«
»Und nun?« Heute schien sie besonders auf Krawall gebürstet zu sein.
»Was, und nun? Es gibt in diesem Kaff kein Hotel; nicht einmal eine klitzekleine Pension! Ich brauche Hilfe«, stellte er sich innerlich schon darauf ein, dass er auch noch einen Kniefall vor ihr machen musste.
Doch so weit wollte sie es nicht kommen lassen und zerbrach sich dem äußeren Anschein nach den Kopf. Sie knabberte etwas hilflos auf ihrer Unterlippe herum, während ihr Blick wild durch den Raum flog. Sie stellte die eine Hand an die Hüfte und rieb sich mit der anderen die quietschroten Haare am Hinterkopf kraus. Gustav war leicht irritiert, denn er hatte nicht vermutet, dass es einem Menschen so große Schwierigkeiten bereitete, etwas Beherztheit zu zeigen. Er wusste ja nicht, dass das Amalies Art war, nach einer Lösung zu suchen. Doch es war ihm auch nicht zu verdenken, dass er ihr nach allem eher zutraute, ihn viel lieber mit einer Heugabel aus dem Café jagen zu wollen.
»Okay! Was immer mich auch geritten hat: Sie können im Hinterzimmer auf dem Sofa schlafen. Und morgen kümmern wir uns dann um Ihr Auto.«
Mit einem Fingerzeig brachte sie ihn in das kleine Hinterzimmer. Akten und Papiere lagen auf dem Schreibtisch verstreut und pflasterten zusätzlich den Boden. Er wankte auf Zehenspitzen über die freien Stellen des Bodens, bis er sich irgendwie und unbeschadet zu dem Sofa durchgekämpft hatte.
»Ich denke nicht, dass wir heute noch irgendetwas erreichen. Nachher hat der Pannendienst auch noch eine Panne. Das wollen wir ja nicht, oder?«
Gustav war kaum imstande, so schnell zu denken wie Amalie redete und zugleich handelte. Sie suchte ein Kopfkissen und eine Bettdecke aus einer großen Holztruhe heraus. Offenbar hatte sie auch schon so einige Nächte auf diesem Sofa verbracht.
Er fuhr sich mit den Händen übers Gesicht, wirkte ein wenig zerknautscht. Er musste ebenso lange auf den Beinen gewesen sein wie sie.
»Sehen Sie hier eigentlich noch durch?«, fragte er, nachdem er sich wieder gesammelt hatte.
»Klar doch! Ich habe meine eigene Ordnung.«
Sie war im Begriff, den Boden freizuräumen, als er sie aufhielt. »Bitte machen Sie sich nicht die ganze Mühe. Ich benötige ausschließlich das Sofa.« Sie starrte ihn nur verwundert an. »Ich habe damit wirklich keine Probleme, auch wenn ich so aussehe.«
Sie nickte kurz. »Meinetwegen! Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich nebenan im Café noch etwas Ordnung schaffe?«
»Selbstverständlich nicht!« Er war außer sich, dass sie jetzt auch noch auf ihn Rücksicht nehmen wollte, obwohl er sie offensichtlich aufgehalten hatte. »Aber brauchen Sie nicht auch etwas Schlaf?«, war er erstaunt.
»Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Morgen haben wir geschlossen. Da habe ich dann noch genug Zeit, um mich auszuruhen.« Sie ging zur Tür zurück, um ihn allein zu lassen. Doch ehe sie sie hinter sich schloss, fragte sie: »Kann ich Ihnen noch etwas Gutes tun?«
Er hatte sich auf dem Sofa niedergelassen und seine Hände unsicher in den Schoß gelegt. Ihm wollte nichts einfallen.
»Etwas zum Trinken?« Sie runzelte die Stirn, als er mit einem Kopfschütteln ablehnte. Vielmehr gab ihr zu denken, dass ihn scheinbar niemand vermisste und er niemanden informieren wollte. Daher wies sie ihn darauf hin: »Ein Telefon?«
Gustav wirkte keineswegs alarmiert. »Nein, danke!«, erwiderte er nur.
3
Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch einmal belästige!« Vor Schreck ließ Amalie den Mopp fallen und wirbelte aufgeregt herum. Sie hatte gerade den Boden im Eingangsbereich gewischt.
Sie fasste sich an die Brust. »Herrgott! Was ist los?«
Er lächelte kleinlaut: »Ich bekomme kein Auge zu! Könnte ich Ihnen nicht Gesellschaft leisten oder Ihnen ein wenig zur Hand gehen?« Er hatte sich von ihr abgestellt gefühlt und hatte schon eine halbe Stunde lang unschlüssig auf dem Sofa gesessen, bis er sich überwinden konnte, an sie heranzutreten.
»Ich ... ähm!« Sie blickte nach links und rechts und musste feststellen, dass es nichts mehr zu tun gab. Jedenfalls nichts, wobei er ihr helfen konnte. »Bin so weit, so gut fertig. Aber wir können gern noch etwas zusammen trinken!?«
Auf einmal war Amalie ganz nett zu dem fremden Mann. Was war passiert?
Sie musste sich eingestehen, dass er auf dem zweiten Blick ein viel sympathischeren Eindruck machte. Ihr gefiel seine Menschlichkeit, die sie ihm auf dem ersten Blick nicht zugetraut hatte. Er war ihr zunächst wie ein verwöhntes Muttersöhnchen vorgekommen, vielleicht auch wie ein Idealist mit einer gewissen Realitätsferne, der seine Mitmenschen schikanierte und sich Freunde kaufte.
Den granitfarbenen Daunenparka und das Jackett hatte er indessen abgelegt und im Hinterzimmer auf dem Sofa liegen gelassen. Die weinrote Krawatte hatte er weit gelockert, die ersten beiden Knöpfe des Hemdes geöffnet und die Ärmel bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt. Das dunkle, kurze Haar, das zuvor mit ausreichend viel Haargel nach hinten gekämmt war, war nun recht leger aufgewirbelt.
Er erkannte an ihren Augen, dass sie ihn von oben bis unten inspizierte. Er fand es auch gar nicht unangenehm, denn er wusste sehr wohl, wie er auf andere wirkte. Und dann waren sie zumeist (so, wie auch aktuell Amalie) recht überrascht, dass er nicht der Spießer war, der er in seinem steifen Anzug zu sein schien.
Er nahm ihren Vorschlag dankend entgegen. »Ich fürchte, ich brauche etwas Stärkeres für die Nerven.«
Während sie hinter die Theke ging, um sich für ein Getränk zur Verfügung zu stellen, fragte sie schmunzelnd: »Wegen mir? Oder wegen des Unfalls?« Dann wandte sie sich um und ging in die Knie, um eine Flasche Whisky herauszuholen. »Genügen Ihnen in etwa diese Umdrehungen?«
Er begrüßte den Whisky mit einem Kopfnicken.
Dann seufzte er: »Ich verstehe gar nicht, wo plötzlich dieser Schneesturm herkam!« Er richtete seinen Blick leicht beängstigt hinaus. Er befürchtete, dass sein Auto bis morgen ganz und gar von Schnee bedeckt sein und er es nicht mehr wiederfinden würde, obwohl der Sturm sich langsam legte und die Schneeflocken begannen, ausgewogen zu Boden zu segeln.
Nachdem sie ihm den Alkohol eingeschenkt hatte, ließ sich Amalie auf einen der Barhocker vor der Theke nieder und legte ihre Hände auf der Holzplatte ab. Sie fühlte sich erschöpft, doch das ließ sie nicht erkennen. Sie mochte es nicht, wenn sie jemand für schwach hielt. So nahm sie nebenbei den Putzlappen auf, der einsam auf der Theke lag, und ballte ihn in ihrer Rechten, als müsste sie ewige Arbeitsbereitschaft demonstrieren oder sich einfach an irgendetwas Vertrautem festhalten.
Na ja, sie saß nach wie vor einem fremden Mann zur Seite, der, zugegeben, von Minute zu Minute attraktiver auf sie wirkte (auch ganz ohne Alkohol), und trotzdem nicht wusste, über was sie sich mit ihm unterhalten sollte. Bisher hatte sie lediglich die vergrämte Gastgeberin gegeben, was ihr selbst gar nicht gefiel, da Gustav sich viel galanter zeigte.
Er nahm das Whiskyglas zur Hand, roch daran und nahm einen großzügigen Schluck daraus. Er schüttelte sich. »Scheiße!« Seine Augen wurden feucht. Er lachte: »Ich trinke selten so was Hartes.«
»Wieso sagen Sie das denn nicht gleich? Ich habe auch Wein da.« Sie war im Begriff, erneut hinter die Theke zu eilen, als er seine Hand auf ihren Arm legte.
»Nein, lassen Sie es gut sein. Ich sagte, ich brauche etwas für die Nerven und nicht, dass ich mich betrinken will.« Sein Lächeln war sanft. Beinahe so, als wolle er sie schonen.
Sie fixierte sein Gesicht. Es hatte wunderbar markante Züge. Besonders das breite, stoppelige Kinn mit dem Grübchen fiel ihr sofort ins Auge. Und dann blickte sie in seine klaren grünen Augen. Der Blick scheute ihren nicht. Es war, als würden diese Augen tief in ihre Seele eindringen.
Innere Panik ergriff sie. Sie musste seinem Blick weichen. So geht das nicht! Sie drehte ihren Kopf verstört weg. »Nun gut! Wie kommt es, dass niemand Sie vermisst?«
Er versuchte, ihr zu folgen. Erfolglos. »Bitte?«
»Sie haben das Telefon abgelehnt. Erwartet Sie denn niemand daheim?«
Dann lachte er etwas überfordert, wie sie fand. Er winkte ab: »Nicht diese Nacht.«
Sie spürte, dass er ungern darüber sprechen wollte. Deshalb wechselte sie geflissentlich das Thema. Sie wollte sich nicht in die Nesseln setzen. »Und? Was machen Sie so beruflich?«Die Frage musste ja früher oder später kommen, wenn man ihn im Anzug kennen lernte. Doch er verstand es, sich in dieser Hinsicht gelassen zu geben. »Ich bin Architekt.«
»Architekt«, wiederholte sie nachdenklich. Irgendwie konnte sie damit nichts anfangen. Vielleicht, weil es ihr wenig produktiv erschien. Und vielleicht auch, weil es offenbar in einem solchen Leben unentwegt um Geld ging. Eigentlich sogar mehr ums Geld als um die Arbeit. »Und das sind Sie so richtig mit Leib und Seele, ja?« Das klang ziemlich provokant.
Er verstand nicht, warum sie dieser Beruf so anstieß! »Na ja, offen gesagt ...« Er unterbrach sich. Sollte er mit dieser fremden Frau wirklich derart private Details teilen? Irgendwie kam ihm der heutige Abend rätselhaft vor. War es ein Zeichen? Sollte dieser ihm irgendetwas Wichtiges mitteilen? Gut, es konnte auch sein, dass er sich abermals verrückt machte. Doch warum hatte er das Bedürfnis, mit der Fremden, die so gar nicht in das Leben, was er führte, passte, darüber zu reden?
»Warum drücken Sie plötzlich auf die Bremse?«
»Na, weil ich gerade feststellen musste, dass ich Sie gar nicht kenne, und es ist ganz schön eigenartig, dass Sie mir das Gefühl geben, als wären wir alte Freunde. Ist das nicht absurd?«
Ja, das war es, wenn sie bedachte, dass keine Frau nur ein Kumpel für dieses Bildnis von einem Mann sein konnte. Ein solcher Mann war nicht dafür gemacht.
»Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie unhöflich ich eben noch zu Ihnen war.« Sie grinste kess.
Er nahm ihr die Reaktion seiner Ankunft nicht mehr übel. Ehrlich gesagt war es ihm sogar schon wieder entfallen. Es hatte kein Gewicht mehr, nachdem sie nun so gesellig war. Außerdem bemerkte er durchaus, dass sie ihn sympathisch fand und es ihr gar Vergnügen bereitete, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Er sah es daran, dass sie schon längst ins Bett hätte gehen können, da sich doch die Müdigkeit so augenfällig in ihren Zügen abzeichnete, sich jedoch entschieden hatte, ihm Gesellschaft zu leisten.
»Okay!« Er traute seinem Bauchgefühl, sich Amalie gegenüber offen äußern zu können. »Eigentlich hat mich mein Vater als Teilhaber eingetragen. Ich habe nicht einmal Architektur studiert, so wie mein Vater. Ich bin damit aufgewachsen, wurde von ihm gelehrt, besitze also all das nötige Wissen, um das Unternehmen voranzutreiben, aber das Werk hat mein Vater vollbracht.«
Ihr schwante, worauf Gustav hinaus wollte. »Lassen Sie mich raten: Und eigentlich sind Sie in dieser Stellung total unglücklich und Sie träumen von etwas ganz anderem?«
Er war etwas verunsichert, zugleich bewunderte er ihre Menschenkenntnis. Doch was hatte er von jemandem erwartet, der in einem lokalen Gewerbe tätig und tagtäglich mit vielen verschiedenen Charakteren konfrontiert war?
»Was hat mich verraten?«
»Dass Sie sich so außen vor lassen. Nun gut, und das Wort ›eigentlich‹ finde ich außerdem sehr fehl am Platze, wenn man im Grunde seines Herzen glücklich ist.«
Er nickte bestätigend. »Ich mache meine Arbeit pflicht- und verantwortungsbewusst. Ich werde dafür bezahlt, dass ich meine Arbeit gut mache. Aber genau genommen habe ich mich immer schon für Autos interessiert. Ich wollte meinen Vater lediglich nicht enttäuschen.«
»Dafür haben Sie aber genug Geld, um so«, sie wies mit der Hand auf sein Erscheinungsbild hin, »herumlaufen und kleine Cafébetreiberinnen beeindrucken zu können.« Sie zwinkerte ihm neckisch zu. Dabei wollte sie gar nicht flirten.
Er lachte kurz. »Ich bin mir durchaus klar darüber, dass mich viele für einen Angeber halten. Aber nachdem Sie mich ja nun kennen gelernt haben, denken Sie das doch nicht wirklich immer noch, oder?« Er war weder darauf bedacht, gut anzukommen noch war er überheblich; er wusste nur, dass er nicht der war, für den er gehalten wurde.
Sie hob die Schultern unbeeindruckt. »Im Moment können Sie noch alles sein!« Menschenkenntnis hin oder her! Die half ihr nicht weiter, wenn sie einem Mann begegnete, der ihr gefiel. Und überhaupt, fand sie, hatten Männer ein Talent dafür, sich als bestmöglichen Traummann zu verkaufen, solange die Beute nicht im Sack war. Und aus irgendeinem Grund glaubte sie, dass Gustav zu dieser Sorte Mann gehörte, der ganz genau wusste, wie er auf Frauen wirkte. Sie wollte ihm nicht unterstellen, dass er es für sich ausnutzte, doch sie nahm an, dass er all die Bewunderungen insgeheim genoss und sich für nur eine Frau zu schade hielt.
Dachte sie das ernsthaft?
»Ich verstehe.« Er grinste spitzbübisch. »Ich habe auch irgendwann einmal gehört, dass Frauen mit roten Haaren im 15. und 16. Jahrhundert auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.«
Sie lachte: »Diese Farbe ist aber gekauft.«
»Gott sei Dank! Sonst hätte Ihr Vater bei Ihrer Geburt annehmen müssen, er wurde mit Pumuckl betrogen.«
Sie verschränkte die Arme ineinander: »Wollen Sie mir also sagen, ich gefalle Ihnen nicht?«
Er räusperte sich. Er wusste, dass sie gerade nur miteinander scherzten, doch ihm war daran gelegen, sie wissen zu lassen, wie ernst er seine Antwort meinte. »Sie gefallen mir sogar sehr!« Sein Blick war leidenschaftlich. Das gruselte Amalie ein wenig.
Was passierte hier eigentlich gerade? Sie hatte es zuvor für ein Ammenmärchen gehalten, wenn jemand ihr von der Liebe auf den ersten Blick erzählt hatte, doch nun war sie selbst drauf und dran, sich in einen Fremden zu verknallen, der ihr binnen einer einzigen Stunde vertraut war. Und dabei verstand sie nicht einmal, was ihr an ihm so gefiel. Sie hielt sich nicht in der Position, es überhaupt beurteilen zu können, denn musste man einen Menschen nicht erst dafür kennen? Oder war sie auf einmal unter die Oberflächenkratzer gegangen? Immerhin hatte sie sich ja selbst dabei ertappt, dass seine übergroße Attraktivität sie nicht losließ.
Nein!
Ganz bestimmt hatte Amalie etwas anderes überzeugt. Oder? Oder???
Sie wollte aber nicht überzeugt sein!
Über diese Feststellung war sie derart schockiert, dass sie vom Hocker sprang und so tat, als wäre sie schlagartig müde geworden, zu müde, um das Gespräch weiterzuführen. Dabei hätte sie gerade nichts sehnlicher getan. Sie hatte nur vor der Entwicklung Angst. Was würde nach einer weiteren Stunde passieren? Würde sie ihm einen Heiratsantrag machen?
»Verzeihen Sie, morgen steht eine Hochzeit an. Ich muss dafür möglichst ausgeruht sein, sonst stehe ich das nervlich nicht durch«, verkündete sie scheinheilig, wenngleich der Inhalt der Wahrheit entsprach.
Er sah verdutzt aus. Da es ihm vorkam, als hätte sie mitten im Gespräch abgebrochen, fragte er besorgt: »Habe ich irgendetwas Falsches gesagt?«
»O nein!«
»Doch, das habe ich! Sie sind auf einmal so ablehnend.« Er sah sogar ernsthaft enttäuscht aus.
»Es ist nur ...« Nun trat sie auf die Bremse, so dass er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte.
»Na, sagen Sie schon!«
Sie setzte sich wieder, wandte sich ihm verlegen zu. »Jetzt halten Sie mich bestimmt für eine unentschlossene, anstrengende Zicke, was?«
Das empfand er nicht so. Was hatte sie schon derart Entsetzliches getan? Sie war nur unsicher, das war alles. Trotzdem antwortete er in der Art eines Scherzes: »Einen klitzekleinen Knall scheinen Sie wohl zu haben, ja.« Wie klitzeklein ihr Knall war, zeigte er mit Daumen und Zeigefinger und lächelte sein charmantestes Lächeln.
Sie stöhnte innerlich und dachte: Und schöne Zähne hat er auch noch! So perfekt konnte doch keiner sein! Sie suchte nach irgendeinem Fehler. Und sei es nur eine winzige Narbe. Doch sie vermutete, dass selbst eine solche liebenswert an ihm ausgesehen hätte.
»Sie wissen doch: Menschen ohne Macke sind Kacke!«
Auf dieses Stichwort hin begutachtete er sie. Nachdem sie es ja schon mit ihm getan hatte, konnte sie ja nichts dagegen haben.
Auch wenn quietschrotes Haar völlig gegen die Natur war, war es, als ob sie zu ihr gehörten wie die vollen, sinnlichen Lippen. Er fragte sich, ob sie sich weich anfühlten, wenn man sie küsste? Sie hatte hohe Wangenknochen und ein spitzes Kinn. Und die Augen strahlten blau und sanftmütig durch die Brille hindurch. Es war eine schwarze Vollrandbrille. Nur der innere Rand war leicht rosafarben. Die Form erinnerte an die Sechziger Jahre. Sie verlief nach oben hin spitz. Sowieso strahlte sie eine angenehme Ruhe aus. Sie war jemand, bei dem man sich gut aufgehoben fühlte. Wenn er sie also genauer betrachtete, war sie gar nicht so mädchenhaft, wie er es zuvor durch die kleine, zierliche Gestalt empfunden hatte. Ihre Züge waren sehr feminin.
Und wie alt mochte sie sein? Vierundzwanzig? Fünfundzwanzig? Sie wirkte sehr abgeklärt und reif. Er kannte solche Menschen. Sie waren in diesem Alter nur dann so kontrolliert und selbstständig, wenn sie es sein mussten. Ihm wurde klar, dass er mehr über Amalie erfahren wollte.
Er blickte sich im Café um. Auf den Tischen standen rote Weihnachtssterne in weißen Übertöpfen auf grünen Tischdecken und auf der Theke stand ein Adventsgesteck, in dessen Mitte eine dicke, goldene Kerze steckte, die zu einem Drittel heruntergebrannt war. Die Fenster zierten Bilder verschiedener Motive, die mittels Schablonen mit Schneespray angebracht waren. Neben der Eingangstür stand ein kleiner Nadelbaum auf einem kniehohen Podest. Er war schlicht behangen, mit einer Sternenlichterkette und rotweiß gestreiften Christbaumkugeln. Sie erinnerten an Zuckerstangen. Und ein brauner Holzschlitten mit einem Weihnachtsmann zierte die Baumkrone. Und all das in Miniaturgröße.
Es war nicht viel, doch es fühlte sich besinnlich an. Vielleicht lag es ja an dem Café selbst, denn mit seinem Mobiliar aus Ebenholz und der Holzvertäfelung mit der gemusterten Vintagetapete hatte es einen antiken Charme und sandte eine gemütliche Atmosphäre aus.
»Wie verbringen Sie die Weihnachtstage?«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete Amalie unbeschwert. Wie konnte man so etwas nicht wissen? War es nicht klar, dass man solche Tage mit der Familie feierte?
»Es sind bis dahin ja auch noch zweieinhalb Wochen.« Er beschloss, von sich zu reden, wenn sie schon nichts über sich zu erzählen wusste. »Mich erwartet ein riesiges Festmahl. Ich hasse es, zumindest auf diese Weise, weil es immer so protzig ausgestattet wird. Die Stimmung wirkt erzwungen. Na ja, Sie können sich das ungefähr vorstellen.«
Sie nickte. »So läuft das unter den ganzen reichen Schnöseln.«
»Kennen Sie denn so viele?«, stänkerte er.
»Ein paar. Aber die meisten kennt man ja aus dem Fernsehen.« Sie grinste. Sie nahm an, dass er sie für anmaßend hielt. »Sie finden mich zu voreingenommen, nicht wahr? Aber wenn man nicht will, dass Menschen voreingenommen sind, warum lebt man dann so sehr gegen den Strom? Das ist doch vielmehr provokant!«
Er musste lachen, wusste allerdings noch nicht, worüber mehr: Darüber, dass sie sich zu rechtfertigen versuchte, ohne dass er etwas in dieser Richtung kritisiert hatte, oder darüber, dass sie nicht bemerkte, dass sie die Dinge nur schönredete!
»Sie meinen also, dass ich mit meiner Erscheinung und mit meinem Bankkonto gegen den Strom schwimme?«
Sie war etwas beschämt. Sie stand zu ihrer Meinung, doch sie spürte, dass er sich persönlich diskriminiert fühlte. »Nein, auf Sie trifft das irgendwie nicht zu. Obwohl Sie auf den ersten Blick nicht gerade der Sympathischste sind. Vermutlich liegt es auch nur an mir.«
»Gewiss! Denn in den Kreisen, in denen ich sonst so verkehre, legt man nicht nur Wert auf das, was Sie an mir kritisieren, sie verlangen es sogar von mir ab. Und damit Sie mich nicht wieder falsch verstehen: Nein, ich habe überhaupt kein Problem mit Ihnen, sondern Sie mit mir!«
Es ärgerte sie, dass er recht hatte. Es war sie gewesen, die ihn aufgrund seiner bloßen Erscheinung verurteilt hatte.
Sie ließ sich nichts anmerken. »Das klingt ganz danach, als hätten Sie es gern schlichter?«
Er grübelte. »Es widert mich nicht direkt an, aber Ihre Welt ist zum Beispiel viel ehrlicher und natürlicher. Es macht es deshalb einfacher.«
»Einfacher? Wenn ich da so an meine Probleme denke ...«
»Aber die Probleme sind echt, verstehen Sie? In dieser snobistischen Gesellschaft ist ein echtes Problem schon, wenn der Kaviar ausgeht.« Zugleich wollte ihm nicht in den Kopf, dass Amalie Probleme hatte. Sie wirkte gar nicht wie jemand, der es schwierig hatte. »Nennen Sie mir ein Problem, das Sie quält.«
Sie war sich gar nicht bewusst darüber, dass er durch ihre Äußerung davon ausging, dass es sie quälte. »Na ja ... also ...« Sollte sie es wagen? Warum eigentlich nicht? Gustav fiel die Offenheit ja auch nicht schwer. »Das Geschäft läuft nicht so gut. Wir leben am Existenzminimum. Aber ich möchte es nicht aufgeben, weil es seit fast siebzig Jahren existiert.«
»Ist es ein Familienunternehmen?«
Sie nickte bedrückt.
»Natürlich ist es das!« Warum sonst sollte jemand freiwillig am Existenzminimum leben? »Und wenn ich Ihnen helfe?«
»Wobei?«, war sie beunruhigt.
»Ich könnte Ihnen finanziell etwas ...«
»Das kommt gar nicht in die Tüte!«, erhob sie die Stimme. Sie war empört. Sie wäre es bei jedem gewesen. Doch bei ihm war sie es besonders.
Mit dieser Reaktion musste er ja rechnen. »Aber jetzt, da ich das Café und die dazugehörige Betreiberin kenne, möchte ich nicht, dass es pleite geht.«
»Wissen Sie, Ihr Geld wird daran nichts ändern. Sie haben wirklich keine Ahnung, worum es hier geht.« Dachte er, man konnte im Leben alles mit Geld regeln? Selbstverständlich denkt er das; das denken nämlich alle Geldleute!
»Dann erklären Sie es mir eben, anstatt mich so derb anzugehen!« Er sagte es absichtlich geschwollen.
Sie blickte kurz zu Boden, dann wieder zu ihm auf. »Ich hätte damit nicht anfangen sollen. Entschuldigen Sie, das ist unfair!«
Er schüttelte den Kopf: »Das muss Ihnen nicht leidtun. Ich möchte es aber verstehen. Also erzählen Sie schon, Amalie.«
»Nun gut.« Sie atmete tief durch, um sich zu besinnen. »Es geht mir um das Café und nicht darum, dass ich am Existenzminimum lebe. Mithilfe Ihres Geldes kann es natürlich fortbestehen, aber was habe ich davon, wenn niemand das Bedürfnis hat, hierher zu kommen?«