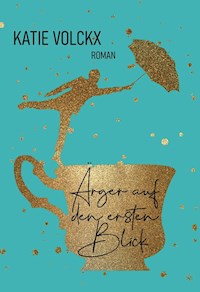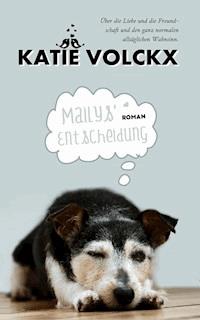Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Jahr könnten für Leonie die heiligen Tage vor Weihnachten nicht durchgeknallter laufen: Streit mit der besten Freundin, eine Ehekrise, die nicht einmal ihre ist, ein Einbrecher, der offenbar kein bisschen an ihren Habseligkeiten interessiert ist und die mühselige Beziehung mit ihrem nichtsnutzigen Auserwählten. Da bleibt nur zu hoffen, dass es schlimmer nicht mehr wird und Leonie auf ihrem Marsch durch den Irrgarten nicht die Orientierung verliert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Samstag, 13. Dezember
»Hände hoch!«, hörte ich eine tiefe, bedrohliche Stimme hinter mir brummen, daraufhin das Ratschen einer Schusswaffe und ein schweres, ungeduldiges Ein- und Ausatmen.
Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Hände hoch? Vor Schreck riss ich meine Augen auf und erstarrte stehenden Fußes. Ich wagte nicht, mich umzudrehen und hoffte inständig, dass das nur ein geschmackloser (sehr geschmackloser) Scherz oder ein grauenhafter (sehr grauenhafter) Traum war.
»Hände hoch, hab ich gesagt!«, wiederholte der Mann schon wesentlich aggressiver, weil ich mich aus seiner Warte scheinbar weigerte.
Ich tat, was er sagte, sofern ich dazu noch in der Lage war. Denn mein ganzer Körper war inzwischen derart verkrampft, dass meine Motorik nicht mehr die beste war. Mein Atem stand still.
»Das Messer weg!«
Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass ich es noch in der Hand hielt. Ich ließ es einfach auf die Küchenablage fallen. Es klirrte und vibrierte noch eine kleine Weile auf der gefliesten Oberfläche, ehe es endlich Ruhe gab. Gleichzeitig spürte ich eine leichte Wut aufkommen, denn er hatte das auf eine Weise gesagt, als ob ich hier die Kriminelle wäre. Was konnte ich denn bitte schön dafür, dass er mich ausgerechnet bei der Zubereitung meines Salates zum Abendbrot erwischt hatte?
»Nicht umdrehen, verstanden?«
Ich nickte nur wild wie eine Henne. Es kam mir nämlich ganz recht, keine Zeugin seiner äußeren Erscheinung zu werden und somit als potenzielle Leiche zu fungieren, auch wenn sich seine Gestalt in interessanten Grundzügen auf der Glasfläche des Küchenfensters, das direkt vor mir lag, widerspiegelte. Aber ich tat so, als könnte ich diese nicht wahrnehmen.
»Geh zur Abstellkammer!«
Ich hörte ihn sich mir nähern. Dann presste er den harten Lauf der Waffe zwischen meine Schulterblätter und stupste mich dort hin. Ich hätte auch ganz von allein dort hingefunden, aber anscheinend hielt er sich für den einzig Schlauen in diesem Raum. Na schön, oder es ging ihm einfach nicht schnell genug.
Er befahl mir, die Tür zur Abstellkammer zu öffnen. Dann stieß er mich hinein, weshalb ich mit dem Fuß an der Türschwelle hängenblieb und gegen einen Vorratsschrank knallte. Es schepperte und wackelte einmal kräftig. Dann hörte ich den Eindringling die Tür hinter mir zuschlagen und wie er einen großen Gegenstand über den leicht verschlissenen Fliesenboden schob, um die Tür zu verbarrikadieren, da die Tür keine montierte Schließeinrichtung hatte, um sie zu verriegeln. Es musste die schwere, massive Uralt-Kommode meiner Oma gewesen sein.
Ich fasste mir an den Mund, um zu prüfen, wie viel Blut ich verlor, da ich mir bei meinem Sturz auf die Lippe gebissen hatte. Doch der Schmerz war wohl größer als der Schaden.
Für einen Gauner, der einem das Gut und Haben unter dem Hintern wegstehlen wollte, verhielt er sich verdächtig still. Ich lauschte nach Geräuschen, um zu ermitteln, in welchem Winkel des Hauses er sich gerade aufhielt und auf welche Gegenstände er es abgesehen hatte. Außerdem musste ich ja wissen, wann er endlich fortging, damit ich mich irgendwie aus der Kammer herauskämpfen konnte, um dann die Polizei zu rufen. Vorausgesetzt, ich würde das ganze Spektakel überleben. Was wusste ich denn schon, wozu er kurzerhand imstande war? In diesem Verbrecherhirn steckte ich ja nicht drin, wenngleich mir diese kriminelle Handlungsweise allgemein vertraut sein sollte. Und doch saß mir die Angst in den Knochen und schüttelte mich leicht, doch beständig durch.
Inzwischen war ich schätzungsweise eine Stunde in dieser Kammer gefangen, hatte mich auf dem Boden niedergelassen, die Beine angewinkelt und den Kopf in die Armbeugen gelegt. Es war ja nicht so, dass ich nicht versucht hätte, hier irgendwie herauszukommen, nachdem der Einbrecher die Haustür ins Schloss geschlagen und sich auf und davon gemacht hatte, aber ich hatte es nicht zustande gebracht. Nicht nur, weil ich zu kraftlos war, auch wagte ich mich einfach nicht vom Fleck. Irgendwie fühlte ich mich in dieser Kammer sicher und wäre sogar bereit gewesen, die gesamte Nacht hier zu verbringen, wenn es hätte sein müssen.
Aber das musste nicht sein!
»Schatz, ich bin wieder zu Hause«, hörte ich Matz, den Nichtsnutz, nämlich endlich rufen. Er knallte die Haustür auf eine Weise zu, dass es mich wütend machte.
Er war so unglaublich rücksichtslos. Und narzisstisch. Sobald er einen Raum betrat, musste er immer sichergehen, dass alle sich darin befindlichen Menschen nach ihm umdrehten und ihn zum Mittelpunkt der Welt machten. Nein, es war nicht nur die Aufmerksamkeit, die er genoss, er wollte förmlich bewundert werden. Wofür? Für alles, was er tat, wenn er denn mal etwas tat! Dafür, dass er den Einkauf erledigte, dafür, dass er den Müll herausbrachte, dafür, dass er beim Essen nicht schmatzte, dafür, dass er immerhin noch am Vormittag aus dem Bett fand oder einfach nur dafür, dass er eigenständig atmete.
»Schatz? Wo bist du denn?« Ich hörte ihn das Erdgeschoss ablaufen. »Leonie?«
Ich atmete tief durch. Ich weiß, in meiner Situation hätte jeder andere bereits um Hilfe gerufen, bevor jemand das Haus betrat, doch bei Matz war ich auch nicht gerade in besseren Händen.
»Hiiier«, rief ich mehr schlecht als recht.
»Leonie?« Ich konnte seiner Sprechweise entnehmen, dass er sich nicht sicher war, ob er richtig gehört hatte.
»Ich bin hiii-hiiier!« Jetzt klang ich nicht nur lustlos, sondern noch dazu genervt.
»Wo ist hier?«
Konnte er nicht einfach meiner Stimme folgen? »In der Vorratskammer, Mann!«
»Bitte wo?« Er traute seinen Ohren nicht.
»In der Scheißkammer!«
Dann kam er endlich in die Küche. Stille!
»Hallo?«, rief ich durch die Tür. »Bist du kollabiert, oder was?«
Eilende Schritte. »Nein ...« Er machte die Kammertür frei. Dabei stöhnte und keuchte er, als wäre der Schrank aus Beton. »Was machst du denn da drin?«
Sobald die Tür aufging, drängte ich mich an ihm vorbei und blieb inmitten der Küche stehen, um den Duft von Freiheit zu inhalieren. Mit der einen Hand stützte ich mich auf dem großen Küchenblock ab, der in der Mitte des Raumes stand, und die andere stemmte ich in die Taille.
»Testen, ob ich an Klaustrophobie leide«, antwortete ich ironisch, während ich ihn völlig verstört von oben bis unten begutachtete. »Was zum Teufel hast du gemacht? Warum bist du so ... bunt?«
»Ach«, winkte er ab, als wäre das nicht der Rede wert, »ich war mit den Jungs nur ein bisschen Paintball spielen.«
Was sonst? Der dreiunddreißigjährige Matz war also spielen gewesen, während ich, seine geliebte Freundin, mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden war.
»Solltest du deinem Vater nicht beim Schmücken des Hauses helfen?« Rainer und Margret, Matz' Eltern, liebten es kitschig. Nicht nur im Innenbereich, auch im Garten und sogar auf dem Haus musste es zu Weihnachten wild blinken und leuchten. Davon, dass es sich beinahe nicht mehr lohnte, wollten sie nichts wissen, denn nichts und niemand sollte darunter leiden, dass die dreimonatige Weltreise, von denen sie ihr Leben lang geträumt hatten, erst vor drei Tagen geendet war.
»Na ja, Papi hat mich ...« Matz runzelte die Stirn. »Egal! Sag mir lieber, was zur Hölle hier los war!« Er zeigte auf den Schrank, den er eben noch mit stählernen Muskeln fortschieben musste, um seine Prinzessin zu retten.
Ich wandte mich von ihm ab. »Ich wurde überfallen.« Mit schnellen Schritten ging ich ins Wohnzimmer, um das Telefon zu nehmen und die 110 zu wählen. Mir fiel nämlich gerade wieder ein, dass ich den Überfall endlich melden sollte.
»Du wurdest was?«
»Hörst du heute schlecht?«
»Leonie, das ist nicht witzig!« Er eilte an meine Seite, um mich zu drücken, was ergenauso gut hätte bleibenlassen können, so schlaff, wie er an mir hing. Man könnte meinen, er wollte sich auf mir abstützen, völlig geschafft vom Kriegspielen. »Sag mir, dass das nicht wahr ist.«
Ich wand mich aus seiner Umklammerung, als sich endlich ein Polizeibeamter am anderen Ende der Leitung meldete. »Hallo, Leonie Pfeiffer hier. Ich wurde vor ... vor ...«, ich blickte auf die Kaminuhr, die in unserem Fall auf einem Sideboard stand, um mir darüber klar zu werden, wie lang ich in dieser Kammer wirklich festgesessen hatte, »vor fünfzig Minuten in meinem Haus überfallen. – Ja, überfallen. – Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, zu überprüfen, was fehlt. – Das wäre nett, ja!« Ich gab meine Adresse durch und legte auf.
Schnurstracks eilte ich ins Obergeschoss, um nach dem wertvollen Schmuck und dem Bargeld unter der Matratze (Ja, ja, ich weiß, sehr originell!) zu sehen.
Matz heftete sich an meine Fersen. »Leonie, was heißt hier überfallen? Rede mit mir, verdammt!«
»Was gibt es an ›Ich wurde überfallen‹ nicht zu verstehen?« Ich hielt abrupt an, wandte mich ihm zu und schaute ihn finster an.
Er fiel beinahe über mich drüber. »Die Worte kapiere ich sehr wohl, aber nicht dein Verhalten.«
Mein Blick ruhte auf seinen Lippen, weil ich mir seine Äußerung erst einmal durch den Kopf gehen lassen musste. »Ich weiß nicht, was du meinst«, schaltete ich auf stur und setzte meinen Gang ins Schlafzimmer fort.
Matz hätte es nicht verstanden, wenn ich heulend in seinen Armen zusammengebrochen wäre. Er war nicht der Typ, der in solchen Momenten Trost zu spenden wusste. Stattdessen hätte er nur zaghaft, nein, gar ablehnend meinen Kopf getätschelt, als wäre ich von einem Magen-Darm-Virus befallen. So musste ich viele Dinge mit mir selbst oder mit meiner besten Freundin Paulina ausmachen. Und das war der Grund, aus dem ich vor ihm die Coole markierte.
Stracks steuerte ich meine Schmuckschatulle an und kramte lautstark darin herum. Aber ich konnte beim besten Willen nicht erkennen, dass der Einbrecher irgendein Schmuckstück entwendet hatte. Als ich an dieser Stelle nicht weiterkam, sauste ich zur Matratze, hievte sie mit aller Kraft nach oben und schnappte mir den kleinen weißen Briefumschlag. Ich brauchte nicht nachrechnen, ob der Betrag noch komplett war, denn welcher Einbrecher würde sich nur ein oder zwei Scheine herausnehmen und den Rest des Geldes fein säuberlich an Ort und Stelle zurücklegen?
»Wo hast du das ganze Geld her?«
Da kam mir in den Sinn, dass ich Matz gar nichts von meinem Sparstrumpf erzählt hatte. Das war eine recht verzwickte Situation, in die ich nun geraten war.
»Sag schon.«
»Dein Timing ist wie immer beschissen«, machte ich ihn darauf aufmerksam, dass in wenigen Augenblicken die Polizei auf der Matte stehen würde und für Diskussionen wie diese nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt war.
Ich stopfte mir den Umschlag in den Hosenbund und lief wieder ins Untergeschoss. Jetzt, da er davon wusste, war Vorsicht geboten. Denn Matz war groß im Geldausgeben, doch nicht im Herbeischaffen. Und dieser Sparstrumpf sollte mich gewissermaßen absichern.
»Ich habe das Recht zu erfahren, wo du das Geld her hast, Leonie.« Er hielt mich am Arm fest.
Das mochte ich so gar nicht. »Nimm deine Hand weg!« Meine Stimme und mein Blick waren messerscharf. »Wie kommst du darauf, dass das Geld irgendetwas mit dir zu tun hat? Es ist meins.«
»Wir sind seit zwei Jahren ein Paar. Natürlich geht es mich etwas an, wenn du Geld vor mir versteckst.«
»Ich verstecke Geld vor dir?« Ich lachte gellend auf, konnte mich kaum halten. »Matz, das nennt man sparen.«
Er zischelte durch die Zähne. »Wofür?«
Einfallslos zuckte ich mit den Schultern. »Vielleicht für schlechte Zeiten?«
»Schlechte Zeiten? Was für schlechte Zeiten? Hast du vor, dich von mir zu trennen?«
Ich dachte: Ausgezeichnete Idee, sagte stattdessen: »Ich rede nicht von uns, sondern davon, falls die Waschmaschine kaputtgeht oder wir einen Wasserrohrbruch haben oder so.«
Matz' Blick war starr vor Entsetzen. »Was für ein Wasserrohrbruch?«
»Falls!«, schrie ich ihn an. Ich wusste, dass es nichts brachte, wenn ich laut wurde, schließlich lag es ja nicht an seinen Ohren, dass er mich nicht verstand.
»Das erklärt trotzdem nicht, wieso du mir das verschwiegen hast.« Bockig wie ein siebenjähriger Schuljunge verschränkte er die Arme vor der Brust und schürzte die Lippen. Er erweckte in mir den Instinkt, ihn mir übers Knie legen und ihm den Hintern versohlen zu wollen.
Seufzend ließ ich mich auf dem Sofa fallen. »Weil du nicht sparen kannst.« Erschlagen legte ich den Kopf zurück auf die Lehne und rieb mir die Wangen.
»Das stimmt doch gar nicht!«
Ich schwor mir, dieses unreife Teufelskreis-Spiel jetzt nicht mitzuspielen: 'türlich! Gar nicht! Doch! Nein! Doch! Neiiin! Dooohoooch! Du spinnst! Ich spinne nicht! Klar, spinnst du! Gar nicht! Doch! Nein! Doch! Neiiin! Dooohoooch! Dafür war ich einfach zu müde. Nicht müde wie müde. Müde wie: ich war zu alt dafür und hatte es satt.
»Vergiss es!«, resignierte ich also.
»Nein, du hast Geheimnisse vor mir.«
Wer hier wohl Geheimnisse hat! Aber auch das Spiel war ich leid. »Lass es gut sein, Matz«, klang ich erschöpft. »Lass es doch einmal gut sein, ja?«
»Und können Sie Angaben zu äußeren Merkmalen machen?«, fragte Klein, ein recht großer, wohlernährter, verschlafener Polizeibeamter um die sechzig, nachdem ich ihn und seinen Kollegen in der Küche herumgeführt und den genauen Tathergang beschrieben hatte. Nun rutschten irgendwelche Leute über den mediterranen Fliesenboden, um eventuelle Schuhabdrücke oder andere verwertbare Spuren zu sichern, und verteilten an verschiedenen Stellen dieses schwarze Pulver, um nach verdächtigen Fingerabdrücken zu suchen.
Der Polizeibeamte und ich saßen im Wohnzimmer an meinem runden Esstisch. »Na ja ... hm ... er war groß, hatte eine schlanke Figur, einen weißen Vollbart und rote Klamotten an.«
Klein räusperte sich. Sein Partner, der sich nur einige Schritte von uns entfernt aufhielt und meinen werten Lebensgefährten befragte, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Hören Sie, ich wurde gerade mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Was ist daran witzig?«
»Frau Pfeiffer, darüber sind wir uns durchaus bewusst, aber Sie beschreiben uns praktisch einen Weihnachtsmann. Das hilft uns insbesondere zur Weihnachtszeit nicht gerade weiter.«
»Er war schlank!«, wies ich ausdrücklich darauf hin, dass das schon ein bisschen ungewöhnlich war.
»Das grenzt die Suche natürlich erheblich ein!«, erwiderte er mit gespielter Ernsthaftigkeit. Dann entschuldigte er sich. »Wissen Sie, dieses Merkmal ist eben nicht gerade sehr charakteristisch.«
Wo er recht hatte, hatte er recht. Doch ich hatte nun mal nicht mehr sehen können. »Na schön!«
»Na schön – was?«
»Dann kann ich wohl keine Angaben zu seinem Erscheinungsbild machen.«
»Okay, und was wurde Ihnen gestohlen?« Er kritzelte das Wort Diebesgut mit Doppelpunkt dahinter auf seinen Notizblock.
»Nun, na ja ...«, räusperte ich mich, denn es war mir etwas peinlich, »die Wertgegenstände sind alle noch da.«
Verwundert zog Klein die Augenbrauen hoch. »Wie? Bitte?« Er blinzelte unkontrolliert. »Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie bedroht und ausgeraubt wurden, nicht wahr?«
»Hab ich das?« Ja, das hatte ich, noch vor fünf Sekunden.
»Sie wurden also nicht ausgeraubt?«
»Allem Anschein nach nicht.« Verlegen wich ich Kleins Blick aus. Dabei fiel mir das Wandregal mit den Familien- und Freundschaftsbildern in den bunten Rahmen ins Auge, das über dem Sofa hing, auf dem Matz gerade mit reibenden Händen (ein für ihn typisches Merkmal dafür, dass er überaus nervös war) saß. Ich kniff meine Augen zusammen, um diesen Bereich scharf zu stellen. Nicht nur, dass einige Bilder auffallend verschoben waren, eines fehlte sogar.
»Ist Ihnen doch etwas aufgefallen?«, war Klein durch mein Verhalten aufmerksam geworden und blickte nun in dieselbe Richtung, in die ich sah. Allerdings richtete er seinen Blick argwöhnisch auf Matz.
Als ich das wahrnahm, versetzte es mich in Alarmstimmung. »Oh nein – nein, nicht doch.«
»Hören Sie, das alles hier kommt mir ein bisschen suspekt vor. Wurden Sie nun überfallen oder nicht?« Klein klang plötzlich streng. Vielleicht war er aber auch nur müde und wollte um diese Zeit einfach nur zu Hause bei seiner Familie sein.
Darum beschloss ich, es nicht komplizierter zu machen, als es ohnehin schon war. »Also gut, ich war gerade in der Küche, um mir den Salat zuzubereiten ...«
Klein stöhnte: »So weit waren wir schon, Frau Pfeiffer.«
»Ich bitte Sie, ich versuche doch nur, die Sachlage so genau wie möglich zu rekonstruieren, wenn es schon so wenig Anhaltspunkte zum Täter gibt.«
»Aber es nützt alles nichts, wenn dabei keine Täterbeschreibung rumkommt, verstehen Sie das denn nicht?«
Allmählich bereute ich es schon, die Polizei gerufen zu haben, zumal nicht einmal etwas gestohlen worden war. Und dass ich fünfzig Minuten in der Kammer eingesperrt war, würde ich auch ganz ohne psychotherapeutische Hilfe verkraften.
Ich sprang vom Stuhl. »Ich bitte die Herrschaften, sofort mein Haus zu verlassen«, rief ich in die Runde und klatschte in die Hände, um die Meute auf Trab zu bringen.
»Leonie!«, rief Matz entsetzt.
Und Klein warf hinterher: »Frau Pfeiffer, nun beruhigen Sie sich doch.«
Ich wandte mich zu ihm um und rümpfte die Nase. »Ähm, Herr Klein, ich bin vollkommen ruhig. Ich möchte nur, dass Sie alle auf der Stelle mein Haus verlassen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Den Rest regele ich.« Ich wedelte mit dem Zeigefinger auf das schwarze Pulver, das, wie mir schien, inzwischen im ganzen Haus verteilt worden war. »Zum Beispiel hinter Ihnen aufräumen.«
»Frau Pfeiffer, wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ...«
»Ja, ja, tun Sie das«, fuhr ich ihm zweifelnd ins Wort. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun ... Wie konnte man nur so lügen? Fakt war doch, dass keiner bei dem Einbruch umgekommen war. Es war ja nicht einmal etwas geklaut worden, was mich sogar gewaltig ärgerte. Ich meine, was fiel dem Einbrecher ein, mir mit seiner Pistole erst eine Heidenangst einzujagen und mich so viehisch in die Kammer zu stoßen, wenn er dann einfach ohne Beute abhaute? Wofür war das gut gewesen?
»Was war das bitte?«, raunzte Matz mich an, als wäre er plötzlich der Vernünftige von uns beiden, sobald er die Haustür hinter den Polizeibeamten geschlossen hatte.
Ich lief in die Küche, um mir einen Pfefferminztee aufzubrühen. »Lass das meine Sorge sein, in Ordnung?« Ich hatte keine Nerven dafür, mit ihm darüber zu debattieren.
»Fandest du das nicht etwas unhöflich? Ich meine, die Truppe ist extra nur wegen dir aufgeschlagen ...«
»Was kümmert dich das?« Ich ließ das Wasser in den Wasserkocher rauschen und rollte mit den Augen. »War doch schließlich mein Überfall!« Was redete ich denn da für einen Stuss?
Er lachte höhnisch auf. Mehr auch nicht.
Während sich das Wasser erwärmte und ich den Teebeutel in eine Tasse gab, erklärte ich: »Hör mal, ich bin einfach müde, okay? Ich gehe gleich zu Bett.« Ja, ich war überfordert. Aber das konnte Matz nicht wissen. Nicht, weil ich es ihm nicht sagte, sondern weil es ihn nicht interessierte. Also war mir nach Rückzug, um das Geschehene zu verarbeiten und drüber zu schlafen. Heute würde ich nicht mehr als Blödsinn von mir geben.
»Okay!« Schlecht gelaunt stapfte er in den Korridor, riss seinen Mantel von der Garderobe und verdrückte sich ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Es war auch nicht nötig, mir Auskunft darüber zu geben, wohin ihn die Reise führte. In Fällen wie diesen konnte ich mich darauf verlassen, dass er sich mit seinen Freunden traf, um den Frust in Alkohol zu ertränken. Doch ausnahmsweise war es mir herzlich egal. Ich ging zur Haustür und schob sogar die Kette und den Riegel vor, damit er in der Nacht nicht hineinkommen würde. Sollte er doch ruhig draußen in der Kälte versauern.
Als ich auf dem Weg zurück in die Küche war, um das heiße Wasser aufzugießen, blieb ich abrupt stehen, denn just fielen mir wieder die verschobenen Bilderrahmen ein, die den Einbrecher brennend interessiert haben mussten. Also ging ich nicht nach rechts in die Küche, sondern nach links ins Wohnzimmer, stellte mich dem Regal gegenüber und starrte auf die Rahmen, um zu verstehen, wieso dieser Kerl das getan hatte. Und warum hatte er eines der Bilder entwendet? Mir war sofort klar gewesen, welches Bild fehlte: es zeigte mich als dreizehnjährigen Teenager mit meiner Lieblingsbetreuerin Agnes vor dem Kinderheim, in dem ich bis zu meinem achtzehnten Geburtstag untergekommen war, während meine Adoptiveltern neben anderem ihre Haftstrafe abgesessen hatten. Da drängte sich mir die Frage auf, was der Einbrecher ausgerechnet mit diesem Bild wollte. Mir erschloss sich der Sinn nicht.
Allerdings würde sich mir heute sowieso nichts Sinnvolles mehr erschließen. Mein Kopf war prall gefüllt mit einer Unmasse an Informationen, die sich in einem einzigen Chaos verloren hatten und dringend sortiert werden mussten.
Dann fixierte ich den Adventskranz, der in der Mitte des Esstisches stand. Er war schlicht, mit vier weißen Kugelkerzen, mit Tannenzapfen und mit roten Schleifchen ausgestattet. Ich konnte kaum fassen, dass morgen schon der dritte Advent sein würde. Nicht, weil die Zeit wie im Fluge zu vergehen schien, sondern weil es sich überhaupt nicht wie Weihnachten anfühlte. Dabei hatte ich diese Zeit immer so genossen: die Ausflüge auf verschiedene Weihnachtsmärkte, die ausgiebigen Einkaufsbummel mit meiner Busenfreundin Paulina, das Herbeischaffen und Schmücken der Rotfichte, das Einpacken von Geschenken, die Planung des Weihnachtsessens und vieles mehr. Doch dieses Weihnachten wollte mich emotional einfach nicht packen, und ich hatte nicht die mindeste Ahnung, warum das so war.
Und ob ich das wusste! Doch ich hatte mir geschworen, mich nicht von negativen Energien beherrschen zu lassen. Am Ende war ich allerdings nicht dagegen angekommen. Spätestens mit dem heutigen Überfall war das Maß offensichtlich voll.
Und doch wollte ich mich immer noch nicht entmutigen lassen. Ich bildete mir ein, dass mich ein warmer Pfefferminztee im Bett vor dem Flimmerkasten kurieren könnte. Wenigstens ein bisschen.
Und das schwarze Pulver? Das könnte ich auch genauso gut morgen in aller Ruhe entfernen.
Sonntag, 14. Dezember
Nachdem mich meine Arbeitskollegin Emmy, die mir inzwischen eine gute Freundin geworden war, dazu ermutigen konnte, wenigstens ein bisschen mit ihr bummeln und einen Kaffee trinken zu gehen, fühlte ich mich besser als erwartet. Anfangs war ich noch recht verhalten gewesen, konnte nicht ganz ablassen von der Tatsache, dass ich zurzeit nicht allzu viele Gründe zum Lachen hatte, doch dann hatte ich dieses reduzierte Paar Pumps einer beliebten Marke erspäht und ab da an wusste ich: Gott liebte mich doch!
Ein wenig Mitleid hatte ich dennoch mit den Verkäufern und den Servicekräften des Einkaufscenters, die an diesem verkaufsoffenen Sonntag arbeiten mussten, nur um anderen Menschen ihre Freizeit zu ermöglichen. Andererseits war das Center auch nur vier Stunden geöffnet.
Wir erhaschten einen freien Platz in einem überfüllten Café, ließen die Tüten mit unserer wertvollen (wenn auch nur im ideellen Sinne) Ausbeute einfach zu Boden plumpsen und fielen vor Erschöpfung auf die weich gepolsterten Stühle. Uns qualmten die Füße.
Es duftete herrlich nach frisch gemahlenem Kaffee, nach Gebäck und nach Zimt. Um uns herum herrschte das reinste Stimmengewitter, hinter der Theke krächzten alle möglichen Maschinen zur Zubereitung der warmen Getränke, ein Kinderchor, der seit einer Stunde Weihnachtslieder in der ersten Etage live zum Besten gab, schmetterte gerade »Es ist ein Ros entsprungen« und alle fünfzehn Sekunden ging von irgendwoher ein Handy. Doch über die gesamte Geräuschkulisse hinaus nervte mich nur eine einzige Sache: die rothaarige Frau am Nachbartisch (der allerdings so nahe bei stand, dass sie mir quasi auf dem Schoß saß), die einen Kugelschreiber in der Hand hielt und diesen nonstop klickte. KLICK-KLACK-KLICK-KLACK. Dabei gedachte sie nicht einmal, ihn zu benutzen. Jedenfalls schloss ich darauf, da sie keinen Notizzettel oder etwas dergleichen vor sich auf dem Tisch zu liegen hatte. Sie klickte den Kugelschreiber nur so vor sich hin, während sie mit ihrem Gegenüber in einem Gespräch vertieft war.
»Ich glaube, ich werde für solche wilden Unternehmungen einfach zu alt«, japste Emmy, die übrigens zehn Jahre älter war als ich und darum diese profane Äußerung durchaus seine Berechtigung hatte.
Doch was war meine Ausrede? Denn ich rang ebenfalls wie verrückt nach Luft. »Ich auch«, fiel mir nur dazu ein.
»Lass dir gesagt sein: ab dreißig geht es steil bergab.« Sie schenkte mir ein heiteres Lächeln. »Vielleicht sollten wir das öfter machen, damit wir nicht früher als nötig einrosten, was?«
»Liebend gern.« Oder vielleicht fange ich mit irgendeinem Sport an, überlegte ich. Jeder musste doch einen Vorsatz fürs nächste Jahr haben, oder? Und vielleicht könnte ich Emmy dazu motivieren, es mir gleich zu tun. Zu zweit würde es bestimmt viel mehr Spaß machen. »Aber meinst du nicht, dass wir, auf Dauer gesehen, pleite gehen würden?«
Sie nickte heftig. »Höchstwahrscheinlich. Doch was wäre die Alternative?«
Eine Bedienung, weiblich, Mitte zwanzig, strenger Zopf, riesengroß und spindeldürr, schnellte zu uns an den Tisch. Mit gestresstem Gesichtsausdruck (welchen man ihr nicht verdenken konnte, so turbulent, wie es hier zuging) nahm sie unsere Bestellungen auf. Eine heiße Schokolade für Emmy und einen großen Kaffee für mich.
Als sie sich zum nächsten Tisch durchschlängelte, um weitere Bestellungen aufzunehmen, schlug ich vor: »Fitnesscenter?«
Emmy schaute mich fragend an. Es war ihr anzusehen, dass sie den Faden völlig verloren hatte. »Entschuldige?«
Ich lachte: »Die Alternative.«
»Zu was?«
Was zum Henker war auf einmal los mit Emmy? War das nur ein harmloser Blackout oder litt sie etwa an Alzheimer? »Zum Shoppen.«
Dann schlug sie sich gegen die Stirn. »Donnerlittchen!«
»Das passiert mir auch öfter«, log ich.
»Ich war nur ganz erblasst vor Neid.«
Hatte ich etwas verpasst? »Vor Neid?«
»Schau dir diese Figur an, Leonie«, deutete sie mit einem Nicken auf die Bedienung. »Nach zwei Kindern kann ich davon nur träumen.« Emmy war gar nicht sonderlich aus der Form geraten, sie war nur nicht so hager. Es stand außer Zweifel, dass nur ihre Selbstwahrnehmung gestört war.
»Du siehst doch toll aus.«
Das tat sie wirklich. Sie hatte meine Größe, vielleicht fünf Kilo mehr auf den Rippen, hatte sehr feminine, weiche Gesichtszüge, trug die dunklen Haare kinnlang und Falten suchte man bei ihr vergebens. Na gut, wenn sie lachte, bildeten sich Krähenfüße um die Augen, doch das wirkte apart, nicht alt oder abgewrackt. Also, warum ließ Emmy sich von der Zahl vierzig so einschüchtern?
»Sag das mal Hannes«, erklärte sie nüchtern. Sie war derart emotionslos, dass es weitere Erklärungen überflüssig machte.
»Die Luft ist raus, was?«
Frustriert hob sie die Schultern. »Absolut!«
»Und ist da noch etwas zu retten?«
»Kann sein.« Sie wirkte interessenlos. »Vielleicht der Kinder wegen?«
Ich versuchte, nicht erkennen zu lassen, dass ich dieses Argument ausgesprochen lahm fand. Doch möglicherweise hatte ich als Kinderlose auch einfach nicht die leiseste Ahnung von solchen Dingen. »Wie alt ...«
Emmy unterbrach mich. »Du hast recht, das ist absurd. Basti und Robert sind neunzehn und siebzehn. Beinahe alt genug, um eigene Familien zu gründen.«
»Stimmt.« Ich war nicht wirklich überrascht, dass sie von selbst drauf gekommen war, denn man merkte ihr an, dass sie die Trennung im Grunde genommen mehr wollte als ihr Ehemann und ihr lediglich der Mut fehlte, sich von dem gewohnten Alten, das praktisch ihr ganzes Leben ausmachte, zu trennen.
»So läuft das immer, nicht wahr?«
Endlich brachte die Bedienung unsere Getränke herbei. Wir bedankten uns mit einem Lächeln. Und ganz zu unserem großen Erstaunen bekamen wir eines zurück.
Dieses Mal hatte Emmy sich von den sogenannten Traummaßen der Bedienung nicht aus dem Konzept bringen lassen und fuhr fort: »Du denkst, du hast deine große Liebe gefunden, gründest eine Familie und hast eine Zeit lang deine helle Freude daran. Aber plötzlich schleicht sich die Routine ein. Es gibt keine Überraschungen mehr und alles ist so bieder und vorbildlich. Alles, was man miteinander erleben konnte, hat man erlebt. Irgendwann kommt die Erkenntnis, dass das Leben zu kurz ist, um sich da einfach nur weiter durchzuquälen.« Sie machte eine Pause und seufzte. »Plötzlich ist dieses Leben, das man einmal so sehr wollte, nur noch eine Qual. Ist das nicht grotesk?« Sie schüttelte den Kopf vor sich hin, stieß ein kurzes spöttisches Lachen aus und nahm den ersten Schluck von ihrem heißen Kakao. »Aber weißt du, was noch grotesker ist? Dass man all das, was einem hier und jetzt mit dem aktuellen Partner aus dem Hals hängt, mit jemand Neuem noch einmal genauso durchleben würde, so, als wäre es die Erfüllung und das ganz große Glück.«
Ich hätte lügen müssen, wenn ich sagte, dass mich diese Erkenntnis nicht ängstigte, gerade weil dieser Prozess sich bei Matz und mir wesentlich schneller abspulte als bei Emmy und Hannes. Hieß das nun, dass ich beziehungsunfähig war? Immerhin hatte ich bis heute noch keine anständige Beziehung auf die Beine gestellt. Trotz meiner verrückten Kindheit hatte ich mein Leben vollkommen im Griff, benutzte meine Vergangenheit zu keiner Zeit dafür, Ausreden zu finden, wenn in meinem Leben irgendetwas schiefgelaufen war. Doch heute musste ich mir zum ersten Mal ernsthaft die Frage stellen, ob meine Beziehungen ebendarum immer so chaotisch blieben, wie sie schon immer gewesen waren. Und das spiegelte sich nicht nur in den Liebesbeziehungen wider, sondern auch in den sozialen. Ich hatte es schon immer schwer gehabt, Menschen zu finden, die zu mir passten und mich mit ihnen anzufreunden. Und ja, ich gestehe, nicht selten lag es auch an meiner unzugänglichen, unterkühlten Art, die ich mir ganz bewusst zu eigen gemacht hatte, da ich mir einbildete, dass es das Leben erforderte.
»Also, was genau ist das verdammte Problem?«, schmiss Emmy in den Raum. Diese Frage hatte sie nicht mir, sondern mehr noch sich selbst gestellt.
Trotzdem antwortete ich darauf: »Na ja, wie mir scheint, liebst du ihn einfach nicht mehr.«
Sie nickte. »Wahrscheinlich hast du recht. Lange Zeit habe ich gehofft, mich würde nur das eintönige Leben schlauchen.«
»Ach Emmy, mach dir keine Vorwürfe. Es ist normal, dass Menschen sich weiterentwickeln. Und manchmal eben nicht in dieselbe Richtung. Mit vierzig möchte man ganz andere Dinge als mit zwanzig. Aber mit vierzig hat man den Vorteil, dass man viel geerdeter und nicht mehr so sprunghaft ist.«
»Offenbar weißt du, wovon du redest?«
»Bin ich ein so offenes Buch?«
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Jeder, der von dir und Matz weiß, war sich von vornherein sicher, dass das mit euch keine Zukunft haben kann.«
Ich war erschrocken über so viel Offenheit. Aber noch mehr erschrocken war ich darüber, dass die Allgemeinheit scheinbar Wetten auf unsere Beziehung abgeschlossen hatte. Was machte ein Aus so wahrscheinlich? War es auf Matz oder auf mich zurückzuführen?
Ich rang mich durch und fragte einfach mal nach.
Emmy machte den Eindruck, als ob sie sich scheute, mir nun Rede und Antwort zu stehen, obwohl sie gerade noch selbst damit angefangen hatte. »Nun ja, weißt du ...« Betreten räusperte sie sich. Ich sah ihr an, wie sie Worte in ihrem Kopf formierte, nur damit es mich nicht so sehr treffen würde. Sie wand sich ein wenig auf ihrem Stuhl, so, als ob sie ihre Offenheit inzwischen bedauern würde, und räusperte sich ein weiteres Mal. »Die Sache ist die: er ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Er ist bekannt für die ein oder andere Affäre, dafür, dass er sich gern aushalten lässt. Und für seine Faulheit.«
Mein Blick sagte: Ach ja?
Emmys Blick sagte: In der Tat!
Währenddessen drängte sich mir wieder dieses Klickgeräusch des Kugelschreibers auf. Allmählich kam ich mir vor wie ein Tinnitus-Patient und ich musste mich wirklich beherrschen, nicht das Schreien anzufangen, nur damit dieses Geräusch übertönt würde. Doch ich versuchte, mich wieder aufs vordergründige Thema zu konzentrieren: Matz!
Wie kam es, dass mir das im Vorfeld nicht bekannt gewesen war? Plötzlich hatten es alle gewusst! War das die Konsequenz auf mein Leben als Einsiedlerin? Denn, um ehrlich zu sein, wusste ich eigentlich gar nichts von irgendjemandem aus der Kleinstadt und der Umgebung, wenn ich nicht selbst schon einmal näheren Kontakt zu einer Person gehabt hatte. Ich wusste ja nicht einmal etwas über meinen direkten Nachbarn. Ich wusste nur, dass er Rentner war, der dort ganz allein wohnte und sich im Sommer gern nackt auf einer Liege in seinem Garten von der Sonne braten ließ.
»Das höre ich zum ersten Mal«, trotzte ich, um mir nicht anmerken zu lassen, wie dumm ich mir vorkam.
»Im Ernst?«
Jetzt zog auch ich eine Augenbraue hoch und warf ihr einen vielsagenden Blick zu.
»Ich konnte ja nicht wissen, wie ahnungslos du bist. Man denkt sich seinen Teil, das war's.«
»Willst du mir damit sagen, dass du die ganze Zeit über angenommen hast, dass ich mir über seinen fragwürdigen Ruf bewusst bin und ich es der Liebe wegen gleichmütig erdulde?«
Emmy ließ den Blick auf ihre Hände sinken, die auf der Tischplatte lagen, die Finger ineinander geflochten. »Entschuldige, Leonie, aber du warst glücklich. Das war das Einzige, was zählte. Ich wollte kein Querschläger sein. Man weiß doch, wo das immer endet. Ich meine, ich mag dich. Ich mag dich eben sehr, verstehst du?«
Ja, ich verstand.
Zu jenem Zeitpunkt hatten Emmy und ich einander gerade erst in der Arbeit kennengelernt. Sie war neu gewesen und ich sollte sie einarbeiten. Und aus einem mir unerfindlichen Grund hatte sie einen Narren an mir gefressen. Ausgerechnet an mir! Andere Kollegen waren viel geselliger, aufgeschlossener und einfühlsamer als ich. Ich war eher förmlich und sachbezogen – professionell eben. Doch Emmy hatte mir erklärt, sie hätte es in meinen Augen gesehen, dass wir zueinander passten. (Daraufhin hatte ich meine Augen so lange und gründlich im Spiegel betrachtet wie noch nie zuvor in meinem Leben, um irgendein Merkmal ausfindig zu machen, das ihre These unterstützte. Doch das Einzige, was ich herausgefunden hatte, war, dass das rechte Auge niedriger saß als das linke.) Deshalb hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, meine Fassade zum Bröckeln zu bringen und zu mir durchzudringen. So wäre sie allem, was mich gegen sie aufgebracht hätte, aus dem Weg gegangen.
Ich schenkte ihr ein offenes Lächeln als Antwort. »Ich hätte mir viel Ärger erspart.«
»Seien wir realistisch: hättest du mir geglaubt?«
»Tut man das je, wenn man frisch verliebt ist?«
Emmy seufzte schwer, sank in die Lehne zurück und legte ihre Hände auf den Bauch wie eine Schwangere. »Sitzt der Schock sehr tief?«
»Offen gesagt, nein!«
»Nein?«
Es war eine Sache, dass ich es nicht früher gewusst hatte, eine andere, dass ich immerhin während unserer Beziehung hinter diese unangenehmen Eigenschaften gekommen war. Ich baute mich mit dem Gedanken auf, dass es irgendwo da draußen Leute gab, die nicht einmal das von selbst geschafft hätten.
»Genau wie du stehe ich vor einer schwierigen Entscheidung.«
Emmy machte große Augen. »Warum hast du mich nicht zu Rate gezogen, wenn es derart schlecht um euch bestellt ist? Das wusste ich nicht.« Sie sah ernsthaft gekränkt aus.
»Ich gehe eben ungern an die Öffentlichkeit mit meinen privaten Angelegenheiten.«
»Du nennst mich Öffentlichkeit?«
»Nein, natürlich nicht im klassischen Sinne. Ich bereinige das Problem nur gern an der Stelle, wo es sitzt.« Ich verschwieg, dass ich für Angelegenheiten wie diese üblicherweise auf Paulina, meine ganz persönliche Psychotherapeutin, zurückgriff, weil ich ahnte, dass Emmy es als Beleidigung auffassen könnte. Und jetzt erst recht, da sie wusste, dass Paulina und ich miteinander Knatsch hatten. Aber dass ich lieber ein Problem anpackte, statt stundenlang davon zu sprechen, hatte trotzdem seine Richtigkeit.
»Schon gut.« Scheinbar wollte sie es mir überlassen, wem gegenüber ich mich aussprechen wollte und wem gegenüber nicht. Und doch bohrte sie nach einer kurzen Denkpause nach: »Also beabsichtigst du, die Beziehung zu beenden?«
»Ich schätze schon.«
»Das heißt, du bist dir noch unschlüssig?«
Ich horchte in mich hinein. Nein, eigentlich nicht. »Nein, eigentlich steht es fest.«
Emmy zog die Augenbrauen zusammen. Es war die Art, mir mitzuteilen, dass sie sich ein wenig verschaukelt fühlte. »Wenn du Worte wie ›ich schätze‹ oder ›eigentlich‹ verwendest, weist es nicht gerade darauf hin, dass du dir sicher bist, Leonie.«
»Verdammt, ich weiß, aber ich bin mir sicher!« Ich atmete tief durch. »Ich bin nur der Auffassung, dass Weihnachten nicht gerade der richtige Zeitpunkt ist, um mit jemandem Schluss zu machen, findest du nicht?«
»Es mag durchaus taktlos erscheinen, aber wenn die Fronten klar sind ... Die Fronten sind doch klar?«
»Das nehme ich an.«
»Du nimmst es an?« Sie starrte mich völlig verdattert an. Sie musste meinen, Matz und ich lebten ein Leben reich an Verdrängung und Heuchelei.
»Er scheint nicht direkt unglücklich, nur ein bisschen genervt von meiner zickigen Art, die in letzter Zeit immer häufiger hervorbricht. Außerdem weiß ich auch nicht, wie weit seine Wahrnehmungskraft reicht. Nicht, dass ich ihn für strunzdumm hielte, aber du weißt ja: Männer!«
»Tztz«, erwiderte Emmy Augen verdrehend. »Männer wie er sind sich sehr wohl bewusst, wann es brenzlig wird. Spätestens wenn er nicht mehr widerspricht und sich zurückzieht, um erst einmal Gras über manch strittige Angelegenheiten wachsen zu lassen, solltest du dir Gedanken machen. Aber so richtig schlimm ist es erst, wenn er dir ein Geschenk aus der Reihe macht. Er will dich damit besänftigen, dich daran erinnern, warum du dich einst in ihn verliebt hast. Und wenn gar nichts mehr geht, drückt er auf die Tränendrüse, denn welche Frau fühlt sich nicht geehrt, wenn der Mann, sonst so zäh und potent, sich plötzlich so sensibel und angreifbar zeigt und wegen ihr heult?«
Nun kam ich mir strunzdumm vor. Es ging mir nicht darum, ihn nicht verletzen zu wollen oder darum, nicht in der Rolle der Bösen auftreten zu müssen oder gar darum, dass ich tief im Innern glaubte, da wäre noch etwas zu retten. Es ging einzig darum, dass ich mich nicht in der Lage fühlte, der Beziehung den Gnadenschuss zu geben. Ausgerechnet ich! Ich wusste nicht wann, wie oder wo ich es tun sollte. Doch eigentlich kam es mir mehr noch so vor, als ob es sich nicht gehörte.
»Seit wann bist du so zimperlich?«, war Emmy, die sich inzwischen an meine raue Art gewöhnt hatte, zu Recht erstaunt. Obwohl ich ja der Meinung war, dass ich gar nicht mehr so rau war, sobald ich einen Menschen in mein Herz geschlossen hatte. Aber nun tat sie ja gerade so, als käme ich einem wilden, mordlustigen Tier gleich, das unter Umständen seine Beute am lebendigen Leibe begann zu verspeisen.
»Womöglich bin ich es einfach nur gewohnt, dass sonst immer ich die Verlassene bin (in jeder Hinsicht).« Es gab Dinge im Leben, die konnte man nun einmal nicht erklären, auch wenn ich dazu neigte, es trotzdem immer wieder auf einen Versuch ankommen zu lassen. Und seit Neuestem scheiterte ich immer öfter daran – so wie jetzt.
Wieder verdrehte sie die Augen. »Und seit wann zergehst du in Selbstmitleid?«
»Das tue ich doch gar nicht!«, protestierte ich so energisch, dass ich die Kontrolle über meine Stimme verlor und einige Leute, die sich unmittelbar in unserer Nähe befanden, nach mir schauten. »Außerdem windest du dich ja auch und kannst keinen plausiblen Grund dafür angeben, aus dem du nicht längst die Scheidung eingereicht hast.« Ja, ich weiß, es war kein feiner Zug, von mir auf sie zu lenken, nur um irgendwie den Kopf aus der Schlinge zu bekommen, aber mir schien, dass ihre Vorwürfe ausufern wollten. Ich mochte mich nicht rechtfertigen, schon gar nicht, wenn ich mir mein zaghaftes Verhalten selbst nicht richtig erklären konnte.
»Und könnten Sie das mit Ihrem Scheißkuli endlich mal bleibenlassen?«, brachte ich dank meiner Rage endlich den Mut auf, die rothaarige Frau am Nachbartisch auf ihre Macke anzusprechen. Gut, es glich eher einem Fauchen, aber das war wirklich nicht mehr zum Aushalten gewesen. Friede, Freude, Weihnachtszeit hin oder her.
Mit tellergroßen Augen und steifgefrorenem Gesicht wandte die Frau sich mir zu. Sie umklammerte den Kugelschreiber und hielt den Daumen in die Höhe, als hätte irgendwer auf Pause gedrückt.
»Entschuldigen Sie bitte«, pendelte sich mein Tonfall reflexartig ein, als ich sah, dass ihre Augen sich langsam mit Tränen füllten und ihr Kinn zu zittern begann, »aber dieses Geräusch«, zeigte ich auf den Kugelschreiber, »treibt mich in den Wahnsinn.« Sogar ein freundliches Lächeln warf ich hinterher. Allerdings wagte ich zu bezweifeln, dass ich damit jetzt noch Eindruck schinden konnte.
»Ich ... ähm ... gewöhne mir gerade das Rauchen ab«, war ihre Stimme nur ein Hauch.
»In Ordnung, Gratulation, aber«, sprach ich nun so elfenhaft wie nur möglich, »könnten Sie dann nicht auf etwas weniger nervtötende Maßnahmen zurückgreifen wie Kaugummikauen oder Stricken? Es besitzt nämlich nicht jeder so ein starkes Nervenkostüm wie Ihre Begleitung.« (Nebenbei bemerkt war die Begleitung männlich. Er musste schon sehr verliebt in sie sein, um darüber hinwegsehen zu können.)
»Ja ... ja klar.« Gleich darauf steckte sie den Kugelschreiber in ihre kleine schwarze Handtasche und kramte darin herum. Offensichtlich suchte sie tatsächlich nach Kaugummis.
Es tat mir in der Seele weh, dass ich sie so angefahren hatte. Im Grunde konnte sie doch überhaupt nichts dafür, dass ich mein Liebesleben nicht auf die Reihe bekam. So war ich ihr wenigstens diesen verdammten Kaugummi schuldig, oder? Also wühlte auch ich in meiner Tasche herum, während Emmy mich schmunzelnd dabei beobachtete, statt Hilfe zu leisten und für alle Fälle auch ihre Handtasche abzusuchen.
Doch dann hatte ich die Packung Kaugummis gefunden, nachdem ich den halben Inhalt meiner Tasche auf dem Tisch verstreut hatte, und reichte der Frau gleich das ganze Päckchen. Sie nahm es nur zögernd an sich (vermutlich dachte sie, ich wolle sie zu allem Überfluss auch noch vergiften) und wisperte irgendetwas. Ich deutete es als ein Danke.
Und während ich meine Sachen wieder in die Handtasche einsortierte, überdachte ich mein Benehmen. Ich meine, ich hatte doch nicht im Sinn, Menschen grundsätzlich Angst einzujagen, vor allem dann nicht, wenn es um Bagatellen wie Kugelschreiberklicken ging. Aber die Tatsache, dass die rothaarige Frau sich nicht zur Wehr gesetzt hatte, zeugte dafür, dass meine Wirkung genau das tat. Es stimmte mich gar traurig.
Außerdem überkam mich das Gefühl, mich bei Emmy entschuldigen zu müssen. Schuldbewusst sah ich zu ihr auf. »Es ist nicht anständig von mir, dich und mich zu vergleichen. Bei dir hängt so viel mehr dran.« Nein, es waren nicht nur die Kinder, die alt genug waren, um zu verstehen, dass Liebe viel zu komplex war, als dass sie nicht auch dessen Eltern das Genick brechen könnte (ganz bestimmt hatten sie selbst bereits ihre ersten, ganz eigenen Tragödien hinter sich). Vielmehr waren es die vielen Jahre, die Emmy und Hannes zusammengeschweißt hatten – so sehr, dass man sich die beiden gar nicht als ein Einzelwesen vorstellen konnte. Und was hatten die popeligen zwei Jahre aus Matz und mir gemacht? Auf was konnten wir schon zurückblicken? Es gab nichts, was nur annähernd so sehr von Bedeutung war, dass es sich mit Emmys Ehe entgegensetzen lassen konnte.
»Der Stress mit den Männern zermürbt unsere Köpfe. Lass uns den Frust nicht aneinander auslassen.« Im Gegensatz zu mir waren Emmys Gesichtszüge entspannt.
»Und an anderen«, deutete ich unauffällig auf die rothaarige Frau, die mich keines Blickes mehr würdigte, aber immerhin meine Kaugummis in Anspruch genommen hatte.
»Zeig mir lieber noch einmal deine neuen Pumps.«
Bei diesen Worten strahlte ich wieder, griff die Tüte, in der diese sich befanden und reichte sie ihr. »Der Hammer, was?«
»Auf jeden Fall.«
»Ist das nicht Paulina da hinten?«, zeigte Emmy zwanzig Minuten später mit dem Finger auf eine gackernde Gestalt vor dem offenen Eingang des Cafés, die sich dabei an der Schulter ihres Begleiters festhielt. Vermutlich brach sie vor Lachen jeden Moment zusammen.
Ich verschluckte mich beinahe an dem letzten Schluck meines Kaffees, der schon ekelhaft erkaltet war. (Mit Emmy vergaß ich einfach die Zeit.) »Sieht ganz danach aus«, raunte ich bitter, mehr ihres Begleiters wegen: Thor (Ja, so heißt er wirklich!) - Ein Grund unseres Streits.
»Ich habe sie nicht gleich erkannt. Sie sieht ... ganz anders aus«, sprach Emmy hinter vorgehaltener Hand, als hätte Paulina sie aus dieser Entfernung hören können.
»Ganz anders« bedeutete in diesem Fall, dass Paulina sich die Haare blond färben (vor drei Wochen waren sie noch haselnussbraun) und bis zur Taille verlängern lassen und ihre sonst so sportliche Kleidung gegen hohe Stiefel und einen knieumspielten Mantel aus braunem Fellimitat eingetauscht hatte. Und ihre Schminkgewohnheiten hatten sich natürlich auch massiv verändert. Plötzlich waren Smokey Eyes sexy (früher völlig widernatürlich) und rot bemalte Lippen und Fingernägel sinnlich (früher total billig).
»Ganz anders« bedeutete in diesem Fall also: nuttig.
»Ganz anders« bedeutete in diesem Fall allerdings auch: Der zweite Grund unseres Streits.
Ich machte mich klein auf meinem Stuhlund betete, dass sie mich nicht entdeckte. Ihre Aufmachung war einfach zu beschämend und ich wollte mit dem, was diese aussagte, nicht in Verbindung gebracht werden.
Doch da war es schon zu spät.
»Ach, sieh mal einer an«, keifte Paulina vom Eingang aus durch das Café. Ich tat so, als wäre nicht ich gemeint. Dennoch lief ich hochrot an. Plötzlich fühlte ich mich von jedem im Raum angeglotzt, dabei glotzte ein jeder (inklusive der Pudel einer älteren Dame) vollkommen entrüstet zu Paulina. »Neue beste Freundin gefunden?«
Ich hatte noch eine reelle Chance, einigermaßen heil aus dieser Nummer herauszukommen, denn sie hatte noch nicht meinen Namen gerufen, sodass automatisch alle Augenpaare nach der betroffenen Person suchen würden. Denn wenn sie das erst einmal täte, wüssten alle ganz genau, wer Leonie Sophia Pfeiffer war (sie hatte die dusselige Angewohnheit, meinen vollen Namen auszusprechen, wenn sie verärgert war oder ich sie aus verschiedenen Gründen nicht beachtete, was äußerst unvorteilhaft war, wenn ich mich an einem öffentlichen Ort wie dem jetzigen aufhielt und mir alle Anwesenden gänzlich fremd waren), schließlich gäbe es nur eine einzige Person in diesem Café, die ihr glühend rotes Gesicht verzweifelt hinter den Händen zu verstecken versuchte. Und die rothaarige Frau würde sich ganz sicher in den Hintern beißen, weil sie sich von einer solchen Thusnelda wie mir hatte einschüchtern lassen. Wie könnte man mich auch ernst nehmen mit einer Erscheinung wie Paulina (im gegenwärtigen Zustand) an meiner Seite?
»Bedienung?«, näselte Emmy mit einem Mal gespielt schnippisch. »Könnten Sie bitte diese wüste Gestalt entfernen? Ich fühle mich in meinem Frieden gestört.« Auf der Stelle wollte ich in Gelächter ausbrechen, doch ich biss mir auf die Lippen, um es nicht noch schlimmer zu machen – für Paulina. Immerhin war sie nach wie vor meine beste Freundin, nahm ich jedenfalls an.
Ein junger Mann kam hinter der Theke hervor. Er erweckte den Anschein, dass ihm der Laden gehörte, aber auch, dass er bereits vor Emmys Aufforderung auf dem Weg zum Eingang gewesen war. »Ich bitte Sie ...«, wies er wie ein Verkehrspolizist mit einer Hand vom Café weg, mit der anderen berührte er Paulinas Arm sanft.
Thor baute sich mit seinen ein Meter achtundneunzig und dem muskelbepackten Oberkörper vor dem Cafébetreiber auf, der weder in der Höhe noch in der Breite mit ihm mithalten konnte. »Nimm deine Schmalzfinger von ihr.«
Entwaffnend hob der Cafébetreiber die Hände. »Die Gäste wünschen nur, in Ruhe gelassen zu werden.«
»Sind wir etwa keine Gäste?«, schrillte Paulina.
»Im Augenblick machen Sie mir nicht den Eindruck, nein.«
Paulina wollte sich an dem Cafébetreiber vorbeidrängen. »Okay, das können wir ändern.«
Doch er versperrte ihr den Weg. »Ich fordere Sie erneut auf zu gehen.«
Thors Gesichtszüge verfinsterten sich. Ich sah den Cafébetreiber schon bewusstlos und völlig verknotet in einer Ecke liegen, doch Thor machte nur einen raschen Schritt nach vorn, um ihn in Schrecken zu versetzen.
Da verhielt sich Paulina weitaus giftiger. »Passen wir etwa nicht in dein High-Snobiety-Lokal, oder was?«
»Wenn Sie so auftreten, nicht!« Ich hatte immer gedacht, ich wäre mutig, aber der Cafébetreiber belehrte mich heute eines Besseren.
»Ha!«, rief sie. »Was willst du damit sagen? Dass ich aussehe wie eine Nutte?« Dass sie das Thema zuweilen von sich aus anschnitt, lag lediglich daran, dass sie, seit ihrem Imagewechsel, alle naselang darauf aufmerksam gemacht wurde, und nicht daran, dass es ihr tatsächlich bewusst war.
»Wer redet denn von Ihrem Erscheinungsbild?«, wunderte er sich anscheinend ernsthaft und machte ein Gesicht, als hätte sich Paulinagerade vor seinen Füßen übergeben. »Ich rede von Ihrem Geschrei von eben.«
Und irgendwie hatte diese Antwort gesessen, denn sie sah plötzlich zerstreut aus, so, als hätte er ihr gerade eröffnet, dass ihre Mutter zu Tode gekommen war. Das bemerkte auch der Cafébetreiber und wandte sich wieder entspannt seiner Arbeit zu. Wir alle konnten wohl damit rechnen, dass der Tumult nun vorüber war.
Ehe sie mit ihrem Thor sprachlos von dannen zog, trafen sich unsere Blicke, und wenn mich nicht alles täuschte, standen ihr Tränen in den Augen.
Ich war noch immer erschrocken von Paulinas respektlosem und aufständischem Verhalten, als Emmy mir zuflüsterte: »Also, Benehmen ist in letzter Zeit wirklich Glücksache bei ihr, was?«
Ich grinste halbherzig. »Ich weiß auch nicht, was dieser Thor an sich hat, dass sie sich so umbiegen lässt.«
»Er sieht aus wie ein Zuhälter. Vielleicht ...«
»Das ist er nicht«, fuhr ich ihr ins Wort, »das habe ich schon überprüft. Es ist etwas anderes.«
»Es ist sehr schade um sie. Sonst ist sie so nett. Etwas zickig, aber nett.« Gelegentlich hatten Emmy, Paulina und ich zusammen etwas unternommen oder uns einfach nur für einen gemütlichen DVD-Abend bei mir zu Hause versammelt, wenn Matz mit seinen Jungs am Wochenende losgezogen war. Daher wusste Emmy, wovon sie redete.
»Danke übrigens.«
»Wofür?« Offensichtlich durchforstete Emmy ihr Unterbewusstsein nach einem wertvollen Hinweis, der ihr die Antwort vor mir gab.
»Na ja, du hast vermieden, dass sie meinen Namen wieder raus krakelt.«
Emmy lachte. »Eigentlich kannst du froh sein, dass sie nicht auch noch deine Adresse und Telefonnummer hinten anfügt.«
»Und du hast die Leute hier glauben gemacht, dass du diejenige bist, die Paulina angesprochen hat.«
Darüber schien sich Emmy nicht ganz klar gewesen zu sein. »Oh!«, brachte sie daher nur hervor.
Nun musste ich lachen.
»Meinst du wirklich?«
Demonstrativ schaute ich mich um. »Es hat sich niemand sonst beschwert. Das ist so eine psychologische Sache, schätze ich.«
»Oh Mann«, jammerte sie, »dann lass uns besser aufbrechen, bevor mich hier irgendeiner nach meinen Dienstzeiten fragt.«
Ja, vielleicht war es gemein, dass wir Paulinas nuttiges Outfit unentwegt verspotteten, andererseits taten wir das nur, weil es nun mal nicht Paulinas Lebensart war. In Wirklichkeit thematisierten wir es nur, weil es uns belastete.
***
Während ich darauf wartete, dass der Barkeeper meinen Cocktail mixte, spielte ich mit dem Zeigefinger nachdenklich an einem der Dekoelemente, das direkt vor meiner Nase auf dem Tresen stand. Ich wusste nicht einmal, was genau es darstellen sollte, ich wusste nur, es sollte weihnachtlich anmuten mit den Kiefernzweigen und den goldenen Schleifchen.
Noch immer konnte ich es nicht fassen, dass ich den dritten Adventsabend in einer Bar ausklingen ließ, nur weil mich zu Hause plötzlich die Einsamkeit übermannt hatte. Auf einmal fühlte sich mein Leben so leer an. Da konnten die neuen Pumps auch nichts dran ändern. Aber heute war hier nicht sehr viel los. Warum auch? Es gab Menschen, die fühlten sich im Kreise ihrer Familien gut aufgehoben, speziell an diesen Tagen.
Nun gut, ich hatte ja gar keine Familie! Meine leiblichen Eltern kannte ich nicht, denn ich war schon als Baby zur Adoption freigegeben worden, meine Adoptiveltern waren einesteils tot und anderenteils im Knast, und für eine eigene Familie hatte mir bislang entweder der richtige Partner oder der Eisprung zur passenden Zeit gefehlt.
Bei Matz kam beides zusammen. Es gab das erste Jahr, in dem er sehr darum bemüht war, mich glücklich zu machen und in dem wir uns schon recht früh über Zuwachs einig gewesen waren. Doch ich war nie schwanger geworden (gottlob). Im zweiten Jahr konnte er sein zweites (wahres) Ich kaum noch länger verbergen und hatte sich fast unmerklich zu einer faulen, selbstsüchtigen Hohlfigur entwickelt. Dazu lag die Vermutung nahe, dass er mich mit einer anderen Frau betrogen hatte.
Allerdings war ich mir erst vor einigen Wochen darüber bewusst geworden, dass nicht nur er, sondern auch unsere Beziehung aus den Fugen geraten war. Dennoch konnte ich ihn ja nicht erbarmungslos auf die Straße setzen. Nicht, dass ihn seine Eltern seinem Schicksal überlassen würden, aber sie wussten nur zu gut um seine wahre Natur und waren es ebenso leid wie ich. Im Grunde genommen wollte ich ihnen mein Elend nicht aufbürden, auch wenn unser Verhältnis nicht das beste war (na ja, vor allem das zwischen Margret und mir) und es mir daher vollkommen gleich hätte sein können.
Ein Typ setzte sich direkt neben mich.
Warum direkt neben mich? Der Tresen war etwa acht Meter lang, an dem zwölf Barhocker standen, von denen neun nicht besetzt waren. Aber er setzte sich ausgerechnet neben mich und raubte mir unnötigerweise meine Armfreiheit. Frechheit!
Unauffällig schielte ich zu ihm, ohne meinen Kopf zu bewegen, doch allein aus dem Augenwinkel erkannte ich nicht mehr als eine unscharfe Gestalt, die die Arme auf den Tresen gelegt hatte. Also war ich gezwungen, meinen Kopf auf meiner Erkundungsreise nun doch ein wenig zu drehen. Sofort fing ich seinen Blick ein, der unangenehm an mir klebte. Ich erschrak und wandte meinen Kopf blitzartig wieder ab. Er nahm mir also nicht nur meine Armfreiheit, sondern starrte mich auch noch an. Hatte er denn keine gute Kinderstube genossen?
Wütend kaute ich und verengte meine Augen.
Doch dann wurde mir meine abweisende Art irgendwie peinlich. Ich konnte doch nicht so tun, als wäre er nicht da, wenn sich unsere Blicke ohnehin schon getroffen hatten. So entschied ich mich, ihn noch einmal spontan bei drei anzusehen. Sein Blick haftete immer noch an mir, was meine Wut steigerte.
»Entschuldige«, ergriff ich die Initiative, »habe ich Dreck an der Backe oder warum glotzt du mich so blöd an?«
Jetzt grinste der Typ auch noch breit. »Du kommst mir unheimlich bekannt vor, aber mir will partout nicht einfallen, wo ich dein Gesicht schon einmal gesehen habe.« Seine Sprechweise war sympathischer als sein Benehmen, aber seine Anmachsprüche genauso wenig originell wie meine Geldverstecke.
»Deshalb musst du dich ja nicht gleich so aufdrängen, oder?«
»Wie lernst du dann für gewöhnlich Leute kennen? Ich meine, wir sind hier in einer Bar.«
Ich grübelte kurz. »Na, jedenfalls nicht, indem ich ihnen auf die Schultern springe.«
Plötzlich schnellte er vom Hocker und ließ sich auf dem nächsten wieder nieder. »Besser so?«, rief er so übertrieben laut, als hätte er sich ganz ans andere Ende des Tresens gesetzt.
Der Barkeeper brachte mir endlich meinen Cocktail, dann nahm er die Bestellung von dem Scherzkeks auf. Der wollte nur ein belgisches Bier. Wenn er nur Bier wollte, warum war er in eine Bar gekommen? Hätte es nicht auch eine Kneipe getan? Denn da hätten seine frechen Umgangsformen wesentlich besser hineingepasst und sicher viel mehr Anklang gefunden.
Nun trennte uns jedenfalls ein Hocker und ich musste zugeben, dass sich das wirklich gleich viel angenehmer anfühlte. »Da fragst du noch?« Ein Lächeln huschte über meine Lippen. Herrje, immerhin gab er sich Mühe!
»Sicherheitshalber! Es hätte ja durchaus sein können, dass dir das noch zu nahe ist.«
»Na ja, dein Aftershave rieche ich noch.« Das tat ich wirklich. Es roch würzig-penetrant.
Er hob eine Augenbraue an. »Soll ich mich jetzt auch noch duschen gehen?«
»Das klingt ein bisschen danach, als hättest du eine Aversion gegen Wasser«, zog ich ihn auf und hatte sogar richtig Spaß daran.
Er anscheinend ebenfalls. »Ich habe wohl eher eine Aversion gegen Stinkstiefel wie dich.« Er zwinkerte mir mit einem Auge zu. »Wie kann ein einziger Mensch so mies gelaunt sein? Und das auch noch an diesen heiligen Tagen.«
Trotzig zuckte ich mit den Schultern und drehte nervös mein Glas. »Ich habe mir Weihnachten auch etwas anders vorgestellt. Stattdessen stehe ich a) kurz vor einer Trennung, habe b) Stress mit meiner besten Freundin, werde c) immer runder um die Hüften herum und bin d) zu allem Überfluss gestern auch noch überfallen worden – in meinem eigenen Haus, versteht sich.« Ich beobachtete ihn dabei, wie seine Augen bei jedem Punkt größer wurden vor Erstaunen. Nur Punkt C veranlasste ihn, einen kurzen prüfenden Blick auf meine Hüften zu werfen.
Er nahm einen großen Schluck aus seinem Bierglas, ein Akt, der mich ahnen ließ, dass er es für seine Nerven brauchte. »Okay! Zu Punkt A: Warum? Zu Punkt B: Warum? Zu Punkt C: Es ist alles da, wo es hingehört. Und zu Punkt D: Jetzt weiß ich, warum du mir so bekannt vorkommst.«
»Ach ja?«, bezog ich mich lediglich auf die Antwort auf Punkt D. »Und woher?« Ich war richtig überrascht, dass das doch nicht nur eine doofe Anmache gewesen war.
»Na, der Überfall steht doch im Tagesblatt. Und über dem Artikel ist ein kleines – sehr kleines – Bild von dir abgedruckt.«
»Im Ernst?«, klang meine Stimme hell vor Aufregung. »Woher wissen die davon?«
Der Barkeeper hatte unser Gespräch aufmerksam verfolgt und griff unter den Tresen. Da holte er die Zeitung von heute hervor, legte sie mir direkt vor die Nase und tippte mit dem Finger auf den Artikel auf der Titelseite. Sofort hob ich diese auf und hielt sie mir dicht vors Gesicht, weil ich meinen Augen nicht trauen wollte.
»Das darf ja wohl nicht wahr sein!« Beim Lesen klappte mein Kinn herunter. »›Leonie Pfeiffer stundenlang in der Vorratskammer der Küche eingesperrt, als ihr Verlobter Matz Grimm sie befreit und die Polizei ruft‹«, las ich vor, mehr vor mich hinmurmelnd.
»Deshalb habe ich dich auch nicht gleich erkannt. Das Bild in der Zeitung macht einen ganz anderen Menschen aus dir. Aber diese Augen«, warf er mir ein vor Sehnsucht zergehendes Lächeln zu, »die sind dieselben.«
Ich stellte mich taub. »Woher haben die das überhaupt? Das ist sechs Jahre alt.« Dann flog mein Blick weiter über den Artikel. Zwischendurch stieß ich immer mal wieder ein fassungsloses: »Die sind doch wohl ... (bescheuert)« oder ein verärgertes: »Die haben doch wohl ... (den Schuss nicht gehört)« aus, konnte die Sätze aber nie beenden. Das war einfach zu grotesk. »Hör mal zu«, richtete ich mich an den Fremdling, der mir doch eben noch mit seiner Existenz auf den Wecker gefallen war. »›Der Einbrecher klaute den transportablen Tresor samt zwanzigtausend Euro aus dem Rollcontainer des Schreibtisches, als er den dazugehörigen Schlüssel nicht finden konnte.‹ Wir besaßen noch nie einen transportablen Tresor. Und schon gar keine zwanzigtausend Euro. Ist das zu fassen?«
»Na, da hat dein Verlobter seinen Nachnamen ja völlig zu Recht, hm?«, bemerkte der Barkeeper trocken, während er leger ein Glas polierte und es zum Quietschen brachte.
Der Fremdling lachte herzhaft und fuhr sich mit den Händen durch seine dunkle Sturmfrisur. »Stimmt, an ihm scheint ein guter Märchenerzähler verloren gegangen zu sein.«
Der war zwar gut (!), aber mir war, wenig überraschend, derzeit nicht zum Lachen zumute. »Woher wollt ihr denn wissen, dass das von ihm aus kommt, hm? Hm?«