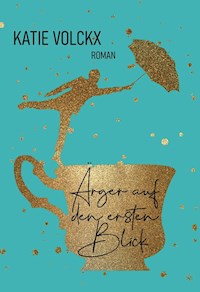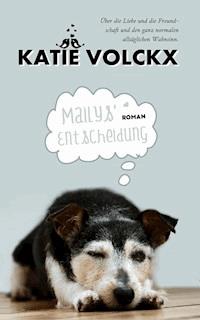
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Liebe und die Freundschaft und den ganz normalen alltäglichen Wahnsinn. >>> Die leicht wunderliche und konservative Heidi alias Püppi fühlt sich einsam und braucht dringend eine Finanzspritze. Aus diesen Gründen sucht ihr prädominanter Bruder mittels Zeitungsannonce eine Mitbewohnerin für sie. Der trifft jedoch nicht nur gern wichtige Entscheidungen über ihren Kopf hinweg, sondern mischt sich auch gern einmal in das Privatleben seiner kleinen Schwester ein. Mit ihrer vorlauten Freundin Hanna fährt Heidi da allerdings auch nicht immer besser. Vielmehr hält diese sie mit ihrer bedrückten Gemütsverfassung völlig in Atem. Dabei hätte Heidi in ihrer Selbstfindungsphase tendenziell viel mehr Hilfe nötig, insbesondere in den Liebesangelegenheiten, welchen sie mit einem Mal gegenübergestellt ist. Infolge ihrer Unerfahrenheit ist ein Verwirrspiel der Gefühle vorprogrammiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Wieder so eine eingebildete Ziege«, brummelte ich, während ich die Tür hinter der einundvierzigsten Interessentin mit dem Fuß ins Schloss stieß, auf die ich mich ohnehin nur schwer konzentrieren konnte. Denn noch vor fünf Minuten hatte ich ein Telefongespräch mit einem anderen Bewerber geführt, der sich für das zu vermietende Zimmer interessiert zeigte. Noch immer hielt ich das schnurlose Telefon in der Hand und noch immer schüttelte ich fassungslos den Kopf.
Wies die Annonce nicht ausdrücklich darauf hin, dass ich das teilmöblierte Zimmer ausschließlich an eine Vertreterin des schönen Geschlechts vermieten würde?
Da hatte doch ein junger Mann tatsächlich die Nerven, mich davon überzeugen zu wollen, dass er der einzig wahre und richtige Mitbewohner für mich wäre. Zugegeben, mit seiner munteren, aufgeschlossenen und vor allem witzigen Art hatte er einen gewissen Charme versprüht und wusste sich auch zu artikulieren, doch deswegen würde er noch lange kein Mädchen ersetzen. Er war ein Bursche! Und das verstieß gegen meine Grundsätze.
Seufzend ließ ich mich auf die Couch fallen und warf das Telefon neben mich aufs Sitzpolster. Ich sank in die Lehne zurück, legte den Kopf in den Nacken, starrte an die Zimmerdecke und erwischte mich dabei, wie ich die Struktur der Raufasertapete inspizierte. Meiner Meinung nach nahm ein Gegenstand auch mal eine ganz merkwürdige Form an, sobald ich mich auf diesen intensiv konzentrierte. Eine abnorme sogar. Und so geschah es auch mit der Raufasertapete: Die ungleichmäßigen Beulen wirkten wie juckender, ansteckender Ausschlag und störten das Gesamtbild.
Seit die Annonce vor einer Woche in der Tageszeitung erschienen war, rannten mir die Mädels regelrecht die Bude ein. Allerdings wunderte mich das inzwischen gar nicht mehr, da mein neugieriger Nachbar (ich nannte ihn völlig zu Recht 007), der die Wohnung auf der ersten Etage direkt unter mir bewohnte, langatmig darüber aufgeklärt hatte, wieso die Nachfrage eines WG-Zimmers in einer Großstadt wie Berlin so riesig sei. Hätte ich im Vorhinein gewusst, dass sich die Suche nach einer Mitbewohnerin derart schwierig gestalten und ausschließlich Stress bewirken würde, hätte ich weitestgehend über das Bedürfnis einer solchen hinweggesehen.
Andererseits war die Annonce ja nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf den meines fünf Jahre älteren vorherrschenden Bruders Emil, der es, nebenbei bemerkt, nicht mochte, Emil genannt zu werden, weil er den Namen für lächerlich hielt. Er pflegte immer zu sagen: »Da kann ich mir das Wort Niete auch gleich auf die Stirn tätowieren lassen.« So nannte jeder ihn seit Jahr und Tag Beck: Ein Kürzel aus unserem Familiennamen Halbeck.
Wenn jemand das allerdings nachvollziehen konnte, dann war ich das. Mit meinem Namen fuhr ich nämlich auch nicht viel besser. Da waren erste Reaktionen wie »Heidi? Wie die Heidi von der Alm?« oder »Wo hast du denn Alm-Öhi und Peter gelassen?« vorprogrammiert. Unsere Namen schrien ja förmlich nach Hohn und Spott, fand ich. Wir konnten bis heute nicht verstehen, was unsere Eltern bei der Namenswahl geritten hatte.
Wie auch immer, es mochte zwar seine Idee gewesen sein, Schuld hatte ich trotzdem selbst. Ich hatte ihm nämlich lang genug mit einer Arie über Einsamkeit und Armut in den Ohren gelegen. Offenbar hatte er es deshalb nicht für nötig gehalten, den Vorschlag vorab zu unterbreiten, geschweige mich, die ahnungslose kleine Schwester, zumindest kurz über ihr Glück zu unterrichten, sondern hatte die Annonce direkt über meinen Kopf hinweg aufgegeben und es schlussendlich als Überraschung bezeichnet. Natürlich hatte ich die »frohe« Botschaft entsprechend übellaunig aufgenommen, bis ich endlich kapiert hatte, dass mein werter Bruder ja nur gute Absichten verfolgt hatte. Und immerhin hatte er meinen Wunsch nach einem Wesen weiblicher Natur bedacht. Hätte ich jedoch geahnt, wie empfindlich ich auf die hochmodernen Mädchen von heute reagierte, hätte ich mir lieber ein Haustier zugelegt. Es hieß ja, Hunde hätten therapeutische Fähigkeiten.
Nicht, dass ich therapeutische Hilfe ernsthaft nötig hätte, aber in dieser sehr verrückten Welt konnte man weiß Gott nicht genug zur gesundheitlichen Vorsorge beitragen. Gewiss wirkte das sehr spießig: Ich rauchte nicht, trank keinen Alkohol, guckte immer fünfmal mehr nach rechts und links, bevor ich die Straße überquerte, umging strikt jede Situation, von der nur im Ansatz Gefahr ausgehen könnte (Fahrstuhl fahren, in tiefen, dunklen Seen schwimmen, Karussell fahren, mit dem Flugzeug fliegen, auf die Sonnenbank gehen und so weiter und so fort) und ernährte mich vegetarisch. Die Idee, mich gar vegan zu ernähren, hatte ich indessen so schnell verworfen, wie sie mir gekommen war, denn ich ertrug meinen morgendlichen Kaffee einfach nicht ohne Vollmilch, liebte weichgekochte Eier zum Frühstück und Käse überbackene Dinge wie Pizza und Aufläufe aller Art.
Der eine oder andere mochte glauben, es wäre für mich schon eine Herausforderung, morgens aus dem Bett zu steigen und ich hätte keinen Spaß am Leben. Doch tatsächlich war der Grund meiner Defizite nur einer: Ich hatte die letzten neun Jahre im Kloster zugebracht! Nein, Sie leiden nicht an Wahrnehmungsstörungen – Sie haben sehr wohl richtig gelesen: Ich war einmal eine Ordensschwester.
Mein einstiger Entschluss war für die meisten nur eine fixe Idee gewesen, nicht zuletzt, weil der Entschluss, ein Leben im Kloster zu führen, für mich bedeutet hatte, meine Familie, meine Freunde, meinen (verhassten) Putzjob und meine Heimat hinter mir zu lassen. Warum hatte ich geglaubt, ich hätte Gott nur auf diesem Wege nahe sein können? Verständlich, dass es niemandem in den Kopf gegangen war. Aber gegen aller Kritik war ich zunächst dem Ruf meines Herzens gefolgt.
So stand ich neun lange Jahre als Ordensschwester unter dem Pseudonym Jordana durch. Ehe ich mich jedoch mit dem ewigen Profess auf Lebenszeit an den Orden gebunden hätte, hatte ich ein weiteres Mal einen existenziellen Entschluss gefasst, und zwar den, zur Besinnung zu kommen. Ein restliches Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam, während dort draußen in der Welt der Bär tobte, hatte mir plötzlich nicht mehr zugesagt. Und, um ehrlich zu sein, klang der Name Jordana nicht gerade besser als Heidi.
Mittlerweile war ich achtundzwanzig, seit einem Jahr »auf freiem Fuß«, wie gesagt ein Hosenscheißer, arm und immer noch keusch. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich auch im Kloster bleiben können.
Na gut, ich war nicht bettelarm! Beck hatte mir immerhin seine Eigentumswohnung vermacht – einfach so geschenkt, als er sich mit dem Gedanken getragen hatte, mit seinem Lebensgefährten Hugo in ein Einfamilienhaus an den Stadtrand zu ziehen. Vermutlich war er einzig überglücklich gewesen, dass ich wieder Verstand angenommen und den Weg der Rückkehr ins soziale Leben angetreten hatte. Und wenn ich bei ihm schon mal ein Zimmer hatte, wollte er mir dieses Heim nicht wieder nehmen.
Meines Erachtens war die Wohnung für eine einzige Person wirklich zu groß. Diese hatte zwei Schlafzimmer, einen großen Wohnraum, an dem die offene Küche anschloss, ein großes Wannenbad, das von meinem Schlafzimmer abging und mir damit jegliche Intimsphäre ermöglichte, und ein Gästebad mit Dusche über eine Fläche von gut hundertzehn Quadratmetern verteilt. Die Schlafzimmer und das Duschbad gingen vom großen Wohnraum ab. Es existierte kein Flur; die Wohnungstür führte direkt in den großen Wohnraum hinein.
Übrigens war ich die Letzte, die erfahren hatte, dass Beck schwul war; war ja im Kloster! Sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, war ein harter Kampf, denn als ich ihn das letzte Mal, vor meinem Klostereinzug, gesehen hatte, war er der größte Playboy aller Zeiten und hatte alles besprungen, was Puls hatte. Ihm hatte völlig ferngelegen, sich jemals fest zu binden. Nicht zuletzt aus diesem Grund fand ich es sehr fragwürdig, dass jedermann so ohne Weiteres mit Becks Homosexualität zurande kam, jedoch nicht mit meinem ehemaligen Wunsch, Nonne zu werden. Klar, ich hatte recht untypische Sichtweisen für ein junges Mädchen, während Homosexualität zu keiner Zeit untypisch, vielmehr überraschend war, doch beides nahm aus Überzeugung seinen Lauf.
Zumindest war ihm seine Homosexualität zugute gekommen. Denn damals war er nicht nur dieser Playboy, sondern noch dazu ein Luftikus. Inzwischen war er total bieder geworden. Zuerst hatte ich gedacht, Beck wäre von Außerirdischen entführt und durch einen besseren Klon ersetzt worden, aber dann hatte er die Geschichte mit der Weberknecht-Spinne, mit der er mich schon Zeit meines Lebens aufzog, vor seinem Herzallerliebsten wieder herausgekramt. (In dieser prügelte ich mit einem meiner Flip-Flops auf eine Weise auf die besagte Spinne ein, als hätte ein mordlustiger Löwe vor mir gestanden.) So wusste ich, dass er lediglich erwachsen geworden war, im Großen und Ganzen. Männer hinkten ja bekanntlich immer eine Spur hinterher.
Apropos Männer.
Auch wenn ich im Kloster gewesen war, wusste ich sehr wohl, wie jene tickten. Meine beste Freundin Hanna hatte mich vielmals aufgeklärt, da sie sich einbildete, ein Leben im Kloster wäre gleichzusetzen mit einem Leben hinterm Mond. Ich wollte ihren Eifer nicht mit Füßen treten, deshalb hatte ich ihre bisherigen Anekdoten stillschweigend ertragen und diese geschmeidig ins eine Ohr herein- und ins andere Ohr herausfließen lassen.
Seit unserer Jugend waren wir unzertrennlich (während meines Klosteraufenthalts hatten wir zumindest regen Brief- und Telefonverkehr). Hanna war mir immer zwei Jahre voraus, was sie mir gelegentlich unter die Nase rieb. Allerdings hatte es in den letzten Monaten abrupt nachgelassen. Dafür gab es auch einen deftigen Grund: Hannas dreißigster Geburtstag! Und der stand in zehn Tagen bevor.
Schon seit Wochen – ach, was rede ich da? – seit Monaten hielt sie etwa dreimal die Woche beachtliche Vorträge darüber, was dieses Alter Unheilvolles mit sich brächte. Schlagartig würde die Haut in jedem noch so kleinsten Winkel erschlaffen, die Tränensäcke wären im Notfall nicht einmal mehr mit Eiswürfeln kleinzukriegen, die Falten würden sich immer tiefer um die Mund- und Augenpartien pflügen und die Brüste sowie der Hintern könnten sich gegen die Schwerkraft wohl oder übel nicht mehr länger durchsetzen. Dass sich meine Anteilnahme in Grenzen hielt, lag wohl daran, dass ich die Maßgeblichkeit der äußeren Erscheinung nicht mehr gewohnt war. Ich meine, in der Klosterzeit besaß ich nun mal keinen Hintern oder Brüste oder andere pikante Körperteile; primär besaß ich nur meine Seele, meinen Glauben, na ja, und meine schwarze Ordenstracht. Aber wenigstens erklärte Hannas Angst vorm Altern die doppelte Schicht Make-up, die sie schon seit geraumer Zeit auftrug ... unnötigerweise, sei an dieser Stelle einmal gesagt.
Tja, und ich war immer davon ausgegangen, dass Frauen erst ab vierzig begannen durchzudrehen. Das war wohl falsch gedacht.
Einmal hatte Beck versucht, sie mit Worten wie »Sieh mal, ich stehe noch immer ganz ohne Gehhilfe allein aufrecht« aufzumuntern, war lediglich auf spaßhafte Weise darauf aus gewesen, sie daran zu erinnern, dass er schon lange vor ihr die Dreißig überschritten hatte. Aber natürlich war der Schuss nach hinten losgegangen und sie hatte darauf nur geantwortet: »Bei dir ist das was völlig anderes, du bist schließlich ein Mann!«, was inzwischen jedoch recht umstritten war, denn seit seinem Coming Out hatte er verdächtig viele feminine Züge angenommen. Dann war sie Tür donnernd und mit quietschenden Reifen davongejagt. Nach dieser (das sei betont) recht überzogenen Reaktion hatte ich mir die grandiose Idee, ihr, natürlich nur zum Spaß, zum Geburtstag einen Krückstock zu schenken, lieber aus dem Kopf geschlagen, bevor sie mich damit aus ihrem Leben triebe. Sicher war sicher.
Das plötzliche Telefonklingeln riss mich aus dem Wust unterschiedlicher Gedanken zurück ins Hier und Jetzt. Ich musste nur eine Handbewegung nach rechts machen, um den Hörer vom schnurlosen Telefon zu greifen. Ich fühlte mich benommen, also hauchte ich das Hallo nur.
»Hallo, Ramona Fink ist mein Name. Ich interessiere mich für das WG-Zimmer.« Der Klang ihrer Stimme war hell, wirkte gar, als wäre das dazugehörige Mädchen nicht älter als zehn.
In mir zog sich alles zusammen. All das war mir zunehmend ein Graus. Ich war kurz davor, diese Ramona Fink abzuwimmeln und zu behaupten, dass das Zimmer schon vergeben sei, nur damit ich endlich meine Ruhe hätte – zumindest in Bezug auf den heutigen Tag.
»Wann hättest du Zeit und Lust es zu besichtigen?« Selbstverständlich duzte ich sie.
»Ich möchte nicht aufdringlich sein ... aber wie wäre es mit ... jetzt?«
Mir wurde leicht schummerig. Ich warf einen langen jämmerlichen Blick auf die Uhr. Jede Faser meines Körpers schrie NEIN, aber ich sagte: »Fünf Uhr« und gab meine Adresse durch.
2
Nach zwanzig Minuten saß ich noch immer hier, war vom Anrufer allerdings ausreichend reaktiviert worden. Ich raufte mir die Haare, denn ich war verzweifelt. Ja, das war ich wirklich! Da ich noch immer nur diesen Minijob im Supermarkt hatte und mich ansonsten mein jovialer Bruder mit durchfüttern musste, käme mir eine Ertrag abwerfende Untermieterin mehr als gelegen. Meine Verzweiflung war sogar so groß, dass ich einen kurzen Moment lang völlig den Verstand verloren hatte und den jungen Mann, den ich vorhin noch am Telefon energisch abgewimmelt hatte, wahrhaftig als Mitbewohner in Betracht zog. Wie gesagt, nur einen kurzen Moment lang.
Ich grinste und schüttelte den Kopf über meine Anspruchslosigkeit und hievte mich schließlich vom Sofa, um den Terminkalender zu prüfen. Vor Ramona erwartete ich nur noch eine Interessentin. Ich musste meine Augen ein wenig zusammenkneifen, da ich auf einmal meine eigene Schrift nicht mehr entziffern konnte. Hieß die Gute nun Lena? Oder Lana? Oder gar Lene? War das überhaupt ein L? Herrje, in der Eile hatte es eben rasend schnell gehen müssen, und Unruhe überforderte mich in der Regel nun mal. An und für sich war das doch aber eh alles dasselbe, oder? Und, offen gesagt, ging ich davon aus, dass ich sie ohnehin nicht mögen würde. Ich wägte im Ernst ab, ob es Sinn machte, ihr überhaupt noch die Tür zu öffnen.
Es war jetzt genau sechzehn Uhr. Meine schlechte Laune wurde immer sichtbarer, nicht zuletzt deshalb, weil ich heute noch keinen Fuß vor die Tür gesetzt hatte, aus Angst, ich könnte all die Interessentinnen sonst nicht unter einen Hut bekommen. Ja, ich hätte auch eine Massenbesichtigung arrangieren können, aber wie hätte ich unter diesen Umständen herausfiltern können, wer zu mir passte? Na ja, und natürlich hatte ich auch Bedenken in Hinblick meiner Wertgegenstände im Haushalt. Was, wenn ich den Überblick verloren und jemand meine Wohnung in einem unaufmerksamen Augenblick geplündert hätte?
Ich brauchte frische Luft; und zwar jetzt! Und was ich noch viel dringender brauchte, waren ein paar Nahrungsmittel. In meinem Kühlschrank herrschte gähnende Leere. Heute Morgen hatte ich das letzte trockene Stück Brot mit Ketschup gegessen, was darauf schließen ließ, dass ich schon gestern nicht zum Einkaufen gekommen war. Und deshalb war es doch nur allzu verständlich, dass meine Laune allmählich in den Keller brauste: Mein Magen tobte vor Hunger.
Einen kleinen Augenblick dachte ich angestrengt nach. Dabei knabberte ich auf meiner Unterlippe herum und rieb mir das Kinn, als könnte das meine kleinen grauen Zellen in Gang bringen.
Doch als ich mich endlich für einen Veggie-Döner aus dem Imbiss von gegenüber entschieden hatte und nach meinem Hausschlüssel aus der kleinen Bambusschale auf dem Sideboard neben dem Eingang schnappen wollte, klingelte es an der Haustür. Lang und schrill. Na schön, für den hochfrequenten Klingelton konnte die gute Lena, Lana oder Lene natürlich nichts, für das Dauerklingeln allerdings schon. So etwas Penetrantes käme mir schon mal nicht ins Haus!
Anstandshalber öffnete ich die Haustür per Knopfdruck, ersparte mir schon den ganzen Tag, die ankommenden Interessentinnen durch die Gegensprechanlage zu begrüßen. Ich zog die Wohnungstür auf, schon bevor sie den zweiten Stock erreichte, um sie wissen zu lassen, wo ihr Aufstieg enden würde.
Sie ließ mich lang zappeln. Sie schien alles Zeitraubende gut zu beherrschen. Das machte sie just noch unsympathischer.
Mit einem Mal jagte Mailys aus dem Nichts durch meine leicht gespreizten Beine hindurch direkt in meine Wohnung. Sie fetzte wie von der Tarantel gestochen über das Sofa, einmal quer durch die Küche ins Schlafzimmer, sprang auf mein Bett, hielt eine Sekunde mit spitz aufhorchenden Ohren inne und raste dann, knapp an meinen Beinen vorbei, zurück ins Treppenhaus. Dort bremste sie kurz vor der hinabführenden Treppe ab, rutschte jedoch noch ein bedenkliches Stück auf dem Po weiter. Aber statt die Treppe herunterzupurzeln, wendete sie am Absatz, um dieselbe Runde nochmals zu nehmen. Im selben Moment stolperte mein Nachbar Vincent hastig aus der dritten Etage hinunter, warf mir lediglich einen schnellen, um Verzeihung bittenden Blick zu und drängte mich an meiner eigenen Wohnungstür zur Seite, um Mailys einzufangen. Offensichtlich erfolglos.
Ich eilte ihm nach, fühlte mich noch ein bisschen von Vincents rüden Art angepisst, ließ mir jedoch nichts anmerken. Vielmehr wollte ich ihm behilflich zur Hand gehen, indem ich die ungestüme Jack-Russel-Hündin mit sanfter Sprache anzulocken versuchte. Da das keine Wirkung zeigte, hätte ich sie zu gern mit einer Scheibe Wurst bestochen. Jeder Hund war schließlich bestechlich.
Ich sah Vincent seiner Hündin in mein Schlafzimmer hinterherlaufen, fand das einfach ungeheuerlich, wie er ganz selbstverständlich in meine Privatsphäre einbrach, als wäre ich kaum von Bedeutung. Es stand mir bis zum Hals, musste mich wirklich beherrschen.
Da fiel mir plötzlich ein, dass noch ein paar Karamellbonbons in meiner Nachttischschublade lagen. Ich schlich mich also an Vincent, der inzwischen auf allen Vieren auf dem Boden kroch, da Mailys sich unter dem Bett versteckt hatte, vorbei und fühlte, wie sich meine Kehle zuschnürte. (Wann hatte ich schon mal einen Mann in meinem Schlafzimmer?) Auf den letzten Metern machte ich einen Hechtsprung an die Schublade und grapschte fieberhaft nach einem Bonbon. Ich hockte mich hin, neigte mich so weit es mir möglich war zur Seite, um einen Blick auf die Hündin zu erhaschen, und lockte sie an, indem ich auf ihrer Augenhöhe ein wenig mit dem Papier knisterte.
Keine fünf Sekunden später und ohne Vorwarnung schoss sie unter dem Bett hervor, schnappte feinfühliger als gedacht nach dem Bonbon und fetzte durch die offene Wohnungstür wieder in den dritten Stock hoch. Vincent sah mich böse an, da er befürchtete, dass Mailys das Bonbonpapier mit herunterschlingen und daran ersticken könnte. Doch offenbar gelangte er zu dem Entschluss, seine Worte nicht an mich zu verschwenden und rannte stattdessen Mailys schreiend hinterher.
Mein Blut geriet in Wallung. Wutentbrannt stampfte ich zur Wohnungstür und knallte sie mit aller Kraft zu. Ich konnte hören, wie dieses Geräusch durch das ganze Treppenhaus hallte und 007 kurz darauf seine Tür aufriss, um brüllend um Ruhe zu bitten.
Vincent war mir generell recht ignorant zugewandt. Es machte keinen Unterschied, ob ich ihm ein Lächeln zuwarf oder eine ablehnende Grimasse zog, wenn ich ihm im Treppenhaus begegnete; nach Möglichkeit vermied er ja ohnehin Augenkontakt. Allerdings konnte ich mir bis heute nicht erklären – ja konnte es nicht einmal erahnen –, welches Problem ihn plagte und warum es ihm Anlass gab, mich nicht einmal anständig zu grüßen.
Vor einigen Monaten hatte ich ein Päckchen für ihn entgegengenommen, als der Zusteller ihn nicht persönlich antreffen konnte. Und als ich es Vincent am Abend mit den Worten: »Stets zu Ihren Diensten« und einem neckischen Augenzwinkern überbracht hatte, hatte er sofort ein miesepetriges Gesicht aufgesetzt. Mit einer naiven Freundlichkeit hatte ich ihn gefragt, was für eine Laus ihm über die Leber gelaufen sei, denn mir war nicht klar gewesen, dass dieses miesepetrige Gesicht mir gegolten hatte. Daraufhin hatte er schonungslos geantwortet er hätte etwas dagegen, wenn ich für ihn Pakete entgegennehmen würde.
Anfänglich hatte ich gedacht, Vincent wäre einfach nur ein recht verschrobener, unterkühlter Charakter, doch über die Zeit musste ich betrüblicherweise erkennen, dass sich sein unzivilisiertes Verhalten ausschließlich auf mich bezog. Beck hatte mir schon damals verklickern wollen, dass ich mir das nur einbilden würde, immerhin hätte Vincent sich in all den Jahren ihm gegenüber stets angemessen verhalten, waren gar zu Freunden geworden.
Tja, dazu müsste ich Beck wohl noch einmal meine unbequeme Meinung geigen.
Auf einmal wurde mein Denkvorgang von einem Geräusch unterbrochen, das ein wenig danach klang, als hätte jemand eine Schranktür geschlossen. Das Geräusch kam aus dem zu vermietenden Zimmer. Ich pirschte mich an die Tür heran, die nur einen winzigen Spalt offen stand. Dennoch erhoffte ich mir einen Einblick. Das war natürlich lächerlich.
Mein Atem ging schneller, mein Herz ebenfalls. Ich blieb kurz stehen und verhielt mich möglichst still, um nach einem weiteren Geräusch zu lauschen. Ich meinte, leise Bewegungen wahrzunehmen, aber ich konnte mich auch irren, denn meine rote Seidenbluse raschelte bei jedem Atemzug. Ich stellte Überlegungen an, auch, ob ich nicht besser die Beine in die Hände nehmen und flüchten sollte. Aber mit einem Mal überkam mich der tiefe, innere Drang, meine Neugierde befriedigen zu wollen, und wenn es das Letzte war, was ich tun würde. Also ging ich weiter, hielt den Atem an und stieß die Tür mit dem Fuß auf.
Eine gefühlte Minute am Stück schrie ich. Der Schreck saß tief, wollte und wollte nicht vergehen, obwohl ich zuvor ja das Allerschlimmste erwartet hatte. Ich zitterte am ganzen Leib, meine Knie fühlten sich taub an, musste mich erst einmal irgendwo hinsetzen. Mir wurde ganz übel, deshalb knetete ich meinen Hals.
Ein Typ, jungenhaft, mittelgroß, brit-poppiger Shag mit einem unordentlichen Seitenscheitel (wenn ich sonst keine Ahnung von solchen Dingen hatte, kannte seit Justin Bieber wohl ausnahmslos jeder diese Frisur), glotzte mich mit großen eisblauen Augen an, als wäre meine Anwesenheit in dieser Wohnung nicht normal. Eigentlich glotzten wir uns gegenseitig an, einer geschockter als der andere.
Bis ich allmählich wieder zu mir kam und begriff, was hier vor sich ging. Und schlagartig überkam mich die Wut. Vincent hatte Glück: er wurde gerade von diesem wildfremden Typ getoppt!
Er las mir meine miese Laune von den Augen ab. Und ehe ich das Hühnchen mit ihm rupfen konnte, kam er mir zuvor: »Hallöchen, ich bin Philipp Söderqvest«, stellte er sich vor und versuchte, möglichst beschwingt dabei zu klingen. Er kam zu mir herübergeeilt und begrüßte mich mit weit ausgestrecktem Arm. Es schien, als wolle er mich mit dieser Geste auf Distanz halten. »Machste einen auf Bruce Lee?«
»Wer zum Teufel sind Sie?«, ließ ich seine freche Bemerkung unberücksichtigt und ging in Förmlichkeit über, obwohl er augenscheinlich jünger war als ich.
»Sie waren mit dem Hund beschäftigt«, erklärte er hastig. »Hab Sie angesprochen, aber Sie haben mich nicht registriert.«
Dem Anschein nach hatte mich der Vorfall mit Mailys und Vincent derart aus dem Konzept gebracht, dass ich ganz vergessen hatte, warum ich die Wohnungstür ursprünglich geöffnet hatte.
»Ach so, und da dachten Sie, Sie könnten derweil in der Wohnung herumschleichen und mir einen Heidenschreck einjagen, statt an der Tür stehenzubleiben, bis ich bei Ihnen bin?«
Er nickte. »Ja, das war der Plan – Sie zu erschrecken.« Jetzt mutierte er auch noch zu einem spitzzüngigen Komiker.
»Wir brauchen uns gar nicht weiter zu unterhalten. Ich vermiete das Zimmer nicht an ein männliches Geschöpf.« Ich erhob mich vom Stuhl und bat ihn mit einer Handbewegung, mich zur Wohnungstür zu begleiten.
Er folgte mir nur widerwillig.
Ich war im Begriff die Türklinke hinunterzudrücken, als er seine Hand auf meine legte und mich bat, ihm eine Chance zu geben. Ich lachte kurz, hell und ein bisschen schäbig auf. Doch er meinte es wirklich ernst. Sein Blick war durchdringend und flehend zugleich.
Er war beklagenswert. Das führte immerhin dazu, dass ich meine Grundsätze noch einmal überdachte. Waren diese überhaupt stichhaltig? Es sah zwar nicht danach aus, dass er zurzeit unter einer Kanalbrücke dahinvegetierte, doch er wirkte durchaus wie jemand, der auf dem schnellsten Wege ein neues schützendes Dach über dem Kopf brauchte.
Was genau sprach eigentlich dagegen, das Zimmer einem Mann zu überlassen? Dass er ein Mann war? Diese Begründung fand selbst ich in diesem Moment etwas dünn. Ja, was sprach schon dagegen, diesem Philipp Söderqvest (sein Name klang verdächtig schwedisch) das Zimmer zu vermieten, wenn mir doch die weiblichen Geschöpfe partout nicht zusagten? Vielleicht konnte ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen, mit einer Frau in einer Gemeinschaft zu leben, weil ich es leid war, mein Leben mit Frauen zu teilen, nachdem ich es neun lange Jahre im Kloster getan hatte? Vielleicht hatte das Jahr, das ich mit meinem Bruder und dessen Lebensgefährten Hugo verbracht hatte, mich und meine Ansichten mehr verändert als gedacht?
Er erkannte mein Zögern, wusste das auch sofort für sich zu nutzen, indem er mich mit einer sanften Geste dazu bewegte, zum Sofa hinüberzugehen. »Lassen Sie uns nur kurz darüber sprechen, in Ordnung?« Er lächelte zuckersüß. Auf einmal wirkte er noch viel jungenhafter, so dass ich seine Volljährigkeit allen Ernstes infrage stellen musste. Jedenfalls fühlte ich mich schlagartig steinalt.
Ich war gespannt, mit welchen Argumenten er mich umstimmen wollte.
»Also, erst einmal möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hier so überfalle. Aber nachdem Sie mich am Telefon nur abgefertigt haben, war ich der Auffassung, ein persönlicher Kontakt könnte viel mehr für mich sprechen.«
Siezte er mich nur der Manieren wegen oder war ich ihm zu reif? Genau das ging mir gerade durch den Kopf, während er sich an Erklärungen versuchte.
»Ich suche einen Mitbewohner und keinen Geschäftspartner.« Ich bot ihm das Du an. Und zu meiner Überraschung sah er erleichtert aus. Galant erhob er sich ein Stück und reichte mir nochmals die Hand. Er trug ganz schön dick auf, doch was blieb ihm weiter übrig? Er wollte dieses Zimmer – um jeden Preis!
»Du hast mit dem Sie angefangen ...« Er stutzte, denn er war sich nicht sicher, ob er meinen Vornamen kannte. »Wie … wie heißt du?«
Ich stellte mich mit Heidi vor und wartete auf eine dieser spöttischen Reaktionen auf meinen Namen.
Zunächst grinste er nur. Dann: »Oh, ein neuer Stern am Modelhimmel«, amüsierte er sich köstlich.
Hatte er mich gerade mit einem Model verglichen? Ich fühlte mich gründlich verkohlt. Ganz bestimmt war ich nicht darauf aus, mich kleiner zu machen, als ich war, doch ich war schon sehr unscheinbar, wog bei einer Größe von einhundertdreiundsiebzig Zentimetern vierundsechzig Kilo, hatte zu wenig Brust, dafür einen Tick zu viel Hintern (wenngleich ich persönlich der Überzeugung war, dass die Unstimmigkeiten im Bereich des Erträglichen lagen), hatte einen breiten Kiefer und meine Füße neigten dazu, beim Gehen nach innen zu zeigen.
Zweifellos war mir das noch nie passiert. »Willst du das Zimmer nun haben?«, machte ich meinem Unmut Luft.
»So habe ich das nicht gemeint.« Nervös rutschte er mit dem Hintern auf dem Polster hin und her. »Ich finde dich wirklich nicht zu dick. Es ging mir rein um den Namen.« Ich merkte ihm an, wie es ihm gemächlich dämmerte. Wie konnte er auch annehmen, dass er der Einzige war, dem zu meinem Namen etwas so Glorreiches eingefallen war?
Ich ließ ihn in dem Glauben, dass ich ihm das Fettnäpfchen, in das er ungewollt getreten war, krummnahm, da er sich, meiner Einschätzung nach, seiner viel zu sicher fühlte.
»Eigentlich erwarte ich noch eine Interessentin.« Lena, Lana oder Lene würde sich hier wohl nicht mehr blicken lassen; das war die unbequeme Wahrheit.
»Meinst du Jane?«
Ich schenkte ihm ein verwirrtes Blinzeln. Nicht nur, dass er Bescheid zu wissen schien, noch dazu kannte er den richtigen Namen der vorletzten Interessentin. »Hast du Jane um die Ecke gebracht, damit du ihre Stelle einnehmen kannst, oder was?«
Er lachte gellend auf.
Und ich zuckte zusammen.
Sofort schoss mir 007 von unter mir durch den Kopf. Mir fiel wieder ein, dass er allzeit die Flöhe husten hörte. Mich hätte es also keineswegs gewundert, wenn es in der nächsten Minute an meiner Tür klingeln würde. Tat es aber nicht.
Endlich hatte Philipp sich wieder beruhigt. »Ich habe das Mädchen abgefangen und erklärt, dass das Zimmer bereits vermietet ist ... an mich.« Wieder kam dieses jungenhafte Lächeln zum Vorschein. »Sie war ein bisschen sauer auf dich, aber irgendwann geht auch das wieder vorbei.«
Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich an die Decke gehen oder mich geehrt fühlen sollte. Ich entschied mich für irgendetwas in der Mitte. »Du kannst doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden ...«
Er war risikobereit und unterbrach mich: »Sie hätte nicht zu dir gepasst!«
»Ach, und du schon?« Meine Stimme überschlug sich und ihr Klang glich beinahe meiner Türklingel.
»Jungs sind viel pflegeleichter«, glaubte er offenbar, dass es kein schlagenderes Argument gab.
Der ganze Austausch gestaltete sich allmählich immer komplizierter. Ich wollte Fakten und ging daran, ihn gründlich und konzentriert auszufragen.
»Wie bist du an meine Adresse gekommen?«, schließlich war diese in der Tageszeitung nicht abgedruckt.
»Ich habe meine Schwester gebeten, sich für Ramona auszugeben, nachdem du mich unberührt hast abblitzen lassen.«
Ich versuchte, mich nicht künstlich aufzuregen und nickte die Antwort nur ab. Zuletzt war ich nur froh darüber, dass er kein Spion oder gar ein Stalker war.
Im Kopf machte ich also einen grünen Haken hinter Ramona!
»Wie alt bist du?«
»Dreiundzwanzig.« Er wirkte unverkrampft und ging bravourös mit meiner Vernehmung um.
Schade, dachte ich, er ist ja noch ein Kind! »Was machst du beruflich?«
»Ich bin im dritten Jahr meines Medizinstudiums.«
Oh, er war also ein angehender Arzt. Kurz überrechnete ich die Jahre, die er in etwa benötigen würde, um seinen Facharzt in der Tasche zu haben. Dabei wäre es weitaus interessanter gewesen, von was im Fall der Fälle er gedachte, die Miete für das Zimmer zu bezahlen.
»Na, ich bekomme Unterhalt von meinen einkommensstarken Eltern. Und außerdem jobbe ich abends als Barkeeper.«
Barkeeper erzeugten in mir überwiegend ein unangenehmes Gefühl. Nicht, dass ich viele kennen würde (ich ging nicht aus in Bars), aber ihr Ruf eilte ihnen nun einmal voraus.
»Hast du eine Freundin?« Ich musste das fragen, denn ich wollte mich darauf einrichten, wer künftig innerhalb meiner Privatsphäre verkehren würde. »Oder bevorzugst du mehr noch wechselnde Partner?« Okay, okay, ertappt, das interessierte mich auch ganz persönlich. Und er schien das auch zu bemerken. Deshalb fügte ich hintendran: »Ich bestehe nämlich darauf, dass es hier so ruhig und stressfrei wie möglich zugeht und will nicht das Gefühl haben, mein Leben wäre eine einzige Party«, auch wenn sich das für ihn sterbenslangweilig anhörte.
Er schmunzelte. Ein wenig verlegen sah er dabei aus, was in mir erneut das Gefühl auslöste, ich wäre seine Erziehungsberechtigte.
»Ich habe keine Zeit für eine Freundin. Ich lebe für die Arbeit.« Er wies mich darauf hin, dass er in seiner Freizeit zumeist schlief und dass ich erstaunt wäre, wie selten ich ihn zu Gesicht bekäme. Das beruhigte mich einigermaßen.
Dann beschloss ich, mich nicht weiter wie eine alte Glucke aufzuführen. Letztendlich hatte ich nicht vor, Philipp zu erziehen, sondern einen Mitbewohner zu finden, der zu mir passte. Es fiel mir auch nicht länger schwer, mich auf ihn einzulassen, denn die Chemie zwischen uns stimmte.
Ich erlöste ihn und klärte ihn dafür über die Wohnsituation auf. Eigentlich gab es fast gar keine Bedingungen. »Mein Schlafzimmer ist tabu. Es gibt keine Haushaltskasse – jeder sorgt für sich. Den Kühlschrank unterteilen wir. Es gibt keinen Putzplan, denn jeder ist für sich verantwortlich.« Mehr wollte mir zunächst nicht einfallen.
»Heißt das etwa, ich bekomme das Zimmer?« Es schien ihm jede Bedingung recht zu sein, wenn er dafür nur dieses Zimmer bekäme.
»Tja, ich schätze schon.« Ich war selbst von mir überrascht, denn es war ein viel zu spontaner Entschluss. Ich fürchtete, dass ich diesen eines Tages bereuen könnte, aber im Moment fühlte es sich schlichtweg richtig an.
Er war sprachlos. Hatte es doch anfänglich nicht danach ausgesehen, dass ich, die spröde Klosterfrau, aufgeschlossen genug für neue Wege sein könnte.
»W-w-wann darf ich einziehen?«, stammelte er vor Begeisterung, wirkte so, als müsste er sich beherrschen, mir nicht um den Hals zu fallen. Es bestärkte mich darin, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte.
»Zum ersten Juli.« Das war in einer Woche. »Inzwischen mache ich den Mietvertrag fertig und sorge dafür, dass alles geregelt ist.«
***
Genervt schleuderte ich die beiden Taschen mit den Lebensmitteln auf die Ablagefläche der Küche. Es schepperte einmal kräftig, und ich hoffte, dass die Einweckgläser heil geblieben waren. Gleichzeitig klingelte unermüdlich das Telefon. Es hatte bereits geklingelt, als ich zur Tür hereingekommen war. Ich blieb hart und ging nicht dran, denn im Moment hatte ich nur ein einziges Ziel: die tiefgefrorene Pizza Funghi in den Ofen zu schieben und dann mir in den Mund. Nichts und niemand könnte mich jetzt davon abhalten!
Während die Pizza im Ofen endlich aufbuk, sortierte ich alle anderen Lebensmittel ein. Nur den Streukäse, den ich später zusätzlich auf die Pizza geben würde, ließ ich auf der Ablage liegen. Ich inspizierte den Kühlschrank von oben bis unten. Sollte ich besser kleine Namensschilder vorn an den Gittereinsätzen anbringen, damit Philipp von vornherein den Regeln gegenübergestellt sein würde? Oder wäre das zu albern? Schließlich könnte ich ihm auch so viel Verstand zutrauen, das Seinige und das Meinige auseinanderhalten zu können, nicht wahr?
Erneut klingelte das Telefon. Ich rang mich durch, wenigstens einmal einen Blick auf das Display zu riskieren, nur um mich zu vergewissern, dass es kein Notfall war. Es war Beck, mein penetranter Bruder. Obwohl alles in mir Widerstand leistete, schnappte ich mir das Telefon und ging dran. Wenigstens könnte das Gespräch mir die Zeit bis zum Essen verkürzen.
»Alles in Ordnung? Ich wollte mal hören, ob sich denn heute eine passende Mitbewohnerin gefunden hat?«
Selbstverständlich ging es nur darum! Schon seit dem ersten Besichtigungstag rief er mich jeden Abend an, um die Lage zu checken.
Ich blickte auf die Uhr. Beinahe acht. Mir war zuvor gar nicht bewusst gewesen, dass es schon so spät war.
»Entschuldige, ich bin ein wenig überreizt. Ich will nur noch etwas essen und dann ab ins Bett.«
Beck traute seinen Ohren nicht. »Ins Bett? Es ist noch strahlend hell draußen.«
»Wofür gibt es Jalousien?«
»Na hör mal!« Dem Vernehmen nach konnte er nicht fassen, dass ich um diese Zeit nichts Besseres zu tun hatte. »Dann ist es trotzdem noch strahlend hell. Aber verleugne du ruhig weiter die Realität mit deiner Jalousie.«
Ich ließ mir ungern in meine Lebensweise reinreden, deshalb stöhnte ich muffelig. »Erstens bin ich seit fünf Uhr in der Früh auf den Beinen und zweitens kann ein Besichtigungstag ganz schön schlauchen.«
Er meinte, mir anhören zu können, dass wieder niemand meinen Anforderungen gerecht geworden war. »Du bist aber auch überaus anspruchsvoll!«
Ich lachte. Ich hielt den Hörer von meinem Mund fern, damit Becks Trommelfell nicht zerfetzt würde. Natürlich kannte er die Ursache meines Ausbruchs nicht, lachte jedoch mit mir, wenn auch nur verhalten. Ich gedachte auf sein Urteil zu antworten: »Man kann wohl kaum von Anspruch sprechen, wenn man nach allem Übrigen auf einen Kerl zurückgreifen muss«, doch dann fiel mir noch gerade rechtzeitig auf, wie männerfeindlich das klänge.
»Die Suche hat ja jetzt ein Ende«, berichtete ich mit großer Erleichterung in meiner Stimme. Und jetzt, da ich es ausgesprochen hatte, wurde es mir erst so richtig klar.
Beck war nicht ganz sicher, ob er sich verhört hatte. Er wollte jeden Zweifel ausräumen: »Willst du damit sagen, du warst heute erfolgreich?« Es wirkte, als hätte ich sein ganzes Weltbild durcheinandergebracht.
»Bin ich wirklich so hoffnungslos?«
Mein Bruder räusperte sich. Er brauchte viel zu lange für eine Antwort. Na vielen Dank auch! »Ich würde das nicht unbedingt hoffnungslos nennen.«
»Sondern?« Warum wollte ich das so genau wissen? Es würde ja wohl nicht sehr viel besser werden, oder?
»Du musst eben erst wieder mit dem Leben vertraut werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich.« Er wirkte selbst nicht ganz von seinem Argument überzeugt. »Allerdings«, warf er hinterher, »ist dir die Freiheit ja schon seit einem Jahr wiedergegeben. Eigentlich ...«
Ich fiel ihm ins Wort: »Nun ist aber gut!« Er machte mich ganz zornig. »Du tust ja gerade so, als wäre ich zu gar nichts zu gebrauchen.« Zugegeben, ich war nicht gerade ein Energiebündel und vielleicht nahm ich mir für Entscheidungen ein bisschen mehr Zeit als andere, da ich ungern Dinge übers Knie brach, doch deshalb musste man ja nicht so tun, als wäre ich völlig weltfremd und müsste nun wie eine Blinde ans Leben herangeführt werden. Wieso glaubte mein Umfeld immerzu, man würde im Kloster völlig verdummen?
Beck stieß den Atem grantig aus. »Lassen wir das, es bringt uns immer wieder an diesen Punkt. Und darauf habe ich keine Lust.« Richtig, das war nicht das erste Mal, dass wir das Thema durchzudiskutieren versuchten.
»Ich möchte dich daran erinnern, dass du wieder mit den unterschwelligen Bemerkungen angefangen hast.« Ich erschrak vor mir selbst, denn kaum war der Satz beendet, kam ich mir vor wie ein Baby. Manchmal führte ich mich wirklich unreif auf. So entschuldigte ich mich auf der Stelle für mein kratzbürstiges, überempfindliches Verhalten und nahm meinen exorbitanten Hunger als Vorwand. Und jetzt, da sich der Raum mit dem Pizzaduft nach und nach füllte, lief mir das Wasser im Munde zusammen und machte die Gesamtlage noch unerträglicher.
Er kannte mich nicht erst seit gestern und machte deshalb auch keinen Staatsakt draus. Ich konnte sein Lächeln durch die Hörmuschel hören. »Was ich nur sagen möchte, ist, dass es dir gehörig an Selbstbewusstsein fehlt. Aber lass uns von etwas anderem reden, in Ordnung? Zum Beispiel von deiner zukünftigen Mitbewohnerin.« Tatsächlich war Beck eine recht zänkische Person, die immer alles totdiskutieren wollte und kaum mit seiner Meinung hinterm Berg halten konnte. Doch sein Interesse an die »Mitbewohnerin« war jetzt einfach viel größer.
Erst jetzt registrierte ich, dass ich ihn noch gar nicht darüber aufgeklärt hatte, dass es keine Sie, sondern ein Er war. Plötzlich scheute ich mich davor, weil ich befürchtete, Beck könnte mich für verrückt halten. Außerdem spielte er sich gern wie ein Vater auf, was sich, wie zu vermuten war, daraus ergab, dass Vater seine Familie schon in frühen Jahren für eine andere Frau hinter sich gelassen hatte. So hatte Beck auch noch heute das große Bedürfnis, die Hand schützend über mich zu halten.
»Es ... es ist keine Sie!« Ich hielt inne. Nach außen hin könnte es eine Kunstpause gewesen sein, doch der eigentliche Sinn dahinter war, dass ich mir eine klitzekleine Reaktion erhoffte, die mir vermittelte, dass alles bestens war.
War diese Stille am anderen Ende nun ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen? Ich wollte es herausfinden und redete weiter.
»Er heißt Philipp, ist dreiundzwanzig Jahre alt, studiert Medizin, jobbt als ...«
»Wie um alles in der Welt kam es denn dazu?«, fuhr er mir fassungslos ins Wort, als hätte er mir gar nicht zugehört, nein, vielmehr, als hätte er gar nicht bemerkt, dass ich überhaupt ein Wort gesprochen hatte.
»Ich weiß auch nicht.« Natürlich wusste ich es, ich wollte nur vermeiden, dass Beck mich für naiv hielt. Doch leider musste ich feststellen, dass ich mir mit meiner aktuellen Antwort auch keinen Gefallen getan hatte.
»Du weißt auch nicht?«
Augenblicklich fühlte ich mich, als hätte ich irgendetwas verkehrt gemacht. Warum bloß ließ ich mich immer so kleinkriegen, selbst dann, wenn es niemand darauf abgesehen hatte? »Na-na-natürlich weiß ich es«, stotterte ich geistlos.
Völlig perplex fragte Beck: »Was ist bei dir da drüben los?«
Ich fürchtete, dass er sich ins Auto setzen und in rasender Geschwindigkeit zu mir kommen würde, um höchstpersönlich nach dem Rechten zu sehen. Der Gedanke daran spornte mich an, ihm zu signalisieren, dass alles seine Richtigkeit hatte. »Er hat sich klammheimlich eingeschlichen. Aber das ist gut so, Beck«, erklärte ich, während ich die Backofentür aufklappte, um nach meiner Pizza zu schauen. Die flirrende Hitze, die dabei entwich, war kaum auszuhalten und ich ging zwei Schritte zurück. Dabei griff ich nach dem Streukäse, der auf der Arbeitsplatte noch immer auf seinen Einsatz wartete. Um die Tüte problemlos aufschneiden zu können, klemmte ich das Telefon zwischen Ohr und Schulter. Dann verteilte ich den Käse großzügig auf der Pizza und schloss den Ofen wieder mit einem Fußtritt. »Ich meine, ich scheine ja nicht besonders gut mit Mädels zurande zu kommen. Und mit Philipp bin ich gleich warm geworden.«
Beck wurde das Gefühl nicht los, den Anschluss verpasst zu haben und fragte nach Hintergrundinformationen. Und ehe die Geschichte im heillosen Durcheinander enden würde, begann ich, sie von vorn zu erzählen – so wie es sich gehörte. Als ich fertig war, erntete ich zuvor ewiges Schweigen.
»Das klingt alles sehr sonderbar.« Ich hätte wissen müssen, dass er nichts davon halten würde.
»Was ist denn daran sonderbar?«
Becks Atem ging schwer. »Ach, egal! Ich möchte dir da nicht reinreden.« Diese Antwort ließ unmissverständlich verstehen, dass er sehr wohl danach dürstete, sich jedoch alle Mühe gab, es nicht zu tun. Vermutlich fiel ihm von Zeit zu Zeit mein Alter wieder ein und dass ich durchaus in der Lage war, Entscheidungen allein zu treffen.
Ich ersparte mir, auf irgendeine Weise darauf einzugehen. Stattdessen erklärte ich ihm, dass meine Pizza fertig sei. Er reagierte etwas verschnupft. Aber ich war wirklich hungrig und hatte keine Nerven mehr, mich wieder einmal umfassend belehren zu lassen.
»Lass es dir schmecken, Püppi«, verabschiedete er sich einigermaßen erhaben. Ich ahnte, dass ihm diese Neuigkeit eine unruhige Nacht bescheren würde.
Aber das brachte mich nur zum Schmunzeln.
3
Seit einer Stunde leistete ich Hanna Gesellschaft. Die letzten Tage war es bedenklich still um sie geworden. Jetzt kannte ich auch den Grund. Nein, ausnahmsweise ging es nicht um ihren dreißigsten Geburtstag. Es ging um einen Mann!
»Ich bin nicht vorbeigekommen, um mir den ganzen Abend lang deine Trauermiene reinziehen zu müssen«, zehrte mich ihr nicht enden wollender Trübsinn aus. Eigentlich hatte ich im Sinn gehabt, ihr von Philipp zu berichten, der morgen bei mir einziehen würde. Aber das stand nun hinten an.
»Ich weiß, ich bin zurzeit eine weinerliche Memme«, erklärte sie schluchzend und schnäuzte sich laut in ihr Tempo, »aber momentan steckt einfach der Wurm drin.« Ich erkannte, dass sie mit dem Pflaumenwein in der Vitrine liebäugelte. »Als hätte ich nicht schon Komplexe genug, verlässt mich der Scheißkerl auch noch!« Sie hielt mir eine Hand vor die Nase, zog mit der anderen an dessen Rücken eine Hautfalte hoch, um zu demonstrieren, wie ledrig sie jetzt