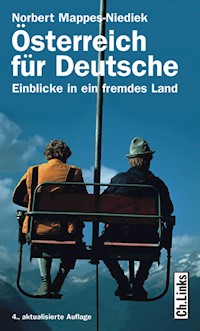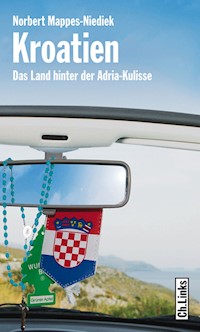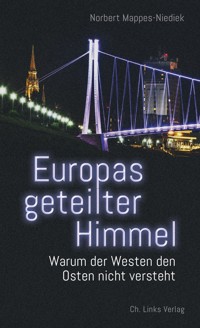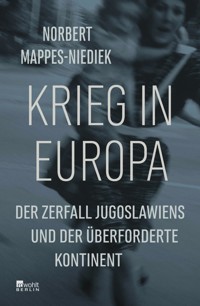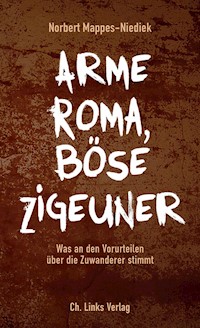
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Links, Ch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik & Zeitgeschichte
- Sprache: Deutsch
Warum kommen die Roma in Osteuropa aus ihrem Elend nicht heraus? Sind sie arm, weil sie diskriminiert werden, oder werden sie diskriminiert, weil sie arm sind? Sind sie arbeitsscheu, kriminell und womöglich dümmer als andere? So wird oft gefragt, wenn auch meistens hinter vorgehaltener Hand. Und die Antwort kennt man natürlich: »typisch Roma.«
Der langjährige Balkan-Korrespondent Norbert Mappes-Niediek unternimmt einen Faktencheck und kommt zu überraschenden Befunden. Zugleich kritisiert er die europäische Roma-Politik und die von ihr beförderte »Gypsy industry« fundamental und zeigt alternative Wege auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Norbert Mappes-Niediek
Arme Roma, böse Zigeuner
Was an den Vorurteilen über die Zuwanderer stimmt
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, Oktober 2012 (entspricht der 2. Druck-Auflage von Oktober 2012) © Christoph Links Verlag GmbH Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0 www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Umschlagfoto und -gestaltung: Burkhard Neie, www.blackpen.xix-berlin.de
Inhalt
Was läuft falsch?
Die Ökonomie der Armut oder: Warum kommen sie aus dem Elend nicht heraus?
Auf dem Weg nach Westen oder: Warum kommen sie, und was suchen sie hier?
Faktum und Vorurteil oder: Werden sie überdurchschnittlich oft straffällig?
Geschichte und Kultur oder: Was ist an ihnen so anders?
Das Volk, das keines wurde oder: Sind sie eine Nation oder doch nur eine Unterschicht?
Vom Elend der Politik oder: Wen vertreten die vielen Organisationen eigentlich?
Auf einen Schelmen anderthalbe
»Eure Journalisten, eure Fotografen und manche eurer Schriftsteller beuten uns nach Strich und Faden aus. Sie legen sich die Dinge sogar zurecht, damit sie ihr Publikum besser unterhalten und mehr Geld verdienen können. Sie bereichern sich auf unsere Kosten und belassen uns in unserem Unglück, verschlimmern es oft sogar noch. Deshalb habe ich mein ganzes Leben lang auch nie jemandem etwas erzählt. Wir denken alle so, und deshalb binden wir ihnen, wenn sie allzu sehr darauf bestehen, einen Bären auf und lachen uns ins Fäustchen, wenn die großen Dummköpfe das alles aufschreiben. Auf einen Schelmen anderthalbe setzen: Das ist unsere Rache.«
Zanko Palești
Was läuft falsch?
Sie begegnen einem flüchtig als Bettlerinnen in langen Röcken oder wenn sie einem Schmutzwasser auf die Windschutzscheibe schütten und dafür einen Euro haben wollen. Man weiß nicht viel von ihnen. In den öden Landschaften aus Bahngleisen, Schnellstraßen und LKW-Parks am Rande von Lyon oder Mailand fliegen bei der Fahrt im Zug kleine Hüttensiedlungen vorbei, von denen man sich nicht vorstellen kann, dass da wirklich jemand wohnt. »Das sind Sinti und Roma«, raunt man einander zu. »Aus Bulgarien und Rumänien.« Aber man weiß auch das nicht wirklich, und es stimmt auch nicht: Es sind Roma, keine Sinti, und sie kommen aus allen möglichen Ländern in Mittel- und Südosteuropa, teils als EU-Bürger, teils als Asylbewerber, manchmal einfach so.
Im Niemandsland zwischen irritierender Alltagserfahrung und bruchstückhaftem historischem Wissen gedeiht üppig ein gedankliches und gefühlsmäßiges Unkraut. Sie stehlen und sind arbeitsscheu, behaupten die einen. Sie machen gute Musik und wurden jahrhundertelang verfolgt, erwidern die anderen. Beides widerspricht sich streng genommen nicht. Aber wenn es um Roma geht, hat das Aneinander-vorbei-Reden Methode. Sie sollen eine Minderheit sein und damit den Maßstäben und den Entscheidungen der Mehrheit wenigstens zum Teil entzogen bleiben. Aber niemand kann erklären, was sie eigentlich so grundsätzlich von anderen Menschen unterscheidet. Sind sie eine eigene Nation? Wollen, sollen sie sich anpassen? Wie geht man »korrekt« mit ihnen um? Sind die Roma ein Problem? Oder haben sie eines?
Behörden wissen nicht, ob sie den rätselhaften Wesen helfen müssen oder ob sie sie loswerden können. Politik und öffentliche Meinung schwanken zwischen Abschiebungsphantasien und diffusen Wünschen nach Integration.
Die Überzeugungen und Konzepte der Parteien und politischen Strömungen scheitern allesamt an den Roma aus Südosteuropa. Mit der ordnungspolitischen Strenge der Konservativen kann man die Gefängnisse füllen und den Armuts-Zuwanderern ihre Familien zerschlagen. Spürt man ein verwahrlostes Kind auf und nimmt es der Mutter weg, so provoziert man nur Leid, keine Besserung. Auch die beliebten strengen Grenzkontrollen funktionieren nicht, denn ein Dasein am Rande der Gesellschaft kann man auch ohne Papiere führen. Sozialisten müssen die schmerzliche Erfahrung machen, dass die Roma meistens wenig Aufstiegsorientierung und Bildungshunger zeigen. Statt ihr Leben auf eine unsichere Arbeitskarriere zuzurichten und dann mit ihrer Gewerkschaft für bessere Löhne zu kämpfen, vertrauen die meisten lieber ihren familiären Netzwerken. Liberale schließlich erleben ihr Freiheitspathos und ihr Lob der Vielfalt an den Roma als bösen Spott. Niemand wählt ein Leben im Elend freiwillig, keiner bettelt aus Berufung. Und mangels Kaufkraft nimmt kein Markt sie wahr.
Für die europäischen Institutionen sind die Roma eine »transnationale« oder »europäische Minderheit«. Vor allem den Osteuropäern wollen sie beibringen, dass sie die Roma in ihrer Eigenheit, ihrer Identität zu respektieren haben und dass sie ihnen gleiche Chancen einräumen müssen – und als Kompensation für ihre Diskriminierung vorübergehend sogar bessere. Arm sind die Roma nur, weil man sie als Volk verachtet und ausgrenzt: das ist die Annahme dahinter, und wenn die Mehrheit ihre Haltung ändert, glaubt man in Europa, wird das Problem sich schon lösen. Das ist aber eine fromme Lüge.
Arm sind die Roma in Wirklichkeit aus exakt demselben Grund, aus dem auch viele Nicht-Roma in Ost- und Südosteuropa arm sind: Es fehlt an bezahlter Arbeit. Die Beschäftigungsrate ist überall in der Region in den letzten zwanzig Jahren bis auf etwa die Hälfte zurückgegangen. Am stärksten war der Schwund bei den minderqualifizierten, den typischen Roma-Jobs. Nicht Ausgrenzung wie im Westen war in Osteuropa historisch das Problem der Roma, sondern ihre niedrige soziale Stellung. Fragt man die Menschen in den Elendssiedlungen Ungarns, Rumäniens oder Serbiens nach ihrem Leben, so erfährt man, dass so gut wie alle jenseits der vierzig früher einen festen Job hatten. Mittlerweile träumen sie nicht einmal mehr davon. Auch in den Slums sind viele erst gelandet, nachdem sie für ihre Wohnungen die Miete nicht mehr bezahlen konnten.
Statt die Armut zu bekämpfen, betreiben die EU und die europäischen Staaten für die Roma Minderheitenpolitik. Natürlich sind Roma auch »anders«, verfügen über eine besondere Kultur, pflegen bestimmte Werte und Bräuche. Aber »anders«, anders als die Mehrheit der Franzosen, Briten oder Deutschen, sind auch die Nordafrikaner in der Banlieue von Paris, die Pakistanis in London und die Türken in Berlin, ohne dass die kulturelle Differenz eine besondere Minderheitenpolitik nötig machen würde. Alle sollen unabhängig von ihrer Herkunft in gleichem Maße an allem teilhaben können, das ist das neue Prinzip.
Was uns Roma-typisch vorkommt, ist in Wirklichkeit oft einfach Balkan-typisch. Die Armut der Roma jedenfalls lässt sich mit ihrer Kultur nicht erklären. Zehntausende Gastarbeiter-Roma aus Jugoslawien leben schon seit den 1960er und 1970er Jahren unerkannt und unauffällig in Mittel- oder Westeuropa. Dass sie sich nicht zu erkennen geben, ist ein trauriges Zeichen dafür, dass es noch immer viele Vorurteile gibt. Dass sie sich aber so mühelos verstecken können, ist der Beweis, dass ihre Kultur eben nicht das Problem ist.
Weil das so ist, hilft Minderheitenpolitik auch nicht gegen die Armut. Die Roma haben nichts, das sie »autonom« unter einander verteilen könnten. Es gibt viele familiäre und örtliche Gemeinschaften und auch ein vages Gemeinschaftsgefühl von Roma über die Grenzen hinweg, aber es gibt keine organisierte Roma-Gesellschaft und auch keinen Grund, eine solche zu entwickeln. Trotzdem wird – teils bewusst, teils unbewusst – fleißig daran gearbeitet – mit dem Versuch, eine »Roma-Elite« zu schaffen, und mit unzähligen Projekten, die von Stiftungen und internationalen Organisationen gefördert werden. Hervorgebracht haben sie eine »Gypsy industry« aus Nichtregierungsorganisationen, die oft nur aus ihrem Vorsitzenden und dessen Bankkonto bestehen und deren Know-how sich im Schreiben von Projektanträgen erschöpft. Den Roma in ihren Slums nützt das Treiben höchstens einmal punktuell; ihre soziale Lage hat sich seit dem Aufblühen der Projektkultur um die Jahrtausendwende eher noch verschlechtert. Wenn Fonds mehr oder weniger ausdrücklich nur für Roma bereitgestellt werden, schafft das in den verelendeten Regionen des Balkan überdies noch Neid und böses Blut.
Als »Roma-Problem« lassen sich die Probleme der Roma und die Probleme mit ihnen nicht lösen. Wenn etwas besser werden soll, müssen die Probleme zunächst bei ihrem richtigen Namen genannt werden. Sie heißen Armut, Arbeitslosigkeit, Bildungsmisere oder unterfinanziertes Gesundheitswesen. Sie zu lösen ist teurer und weniger bequem als die Gründung und Finanzierung eines weiteren Roma-Beirats. Westeuropa braucht eine Modernisierung von Bildungswesen und Verwaltung, Osteuropa zusätzlich ein Infrastrukturprogramm, nicht nur wegen der Roma. Aber wenn wir uns den nötigen Reformen nicht stellen, bleibt auch die große europäische Strategie zur Emanzipation der Roma bloß billige Heuchelei.
Die Ökonomie der Armut oder: Warum kommen sie aus dem Elend nicht heraus?
Nicht einmal in Pata-Rât sind alle gleich. Gabriel, ein Mann in den Vierzigern, kann sich an Geschäftigkeit und Initiativgeist mit jedem Manager messen. Seine Sätze leitet der kräftige, kompakte Mann mit einem Lachen ein, und wenn er erzählt, rudert er mit den Armen. Seinem kleinen Häuschen hat er eine Veranda vorgebaut und sie mit hellroten Kacheln selbst verfliest. Ankommendes Gut checkt er wie ein Schnäppchenjäger, und sein besonderer Stolz ist eine kleine, nicht ganz passende Einbauküche mit glänzenden Schränken und Schubladen. Aber es gibt natürlich auch andere. Elena zum Beispiel, einer dürren Frau von 52 Jahren, steht das Elend ins Gesicht geschrieben. Sie spricht leise und kraftlos und ist zu schüchtern, ihrem Gesprächspartner in die Augen zu blicken. Meistens steht sie allein vor ihrer Hütte, die mit Brettern notdürftig zusammengenagelt ist, und raucht.
Wie alle Leute in den Hütten der kleinen Siedlung an der Müllkippe von Cluj sammeln Elena und Gabriel, was die Städter nicht mehr gebrauchen können. In Pata-Rât leben »Müllmenschen«, wie solche Leute in Reportagen aus Rio de Janeiro oder Buenos Aires doppeldeutig genannt werden. Hält ein Müllwagen an der Sperre vor dem Eingang zur Kippe, klettern als erste die Kinder hinauf und durchwühlen die Ladung, noch bevor der Fahrer sein Ziel erreicht hat und den Abfall auskippt. In der Siedlung, an den Hang einer zugeschütteten Müllhalde gebaut, stehen Hütten aus Holz, Presspappe und Kunststoffplatten. Das Regenwasser bahnt sich seinen Weg durch die Pfade zwischen den Hütten, aber auch zwischen den Platten auf den Dächern. Man geht in Gummistiefeln oder barfuß; alles andere ist sinnlos.
»Die große Armut in der Stadt kommt von der großen Powerteh her«, lässt der Dichter Fritz Reuter einen seiner Romanhelden sagen, wo seine Leser im 19. Jahrhundert doch wussten, dass nur das französische Wort für Armut ist. Analytisch kann der Spruch nicht recht überzeugen. Aber er gibt die Alltagserfahrung der Leute aus Pata-Rât präzise wieder. Wer arm ist, muss für alles teurer bezahlen. Besonders gefragt sind auf der Müllkippe die Flaschen, denn in der Stadt gibt es jemanden, der sie einem abkauft. Über den Erfolg bei dem Geschäft entscheidet die Transportkapazität. Einige hier haben kleine Handwagen. Gabriel hat ein Auto, zwar mit entwertetem Kennzeichen, aber fahrbereit. Elena dagegen muss alles in Taschen in die Stadt tragen. Nur wer fahren kann, kann mit dem Sammeln Geld verdienen. Je mehr man hat, desto billiger wird das Leben. Nur wer Strom hat, kann zum Beispiel mit einer Tiefkühltruhe etwas anfangen, und wer eine Tiefkühltruhe hat, kann abgelaufene Ware aus dem Container hinter dem Supermarkt einlagern. In Pata-Rât holen sich manche den Strom aus Autobatterien von der Müllkippe, was schon zu Bränden geführt hat. An reguläre Stromversorgung oder an ein ordnungsgemäß angemeldetes Auto, gar an einen Führerschein, kommt man nicht ohne Geld. Bei der Kleidung ist das größte Problem, dass man sie im Winter nicht trocknen kann. Wäscht man sie trotzdem, wird man krank, und wäscht man sie nicht, dann stinkt man, und alle gehen einem aus dem Wege. Wer auf der Leiter nach oben hinaus will aus dem Loch, tut gut daran, auch auf die morschen Sprossen der Illegalität zu steigen. Gabriel hat schon mehrere Gefängnisstrafen abgesessen. Aber in Pata-Rât ist Gabriel der Erfolgreichste. Die hier wohnen, nennen den Ort Dallas, wohl weil es hier ähnlich unsentimental zugeht wie in der Ölmetropole.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!