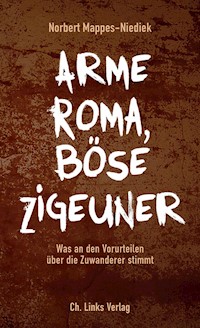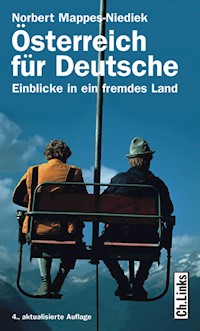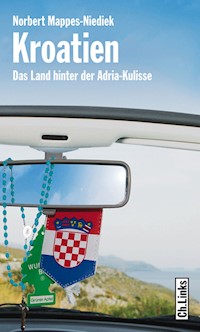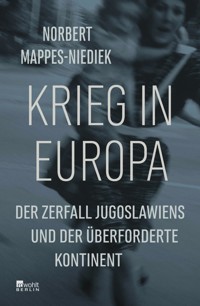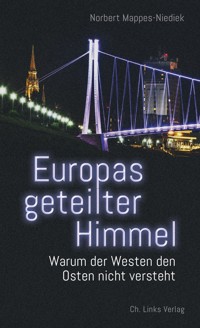
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durch die Geschichte hindurch blickte der Westen auf den Osten herab. Mal war er der Burggraben, der die Festung Europa von den Weiten Asiens trennte, mal eine Art Vorzimmer, mal die Nachhut auf dem großen Weg in die Zukunft. Umgekehrt fühlte sich der Osten vom westlichen Vorbild verkannt und geringgeschätzt, ärgerte sich über dessen Gleichgültigkeit und Arroganz. Die Konflikte werden gerade wieder aktuell.
Norbert Mappes-Niediek beschäftigt sich seit Jahrzehnten als Korrespondent und Politikberater mit Osteuropa. In seinem Buch erklärt er, warum der Ost-West-Gegensatz nach dem Ende des Kalten Krieges nicht überwunden wurde, sondern sich neu aufgebaut hat. Und er zeigt Wege auf, wie man besser miteinander umgehen kann. Der Westen sollte den Osten nicht erziehen wollen, sondern einfach versuchen, ihn zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Norbert Mappes-Niediek
Europas geteilter Himmel
Norbert Mappes-Niediek
Europas geteilter Himmel
Warum der Westen denOsten nicht versteht
Ch. Links Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet
über www.dnb.de abrufbar.
Der Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
1. Auflage, Februar 2021
entspricht der 1. Druckauflage vom Februar 2021
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: Hannah Kolling, Kuzin & Kolling – Büro für Gestaltung, Hamburg, unter Verwendung eines Fotos von Marko Paričić/unsplash.com: Die neue Fußgängerbrücke über die Drau in Osijek (Kroatien)
Karten: Peter Palm, Berlin
Satz: Marina Siegemund, Berlin
ISBN 978-3-96289-112-1
eISBN 978-3-86284-492-0
Inhalt
Für immer auf Platz zwei
Vorurteile in und gegen Europas B-Klasse
Der Missionar und der Intrigant
Geschichte: Ein missglückter Besuch, sein Grund und seine Folgen
Nachbarn und Verwandte
Politik: Im Europa der (ganz verschiedenen) Nationen
Freundliche Übernahme
Wirtschaft: Wie große Gewinner so unglücklich sein können
Brüchige Linien
Alltagskultur: Was uns verbindet und unterscheidet
Osterweiterungen
Wie der Westen erst über den Rhein und dann über die Oder kam
Anhang
Herzlichen Dank!
Anmerkungen
Angaben zum Autor
»Den Himmel wenigstens können sie nicht zerteilen«, sagte Manfred spöttisch.
Den Himmel? Dieses ganze Gewölbe von Hoffnung undSehnsucht, von Liebe und Trauer?
»Doch«, sagte sie leise.
»Der Himmel teilt sich zuallererst.«
Christa Wolf, Der geteilte Himmel
Für immer auf Platz zwei
Vorurteile in und gegen Europas B-Klasse
Das Gras im Garten des Nachbarn ist bekanntlich immer grüner. Auch die Wäsche ist weißer, wie die Frauen von Szombathély wissen. Deshalb bringen sie von Einkaufsfahrten über die nahe Grenze zu Österreich immer einige Packungen Waschmittel mit. Man kriegt dieselbe Marke zwar auch im ungarischen Supermarkt. Da ist sie aber von schlechterer Qualität. Wie überhaupt alles: Tiefkühlpizza, Brühwürfel, Limonade und Keks. Nur die Verpackung ist diesseits und jenseits der Grenze gleich. Beim Inhalt wird man im Osten immer mit B-Ware abgespeist.
Lange war die Erfahrung der Frauen von Szombathély bloßes Alltagswissen oder, wie die Skeptiker es nennen, eine urban legend, etwas, das alle für ausgemachte Sache halten, ohne dass jemand die Quelle nennen könnte. Dann aber griff eines Tages der ungarische Regierungschef das Thema auf. Seine Kollegen in den Nachbarländern stimmten ohne zu zögern ein. Der Präsident der EU-Kommission, ein Mann mit hoch entwickeltem Instinkt, roch sofort das explosionsverdächtige Pulver in dem Thema und ordnete eine Untersuchung an. Sie fand auch statt. Die Ergebnisse der mehrjährigen Prüfungen und Diskussionen umfassen alles, was man über das Verhältnis von Ost und West wissen muss.
Ergebnis Nummer eins: Die Frauen von Szombathély hatten recht; und das gar nicht so selten. Die beliebten Butterkekse eines Hannoveraner Unternehmens zum Beispiel waren im Osten in Wirklichkeit mit Palmöl gemacht. Auch gegen den Vorwurf, sie verkauften sogenannte Mogelpackungen, steckten zum Beispiel in gleich große Chipstüten im einen Land weniger Chips als im anderen, konnten die Hersteller nur schwer argumentieren. Die Aufregung war groß. Eine polnische Zeitung schrieb von »Lebensmittel-Rassismus«, der bulgarische Premierminister sprach von Apartheid. Der Büroleiter des ungarischen Regierungschefs witterte den »größten Skandal der jüngeren Geschichte«. Alle osteuropäischen Länder aktivierten ihre Lebensmittelinstitute, die den Vorwürfen detailliert nachgingen. Wo sie ertappt wurden, redeten die Firmen sich meistens mit den niedrigeren Preisen heraus, die in den ärmeren »Übergangsländern« gezahlt würden. Sie beeilten sich dann aber, ihre Rezepturen und Packungsgrößen zu ändern. Nicht nur die EU, auch die großen Konzerne begriffen schnell, welche Brisanz in den Vorwürfen steckte.
Nur schuldbewusst an die eigene Brust klopfen jedoch wollten die Hersteller nicht. Wo das Qualitätsgefälle nicht bewiesen oder nicht so offensichtlich war, wuschen sie ihre Hände in Unschuld. Zwar gebe es in der Zusammensetzung ihrer Produkte von Land zu Land Unterschiede. Die hätten aber nichts mit der Qualität oder dem Preis zu tun, und schon gar nichts mit Ost oder West. Tatsächlich gehört es zum Grundwissen der Branche, dass sich die Vorlieben von Verbrauchern von Land zu Land und von Region zu Region unterscheiden: In Nordspanien müssen Eidotter dunkel sein, in Südspanien hell. In Böhmen wollen sie saures, in Mähren süßes Brot. »Polnische Konsumenten«, schrieb etwa eine Firma an die EU-Kommission, »haben in Sachen Paprika-Chips völlig andere Geschmackserwartungen als andere EU-Konsumenten.«
Es sei die Kultur, erklärten die Marketing-Experten. Nicht nur bei Lebensmitteln sind die Geschmäcker offenbar verschieden. Spanier wollen Putzmittel mit viel Chlor, Deutsche nicht. In Italien muss das Pulver in der Waschmaschine tüchtig sprudeln und Blasen werfen, sonst denken die Verbraucherinnen: Das wäscht nicht richtig. In Schweden dagegen soll das Waschmittel möglichst nicht auffallen. Dann denkt die Kundin: Es schont die Wäsche.
Die Erklärungen der Hersteller stießen auf wenig Verständnis. In Polen kauften findige Einzelhändler weiter auf eigene Faust Waschmittel von westlich der Grenze und boten sie in kleinen Warschauer Geschäften als »deutsche Haushaltschemie« an, obwohl man die Produkte unter demselben Markennamen auch im Supermarkt um die Ecke bekommen konnte. In einer Umfrage zeigten sich 80 Prozent der Kroaten überzeugt, sie würden von den Konzernen mit minderwertiger Ware abgespeist. Wir bekommen im Zweifel das schlechtere Produkt – Ergebnis Nummer zwei. Die Überzeugung lässt sich nur schwer erschüttern.
Mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen »Kulturen« der Verbraucher hatten die Hersteller alles nur schlimmer gemacht. Zwischen Nord- und Südspanien oder auch zwischen Böhmen und Mähren mögen die Unterschiede Geschmackssache sein. Geht es aber um Unterschiede zwischen Ost und West, steht immer von vornherein fest, was besser ist. Tests helfen da nicht.
Wer zu Hause in Osteuropa mehr Chlor im Putzmittel hat als irgendwo im Westen, ist darauf nicht stolz; wer weniger Chlor bekommt als drüben, auch nicht. Wenn ein Puddingpulver in Slowenien drei Mal so viel Zucker enthält wie in Deutschland, macht es dick und greift die Zähne an. Hat aber die Fanta in Italien doppelt so viel Zucker wie in Ungarn, ist die italienische reich an Geschmack und gehaltvoller. Gut ist, was der Westen hat. Er liefert nicht nur die Produkte, er macht auch die Maßstäbe. Der Umstand bringt jeden Ost-West-Vergleich zum gleichen Ergebnis, egal worum es geht: ob um Limonade, Rechtsgrundsätze, Kunst oder Alltagsverhalten. Erkenntnis Nummer drei lautet: Was im Osten anders ist, wird eben dadurch automatisch zur B-Klasse.
So enden östliche Aufholjagden, auch die erfolgreichen, immer in der Falle, Überholen, wie es einst der Sowjetführer Nikita Chruschtschow wollte, lässt der Westen sich schon per Definition nicht. Wenn damals die Sowjetunion es schaffte, in der Stahlproduktion weltweit zur Nummer eins zu werden, dann nur, um bald darauf zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass Stahl jetzt nicht mehr wichtig war. War man besser als der Westen, blieb die Wertschätzung dafür aus, auch im eigenen Land.
Fünfundsiebzig Jahre lang durfte der Osten nach einer verbreiteten Legende zum Beispiel stolz darauf sein, dass das höchste Gebäude der Welt nicht in London oder Paris stand, sondern in Reval, dem heutigen Tallinn an der Ostsee.1 Aber dass Kirchtürme hoch sein müssen, war eine westliche Idee: Immer ist es der Westen, der gern am Himmel kratzt; im Osten haben die Kirchen normalerweise Kuppeln, die das schützende Firmament repräsentieren. Heute steht in Sankt Petersburg zwar der höchste Wolkenkratzer Europas. Aber als er 2018 eröffnet wurde, stand er weltweit nur auf Platz 12, und in New York interessierte sich für die Höhe von Gebäuden schon niemand mehr. Mit gesellschaftlichem Fortschritt ist es nicht besser. In Russland war höhere Bildung für Frauen früher zugänglich als in den USA. Bloß war das in der traditionellen Sicht, wie sie im Zarenreich vorherrschte, gar kein Vorteil.
Freuen darf man sich im Osten immer nur über Platz zwei. So wurde das rumänische Timişoara nach New York zur zweitgrößten Stadt der Welt mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Budapest bekam nach London die zweite U-Bahn Europas. Um stolz darauf zu sein, bedarf es eines westlichen Vorbilds. Platz eins ist per se unerreichbar. Schon als die Zarin Katharina am Hof zu Sankt Petersburg noch vornehmere Manieren einführte als an den westeuropäischen Höfen, ätzte der päpstliche Nuntius über die »übertriebene Etikette«; offenbar wolle man »den edleren Nationen ähneln«. Ist man mal vorn, hat man eben übertrieben. Man kann über das Ziel hinausschießen. Erreichen aber kann man es nicht.
Der ewige Platz zwei, die Benachteiligung, ist in den Selbstbildern und historischen Mythen der osteuropäischen Nationen angelegt. Der Osten reiht sich selbst nach hinten. Schon die Schlachten und Heldentaten der Vorfahren dienen in der Erinnerung vornehmlich dazu, das eigentlich Wichtige, Wertvolle zu schützen: den Westen. Polen, so will es die Legende, hat nach dem Ersten Weltkrieg verhindert, dass die russische Oktoberrevolution sich nach Deutschland und von dort aus über ganz Europa ausbreiten konnte. Nicht um seiner selbst willen also hat es gekämpft und gelitten. Die Polen waren es auch gewesen, die Wien befreiten, als die Stadt von den Türken belagert war – Wien, nicht etwa Warschau. Bei Sisak schlugen die Kroaten die Türken zurück, die zwar fast ganz Kroatien eroberten, von dort aber nicht weiter nach Westen kamen. Später, im Dreißigjährigen Krieg, stellten Kroaten die kaiserlichen Hilfstruppen, und 1848 schlugen sie in Ungarn die Revolution nieder – für den Kaiser in Wien, nicht für sich selbst.
Wir im Osten haben den Westen verteidigt, ihn sogar gerettet: Die Geschichte hat überall im Osten Europas ihre Variante. In der berühmten Schlacht auf dem Amselfeld haben sich die Serben in den Gefechten gegen die Osmanen verbraucht und dafür fünfhundert Jahre Fremdherrschaft kassiert. Das Verhältnis gibt es auch in moderner Version. Ungarn, so will es eine aktuelle Erzählung, hat 1989 mit der Grenzöffnung die DDR zerstört und den Deutschen damit die Wiedervereinigung geschenkt.
Die Moral dieser Geschichten ist immer dieselbe: Nicht um uns selbst war es uns zu tun, sondern um die anderen, die im Westen. Für sie kämpfen wir, für sie sind wir da.
Geschichtsmythologen, wie sie im 21. Jahrhundert wieder Konjunktur bekommen haben, packen die Erzählung von der Opferrolle gern in das Bild einer mittelalterlichen Festung. Wir, die Polen, Serben, Ungarn, Ukrainer, Kroaten, Bulgaren, kämpfen draußen vor den Mauern gegen die wilden Reiterhorden aus der asiatischen Steppe oder gegen die Muselmanen aus dem Orient. In der aktualisierten Fassung treten dann nicht mehr Mongolen oder Türken auf, sondern die Bolschewiken oder, neuerdings, die Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen Osten. Die Aufstellung bleibt dieselbe. Die Festung ist der Westen; dort sitzen sie sicher und geschützt. Wir dagegen kämpfen ohne den Schutz der Mauer. Wir sind die Mauer.
Unser Kampf, so die osteuropäische Erzählung, wird in der Festung kaum oder gar nicht bemerkt, manchmal sogar arrogant belächelt. Man sieht gar nicht, wie sehr wir uns wehren müssen. Wir kämpfen im toten Winkel. Schlimmer noch: Die drinnen, die im Westen, schütteln den Kopf darüber, wie verbissen wir oft sind. Die Liberalität, die Gelassenheit, die sie sich drinnen gestatten, können wir uns nicht leisten. Wir sind es, die die Moral der Festung hochhalten. Die drinnen dagegen lassen sich gehen. So ist selbst der Stolz auf die eigene Identität, die Sittenstrenge, die Kampfkraft, das Heldentum, ein abgeleiteter Stolz. Was die da drinnen nur predigen, nehmen wir hier draußen als Einzige wirklich ernst.
Es ist das Bild vom dekadenten, moralisch heruntergekommenen Westen, das da im kollektiven Unbewussten ruht. Über Jahrhunderte verkörpert wurde es vom Papst in Rom, der immer nur fromm tat, heimlich aber prasste, herumhurte und in Saus und Braus lebte. Bei entsprechender Gelegenheit lässt sich das Bild jederzeit revitalisieren. Im Kosovokrieg zeichnete die Belgrader Propaganda Serbien als Bollwerk gegen den Islam und gegen den vorgeblichen Primitivismus – beides Kräfte, die nicht in erster Linie Serbien, sondern den Westen bedrohten. Statt den tapferen Serben in ihrem Kampf beizustehen, fiel der Westen ihnen in den Rücken. Als er das Banner der Christenheit hissen sollte, trieb es der amerikanische Präsident mit seiner Praktikantin.
Der Westen schuldet dem Osten Dank, löst seine Schuld aber nie ein: Das Denkmuster bestimmt auch den Blick zurück auf den Kalten Krieg. Das tapfere Polen, das den Westen vor dem Bolschewismus gerettet hatte, wurde Beute der Sowjetunion. Jalta, die Konferenz der alliierten Mächte USA, Sowjetunion und Großbritannien auf der Krim, ist in den neuen nationalen Legenden zur Chiffre für den Verrat des Westens an Ostmitteleuropa geworden. Damals hätten der amerikanische Präsident Roosevelt und der britische Premierminister Churchill die Staaten der Region kampflos dem Einfluss der Sowjetunion und ihres Diktators Stalin überlassen. Noch Anfang der Zweitausenderjahre, als es um die Erweiterung der EU ging, gehörte die »Schuld« die der Westen gutzumachen habe, in jede Politikerrede.
Die Darstellung passt ins Klischee vom geopferten Osten, hält den kritischen Blicken der Historiker aber nicht stand. Nicht erst seit Jalta, sondern schon seit dem Februar 1945 kontrollierte die Rote Armee die Region; sie war es, die die deutschen Truppen aus dem Osten Europas vertrieben hatte. Im Oktober zuvor schon hatte Churchill bei einer Konferenz in Moskau auf einem Zettel festgehalten, welche Mächte in Südosteuropa künftig wie viel Einfluss würden ausüben können: Zu jeweils 90 Prozent sollten Griechenland dem Westen und Bulgarien und Rumänien dem sowjetischen Orbit zufallen, Jugoslawien und Ungarn sollten neutral werden. Die Aufteilung beschrieb die Machtverhältnisse, wie sie damals schon herrschten. Hätte Stalin sich an die Absprachen von Jalta gehalten, wäre der Eiserne Vorhang weniger dicht ausgefallen und auch weiter östlich verlaufen.2
Das Bild vom gleichgültigen, selbstgerechten Westen und vom betrogenen, verratenen Osten ist allerdings nicht aus der Luft gegriffen. Geopfert wurden in Jalta zwar nicht ganze Länder, aber doch Millionen Sowjetbürger und Osteuropäer, die gleich nach Kriegsende »repatriiert«, die in ihre Heimatländer überstellt wurden, obwohl sie dort mindestens Lagerhaft, wenn nicht der Tod erwartete. Sie waren nicht wichtig, Kollateralschaden sozusagen. Schwer zu bezweifeln ist auch, dass der Kaiserhof in Wien im 18. Jahrhundert christliche »Wehrbauern« an der Grenze zum Osmanischen Reich ansiedelte, damit sie gegen die »Türken« kämpften, sie dann aber später im Stich ließ. Wer sich über die östliche Opfer-Erzählung wundert, erinnere sich an den Streit um die Qualität von Lebensmitteln: Die Ost-Butterkekse waren tatsächlich mit Palmöl gemacht.
Auch auf die Abwehr von Kriegsflüchtlingen nach 2015 passt das Bild wieder gut. Deutschland und Westeuropa sahen sich von einem schlecht ausgeleuchteten Burggraben aus migrations- und flüchtlingsfeindlichen Staaten umgeben: Ungarn, Bulgarien, Kroatien. Der Cordon machte eigene Brutalität überflüssig und schonte so das westliche Selbstbild von Humanität und Wertorientierung. Prügelten überforderte mazedonische Polizisten auf Flüchtlinge ein, die eigentlich nach Deutschland, Schweden oder Österreich wollten, sah sich der westliche Fernsehzuschauer ein weiteres Mal in der Gewissheit bestätigt, dass der Osteuropäer zur Fremdenfeindlichkeit neigt. Es ist wie mit den Butterkeksen und den Waschmitteln: Tatsachen befördern das vorgefertigte Klischee. Vorschnelle Verallgemeinerungen lassen sich durch genaueres Hinsehen zwar widerlegen. Im Gedächtnis hängen bleibt am Ende nur, was »mal wieder typisch« war.
***
Umgekehrt ist der Blick von Westen nach Osten vor allem eines: flüchtig. Was soll es dort groß zu entdecken geben? Osteuropa stellt man sich kaum oder gar nicht »anders« vor, weder als unheimlich und damit wirklich gefährlich noch als exotisch und damit irgendwie attraktiv. Keine Charakterisierung kommt ohne Adverbien wie »schon« oder »noch« aus. Zwei Jahrzehnte lang war der Westen der Lehrer. Er stellte die Zeugnisse aus und attestierte den Beitrittskandidaten die Reife. Die Prüfungskandidaten waren stets »spät dran« und »hinten nach« oder aber »gut vorangekommen«. Je nach Fortschritt bekamen sie spezifische »Hausaufgaben«. Für das sogenannte Resteuropa, die sechs verbliebenen Aspiranten auf dem Balkan, gilt das noch immer. Die es nicht einmal zum Kandidaten gebracht haben, sind noch weiter »zurück«. Ein Forscher argumentiert sogar, dass der Begriff Rückständigkeit, englisch »backwardness«, direkt aus dem Ost-West-Verhältnis in Europa hervorgegangen sei: Wenn die einen meinen, sie seien schon so weit fortgeschritten, müssen alle, die sich an ihnen orientieren, sich für rückständig halten.3
Spätestens seit die meisten Länder den Weg in die EU angetreten haben, wird der Ost-West-Unterschied nicht als ein örtlicher, sondern als ein zeitlicher verstanden. Das Setting schließt Gleichwertigkeit aus. Was soll man von Schülern lernen können? Die Entwicklung, die dem Osten bevorsteht, haben wir im Westen schließlich schon hinter uns. Sogar die westlichen Ost-Schwärmer denken im Grunde in zeitlichen Kategorien. Für sie hat, als der Westen sich in ihren Augen in Multikulti, Feminismus und Individualismus verirrte, der Osten seine Ursprünglichkeit, seinen »gesunden Menschenverstand«, seine »ethnische Reinheit« bewahrt. Der Westen ist verrückt geworden. Der Osten ist »noch« normal. Ob man es rückständig nennt oder urtümlich: Die Vorstellung hinter den Attributen ist dieselbe.
Fremdheit gebietet immerhin einen gewissen Respekt. Wer dagegen so ist, wie wir gestern noch waren, oder gar so werden will, wie wir heute sind, muss sich von uns auch Tadel, Kritik und Belehrung gefallen lassen. Nur auch noch beschämen sollte man die Belehrten nicht; gerade in Osteuropa macht der Ton die Musik. Dass sie ein Jahrzehnt lang der Form nach über die erklärtermaßen »nicht verhandelbaren« Richtlinien und Verordnungen der EU verhandeln mussten, ließen die Kandidaten sich noch gefallen. Als aber acht Beitrittsländer sich im Streit um den Irakkrieg auf die amerikanische Seite schlugen und damit Deutsche und Franzosen brüskierten und als Präsident Jacques Chirac daraufhin die Bemerkung fallen ließ, die Kandidaten hätten »eine Gelegenheit verpasst zu schweigen«, bestellte Bulgariens Präsident sogar den französischen Botschafter ein.
Kränkung ist ins Ost-West-Verhältnis eingebaut. Dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg im Osten eine »minderwertige Rasse« ausmachten, Polen und Tschechen zu Dienstboten erniedrigten und deren Menschenleben ihnen noch weit weniger wert waren als die der ebenfalls besetzten Franzosen oder Niederländer, war nur der Höhepunkt eines Verhältnisses, das im Prinzip schon vorher bestand und das im vereinten Europa erhalten blieb. »Verwirklichen lässt sich eine deutsche Übermacht, verheimlichen jedoch nicht«, hat der ungarische Essayist und Schriftsteller György Konrád einmal geschrieben. »Wenn sich auf dem Gesicht der Ausdruck der Überlegenheit spiegelt, blitzt auch in den Augen das Licht des Erkennens auf.«4
Manchmal bricht im Westen noch heute ein archaisches Osteuropa-Bild durch, von dem man im Alltag nichts ahnt. Als in Bukarest einmal ein vierjähriger Junge von Straßenhunden totgebissen wurde, brachte die rumänische Regierung ein Gesetz zur »Hunde-Euthanasie« auf den Weg. Eine französische Tierschützer-Organisation polemisierte gegen »blutige Massensäuberungen« in Rumänien. In Wien fand eine Demonstration vor der rumänischen Botschaft statt: Brennende Kerzen umstellten die Parole »Shame on Romania!« Eine Website, die vornan ein Bild von einem Dutzend toter Welpen zeigte, brachte es auf Hunderte Postings. Auf einem besonders abstoßenden Video unausgewiesener Herkunft waren Männer zu sehen, die einen kleinen Hund anzündeten und sich an dessen Qualen ergötzten. »Ich wünsche diesem Mob in Rumänien einen grausamen Tod«, schrieb eine Frau aus Bayern. »Wieder eine Nation, die ich nicht leiden kann«, pflichtete ihr eine Irin bei. »Wenn die mich wieder mal auf der Straße anbetteln, dann schreie ich es ihnen ins Gesicht.«
Die Rumänen wehrten sich. 60 000 Straßenhunde gebe es in Bukarest, erklärte die Stadtverwaltung, und das Gesundheitsamt gab bekannt, täglich müssten Dutzende Menschen nach Hundebissen gegen Tollwut geimpft werden, jeder fünfte davon ein Kind. In Rumänien gehörte die ganze Empathie dem Vierjährigen aus dem Lindenpark, unter den westlichen Tierschützern galt sie den Hunden. Das Kind habe sich wohl auf ein eingezäuntes Gelände verirrt, stand auf den Websites zu lesen. Hunde sind süß, Rumänen sind grausam: Die Herabwürdigung wurde spontan verstanden.
***
Bis ins 18. Jahrhundert hatte der Westen »den Osten« gar nicht auf dem Schirm. Polen war Polen, Böhmen war Österreich, das Baltikum war deutsch. Russland war ein fernes, düsteres Waldland und lag nicht im Osten, sondern im Norden. Der Balkan dagegen war »Orient« oder »Türkei«; er begann gleich hinter Wien. Wenn im Bewusstsein der Zeitgenossen eine Scheidelinie über den Kontinent ging, dann die zwischen Abendland und Morgenland, also zwischen Christenheit und islamischer Welt. Eine zweite verlief entlang der Alpen und trennte den barbarischen Norden von der Zivilisation der Mittelmeerländer. Einen europäischen Osten gibt es erst seit der Aufklärung. John Ledyard, ein amerikanischer Abenteurer und Weltreisender, schaffte es bis nach Jakutsk in Sibirien. Auf der Rückreise fühlte er sich erst an der polnisch-preußischen Grenze »wieder in Europa«. Es war offenbar ein verbreiteter Topos: Napoleons General Philippe-Paul de Ségur »verließ Europa ganz«, als er über Preußens Ostgrenze nach Polen vorstieß, und fühlte sich »um zehn Jahrhunderte zurückversetzt«. Nichts deutet darauf hin, dass es dort damals wirklich so einen deutlichen zivilisatorischen Unterschied gegeben hätte. Aber das Klischee vom aufgeklärten Westen und dem rückständigen Osteuropa passte gut in das Fortschrittsdenken, das sich gerade herausbildete, und es wollte bedient sein.5
Erst Voltaire und Rousseau, die großen Philosophen der Aufklärung, interessierten sich für den Osten – auf eine gewisse Art zumindest. Voltaire schmachtete Katharina die Große an und lobte das aufgeklärte Wirken der Zarin. Offenbar, dachte er, war die aus Deutschland stammende Prinzessin die Richtige, um die primitiven Bauern zu vernünftiger Lebensführung anzuleiten. Jean-Jacques Rousseau, der »Grüne« unter den Vordenkern der Zeit, lobte dagegen die Freiheitsliebe und Originalität der Polen. Alle Europäer seien furchtbar angepasst, quasi globalisiert, alle sähen gleich aus und dächten ähnlich. Nur die Polen nicht.
Beide Philosophen vermieden es allerdings, ihre Thesen einem Stresstest auszusetzen; weder war Rousseau je in Polen noch Voltaire je in Russland – trotz dringender Einladungen durch die Zarin. Russland und Polen waren ihre »pet nations«, ihre Schoßhund-Nationen, wie die bulgarisch-amerikanische Historikerin Maria Todorova das nennt, wenn mächtige und einflussreiche Personen aus dem Westen östliche Völker als Projektionsfläche für ihre Ideen nutzen.6 Der alte Usus unter europäischen Mächten, sich mit dem nächsten Nachbarn zu verfeinden und mit dem übernächsten zu befreunden, hat zwar in Frankreich und in Polen viel völkerfreundschaftliche Schwärmerei und etwas polnische Emigration nach Paris, aber wenig echte Neugier hervorgebracht. Erst in den 1990er Jahren scheiterte ein deutscher Versuch, die Achse Paris–Berlin nach Warschau zu verlängern und zum »Weimarer Dreieck« auszubauen, an profundem französischem Desinteresse.
Der deutsche Aufklärer Johann Gottfried Herder verfügte über deutlich mehr eigene Anschauung als die beiden Denker aus Frankreich. Er stammte aus Ostpreußen, hatte Rousseau gelesen, aber auch fünf Jahre als russischer Untertan in Riga gelebt und dort Letten, Polen und Russen kennengelernt. Seine Beobachtungen prägen die deutsche und nicht nur die deutsche Vorurteilsstruktur gen Osten bis auf den heutigen Tag. »Die Slawen«, befand der preußische Pastor, seien »kein unternehmendes Kriegs- und Abenteurervolk wie die Deutschen«. Jedenfalls nicht Avantgarde, eher Nachhut: »Vielmehr rückten sie diesen«, den Deutschen, »stille nach und besetzten ihre hergelassenen Plätze und Länder.« Das taten sie beharrlich und erfolgreich, »bis sie endlich den ungeheuren Strich innehatten, der vom Don zur Elbe, von der Ostsee bis zum Adriatischen Meer reicht«.
Herders Charakterisierung ist von 1786. Sie war nicht böse gemeint, aber ist nicht frei von Herablassung. Die Slawen, so Herder, werkelten immer brav und bescheiden vor sich hin und hüpften am Sonntag zu ihren schlichten Melodien. Sie »pflanzten Fruchtbäume und führten nach ihrer Art ein fröhliches, musikalisches Leben«. Dabei seien sie »unterwürfig und gehorsam, des Raubens und Plünderns Feinde«. Durch die lobenden Worte schimmert die Vorstellung, dass dieses gutmütige und kriegsuntüchtige Slawenvolk germanischen, eben »unternehmenden« Schutzes bedurfte. Eines Schutzes, den es aber meistens nicht bekomme, wie Herder seufzend anschließt: »So haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom deutschen Stamme, an ihnen versündigt.« Das war milde ausgedrückt. Gerade eben waren Preußen und Österreicher dabei, zusammen mit den Russen das friedliche Königreich Polen unter sich aufzuteilen.7
Die deutschen Nationalsozialisten schließlich wendeten die völkerpsychologischen Skizzen, wie Herder sie entworfen, aber wohl kaum erfunden hatte, ins Gemeine, Abschätzige, Verächtliche. Überdies taten sie so, als seien ihre bösen Klischees naturwissenschaftlich erforscht und beglaubigt. Im »Günther«, dem weit verbreiteten Standardwerk der nationalsozialistischen Rassenkunde, wird eine ominöse »ostische Rasse« mit den »Eigenschaften des typischen Spießbürgers« beschrieben. »Alles Heldentümliche«, aber auch »Großmut, Leichtsinn, Verschwendung und alles Weitherzige« seien »unostische Eigenschaften«. Mangels »Führereigenschaften« bedürfe der Mensch dort fremder Führung, die er trotz »Nörgelei und Neid« geduldig ertrage – eine Herrenmenschenperspektive, die Tschechen und Polen bald darauf physisch zu spüren bekamen. Russen rechneten die NS-Ideologen zur »ostbaltischen Rasse«, attestierten ihnen »zähe Verbissenheit« und dichteten ihnen eine Nase an, die »für abendländische Anschauungen besonders hässlich« sei. Blonde Haare und blaue Augen, sonst Inbegriff des »Nordischen«, gereichten den Russen nicht zum Vorteil: Ihre Haare seien »aschblond« statt »goldblond«, die Augen mehr grau als blau.8
Der kalte Krieg wurde unter politischer, nicht unter nationaler Flagge geführt, aber die Feindbilder beider Seiten boten genug Raum für die Pflege der alten, nationalen Klischees. Deutsche Nationalsozialisten, die eben noch »slawische Untermenschen« verachtet hatten, ließen ihre Abneigung jetzt den Bolschewiken zuteilwerden, ohne das Objekt ihres Hasses groß umschminken zu müssen. Für die Nachkriegsgeneration verschwand die ganze Region in einem ideologischen Nebel. Interesse an Osteuropa hegten von den 1950er Jahren bis etwa 1980 nur noch einige westliche Kommunisten und wenige osteuropäische Emigranten.
Der Osten wurde das ganz andere. Schon mit Andeutungen, dass sich hinter der ideologischen Fassade des Ostblocks eine Art menschliche Normalität verbergen könnte, ließ sich in dieser Zeit erfolgreich provozieren. »Back in the U.S.S.R.« hieß ein Hit der Beatles von 1968: Im Text freut sich ein Russe nach einer Auslandsreise wieder auf zu Hause – nicht auf Gulag und GPU, sondern auf Berge, Balalaika und ukrainische Girls. »You don’t know how lucky you are, boy«: Schon dieser harmlose Satz, im Liedtext gesungen vom lyrischen Ich, wurde von Konservativen auf politische Korrektheit abgeklopft und als »prosowjetisch« inkriminiert. Gleichzeitig genossen echte Kommunisten aus anderen Weltgegenden – wie Ché Guevara – hohes Ansehen. Dem deutschsprachigen Publikum trug der Schweizer Schlagersänger Stephan Sulke 1977 die Ballade von einem »Mann aus Russland« vor, der tatsächlich Merkmale menschlichen Verhaltens aufwies: »Der Mann aus Russland konnte lachen, fröhlich sein und Witze machen, war ein Mensch genau wie ich und du.« Noch die Anhänger der Friedensbewegung gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen zu Beginn der Achtzigerjahre ließen sich von ihren Pop-Idolen ohne alle Ironie versichern, dass West- und Ostmenschen untereinander im Prinzip paarungsfähig waren: »We share the same biology«, sang der britische Musiker Sting, »regardless of ideology.«
Im vereinigten Europa ist dergleichen nicht mehr zu hören und schon gar nicht zu lesen. Geringschätzung und demonstrative Fremdelei schimmern aber dicht unter der Oberfläche und treten auch immer wieder hervor. Osteuropäer und Osteuropäerinnen teilen sich, wenn sie in Zeitungen so genannt werden, auf in Pflegekräfte und Putzfrauen sowie in Erntehelfer und Fahrer von schrottreifen Kleinlastern. »Eastern Europeans« lieferten durch ihre pure Existenz das ausschlaggebende Argument für den Brexit – verstärkt durch Reportagen aus Boston in der Grafschaft Lincolnshire, einem Ort, wo viele Polen, Litauer und Letten leben. Dass die Immigranten dort störten, Verbotenes oder Unliebsames trieben, wurde nicht bekannt, nicht einmal behauptet. Wenn in Supermärkten Hinweise auf Polnisch, Rumänisch oder Serbisch zu lesen sind, dann als Drohung an potenzielle Ladendiebe. Die deutsche Presse erfand den »Südosteuropäer«, eine Chiffre für die Roma. In den Niederlanden schuf die rechte »Partei für die Freiheit« eigens eine »Meldestelle Osteuropäer«, um eingesessenen Bürgern Gelegenheit zu geben, sich über Zuwanderer zu beschweren.
***
Durch die Geschichte hindurch war Osteuropa für den Westen mal Schwundstufe des eigenen Selbst, mal Vorzimmer oder Burggraben, mal Nachhut. Wenn man ihm doch eine eigene Identität zubilligte, war es bestenfalls ein verunglückter Gegen entwurf oder ein Spiegel, in den man ungern blickte. Für eine Europäische Union aus gleichberechtigten Nationen ist das keine gute Voraussetzung. Konkurrieren die Nationen gar miteinander, ob als Standorte für die modernsten Investitionen, ob um Macht und um Prestige, kann man leicht erraten, wer auf lange Sicht der Gewinner und wer der Verlierer sein wird. Dass die europäischen Staaten im Ringen um Bedeutung und Vorherrschaft die Plätze wechseln, wie es mit dem Beginn der Neuzeit Spanien, Frankreich und England und im späten 20. Jahrhundert Russland und China getan haben, steht in der EU nicht zu erwarten. Aber das wäre ohnehin eine fragwürdige Vision. In einem besseren Europa könnte jeder Einzelne gleichermaßen zu Hause sein und sich selbst entscheiden dürfen, wie stark und ob überhaupt er oder sie sich mit der eigenen Nation identifiziert. »Verstehen sollt ihr uns, und anerkennen!«, hat der erste postkommunistische Regierungschef Polens, Tadeusz Mazowiecki, von seinen westlichen Freunden gefordert, als er noch ein Dissident war: verstehen, nicht erziehen. Den Versuch ist es wert.
Der Missionar und der Intrigant
Geschichte: Ein missglückter Besuch, sein Grund und seine Folgen
»Ich bin nicht gekommen, um mich verwirren zu lassen«, ließ der Gast aus dem Westen sich vernehmen, »sondern um euch zu bessern.« Die Angesprochenen waren wie vom Donner gerührt. Auf den Schrecken folgte Empörung. »Man kann gar nicht sagen«, schreibt einer, der dabei war, »wie viel Frechheit, Anmaßung und Überheblichkeit« die Fremden an den Tag gelegt hätten. »Hochnäsig« und »kühn« hätten sie dahergeredet. Grußlos seien sie dahergekommen. »Sie dachten gar nicht daran, nur ein kleines bisschen den Kopf zu senken.«
Dass der Gast in dem unglücklichen Treffen, von dem hier die Rede ist, so arrogant herüberkam, ist kein Zufall und auch keine reine Charakterfrage. Sein Auftrag war, in einem wichtigen Zentrum des europäischen Ostens für Ordnung zu sorgen und umfangreiche Reformen durchzusetzen. Für den Auftrag wurde ein Mann gebraucht, auf den man sich verlassen konnte und der sich von Einwänden nicht beirren ließ. Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz waren von Vorteil, aber nicht Bedingung. Wichtiger war, dass der Emissär sein Anliegen in aller Klarheit über die Rampe brachte. Längst nicht jeder war für diesen Job geeignet.
Der, um den es hier geht, brachte jedenfalls die besten Voraussetzungen mit. In seiner bisherigen Karriere hatte er ähnliche Herausforderungen schon bestanden. Seine Biografie versprach maximale Loyalität. Sehr früh schon im selben Betrieb sozialisiert, war er einem mächtigen Älteren aufgefallen, der ihn zu seinem persönlichen Sekretär machte. Als der Chef Jahre später zum Vorstandsvorsitzenden aufstieg, nahm er seinen Büroleiter mit in die Zentrale. Dort, in der Metropole des Westens, kamen beide in eine fremde und potenziell feindselige Umgebung. An Machthabern und Platzhirschen, an Domänen, Tabus und ungeschriebenen Gesetzen mangelte es am neuen Wirkungsort nicht. Wohin man auch trat war eine Falle aufgestellt. Lokale Details, Erinnerungen, Gerüchte, die er machtpolitisch hätte ausschlachten können, kannte der treue Sekretär nicht; um sich durchzusetzen, musste der Neuling besonders forsch auftreten, große Linien ziehen, strenge Vorgaben verordnen. Mit der Aufgabe, dem Chef unter solchen Bedingungen den Rücken freizuhalten, hätte jeder andere sich noch schwerer getan.
Kurz: Für die schwierige Mission im Osten schien der bewährte enge Weggefährte des Chefs genau der richtige Mann zu sein. Indes, es schien nur so. Seine Stärken: Durchsetzungskraft, Loyalität, Sendungsbewusstsein, wandelten sich in der fremden Umgebung zu Handicaps. Sie sollten sich fatal auswirken. In der östlichen Hauptstadt war der Emissär zunächst auf ein zögerndes Entgegenkommen gestoßen, das er prompt falsch deutete und das er, statt sich geschmeidig und kompromissbereit zu zeigen, als Einladung für ein besonders forsches Auftreten nahm – ein Fehler, dem auch seine Nachfolger in vergleichbarer Mission schockweise zum Opfer fielen. Auch vertat er sich gründlich in der Einschätzung der Machtverhältnisse an seinem Einsatzort. An der Spitze der formalen Hierarchie war er freundlich aufgenommen worden. Ein gutes Zeichen aber war das gerade nicht.
Auch sonst fehlte es nicht an Missverständnissen. Die Kritik, die östliche Fachleute an seinen Plänen und Ideen übten, war mehr formaler als inhaltlicher Art und schien dem Gast aus dem Westen deshalb – vollkommen zu Unrecht, wie sich bald herausstellen sollte – als leicht überwindbar. Mehr noch: Sein ärgster Widersacher war in der Materie, um die gestritten wurde, offensichtlich nicht besonders bewandert. Wo der Mann aus dem Westen komplizierte Debatten erwartet hatte, stieß er nur auf Machtpoker, Eitelkeiten und undurchsichtige Querelen. Seiner großen Reformidee in ihrer Kühnheit und logischen Stimmigkeit war hier niemand gewachsen, schloss er. Aber es nützte ihm alles nichts. Der Konflikt eskalierte, wurde heftig und endete im Desaster.
Dass die Geschichte des ersten Ost-West-Zusammenpralls nie als Problem von Verhandlungsstrategie, »Message«, Management-Qualitäten und Personalauswahl beschrieben wird, liegt am Timing. Die Begegnung fand im Jahre 1054 unserer Zeitrechnung statt. Erzählt wird sie in historischen und meistens in religions- oder kulturgeschichtlichen Kategorien. Das hat seinen triftigen Grund: Das Treffen ist als ost-westliche Kirchenspaltung in die Schulbücher eingegangen, ein Datum fast so prominent wie die Ermordung Cäsars, die Französische Revolution oder das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ob das Treffen wirklich so ein historischer Einschnitt war, bezweifelt die Wissenschaft heute; offenbar war das große »morgenländische Schisma« im Osten schon nach einer Generation erst einmal wieder vergessen. Aber der Charakter der Mission, der Auftritt der westlichen Delegation, die östlichen Reaktionen, der Verlauf der mehrere Monate dauernden Auseinandersetzung, die Haltungen und selbst die Argumente halten noch für heutige Grenzgänger von West nach Ost wie von Ost nach West eine Lehre bereit.
Humbert hieß der Mann aus dem Westen.9 Er war schon als Kind von den Eltern ins Kloster geschickt und dort gründlich ausgebildet worden. Der tüchtige junge Mönch fiel dem Bischof im nahen Toul auf, der machte ihn tatsächlich zu seinem Sekretär. Als der Bischof Jahre später zum Papst gewählt wurde, nahm er Humbert zusammen mit einer kleinen Truppe jüngerer, engagierter Reformer mit sich in den Palast.
Das Karrieremuster formt Akteure, wie man sie auch heute kennenlernen kann. Nicht verändert haben sich auch die Schattenseiten einer solchen Laufbahn. Die römischen Adels familien betrachteten das Papstamt als ihre Domäne und hatten mit dem neuen »deutschen Papst«, einem Mann aus dem Elsass, wenig Freude. Moyenmoutier in den Vogesen, wo Humbert erzogen worden war, war ein sogenanntes Reformkloster. Anders als in vielen anderen Abteien, vor allem in Italien, wurde hier streng auf Disziplin, Bildung und wirtschaftliche Haushaltsführung geachtet, Tugenden, die allerdings nicht um ihrer selbst willen gepflegt wurden. Hinter der ordnenden Gewalt stand vielmehr eine große Idee.
Humberts Reise nach Konstantinopel ist gründlich dokumentiert.10 Sein Mentor, der sich jetzt Leo IX. nannte, hatte ihn an den Bosporus geschickt, um die dortige Kirche zur neuen römischen Räson zu bringen. Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel, zwischen West und Ost, waren zwar nichts Neues. Die große Reform aber, die Papst Leo jetzt plante, musste besonders schwere Differenzen mit sich bringen. Die Kirche sollte nach der Idee zu einer unabhängigen, geistlichen Macht werden, kontrolliert nicht mehr von den lokalen Fürsten, sondern von einer energischen Zentrale in Rom. Es wurde ein schwieriger, langwieriger Kampf mit vielen Facetten und vielen Akteuren.
Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts sollten sich die Ideen Papst Leos und seines Sekretärs endgültig durchsetzen, allerdings nur im Westen des Kontinents. Es war eine Zeitenwende, die den Umbruch vom »realen Sozialismus« zu Demokratie und Marktwirtschaft an welthistorischer Bedeutung noch übertraf – die erste »Gewaltenteilung« nämlich: Weltliche und geistliche Macht gehorchten fortan ihren eigenen Gesetzen. Bis dahin war die Kirche vom Rest der mittelalterlichen Gesellschaft kaum zu unterscheiden. Adelige Familien pokerten in der ganzen Christenheit um einträgliche Bischofssitze und Abteien, und ihre Sprösslinge führten sich, wenn sie eine Position erobert hatten, nicht anders auf als ihre weltlichen Standesgenossen. Ein wichtiges Instrument, diese Praxis abzustellen und die Kirche unabhängig zu machen, war der Zölibat, ein Thema, dem sich der Reformer Humbert mit aller Leidenschaft widmete. Nur mit der Verpflichtung zur Ehelosigkeit ließen sich die Priester aus dem Machtsystem herauslösen. Solange sie Familie hätten, so der Gedanke, würden geistliche Würdenträger sich trotz noch so frommer Schwüre niemals wirksam daran hindern lassen, ihre Söhne in Ämter und Pfründen zu bugsieren und ihre Töchter strategisch zu verheiraten.
Durchsetzen mussten sich der neue Papst und seine Reformtruppe überall in der Christenheit, in Konstantinopel nicht weniger als in Frankreich oder Deutschland, wo Humbert, die harte rechte Hand des Papstes, nicht weniger als fünf »falsch geweihte« Bischöfe erfolgreich abgesetzt hatte. Nur sollte die disziplinierende Visite am Sitz des damals noch mächtigen oströmischen Kaisers und seines Patriarchen viel schwerer werden als jede andere.
Hier Anhänglichkeit an abstrakte Grundsätze und Treue zur Hierarchie, dort Korruption und totaler Machtkampf um alles und jedes: Das war aus westlicher Sicht das Setting der Begegnung. Entsprechend fielen die Rollen aus, die Gäste und Gastgeber einnahmen. Hier die anmaßenden, besserwisserischen Ideologen aus dem Westen, die alle anderen nötigten, vor ihrer Wahrheit niederzuknien, dort die verbindlichen, höflichen, auf Ausgleich und Kompromiss bedachten, aber auch empfindlichen und intriganten Ostler: ein Gegensatz, dem man auf der Ost-West-Achse auch heute wieder auf Schritt und Tritt begegnen kann.
Der oströmische Kaiser in Konstantinopel empfing die Gesandtschaft aus Rom freundlich. Für ihn war der Papst einfach ein bedeutender Verbündeter gegen die Normannen, die sich gerade in Süditalien festsetzten – nicht mehr als eine Figur auf dem Schachbrett der Macht. Was die Fremden alles im Sinn hatten und was genau sie von ihm wollten, war dem Kaiser, Konstantin IX., entweder nicht verständlich oder nicht wichtig. Weder glaubte der kampferprobte Monarch mit seinen Mitte fünfzig noch an weltweite Reformpläne, noch kümmerte er sich um irgendwelche theologischen Feinheiten. Geistiges überließ Kaiser Konstantin seinem Freund, einem allgemein geachteten Universalgelehrten namens Michael Psellos.
Nicht nur der Kaiser, auch Konstantinopels Spezialisten für Grundsatzfragen zeigten sich gegenüber den Westlern kompromissbereit. Die geistlichen Autoritäten – der gelehrte Kaiserfreund Michael Psellos ebenso wie der Patriarch Petros von Antiochia, dem heutigen Antakya – kritisierten weniger die Inhalte als den Stil Humberts und seiner westlichen Delegation. Psellos etwa rügte vor allem die »Unverschämtheit« der Römer. Dem alten Patriarchen Petros schließlich missfiel, dass Rom offenbar »seinen Willen gegen die übrigen Patriarchen durchsetzen« wolle. Schließlich war auch er, Petros, vom Kaiser in sein Amt eingesetzt worden und fand nach wie vor nichts dabei.
Der Westen trumpft auf, der Osten reagiert widerstrebend; der eine greift an, der andere wehrt sich zaghaft, aber wirkungsvoll: ein eingängiges Bild. Vollständig ist es aber nicht. Dass der Streit eskalierte, lag nämlich nicht nur am apodiktischen Auftreten des Mannes aus Rom. Bei gutem Willen hätten die Ostler den päpstlichen Gesandten noch mit Schweigen und allerlei Scheinkompromissen auflaufen lassen können – Praktiken, über die westliche Emissäre nicht nur im Osten Europas auch im 21. Jahrhundert zu stöhnen pflegen. Für den großen Eklat sorgte vielmehr die Schlüsselfigur auf östlicher Seite, der Patriarch von Konstantinopel, ein Mann namens Michael Kerullarios. Im Vorfeld des Besuchs hatte Michael noch gehofft, die Römer würden seine Sphäre respektieren und sich auf friedliche Koexistenz einlassen. Dass die Gäste ebenso wie er selbst sich auf Gott und die Heilige Schrift beriefen, also nur die einen oder die anderen in der Sache Recht haben konnten, schien für Michael zunächst kein großes Hindernis zu sein. Die »Kirche von Konstantinopel«, meinte der Patriarch, könnte ihre Gebräuche ja, genau wie die römische, einfach für allgemeingültig erachten und so tun, als gälten sie überall auf der Welt.
Mit anderen Worten: Der Westen erhob Anspruch auf die Anerkennung einer allgemeingültigen Wahrheit. Der Osten erhob Anspruch auf seine Besonderheit. Der Westen forderte Unterwerfung, der Osten forderte Respekt. Als Rom klarmachte, dass es (östlich ausgedrückt) den Respekt verweigerte beziehungsweise (in westlichen Begriffen) mit einem Formelkompromiss nicht zufrieden war, ließ Kerullarios keine Brüskierung und keine Schmähung der »Hunde«, »Pestmenschen«, »Gotteslästerer« und »Teufelskinder« aus. Humbert stand ihm nicht nach und schalt seinen Widersacher einen »Esel«, »Drachenschwanz«, »Giftmischer« und, erstaunlich modern anmutend, den »Teig Mohammeds«: einen Wegbereiter des dämonisierten Feindes, des Islam.
Aber neben dem schweren Säbel beherrschte Humbert auch die feine Klinge. Seine Schriften weisen den Mönch aus Lothringen als scharfsinnigen Analytiker von hoher Bildung aus, der obendrein gut schreiben konnte. Michael Kerullarios dagegen war genau der Typ eines geistlichen Würdenträgers, dem der Papst und sein treuer Kabinettschef zu Hause den Kampf angesagt hatten. Das kirchliche Amt war für ihn nicht weniger eine Machtposition als jedes weltliche. Von Theologie hatte der Patriarch keine Ahnung; für derlei Legitimationsideologien hatte er seine Leute. Anfangs hatte der Sohn eines hohen Finanzbeamten aus angesehener Hauptstadtfamilie sich in der Politik versucht und eine Verschwörung gegen den Kaiser angezettelt. Nach deren Scheitern musste er ins Kloster gehen. Was für seinen späteren Widersacher Humbert die lebenslange Bestimmung war, war für Michael eine Strafe. Sein neuer Stand hinderte den nunmehrigen Gottesmann allerdings nicht, weiter um Macht zu kämpfen, in allen politischen Streitfragen mitzumischen und sich sogar zum Kaisermacher aufzuschwingen.
Lässt man die Argumente beider Seiten von damals Revue passieren, jagt ein Déjà-vu-Erlebnis das andere. So listet Kerullarios die zahlreichen Verstöße der Westler gegen göttliche Gebote auf, etwa dass sie sich den Bart rasieren, erstickte Tiere und obendrein verbotene Arten verzehren, dass sie in der Messe zur Fastenzeit kein Alleluja singen – Formalismen allesamt, wie sie in ihrer wahllosen Häufung selbst den formverliebten byzantinischen Zeit- und Glaubensgenossen schon lächerlich vorkamen. Humbert stört an Michael genau das Gegenteil. Er mokiert sich, dass bei den Griechen in der Beichte nicht »nach den Geboten der Liebe Gottes und des Nächsten geforscht wird«, nicht nach dem eigentlich Wichtigen also, »sondern ob einer Bärenfleisch gegessen hat«.
Hier der Formalismus, stures Insistieren auf Nebensächlichkeiten, dort das Beharren auf dem »Eigentlichen«, das Indie-Tiefe-Gehen, das übergriffige Eindringen und Nachforschen, ob jemand es auch wirklich so meint: Auch solche Gegensätze sorgen über die Zeiten hinweg noch immer für Misshelligkeiten zwischen Ost und West. Wenn es dagegen um die Macht und ihre Insignien geht, verstehen die Widersacher die Sprache des je anderen nur zu gut, heute wie damals – wenn etwa Humbert den Patriarchen in der Anrede zum »Erzbischof« degradiert und wenn umgekehrt Kerullarios den Papst nicht als »Vater«, sondern als »Bruder« anspricht und sich, Gipfel der Hybris, die berühmten roten Schuhe anzieht, ein altes Symbol für Macht und Würde, das der Papst sich vorbehält und das noch den 2013 abgetretenen Benedikt XVI. zur Fashion-Ikone gemacht hat.
Sogar ganze Sätze von damals finden, übersetzt, auch aktuell Verwendung. Wie die Besserwisser aus dem Westen sich erdreisten könnten, dortige Verhältnisse zu beurteilen, »wo sie doch nicht einmal unsere Sprache sprechen!« So kann man es vor allem aus dem heutigen Ungarn heute wieder hören. Humbert, der Mann aus Lothringen, hatte die Leitung der Delegation nach Konstantinopel nicht nur bekommen, weil er so eng mit dem Papst war, sondern auch wegen seiner Griechischkenntnisse. Ob es damit wirklich weit her war, ist umstritten; die östlichen Quellen bezweifeln das. Ein wenig Hochstapelei, zumal im Kreise konkurrierender Getreuer rund um den Papst, würde gut ins Humbert-Bild passen; »Ostexperte« wird man auch heute schnell, vorausgesetzt, man verfügt über die »richtige« moralische Sicht.
***
Von tausend Jahre alten Geschichten darf man erwarten, dass sie längst überholt und erledigt sind. Das gilt aber nicht, wenn die Konstellationen sich erhalten haben. Das haben sie; sogar verfestigt und immer wieder verjüngt haben sie sich. Zwar treffen in der Gegenwart längst nicht immer der anmaßende Prediger und der bockige Intrigant aufeinander, wenn in Europa Ost und West einander begegnen. Aber wenn sie es tun, und sie tun es immer wieder, rufen sie auf beiden Seiten vertraute Bilder wach. Selbst dann, wenn Osteuropa ausnahmsweise einmal auftrumpft, wie unter Lenin oder Viktor Orbán, hat es als wichtige Karte die Erinnerung an erlittene Kränkungen auf der Hand.
So heftig wie damals, im Jahr 1054, waren Osten und Westen seit ihrer Christianisierung noch nie zusammengestoßen. In der Folge verschoben sich die Machtverhältnisse in Europa nachhaltig. Humbert kam aus einer Gegend, die zum Kernland erst des christlichen Abendlandes und dann der Europäischen Union werden sollte: dem Gebiet zwischen Rhein und Seine, Köln und Paris. Hier, in Burgund, stand das berühmte Reformkloster Cluny. Von hier, aus dem Elsass, stammte nicht nur der Papst, sondern auch dessen Vetter zweiten Grades, der »römische« Kaiser Heinrich III.
Kaiser, abgeleitet vom römischen Caesar, war der Titel für den Erben des antiken Weltreiches. Nach dem Sinn des Begriffs durfte es nur einen Kaiser geben. Es gab aber deren zwei, einen im Westen und einen im Osten. Der östliche hatte eindeutig den älteren Thron inne, war reicher und kultivierter. Die Rivalität erstreckte sich auch auf das Religiöse. Beiden, dem westlichen wie dem östlichen Kaiser, stand ein christliches Kirchenoberhaupt gegenüber. Unter den fünf »Patriarchaten«, die sich noch auf die Apostel zurückführen lassen, reklamierte das römische einen Führungsanspruch für sich. Die anderen vier, besonders der Patriarch von Konstantinopel, stuften die Position des römischen Papstes zu einem bloß zeremoniellen »Ehrenvorrang« herab.
Es war tatsächlich ein Konflikt zwischen Ost und West, nicht zwischen Nation A und Nation B. Die Menschen in Konstantinopel galten als »die Griechen«, gleich ob sie zu Hause Griechisch oder vielleicht Serbisch, Bulgarisch oder Albanisch sprachen. Dass auch quer durch das abendländische Kernland um Lothringen und Burgund eine Sprachgrenze verlief, spielte ebenso wenig eine Rolle. »Deutsche« und »Franzosen« gab es noch nicht. Humbert mochte in seinem lothringischen Kloster am besten Altfranzösisch gesprochen haben, sein Chef eine Tagesreise weiter östlich mochte im Übergang vom Alt- zum Mittelhochdeutschen groß geworden sein. Für die Konkurrenz im Osten waren sie unterschiedslos »die Franken«. Ihr Ruf am Bosporus war schlecht, sie galten als primitiv. Hundertfünfzig Jahre nach dem Streit zwischen Humbert und Michael belegten die »Franken«, wie berechtigt das Vorurteil war. Vor allem französische Ritter und venezianische Kaufleute plünderten auf einem Kreuzzug, der sie eigentlich zu den heiligen Stätten nach Palästina führen sollte, erst einmal auf brutale Weise Konstantinopel. Am Reichtum und an der Pracht der Stadt hatten sie sich nicht sattsehen können. Jetzt holten sie sich, was sie kriegen konnten, ohne auf Tradition, Würde und Heiligkeit der Schätze zu achten. Die Berichte von der Plünderung Konstantinopels kursieren im orthodoxen Osteuropa bis auf den heutigen Tag und werden regelmäßig hervorgeholt, wenn die Rohheit und moralische Minderwertigkeit des Westens bewiesen werden sollen. Die mehr als 800 Jahre Zeitdifferenz schnurren dann auf einen Augenblick zusammen.
***
Soviel sich sonst auch änderte: Ost und West behielten von da an nicht nur ihre Rollen, sondern auch die Sicht, die sie voneinander pflegten. 400 Jahre nach dem Zusammenprall zwischen Humbert und Michael eroberten die muslimischen Osmanen das seit langem schon geschwächte Konstantinopel und nannten es, auf Griechisch, Istanbul – eis tèn pólin11, was »in die Stadt« heißt und die Richtung bezeichnet, in die die Bauern der Umgebung ihre Waren trugen. Kaiserstadt war Istanbul nun nicht mehr; zu neuer Blüte kam es als Sitz eines islamischen Sultans. Anders als im Westen aber hat sich in Osteuropa ein Bewusstsein von der Kontinuität der Metropole erhalten: Der Name Carigrad, Kaiserstadt, gilt in den meisten slawischen Sprachen inzwischen zwar als veraltet, ist aber im Slowenischen noch immer üblicher Sprachgebrauch.
Bis dahin hatte die Stadt sich als das »zweite Rom« bezeichnet. Das erste, das in Italien, war im Mittelalter stark heruntergekommen; zwischen den Trümmern der Tempel grasten Schafherden. Aber auch mit Konstantinopel sollte es bald bergabgehen. Lange bevor die Osmanen seine Hauptstadt eroberten, war das Reich der östlichen Christenheit auf ein kleines Gebiet östlich und westlich des Bosporus zusammengeschrumpft. Wirtschaftlich, wissenschaftlich und technologisch zog der Westen, Humberts Heimat, ihm davon. Als dann anno 1453 auch das »zweite Rom« gefallen war, wurde der Titel als Hauptstadt der Christenheit vakant. So nahm sich gut dreißig Tagesreisen nördlich von hier ein Großfürst, von dem kaum jemand je gehört hatte, die Nichte des letzten Kaisers zur Frau und eignete sich mit ihr die Symbole des untergegangenen Reiches an. Der Glanz Konstantinopels aber ließ sich in die kühlen Wälder des Nordens nicht mitnehmen. Dass ein Mönch in dem fernen, finsteren Land für die bescheidene Residenzstadt seines Fürsten den pompösen Titel »drittes Rom« prägte – das alles drang ins Bewusstsein der meisten Menschen im Süden und Westen nicht vor. Doch während sich im Westen der Schwerpunkt weg vom Mittelmeer verschob und im Südosten mit dem Islam eine ganz andere Kraft auf den Plan trat, entwickelte sich im Norden des Ostens allmählich ein weiteres Zentrum. Als Portugiesen, Spanier, Engländer und Holländer fremde Meere erkundeten und ihre Kolonien gründeten, eroberten sich niederdeutsche Kaufleute die Ostsee und erschlossen so das weite Russland für den europäischen Markt. Seither gibt es zweierlei Osten. Zur Hauptstadt einer halben Welt sollte Moskau allerdings erst Jahrhunderte später werden.
Das Europa, das am Ende des Mittelalters entstand, hat sich in seinen Grundzügen erhalten. Die Rollen waren schon vorgeprägt. Der antike Vorläufer des Ost-West-Verhältnisses, wie wir es heute erleben, war das Weltbild der alten Griechen gewesen, die im Ausland überall Barbaren sahen, sogar im weiter westlichen Italien. Für die Römer dann und später für die Byzantiner lebten die Barbaren im Norden. Nach dem Fall Konstantinopels drehte sich das Weltbild noch einmal um 90 Grad. Seither steht es fest.
***