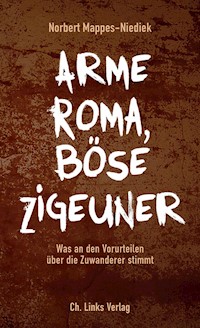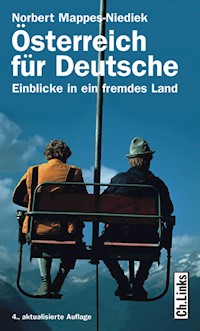26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Jugoslawienkriege haben die Weltöffentlichkeit erschüttert. Sie sind verbunden mit den schlimmsten Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg – mit Folgen, die unmittelbar in unsere Gegenwart reichen. Norbert Mappes-Niediek, langjähriger Südosteuropa-Korrespondent, führt in seiner großen erzählerischen Gesamtdarstellung mitten hinein in dieses dunkle Kapitel der jüngsten europäischen Geschichte: angefangen mit den ersten Panzern in Slowenien und dem Schock darüber, dass im vermeintlich friedlichen Europa plötzlich wieder Krieg ausbricht, bis hin zum UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Er zeichnet die Bruchstellen des gescheiterten Vielvölkerstaats nach, nimmt das unfassbare Massaker im bosnischen Srebrenica in den Blick, fragt nach Interessen und Strategien der Kriegsparteien, aber auch nach der Verantwortung der ausländischen Mächte – und macht so die weltpolitische Tragweite des Konflikts deutlich. Scharfsichtig und eindringlich schildert Mappes-Niediek, der die Region kennt wie wenige andere, den blutigen Zerfall Jugoslawiens – der unseren Kontinent beinah zerrissen und bis heute verändert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Norbert Mappes-Niediek
Krieg in Europa
Der Zerfall Jugoslawiens und der überforderte Kontinent
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung Paul Lowe/Panos Pictures
ISBN 978-3-644-01069-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für Emil
Einleitung – Klare Verhältnisse
1. Slowenien geht von der Fahne: Das Ende des Bundesstaats
Jugoslawien, ein besonderes Land zwischen den großen Blöcken
Viele konkurrierende Identitäten und ein Staat
In Serbien regt sich eine nationalistische Bewegung
2. Kroatien: Ein neuer Nationalstaat kämpft um seine Konturen
Der Konflikt beginnt: Kroatiens Serben lehnen sich auf
Der nächste Schritt: Der kroatisch-serbische Streit wird zum Krieg
Die Stunde Europas schlägt – und vergeht
3. Im offenen Krieg streitet Europa um diplomatische Anerkennung
«Ethnische Säuberungen» und ihre Exekutoren
Die Volksarmee beschießt und belagert Vukovar und Dubrovnik
Die Anerkennung: Ein ratloser Kontinent, ein wild entschlossenes Deutschland
Europas Lösung und ihre fatalen Folgen
4. Bosnien-Herzegowina: Der Tod einer Gesellschaft
Ein Volk oder viele? Bosniens Widerspruch
Vom ethnischen Gleichgewicht zum Desaster
Bosnische Serben schaffen ihren Staat und «säubern» ihn von Muslimen
5. Vermittlung oder Parteinahme? Diplomatie in der Zwickmühle
Scheiternde Verhandlungen, Elend im Land
Terror und Belagerung: Sarajevo, Mostar, Banja Luka
Serben gegen Serben, Kroaten gegen Kroaten, Muslime gegen Muslime
6. Pax Americana: Offensiven zu Lande und aus der Luft
In den USA wirft ein neuer Präsident das Steuer herum
Finale Frontbegradigung und das Massaker von Srebrenica
Von Srebrenica über Knin nach Dayton: Das «Endspiel»
7. Kosovo: Ein letzter Balkankrieg
Albaner und Serben: Ein schwieriges Verhältnis
Los von Belgrad: Vom passiven Widerstand zum bewaffneten Kampf
Auftritt der Nato
Luftkrieg gegen Serbien
Schluss – Friede oder Menschenrechte: Das Dilemma um die Kriege
Anhang
Anmerkungen
[Kapitel]
[Kapitel]
Zeittafel
Literatur
Personen
Dank
Bildnachweis
Für Emil
Einleitung – Klare Verhältnisse
Krieg in Europa: Als der Alarmruf zum ersten Mal nach sechsundvierzig Friedensjahren wieder erklang, traf er auf Entsetzen, mehr aber noch auf ungläubiges Staunen. Krieg, wirklich? Oder doch nur ein Scharmützel, typisch für einen traditionell unruhigen Winkel des Kontinents? Die deutsche «Tagesschau» meldete von «Kämpfen» an jenem Tag Ende Juni 1991 einen toten Soldaten. In Frankreich gehörten die ersten drei Minuten der Acht-Uhr-Nachrichten erst einmal einer Katastrophe im eigenen Land, bei der in einem Thermalbad zwanzig Menschen erstickt waren. Die ersten erschrockenen Solidaritätsadressen erreichten das betroffene Slowenien aus der Nachbarschaft, von einem ungarischen, einem russischen und einem tschechischen Schriftsteller.
Die Nachricht aus Jugoslawien fiel in keine Epoche von Hass und Krieg. Im Gegenteil: So viel Zuversicht und Aufbruch wie in jenen Jahren hatte die Welt lange nicht gekannt. Seit der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, 1986 eine Ära von «Glasnost und Perestroika» eingeläutet hatte, von Offenheit und gesellschaftlicher Umwandlung, fielen die kommunistischen Regime im Osten Europas wie Dominosteine. Im Juni 1989 brachten in Polen erste freie Wahlen die lange verbotene Oppositionsbewegung Solidarność an die Macht. Im November dieses «Annus mirabilis» wurde die Berliner Mauer geöffnet, keine drei Wochen später brachte ein Generalstreik auch das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei zu Fall. Als in Slowenien die Panzer rollten, hatten selbst in Albanien, der härtesten Diktatur Osteuropas, freie Wahlen stattgefunden. Fast überall ging der Übergang unblutig vonstatten. Dass in Rumänien Einheiten der Geheimpolizei mehr als tausend Menschen erschossen, war leicht als Rückzugsgefecht eines untergehenden Regimes zu erkennen. So, als letztes oder vielleicht vorletztes Aufbäumen einer angeschlagenen Diktatur, war auch das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gedeutet worden, bei dem 1989 vermutlich einige Tausend Menschen ums Leben kamen.
Nicht nur im Ostblock purzelten die Diktaturen, auf der ganzen Welt entschieden sich freie Menschen für friedliche und demokratische Formen des Zusammenlebens. Ende 1989 lösten in Chile freie Wahlen den Tyrannen Augusto Pinochet ab. Nur Wochen später wurde in Südafrika nach siebenundzwanzig Jahren Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen; das rassistische Apartheidregime war am Ende. Diktaturen gehen, die Demokratie kommt: Eine unaufhaltsame Gesetzmäßigkeit schien am Werke. Anfangs war es noch zäh vorangegangen. In den siebziger Jahren hatten die autoritären Regime in Portugal, Griechenland, Spanien weichen müssen. Seit den achtziger Jahren dann wurde die Liste der Diktatoren von Jahr zu Jahr kürzer. Als der Siegeszug der Demokratie unumkehrbar schien, verkündete der Amerikaner Francis Fukuyama sogar das «Ende der Geschichte». In den «liberalen Revolutionen» in Osteuropa erkannte der politische Philosoph ein «menschliches Grundmuster», das sich naturhaft durchsetzen würde. Die Kriege in Jugoslawien, die 1992, als sein Buch erschien, gerade voll entbrannt waren, hielt Fukuyama wie die meisten seiner Zeitgenossen für «Geburtswehen einer neuen und allgemeinen demokratischen Ordnung in der Region».[1]
Freie Wahlen, unabhängige Gerichte, offene Debatten schienen die letzten fehlenden Voraussetzungen dafür zu sein, dass die Menschen überall auf der Welt ihre Interessen friedlich gegeneinander abgleichen würden – sowohl innerhalb der Länder, in denen sie lebten, als auch zwischen ihnen. Dass ausgerechnet in Europa der Triumph der Demokratie einen Krieg mit sich bringen würde, mochte sich auf dem Kontinent der sauber abgegrenzten Nationalstaaten niemand vorstellen. Europa vereinigte sich; 1991, das Jahr, als in Jugoslawien Krieg ausbrach, war auch das Jahr, in dem die Europäische Gemeinschaft ein großes Stück weiter zusammenrückte.
Nur das damals achtgrößte Land in Europa trat eine historische Geisterfahrt an, wie es schien. Während auf dem Kontinent die Zeichen auf Vereinigung standen, löste Jugoslawien sich auf, und so gut wie niemand schien es zusammenhalten zu wollen. Millionen flüchteten oder wurden vertrieben, mehr als hunderttausend Menschen kamen in den Jugoslawienkriegen ums Leben. Appelle an eine höhere Vernunft, ein gemeinsames Lebensinteresse, ein vereintes Europa verklangen im Gefechtslärm.
Was wie ein Widerspruch zum großen Trend aussah, interpretierten jene, die den Zerfall vorantrieben, zu dessen Beginn jedoch ganz anders. Das Zusammenwachsen Europas und das Auseinanderfallen Jugoslawiens seien «Teile desselben Prozesses», meinte der damalige slowenische Außenminister, als noch nicht absehbar war, wie schlimm es werden würde. Man wolle ja gerade teilhaben am Projekt Europa, aber anders als sein eigener Teilstaat seien andere Republiken Jugoslawiens «noch nicht darauf vorbereitet, europäische Standards zu erfüllen», was eine Trennung unvermeidlich mache.[2] Seit die Verfassung die Volksgruppen zu den Trägern der politischen Macht erhoben hatte, stritten sie sich unablässig um Posten, Haushaltsmittel, Entwicklungsprojekte, Investitionen und vor allem um den Rahmen, in dem sie streiten wollten: Sollte das Land zentral oder dezentral regiert werden? Wenn eine Ehe nicht funktioniert, ist Scheidung der Ausweg: Das war die gängige Metapher für die Auflösung des Vielvölkerstaats, geeignet, das Geschehen als zwar bedauernswert, aber doch als normal oder wenigstens als unausweichlich erscheinen zu lassen.
Klare Rechnung, gute Freunde: Die Redensart stand noch im offenen Krieg für die Hoffnung, dass nachher alles besser würde. Einmal unter sich, könnte jede einzelne Nachfolgenation sich von den dauernden ethnischen Konflikten ab- und den eigentlichen Problemen zuwenden – den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, wie sie nach dem Ende des Sozialismus auch alle anderen Übergangsländer zu bewältigen hatten. Nahm man den slowenischen Außenminister beim Wort, schien es ohnehin nur eine Trennung auf Zeit zu sein; irgendwann würden auch die jetzt noch uneinsichtigen Nachzügler im Südosten, in Serbien, den Weg ins vereinte Europa finden, würden aus den hoffnungslos zerstrittenen Volksgruppen Jugoslawiens normale Nachbarn werden.
Es war ein Irrtum, und er schleppte sich fort. Zwei Jahrzehnte waren die Jugoslawienkriege schon vorbei, aber noch immer war «der Balkan» in aller Augen das Pulverfass, die Krisenregion, der Unruheherd. Das sollte nicht ewig so bleiben, und so kamen die Potentaten zweier jugoslawischer Nachfolgestaaten, Serbiens und des Kosovo, überein, die verbliebenen Probleme mit einem sauberen Schnitt zu lösen. Wichtige politische Persönlichkeiten vom Rest des Kontinents fanden die Idee gut, trafen sich an einem schönen Sommertag in den Tiroler Bergen und machten die Welt mit dem Einfall bekannt. Man könnte doch ein wenig die Grenzen korrigieren! Noch immer stritten die letzten Kriegsparteien der blutigen neunziger Jahre, Serben und Albaner, um ein paar Dörfer, eine geteilte Stadt, einige Straßen, albern im Grunde, aber nicht wegzuleugnen. Wenn das alles war, was die Streithähne von einem dauerhaften Frieden trennte, warum nicht diesen letzten kleinen Schritt noch gehen?
Ein christdemokratischer EU-Kommissionspräsident aus Luxemburg, eine sozialdemokratische Außenbeauftragte aus Italien und ein grünes Staatsoberhaupt aus Österreich fassten sich ein Herz und warben für den Vorschlag, dass Serbien und Kosovo, zwei unabhängige Staaten aus der Konkursmasse des untergegangenen Jugoslawien, ein paar Gebiete austauschten – nicht viel, aber genug, um einen lästigen Streitpunkt aus dem Weg zu räumen. Aus dem Weißen Haus in Washington kam kräftiger Applaus für die Idee.[3] Wenn sich nach der Aufteilung Jugoslawiens die entspannte Nachbarschaft nicht eingestellt hatte, so war sie wohl nicht gründlich genug vollzogen worden – so die Idee hinter der Initiative. Klare Verhältnisse schaffen: Der Leitgedanke der Kriege zündete noch immer.
Die Idee führte abermals in die Irre. Jahrhundertelang hatten Kroaten, Serben, bosnische Muslime und Albaner unter wechselnden staatlichen Verhältnissen miteinander gelebt – erst in vielen kleinen Fürstentümern, dann in großen Imperien oder im kunstvoll komponierten Jugoslawien der kommunistischen Zeit. Wie ein ewiges Filmdrama, eine Dauerserie zog sich das multiethnische Zusammenleben durch die Zeit. Man war einander nicht fremd, im Gegenteil. Episoden von Streit und Kampf wechselten in der gemeinsamen Geschichte mit Liebesszenen und Folgen ruhigen Nebeneinanderherlebens. Wie ein plötzliches Standbild dann hielt die Aufteilung des Landes die wechselvolle Serie mitten in der schlimmsten Szene an. Wo die Volksgruppen von der staatlichen Aufteilung an nun getrennt voneinander lebten, hatten sie keine Chance mehr, ihre schlechten Erfahrungen mit der je anderen durch neue, gute Erfahrungen in den Hintergrund zu rücken. Eine ganze Generation in Bosnien-Herzegowina kennt ihre Altersgenossen anderer Nationalität nur noch aus dem Fernsehen oder über die schlimmen Erinnerungen der Eltern. Das letzte lebendige Bild von der je anderen Volksgruppe war das vom Feind im Kriege; es erstarrte zum Stereotyp, wurde ideologisch.
Übersichtlichkeit statt «schwieriger Gemengelage», eindeutige Verhältnisse statt «Flickenteppich» erschienen nicht nur den Kriegsherren Jugoslawiens als Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben im künftigen Europa. So war es schon den Deutschen im Zweiten Weltkrieg vorgekommen, als sie Minderheiten deportierten oder sogenannte Volksgenossen «heim ins Reich» holten, ganz wie später auch den von deutscher Eroberung befreiten Nationen im Osten Europas, die nun ihrerseits Deutsche vertrieben. Was sich nicht verträgt, gehört getrennt: Selbst im multiethnischen Jugoslawien der Nachkriegszeit war der Gedanke lebendig. Als der Bundesstaat 1945 von Tito gegründet wurde, waren die neuen Teilrepubliken als Quasi-Nationalstaaten gedacht. Über die Jahrzehnte wurden ihre Grenzen immer mehr zu Sollbruchstellen für die spätere Aufteilung. Als die Halbinsel Istrien aus italienischer unter jugoslawische Herrschaft wechselte, dekretierte Tito treuherzig: Italiener nach Italien! So schien es seiner ganzen Generation nur natürlich.
Nach anderer, modernerer Lesart aber wäre es natürlich gewesen, wenn Menschen dort hätten bleiben und sie selbst sein dürfen, wo sie sich ihr Leben eingerichtet hatten. Künstlich wäre danach im Gegenteil die Aufteilung, die Vertreibung der Menschen aus ihren Häusern. Auf den deutschen, Schweizer, schwedischen oder belgischen Schulhöfen, wo die Kinder der Kriegsflüchtlinge groß wurden, sortieren sich Fremdheit und Nähe heute wieder neu. Dass in jedem Land in Europa auf Dauer Menschen unterschiedlicher Herkunft, kultureller Prägung, Religion und Orientierung, mit verschiedenen Identitäten und Loyalitäten zusammenleben würden und es dafür neue Formen und Konzepte brauchte, sprach sich erst nach den Kriegen in Jugoslawien allmählich herum. Wie ein schauriger Gruß aus der Vergangenheit war den Zeitgenossen erschienen, was in diesem Land geschah. Dabei ist es noch immer eine Herausforderung für Europas Zukunft.
1. Slowenien geht von der Fahne: Das Ende des Bundesstaats
Der Tag vor dem Kriegsausbruch verlief feierlich und erhaben, nur eine gewisse Spannung war zu spüren. Für Mittwoch, den 26. Juni 1991, war in Ljubljana ein großer Festakt unter freiem Himmel angesagt, auf dem riesigen, rundum betonierten Platz der Republik, dem modernsten in der einstigen habsburgischen Provinzstadt. Die Feier ließ an Würde keine Wünsche offen. Zehntausende waren an dem lauen Sommerabend gekommen. «Herr Präsident», rief mit lauter Stimme ein junger Offizier in die spätabendliche Dunkelheit, «die Soldaten der Territorialverteidigung haben sich aufgestellt, um die Unabhängigkeit der Republik Slowenien zu feiern, und stehen bereit für Ihre Inspektion!» Tusch, roter Teppich: Ein neuer Staat war geboren. Der Präsident, Milan Kučan, verbeugte sich kurz und marschierte festen Schrittes an der Parade vorbei. Unter den fröhlichen Klängen der Zdravljica, der Nationalhymne, wurde die Flagge Jugoslawiens eingeholt und die slowenische gehisst. Kučan, ein kleiner, stets ein wenig erschrocken dreinblickender Mann von ganz unmilitärischer Erscheinung, sprach historische Worte: «Heute sind Träume erlaubt», sagte er vor den versammelten Bürgern seiner Hauptstadt. «Morgen ist wieder ein anderer Tag.»
Den slowenischen Politikern war zu diesem Zeitpunkt schon klar, was es am anderen Tag geben würde: Krieg. Sie hatten eine rote Linie überschritten. Dabei war die formale Erklärung der Unabhängigkeit nicht einmal der entscheidende Anlass; eine solche Erklärung hatte am selben Tag, sogar wenige Stunden früher, auch die Nachbarrepublik Kroatien abgegeben, ohne dass die Armeeführung in Belgrad sich gerührt hatte. Allerdings hatte die slowenische Polizei schon am Vortag des Festaktes die Grenzübergänge nach Österreich, Italien und Ungarn eingenommen und die Zollhäuser besetzt – friedlich, ohne einen Schuss, aber eben auch tatsächlich, physisch. Die Stunde der Tat war gekommen. Slowenische Polizisten standen an der Grenze und fragten Urlauber nach dem Pass.
Am besagten anderen Tag, einem strahlend schönen Junimorgen, wollte von den Bussen, mit denen die Bürger von Ljubljana sonst zur Arbeit fuhren, kein einziger kommen. Die meisten Berufstätigen warteten vergeblich und gingen von der Haltestelle wieder nach Hause, die einen besorgt, die anderen achselzuckend. Was los war, konnte sich nach den Geschehnissen der letzten Tage zwar jeder ungefähr vorstellen. Aber wirklich glauben mochte man es nicht.
Eine Frau, Alenka Puhar, wollte es genauer wissen, hielt den Daumen raus und stoppte ein Auto.[1] Sie kam nicht weit: ein Stau. Von der Klagenfurter Straße herüber klangen Geräusche wie von einer Schrottpresse, laut, dumpf, manchmal quietschend, unterlegt von tiefem Grollen. Zu Fuß ging Alenka Puhar weiter in Richtung Stadt. An der Kreuzung mit der großen Umgehungsstraße dann standen sie alle da, die vermissten Busse, zusammen mit etlichen Lastern, Baggern, Müllwagen, alle quer zur Fahrbahn, sodass niemand vorbeikam, und erwarteten die Panzer. Gemächlich, wie in Zeitlupe, unaufgeregt, aber unaufhaltsam rollte von der Autobahn her die Kolonne heran, schob die Busse und Laster wie Spielzeugautos beiseite und rollte gelassen weiter.
Kettenrasselnde Ungetüme auf den gepflegten Boulevards einer mitteleuropäischen Stadt: Das Bild kannte Alenka Puhar, wie alle aus ihrer Generation, noch von Prag, wo dreiundzwanzig Jahre zuvor Panzer der Warschauer-Pakt-Staaten die Tschechoslowakei besetzt hatten, um die «Konterrevolution» zu stoppen. Aber das hier war nicht wie in Prag, ging es Puhar durch den Kopf. Ein paar Passanten beobachteten das Schauspiel, einige empört, die meisten fasziniert. Niemand stand – wie damals, 1968 – mit offenem Hemd vor einem Geschützrohr und rief: «Schießt doch!» Hier fand keine hilf- und aussichtslose Revolte statt. Es war Krieg.
Stunden genügten, um die ganze Bevölkerung des kleinen Landes in den dazu passenden Modus zu bringen. Nicht wenige Menschen hielten in den folgenden Tagen selbst eine automatische Waffe in der Hand und schossen auch. Zum ersten Mal nach 1945, Alenka Puhars Geburtsjahr, dröhnte wieder Luftalarm über Ljubljana. «Es war ein weiterer wunderschöner Sommertag», erinnerte sich Puhar wenig später. «Alle Bunker, alle Keller waren voller Menschen, einige starr vor sich hin blickend, andere weinend, wieder andere mit steinerner Miene, ihre Teddybären, ihre Handtaschen fest umklammernd, und fragten den schweigenden Gott: ‹Menschen fliegen über meinen Kopf. Wollen sie mich töten? Warum wollen sie mich töten?›»
Luftangriffe auf Städte blieben dann doch aus in dem kurzen Krieg um die Unabhängigkeit Sloweniens im Jahr 1991. Aber die Sirenen über Ljubljana schufen eine neue Lage und eine neue Stimmung – nicht nur für die nächsten Tage, sondern für viele Jahre. Die Bomber schweißten die Bürger von Ljubljana zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Jeder konnte Opfer sein. Von jetzt an war die Streitfrage nicht mehr: Wie machen wir es, wo stehen wir politisch, als Slowenen und zugleich als Bürger Jugoslawiens? Oder: Was tun wir? Welche Gesetze schaffen wir uns? Wie verteilen wir unter uns die Macht, die Posten, die Ressourcen? Von jetzt an hieß es: die oder wir.
Sloweniens Würdenträger hatten noch im Ivan-Cankar-Haus gefeiert, dem neuen Kongresszentrum, als in der Nacht zum Donnerstag die ersten Nachrichten eintrafen. In der Nachbarrepublik Kroatien hatten sich Panzerkolonnen der Jugoslawischen Volksarmee in Richtung Slowenien in Marsch gesetzt. Am 27. Juni, um 1.15 Uhr, überschritten sie die Verwaltungsgrenze, nach slowenischer Auffassung nun eine Staatsgrenze. Ebenfalls noch in der Nacht rückten jugoslawische Truppen auch aus den Kasernen auf slowenischem Boden aus und zogen zu den Grenzübergängen und dem Flughafen. Der junge Staat war auf den Angriff gut vorbereitet. Polizei und die sogenannte Territorialverteidigung, eine von jeder Teilrepublik kontrollierte Miliz, hatte an allen wichtigen Punkten auf der Strecke Barrikaden gebaut – ähnlich der auf der Klagenfurter Straße in Ljubljana, die Alenka Puhar beobachten sollte. An vielen Stellen hatten die Panzer mit den Hindernissen ihre Mühe, überall kamen die Konvois zum Stehen. Immer wieder griffen die slowenischen Truppen auch an, schossen mit Kalaschnikows und Panzerfäusten.
Die Generäle in Belgrad hatten mit einer kurzen, wirksamen Intervention gerechnet, nicht mit einem so entschlossenen Widerstand. Vor allem um die Grenzübergänge wurde tagelang gekämpft. Granaten schlugen ein, die jugoslawische Luftwaffe bombardierte Sender und Relaisstationen auf den Bergen Sloweniens. Militärisch hatten die Strategen in Belgrad sich verkalkuliert. Die kleinen Einheiten, die sie an die Grenzen schickten, waren den Truppen der slowenischen Territorialverteidigung zwar nicht an Waffen, aber an Mannstärke erheblich unterlegen – um mehr als das Zehnfache. Auch die Moral der Truppe ließ zu wünschen übrig: Die Entschlossenheit auf slowenischer Seite versetzte die jungen Soldaten aus allen Teilen Jugoslawiens in Schock. Kämpfen für die Einheit des Landes, Einheit mit denen, die da auf sie schossen? Selbst viele Offiziere waren unentschlossen, hin- und hergerissen zwischen Loyalität zu ihren Vorgesetzten und ihrem persönlichen Ethos. Ein Kompaniechef, der an der ungarischen Grenze nicht kämpfen wollte, wurde von seinem eigenen Unteroffizier angeschossen.
Am fünften Tag des Krieges musste Armeechef Veljko Kadijević erkennen, dass er seine Leute für eine verlorene Sache in den Kampf geschickt hatte. Um das Blatt in Slowenien doch noch zu wenden, wandte sich der General an die serbische Regierung mit der Bitte um Nachschub. So autonom sich die Armee auch gerierte: Für die Stellung der Wehrpflichtigen waren die einzelnen Republiken zuständig. Die Antwort aus Belgrad war ein klares Nein. Serbiens Präsident Slobodan Milošević war nicht interessiert an dem Krieg. Die Niederlage war damit total und unumkehrbar. Was aber nicht bedeutete, dass der Krieg vorbei gewesen wäre; er wechselte nur den Schauplatz und wurde schlimmer und schlimmer.
Schlecht vorbereitet und schwach motiviert, müssen die Truppen der Jugoslawischen Volksarmee sich dem Widerstand des geeinten Sloweniens geschlagen geben – hier in Pesnica bei Maribor.
Der Feldzug im Sommer 1991 ging als «Zehntagekrieg» in die Geschichte ein. Effektiv gekämpft wurde aber nur an sechs Tagen. 74 Menschen kamen um, davon 44 jugoslawische Soldaten. Zu den Toten gehörte Janez Svetina, ein bekannter Psychologe, Hobby-Philosoph und überzeugter Pazifist, der lange in Indien gelebt hatte. Er hatte im Grenzort Gornja Radgona die Panzer fotografieren wollen; gerade als er die Mara hob, seine Kamera, traf ihn eine MP-Salve. Ein junger österreichischer Fotojournalist und sein Fahrer wurden von einer Granate getroffen, als sie mit ihrem Geländewagen über die Landebahn des Flughafens von Ljubljana fuhren. Unter den Opfern war aber auch ein junger Pilot der jugoslawischen Armee, der mit seinem Hubschrauber über die Innenstadt von Ljubljana geflogen war. Der Verteidigungsminister des neuen Staates, Janez Janša, hatte den tödlichen Abschuss persönlich betrieben; er sollte die Wende bringen. Dass der Helikopter bloß Brot zu den Truppen bringen sollte und dass der tote Pilot von der Nationalität ein Slowene war, konnte der Minister nicht wissen. Aber dass aus dem Hubschrauber nicht geschossen wurde, war ihm klar. Trotzdem sei der Abschuss der «erste Umschwung im Krieg» gewesen, erklärte Janša später, «viel bedeutender, als es damals manch einem erschien. Die psychologische Barriere war gebrochen.»[2] Wie man einen Krieg führt, wusste Janša nach gründlicher Lektüre der historischen Strategen Clausewitz und Moltke sehr genau. Wer gewinnen wollte, musste töten wollen. Die oder wir: Die Logik des Krieges sollte von nun an ein Jahrzehnt lang in ganz Jugoslawien das Handeln der Verantwortlichen auf allen Seiten bestimmen.
Jugoslawien, ein besonderes Land zwischen den großen Blöcken
Eine alte, bürokratische Elite einer kommunistischen Partei, die im Todeskampf um sich schlug, auf der anderen Seite eine neue Generation aus liberal und demokratisch gesinnten Europäern: Das Muster, das anderthalb Jahre zuvor die Kämpfe in Rumänien erklärt hatte, schien auch auf Jugoslawien gut anwendbar. Die Frau jedenfalls, die am Morgen des 27. Juni 1991 vergeblich auf ihren Bus wartete und wenig später den Einmarsch der Panzerkolonne nach Ljubljana mit ansah, repräsentierte die eine Seite des Konflikts mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Alenka Puhar hatte in jungen Jahren George Orwells «1984» ins Slowenische übersetzt, den bekannten Roman über die Mechanismen einer totalitären Diktatur. Mit einem bahnbrechenden Essay über die Kindheit im späteren Jugoslawien im 19. Jahrhundert nahm sie Themen auf, die zur selben Zeit auch im Westen Europas und in den USA, wo sie studiert hatte, diskutiert wurden: demokratische und autoritäre Erziehung, Patriarchat, die Rolle der Frauen, Machtverhältnisse in der Familie.
Im selben Jahr, als Puhar ihren Aufsatz über die jugoslawische Kindheit schrieb, 1982, startete in Ljubljana das literarische Magazin «Nova Revija», das sich bald an politische Themen heranwagte und zum Kristallisationskern einer neuen, kritischen Zivilgesellschaft wurde. Die Stadt am Südrand der Alpen, an Einwohnern gerade so groß wie Chemnitz oder Mönchengladbach, strahlte mit originellen Ideen weit über die Grenzen Sloweniens und seiner Sprache hinaus. Die Rockband Laibach forderte mit intelligenten Provokationen die jugoslawische Gesellschaft heraus. Kein Tabu war vor der Jugend von Ljubljana sicher. Ein Designstudio mit dem irritierenden Namen «Novi kolektivizem», Neuer Kollektivismus, reichte bei einem Plakatwettbewerb zum Tag der Jugend einen Entwurf aus der Nazizeit ein, bei dem nur die Hakenkreuzfahne durch die jugoslawische Trikolore mit dem roten Stern ersetzt war. Das Projekt errang den ersten Platz und blamierte so den offiziellen jugoslawischen Antifaschismus und dessen kämpferische Ästhetik ebenso peinlich wie gründlich.
Jugoslawien war zwar ein kommunistischer Einparteienstaat. Doch schon seit den 1960er Jahren waren die Grenzen der Meinungsfreiheit deutlich weiter gesteckt als jenseits des Eisernen Vorhangs. Erreicht waren sie in jedem Falle, wenn Tito, der Staats- und Parteichef, angegriffen wurde oder wenn sich jemand des «Nationalismus» schuldig machte – ein Vorwurf, der oft weit ausgelegt wurde. Ausländische Medien aber waren frei zugänglich, und die jugoslawischen nahmen sich von Jahr zu Jahr mehr Kritik heraus. Anders als in den Staaten des Warschauer Pakts herrschte für die meisten Bürger Reisefreiheit, von der vor allem im Nordwesten ausgiebig Gebrauch gemacht wurde. Kleidung kaufte man am liebsten im italienischen Triest, Elektrogeräte im österreichischen Graz. Viele Menschen, besonders in Slowenien, konnten sich das leisten. Schon 1966 schloss Jugoslawien mit Österreich, 1968 auch mit der Bundesrepublik Deutschland ein Anwerbeabkommen. Bis 1990 stieg in Deutschland die Zahl der jugoslawischen Migranten auf über 750000, über 280000 lebten in Österreich, mehr als 170000 in der Schweiz. Die meisten reisten in den Ferien über die sogenannte Gastarbeiterroute in die Heimat.
Die kritische, offene Nachkriegsgeneration, die sich vor allem in Ljubljana Gehör verschaffte, war keine Dissidentenszene wie im Ostblock. Keine verbotenen Bücher oder Zeitschriften gingen von Hand zu Hand, und wer öffentlich Kritik übte, musste sich nicht gleich vor Gefängnis oder vor Spitzeln fürchten. Zwar fanden keine großen Demonstrationen statt. Aber etwa Infotische unabhängiger Gruppen, an denen Unterschriften für dieses oder jenes Anliegen gesammelt wurden, waren gang und gäbe. Zwischen Regime und Opposition gab es keine klare Grenze. Speerspitze der Kritik war der Verband der Sozialistischen Jugend Sloweniens, eine Untergliederung des herrschenden Bundes der Kommunisten.[1] Der Verband war ein echter Machtfaktor: Er verfügte über Dutzende hauptamtliche Mitarbeiter und entsandte sogar Abgeordnete ins Parlament. Seine Zeitschrift «Mladina» (Jugend) fasste Jahr um Jahr immer heißere Eisen an. 1986 forderten Sloweniens «Jusos» auf einem legendären Kongress in der Stadt Krško die förmliche Legalisierung aller zivilgesellschaftlichen Bewegungen, wie sie im Westen damals verbreitet waren: Friedens-, Frauen-, Öko-, Lesben- und Schwulengruppen, dazu die Abschaffung politischer Strafen, das Recht auf Streik, auf Kriegsdienstverweigerung, auf freie wirtschaftliche Betätigung. Die Forderungen genossen auch an der Spitze der slowenischen Partei Sympathie; in jedem Fall waren Reformer und Konservative an ihren öffentlichen Äußerungen für jedermann leicht zu unterscheiden.
Den Gegenpol zu den liberalen Reformern markierte in den slowenischen Kontroversen der 1980er Jahre das Militär. Die Jugoslovenska Narodna Armija, die Jugoslawische Volksarmee, verwaltete einen wichtigen Teil der offiziellen Geschichtserzählung. Sie war aus der Volksbefreiungsarmee und den Partisaneneinheiten im Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Den jugoslawischen Partisanen war es damals als einzigen in Osteuropa gelungen, aus eigener Kraft die deutschen Besatzer abzuschütteln und deren lokale Verbündete zu besiegen. Unzählige Denkmäler und viele heroische Kinofilme sangen ihr Lied. Noch stärker wurde das Selbstbewusstsein der Befreiungskämpfer, als die jugoslawischen Kommunisten unter dem Partisanenführer Tito 1948 mit dem allmächtigen sowjetischen Diktator Stalin brachen und mit der Kraft ihrer Armee eine Invasion, wie sie später die abtrünnigen Ungarn und Tschechoslowaken erleben mussten, verhinderten.
Offiziere, selbst Unteroffiziere, der Jugoslawischen Volksarmee fühlten sich als Elite. Ihre Lebenswelt unterschied sich von der der Normalbevölkerung erheblich. Die meisten wohnten in geschlossenen Siedlungen, kauften in besonderen Läden ein. Für Auslandsreisen brauchten sie eine Sondererlaubnis. Viele waren schon mit vierzehn Jahren in eine Kadettenschule eingetreten und später auf die Militärakademie gewechselt. Wie in anderen Vielvölkerstaaten auf der Welt begriff sich auch in Jugoslawien das Offizierskorps als der Garant der staatlichen Einheit gegen die oft auseinanderdriftenden Volksgruppen. Während sich die meisten Bürger der sechs Teilrepubliken bei Volkszählungen als Serben, Kroaten, bosnische «Muslimani», Slowenen, Mazedonier oder Albaner deklarierten, bekannten sich viele professionelle Soldaten als «Jugoslawen». Nicht ohne Stolz bezeichnete sich die Armee mitunter als «siebte Republik».
Mit der politischen Schulung der Militärs war es nicht weit her. Alte Frontstellungen aus dem Zweiten Weltkrieg – hier Volksbefreiung und Sozialismus, dort Faschismus und Imperialismus – standen in den Köpfen unverrückbar fest. Die komplizierten Debatten in der Partei – etwa über «Arbeiterselbstverwaltung», «gesellschaftliche Unternehmen», «sozialistische Marktwirtschaft» – blieben ihnen meistens fremd. In ihren internen Papieren, die seit den achtziger Jahren immer wieder öffentlich wurden, herrscht der Geist knapper militärischer Briefings, die immer rasch, meistens zu rasch, auf den Punkt kommen müssen: Hinter neuen Bewegungen stehen «fremde Geheimdienste», die Bedrohungen kommen von außen.
Zwar stöhnten in Jugoslawien viele junge Männer unter der Wehrpflicht – anfangs drei Jahre, am Ende für Studenten nur noch zwölf Monate –, aber gänzlich unbeliebt war die Volksarmee in der Bevölkerung nicht. Als viertgrößte Militärmacht Europas trug sie nicht wenig zum Nationalstolz bei. Der Wehrdienst gab den Rekruten die Möglichkeit, das Land kennenzulernen und dabei interessante Erfahrungen zu machen. Junge Männer aus dem reichen Voralpenland Slowenien wurden systematisch in arme, aber spannende Gegenden des Balkans geschickt. Junge Albaner aus dem Kosovo oder aus Mazedonien wiederum lernten die Kommandosprache, Serbokroatisch, und zehrten in ihrem Berufsleben von der Erweiterung ihres Horizonts. Die schlichte, gerade Art der Kommandanten wurde im Kontrast zum ideologischen Kauderwelsch und den undurchsichtigen Intrigen der Politiker nicht selten als angenehm empfunden.
Für die Friedens-, die Ökologie- und die Frauenbewegung, wie sie vor allem in Slowenien um sich griffen, herrschte in der Armee kein Verständnis. Nicht nur widersprachen die Ziele der jungen Rebellen im sozialistischen Jugendverband den patriarchalischen Werten der Militärs: Slowenien, so karikierte Alenka Puhar deren Perspektive, sei den Offizieren wie ein «bad girl» vorgekommen, «immer mit zu kurzem Röckchen, zu stark geschminkt, zu frech».[2] Schlimmer noch: Die politischen Entwicklungen in der nordwestlichen Republik drohten auch die Einheit Jugoslawiens zu gefährden. Ging es um die Einheit, fühlten sich die Generäle ernstlich in der Pflicht. Die Männer an der Spitze der Armee waren fast alle zwischen 1930 und 1935 geboren – zu jung also, als dass sie selbst aktiv am glorreichen Partisanenkampf hätten teilnehmen können, alt genug aber, um zum Publikum für den Kult um ihre Väter und älteren Brüder zu werden. Ihre Ausbilder waren ihre Helden und ihre Vorbilder; sie selbst dagegen hatten nie Gelegenheit gehabt, sich zu beweisen. Als sich Slowenien abzusetzen begann, sahen sie ihren Einsatz gekommen.
Zu einem ersten Zusammenstoß der späteren Kriegsparteien kam es 1988. «Mladina», die Zeitschrift des rebellischen Jugendverbands, hatte im Frühjahr ein geheimes Armeepapier veröffentlicht. Unter dem Titel «Die Nacht der langen Messer» enthüllte darin der «Militärexperte» des Jugendblattes, der neunundzwanzigjährige Janez Janša, Pläne für eine eventuelle Niederschlagung der Demokratiebewegung in Slowenien. Mit Druck erreichte die Armeeführung, dass die slowenische Polizei Janša, den Koautor, den Chefredakteur sowie deren mutmaßlichen Informanten, einen Fähnrich, verhaftete. Kaum waren die vier festgenommen, zog ein Militärrichter das Verfahren an sich. Verhandelt wurde hinter verschlossenen Türen und zudem nicht auf Slowenisch, sondern auf Serbokroatisch – auch gegen die drei Zivilisten. Ganz Slowenien war empört, sofort bildete sich eine breite Solidaritätsbewegung. Dem Verlangen, die Bewegung polizeilich zu unterdrücken, kam die Parteiführung unter dem Reformer Milan Kučan nicht nach.
Fortan herrschte zwischen Slowenien und der Armee offene Gegnerschaft. Ihrem Selbstverständnis als Hüterin der Einheit nach durfte die Armee sich allerdings in die nationalen Querelen nicht einmischen und schon gar nicht gegen eine der jugoslawischen Nationen kämpfen. So glich ihr Agieren noch Tage und Stunden vor ihrem Eingreifen an jenem 27. Juni 1991 einem Eiertanz. Keine politische Entwicklung, nicht einmal die Unabhängigkeitserklärung der Teilrepublik, rechtfertigte einen Militäreinsatz. Die Armee sollte und wollte formal streng nach der jugoslawischen Verfassung vorgehen und erst zuschlagen, wenn tatsächlich etwas passierte – wenn etwa die Slowenen die Grenzübergänge einnehmen würden. Im Geheimen hatte das Parlament deshalb seine Unabhängigkeit schon am Tag vor der Feier erklärt, am 25. Juni. Damit hatte es seiner eigenen Rechtsauffassung nach die Übernahme der Grenzübergänge ermöglicht und sich vor der drohenden Intervention einen Tag Vorsprung verschafft.
An einem Grenzübergang zu Österreich hissen am 29. Juni 1991, nur zwei Tage nach Kriegsbeginn, slowenische Soldaten zum Zeichen ihres Triumphs die Fahne ihrer unabhängigen Republik.
Nationale Gegensätze, wie sie für die jugoslawischen Kriege bald nahezu sprichwörtlich werden sollten, spielten in diesem ersten Konflikt in Slowenien nur eine untergeordnete Rolle. Es ging um die Einheit Jugoslawiens, des Bundesstaats, der in seiner ganzen Geschichte zwischen Zentralismus und Föderalismus oszilliert hatte. Zwar wurde der Streit auf beiden Seiten auch von ethnischen Stereotypen befeuert – über primitive, gewalttätige Machos aus dem jugoslawischen Süden und «weichliche, reiche, verräterische, effeminierte Feiglinge» in Slowenien, wie Puhar das Klischee beschrieb. Nationalistische Mythen aber, wie sie die späteren Kriege antrieben, waren auf beiden Seiten, unter slowenischen Reformern wie in der Armeeführung, unwichtig bis verpönt. Noch im Zehntagekrieg des Jahres 1991 waren einige Generäle, nicht zuletzt der Befehlshaber des führenden Korps, Konrad Kolšek, selbst slowenischer Herkunft. Die anderen hielten demonstrativ an «Brüderlichkeit und Einheit», der Parole der Tito-Ära, fest und missbilligten den nationalen Eigensinn der Politiker. Verteidigungsminister Veljko Kadijević war Sohn einer Kroatin und eines Serben, der als ehemaliger Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg zum «Hochadel» der kommunistischen Partei gehörte; Tito selbst hatte eine slowenische Mutter gehabt. Das Umfeld aber, in dem Slowenien und die Armee 1991 Krieg gegeneinander führten, war schon seit Jahren hoch nationalistisch aufgeladen.
Viele konkurrierende Identitäten und ein Staat
Nach einem gern zitierten Wort des Staatsgründers Tito war das Jugoslawien, das die Volksarmee mit ihrem Slowenien-Feldzug schützen und retten wollte, ein Land «mit zwei Alphabeten, drei Sprachen, vier Religionen und fünf Nationen, die in sechs Republiken leben, von sieben Nachbarn umgeben sind und mit acht Minderheiten auskommen müssen». Das Bonmot wurde vielfach variiert. Gemeint waren aber immer: ethnische und kulturelle Vielfalt sowie eine komplizierte Struktur und eine schwierige Umgebung.
Die beiden Alphabete, das lateinische und das kyrillische, waren das geringste Problem. Bei den drei Sprachen hatte Tito an das damals so genannte Serbokroatische sowie an das Slowenische und das Mazedonische gedacht – auch das keine unüberwindliche Hürde im Zusammenleben, denn mit etwas Mühe können Menschen zwischen Kärnten und Bulgarien einander verstehen. Die vier Religionen spielten im kommunistischen Staat naturgemäß keine große Rolle. Wichtig dagegen waren die fünf Nationen[1] und sechs Republiken, aus denen der Bundesstaat sich zusammensetzte und die sich historisch, wirtschaftlich und später auch politisch teils gewaltig unterschieden. Unter den in dem Tito-Wort zitierten sieben Nachbarn hatten einige anfangs Begehrlichkeiten auf jugoslawisches Territorium gezeigt, gaben sich aber spätestens Ende der 1950er Jahre zufrieden. Von den acht nationalen Minderheiten schließlich, in Wirklichkeit waren es einige mehr, war nur eine ein Problem: die albanische. Sie war zahlenmäßig so stark wie drei der fünf Nationen, sprach eine für alle anderen unverständliche Sprache und grenzte zudem an einen albanischen Nationalstaat.
Zwistigkeiten zwischen den Volksgruppen begleiteten Jugoslawien schon seit seiner Gründung nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die Osmanen hatten das Volk nach Konfessionen eingeteilt, die Habsburger nach Nationalitäten. Serben, Kroaten und Slowenen entwickelten je eigene Nationalbewegungen. Muslime und andere Gruppen hatten daran keinen Anteil. Viele Bürger des jungen Staates wussten auch nach 1918 nicht, als was sie sich in nationaler Hinsicht fühlen sollten. Entsprechend schwierig war es, das Gebilde überhaupt zu benennen. Waren Serben, Kroaten und Slowenen, die dem neuen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen den Namen gaben, ein Volk oder drei? Die Verfassungsväter schufen die merkwürdige Formel, es handele sich um «ein Volk mit drei Namen». Nur das vor dem Krieg schon unabhängige Serbien, das dem neuen Staat die Hauptstadt und das Königshaus hinterließ, verfügte bereits über ein entwickeltes Nationalgefühl und über alle Insignien, die in der Region zu einem Nationalstaat gehörten: eine eigene Literatur, eine Geschichtserzählung nach romantischem Muster, eine ruhmreiche Armee und ein eigenes christlich-orthodoxes Patriarchat. Die Kroaten hatten es in Österreich-Ungarn immerhin zu einer Nationalbewegung gebracht, die an einen eigenen Adel, ein umfangreiches Schrifttum und eine mittelalterliche Geschichte anknüpfen konnte. Die Slowenen schließlich galten als «geschichtsloses Volk». Beide, Slowenen und Kroaten, waren im Habsburgerreich auf verschiedene Fürstentümer verteilt gewesen und brachten ganz andere Erfahrungen mit als die Bewohner Serbiens.
Zeit, den neuen Staat gründlich zu planen, war nicht. Kaum war er ausgerufen, stellte sich heraus, dass vor allem Kroaten und Serben sich unter einem gemeinsamen Staat etwas sehr Verschiedenes vorgestellt hatten. Für die meisten Serben war das neue Königreich einfach ein vergrößertes, zentralistisches Serbien. Die meisten Kroaten dagegen hatten wie selbstverständlich unterstellt, es würde ein durch und durch föderales Gebilde dabei herauskommen – ähnlich wie die Donau-Monarchie. Nur die Slowenen fügten sich leicht ein. Sie hatten an nationaler Eigenständigkeit nichts zu verlieren.
Bald kam es zwischen den gegensätzlichen Konzepten von Serben und Kroaten zum Clash; die Streitigkeiten zogen sich über mehr als zehn Jahre hin. Dann beschloss der König, künftig keine Volksgruppen, sondern nur noch Jugoslawen zu kennen, und herrschte diktatorisch und zentralistisch. 1941 schließlich überfiel Hitler-Deutschland das Land und teilte es auf; die Nachbarländer Großdeutschland, Italien, Ungarn, Bulgarien und Albanien bekamen je ein Stück. Serbien wurde Besatzungsgebiet, und in der Mitte des zerschlagenen Jugoslawien entstand ein «Unabhängiger Staat Kroatien» unter der Herrschaft der Ustascha, einer faschistischen Emigrantengruppe, und unter deutscher Dominanz. Auf ihrem Staatsgebiet, das auch das ganze heutige Bosnien-Herzegowina umfasste, verfolgten und vernichteten die Ustascha systematisch die Serben, die Juden und die Roma.
Im annektierten Slowenien, im besetzten Serbien und im «Unabhängigen Staat Kroatien» bildeten sich rasch Widerstandsgruppen, die Anschläge auf Besatzer und Ustascha verübten. In Serbien hatten sie sich auch königstreuer Freischärler zu erwehren, der sogenannten Tschetniks. Geführt wurde der «Volksbefreiungskampf» von einem geheimnisumwitterten Kommunisten, von dem anfangs nur der Deckname bekannt war: Tito. Kein Bild gab es von dem Mann, Legenden umrankten ihn ähnlich wie später Che Guevara.[2] Die Partisanen gewannen immer weiter an Boden, trieben die Besatzer in die Enge und begannen schließlich, das zerteilte Land nach neuen Kriterien neu aufzustellen. Noch vor Kriegsende beschloss der kommunistisch geführte «Antifaschistische Rat der Volksbefreiung», aus Jugoslawien sechs föderale Republiken zu bilden: Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Mazedonien und Montenegro. Der König hatte die Nationen ignoriert, Tito gab ihnen politische Bedeutung. Um das Übergewicht Serbiens auszutarieren, entstanden auf dem Gebiet der größten Republik zusätzlich zwei «autonome Provinzen»: die Vojvodina im Norden und Kosovo im Süden.
Bis zum Bruch mit Stalin 1948 regierte Tito sein befreites Land auf rein stalinistische Art. Wie sein sowjetisches Vorbild ließ er unmittelbar nach dem Krieg zuvor entwaffnete Kollaborateure der Besatzer zu Zehntausenden niedermetzeln. Als Stalin aber bald nach dem Krieg das Selbstbewusstsein und den Eigensinn der Jugoslawen spürte, erklärte er Tito zum «Verräter» und schloss die jugoslawische Partei aus dem Kommunistischen Informationsbüro, der Nachfolgeinstitution der Kommunistischen Internationale, aus. Zögernd zunächst begann damit das jugoslawische Modell von Arbeiterselbstverwaltung und sozialistischer Marktwirtschaft, ein «dritter Weg» zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus. Die innerjugoslawischen Konflikte, die der neue Staat aus der Kriegs- und Vorkriegszeit geerbt hatte, waren zwar abgemildert, aber nicht vergessen. Die Interessen der Volksgruppen gegeneinander auszutarieren wurde für die Staats- und Parteiführung zur wichtigsten Aufgabe. Ausgefeilte Modelle von Quotierung und Repräsentanz entstanden. Auf internationalen Kongressen zu Minderheitenfragen glänzten die Jugoslawen regelmäßig mit originellen Ideen. Selbst kleine Minderheiten konnten ihre Kinder in der Muttersprache unterrichten lassen.
In der Nachkriegsgeneration begann die Erinnerung an den Befreiungskampf im Zweiten Weltkrieg langsam zu verblassen. Wer in der Stadt lebte, kein politisches Amt anstrebte und keinen Quotenjob brauchte, wusste vom Nachbarn oder Arbeitskollegen oft nicht mehr, ob er nun Serbe oder Kroate war. Wirtschaftsfragen rückten in den Vordergrund. Auch der Mangel an Demokratie wurde zum Thema. 1968 rebellierten wie in ganz Europa in Belgrad die Studenten. Drei Jahre später brachen auch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb Proteste los – die allerdings nur zum Teil schon demokratisch, zum mindestens ebenso großen Teil aber national motiviert waren. Beide Bewegungen schlug Tito gewaltlos, allein kraft seiner Autorität nieder; in Serbien wie in Kroatien musste die Parteiführung abtreten. Als die Welle abgeflossen war, oktroyierte Tito dem Land 1974 eine neue Verfassung. Mit dem neuen, staatsbürgerlichen Jugoslawentum, das sich in der städtischen Jugend ausbreitete, konnte der zweiundachtzigjährige Parteichef nichts anfangen. Er konzentrierte sich darauf, die altvertrauten nationalen Gegensätze auszugleichen. Damit alle ethnischen Gruppen zufrieden waren, bekam Jugoslawien eine extrem föderale Struktur. Jede der sechs Republiken verfügte über eine eigene Nationalbank, einschließlich der Lizenz zum Gelddrucken, eine eigene Polizei, eigene Gerichte. Das Staatspräsidium setzte sich aus je einem Vertreter der sechs Republiken und zwei autonomen Provinzen zusammen. Ein «Bundesvollzugsrat», die Regierung, verfügte nur noch über begrenzte Kompetenzen. Gesamtjugoslawisch blieben die Armee, die in sich ebenfalls föderalisierte Partei und – der Parteichef selbst. Tito ließ sich gern den «einzigen Jugoslawen» nennen; Artikel 333 der Verfassung erwähnt ihn namentlich, ein Unikum in der internationalen Rechtsgeschichte.
Titos Todestag prägte sich einer ganzen Generation ein wie später der 11. September 2001: Jeder wusste zu sagen, wo er sich befand, als ein grauer Funktionär mit trauriger Miene am Nachmittag des 4. Mai 1980, einem Sonntag, im Fernsehen den Tod des Staatsoberhaupts bekanntgab. In Split an der Adriaküste spielte die Heimmannschaft Hajduk gerade gegen Roter Stern Belgrad, als in der einundvierzigsten Minute die Nachricht über den Stadionlautsprecher kam. Zehntausende brachen in Tränen aus, ein Spieler kollabierte. Spontan erklang aus fünfzigtausend Kehlen das damals verbreitete Lied: «Genosse Tito, wir schwören dir / Von deinem Pfad weichen wir niemals ab!»[3]
Josip Broz, so sein eigentlicher Name, war ein Titan des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Sieg im Zweiten Weltkrieg, dem Bruch mit Stalin, dem Aufbau der Blockfreien-Bewegung genoss der Bauernsohn aus dem Zagorje, einer hügeligen Landschaft an der kroatisch-slowenischen Grenze, auf der ganzen Welt Ansehen. Als Schlosserlehrling war er nach Wien gekommen und hatte auch Deutsch gelernt; als Staatsgast ließ er sich später zu dem Haus führen, für das er damals das Treppengeländer gefertigt hatte. Königin Elisabeth II. entzückte der charmante Marschall mit der wilden Vergangenheit durch sein autodidaktisch erworbenes Klavierspiel. Auf seiner Jacht parlierte er mit Willy Brandt und Leonid Breschnew. Dass er mit Nehru, Nasser und Sukarno befreundet war, den Häuptern Indiens, Ägyptens und Indonesiens, dass zu seinem Begräbnis schließlich die gesamte Weltspitze anreiste, erfüllte die Zeitgenossen aller jugoslawischen Nationalitäten mit Stolz. Einen einzigen Fehler habe er gemacht, hieß es später ironisch: Er hätte nicht sterben dürfen.
Einen Nachfolger hatte Tito nicht aufgebaut. Selbst wenn er es versucht hätte, wäre es ihm wohl auch nicht gelungen. Spätestens seit der Verfassung von 1974 gründete der ganze Staat auf dem Proporz der Volksgruppen. Wer immer in dem fragilen Gleichgewicht das Amt des Schiedsrichters übernahm, hätte selbst keiner der Gruppen angehören dürfen. «Jugoslawe» sein, wie viele Armeegeneräle, reichte nicht, denn indem die deklarierten Jugoslawen neben die «Nationen» und «Nationalitäten» traten, waren sie in der Logik des Systems selbst wieder eine Art Volksgruppe. So ging die Macht im Staate auf ein Kollektiv über: das achtköpfige Staatspräsidium. Schon zu Lebzeiten Titos hatte das Gremium in der Bevölkerung wenig Sympathie genossen. Von «Schneewittchen und den acht Zwergen» war die Rede, unter anderem eine Anspielung auf die blütenweiße Fantasieuniform, die Tito gern trug. Mit dem Tod des Staatschefs war aller Glanz dahin. Nicht zuletzt mit den erheblichen Problemen des Alltags erwies sich das Staatspräsidium als überfordert. «I posle Tita Tito», war die hilflose Parole der Epigonen: Auch nach Tito – Tito.
Der Marschall war noch kein Jahr tot, als im Südwesten der Föderation, in der autonomen Provinz Kosovo, Studentenunruhen losbrachen, ausgelöst vom Ärger über das ungenießbare Mensaessen und getragen von Perspektivlosigkeit. Vollbeschäftigung konnte das marktwirtschaftliche Jugoslawien schon lange nicht mehr garantieren. Die unterentwickelten Regionen traf es am härtesten, besonders die Albaner mit ihrer hohen Geburtenrate; die Arbeitslosigkeit im Kosovo lag bei über vierzig Prozent und in der Jugend noch weit höher. Im Bestreben, die ärmliche Provinz zu emanzipieren, hatte Tito 1970 die Hauptstadt des Kosovo, Prishtina, im brutalistischen Stil der Zeit mit viel Beton ausbauen lassen und auch mit einer albanischsprachigen Universität beschenkt. Mangels Arbeitsplätzen gingen die jungen Leute nun massenhaft studieren. Weder waren sie aber in den überfüllten und schlecht ausgestatteten Schulen auf ein akademisches Studium richtig vorbereitet, noch erwartete sie an der Universität ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal. Ihre Lieblingsfächer wurden Albanologie, Politikwissenschaft, Geschichte – ideologische Studienrichtungen, mit denen man wenig anfangen konnte und außerhalb des Kosovo gar nichts, wenn sie, wie meistens, auf Albanisch gelehrt wurden. Was man da fordern sollte, wussten die Studenten selbst nicht recht. «Kosova republika!» war die wichtigste Parole der ratlosen Demonstranten: Ihr Land sollte von einer Provinz zu einer Republik aufgewertet werden. Die erschrockene Führung in Belgrad witterte, nicht zu Unrecht, Nationalismus und ließ die Jugendrevolte von serbischer Polizei niederschlagen. Nicht nur im Kosovo, auch im liberal empfindenden Slowenien löste die Härte Empörung aus. Zwischen Serbien und der Bevölkerung seiner autonomen Provinz war die Atmosphäre nachhaltig vergiftet. Reformern in ganz Jugoslawien schwante Unheil.
Tito hatte der Nachwelt ein extrem föderales Gebilde hinterlassen. Der Struktur nach war Jugoslawien mit der Verfassungsreform von 1974 weniger ein Staat als eine Staatengemeinschaft – ähnlich wie später die Europäische Union. Die Wirtschaftspolitik war im Wesentlichen Sache der Republiken, die bei der Arbeitslosigkeit und bei den Einkommen zunehmend auseinanderdrifteten. Im Kosovo wurde 1981 nicht einmal mehr ein Drittel des jugoslawischen Durchschnittseinkommens erwirtschaftet, in Slowenien dagegen das Doppelte. Haushaltsverhandlungen wurden immer mehr zum Streit zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern. Kroatien führte Beschwerde darüber, dass es mit seiner langen Küste und den vielen Touristen um ein Viertel mehr zum Nationaleinkommen beitrage als der Durchschnitt, dass die persönlichen Einkommen der Kroaten aber nur sechs Prozent höher lägen. Schuld daran waren aus kroatischer Sicht nicht nur üppige Ausgleichszahlungen für unterentwickelte Gebiete, sondern vor allem die Banken. Sie waren Staatseigentum, saßen meistens in Belgrad und vergaben ihre Kredite nach schwer durchschaubaren Kriterien. Die reicheren Republiken wehrten sich dagegen, in ein Fass ohne Boden zu zahlen. Die ärmeren Republiken konterten mit der Tatsache, dass die Einkommensschere sich immer weiter öffnete. «Alle fühlten sich von allen ausgebeutet», hat der jugoslawische Wirtschaftsexperte Jože Mencinger das Verhältnis auf den Punkt gebracht. «Und alle zu Recht.»
Mochten sich auch alle gleichermaßen ausgebeutet fühlen: In ihrem jeweiligen Verhältnis zum Bundesstaat unterschieden sich die Jugoslawen der unterschiedlichen Nationalitäten deutlich. In einer beliebten Anekdote besuchen ein Serbe und eine Slowenin gemeinsam den Bleder See, ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel im äußersten Nordwesten des Landes, in Slowenien. «Naš Bled!», ruft der Serbe aus, überwältigt von der lieblichen Insel mit dem Kirchlein und von der majestätischen Alpenkulisse. «Unser Bled!» – «Wieso euer Bled?», fragt verdutzt die Slowenin. «Es ist doch unseres!» Der fiktive Wortwechsel enthält einen Grundwiderspruch des untergegangenen Jugoslawien. Die Slowenin ist mit ihrer slowenischen Identität im Reinen. Mag ihr Land auch Teil eines größeren Ganzen sein: Es ist ihres und niemandes sonst. Anders der Serbe: Er findet nichts dabei, sich überall in dem Bundesstaat zu Hause zu fühlen. Das heißt nicht, dass sich nicht auch Slowenen, Kroaten, Mazedonier, Bosnier, selbst Kosovo-Albaner als Jugoslawen gefühlt hätten. Aber ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu Jugoslawien war von dem zu ihrer jeweiligen nationalen Gemeinschaft säuberlich unterschieden. Bei den meisten Serben dagegen waren die beiden Gefühle vermischt. Als Jugoslawien zerbrach, wurde den Serben ihre Ambivalenz nachträglich als Imperialismus oder als Hegemoniestreben ausgelegt. Zu Unrecht: Eine ähnlich unklare, teils nationale, teils jugoslawische Identität unterstellten die Serben auch ihren nichtserbischen Landsleuten. Wie der Mann in der Anekdote waren sie verblüfft festzustellen, dass es anders war. Hätte – etwa bei einem gemeinsamen Besuch in der Hauptstadt – die Slowenin «Unser Belgrad!» ausgerufen, hätte der Serbe nichts dabei gefunden. Das Wir in seinem Ausruf «Unser Bled» schließt die Slowenin selbstverständlich mit ein. Im Verständnis der Slowenin dagegen ist der Serbe nicht mitgemeint.
In Serbien regt sich eine nationalistische Bewegung
Jugoslawien könne mit einem albanischen, mit einem slowenischen, zur Not auch mit einem kroatischen Nationalismus leben, warnten Beobachter in den 1980er Jahren, aber nicht mit einem serbischen. Serben machten gut 36 Prozent der Bevölkerung Jugoslawiens aus. Serben lebten nicht nur in Serbien, sondern auch in allen anderen Republiken, vor allem in Bosnien-Herzegowina und in Kroatien. Serbiens Hauptstadt war zugleich die Hauptstadt der Föderation. Als Jugoslawien entstand, war Serbien schon lange ein selbstständiger Staat gewesen, wie sonst nur das kleine Montenegro, das nach damaligem Verständnis aber ebenfalls ein serbischer Staat war. Die vollwertige Nation, die Serbien schon war, ging 1918 in Jugoslawien auf. Dass die neu Hinzugekommenen, vor allem die Kroaten, auf ihrer Identität und Sonderrolle beharrten, erlebten national denkende Serben seinerzeit als Kränkung. Im Ersten Weltkrieg hatte Serbien im Kampf gegen Österreich-Ungarn 1,2 Millionen Kriegstote zu beklagen, 28 Prozent seiner Bevölkerung, mehr als das viel größere Feindesland. Hatten die Serben nicht gekämpft und gelitten, um die südslawischen Brüder und Schwestern aus dem habsburgischen Völkerkerker zu befreien? Hatten sie nicht ihren Staatsnamen zugunsten des größeren Ganzen aufgegeben? Solches Denken blieb über die Jahrzehnte bestehen und verstärkte sich noch. Hatten wir Serben nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem im kroatischen Namen Hunderttausende von uns ermordet worden waren, die Nation der Täter nicht großzügig rehabilitiert? Und jetzt war ein eigensüchtiger, missgünstiger Partikularismus der Dank! Im nationalen Gedächtnis serbischer Jugoslawen blieben solche Argumentationen auch nach langer Zeit noch abrufbar.
Am 24. September 1986 erschien in der Belgrader Boulevardzeitung «Večernje Novosti» (Abendnachrichten) unangekündigt und ohne große Erklärungen ein ungewöhnlich langer Text, der aber bei genauerem Hinsehen noch weit spannender war als die «schwarze Chronik» von Einbrüchen und Messerstechereien, mit der das Blatt seine Leserschaft sonst zu unterhalten pflegte. Es waren Auszüge aus dem Entwurf zu einem «Memorandum», einer ausführlichen Analyse zur Lage der Nation. Als kollektiver Autor firmierte die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, ein ehrbares Gremium aus den führenden Wissenschaftlern und Intellektuellen der Republik. Wer das Papier sorgfältig las, konnte wissen, dass Jugoslawien am Ende war. Folgt man der Logik der Argumentation, zeichnen die Autoren genau vor, was in den folgenden Jahren geschah – auch wenn sie die Entwicklung wohl weder geplant noch vorhergesehen haben.
Das Memorandum[1] zerfällt in zwei gleich lange Teile. Der erste – überschrieben mit «Die Krise in Jugoslawiens Wirtschaft und Gesellschaft» – enthält eine schonungslose, genaue und faire Analyse des beklagenswerten Zustandes, in dem sich das Land Mitte der 1980er Jahre befand: der Schuldenkrise, der wirtschaftlichen Rezession, der politischen Rat- und Tatenlosigkeit. Übergangslos folgt dann ein zweiter Teil: «Der Status Serbiens und der serbischen Nation». Als hätte jemand einen Schalter umgelegt, blenden die Autoren hier alles, was sie auf den vorigen Seiten so treffend analysiert haben, aus und betrachten die Probleme Serbiens fortan kompromisslos und ausschließlich aus serbisch-nationaler Perspektive. Nicht mehr als heimliches Staatsvolk Jugoslawiens treten die Serben in diesem zweiten Teil auf, keine Sonderrolle in dem Vielvölkerstaat wird ihnen mehr zugebilligt. Sie erscheinen nun als eine jugoslawische Nation unter vielen, eine, die wie alle anderen auch nur die eigenen Interessen im Auge hat und auf das große Ganze keine Rücksicht nimmt. Bildlich gesprochen: Nicht «Unser Bled!» rufen die Autoren des Memorandums aus, wie der Serbe in der Anekdote es tut, sondern «Unser Belgrad!», und sie meinen es so exklusiv, so ausschließend wie die Slowenin, wenn sie von «unserem Bled» spricht.
Die Situation, um die es in dem zweiten Teil des Memorandums geht, ist dieselbe, wie sie im ersten, «jugoslawischen» Teil beschrieben wird. Nur die Perspektive hat gewechselt. Für alles gibt es nun eine nationale Erklärung. Immer hätten Serbien und die Serben um des Bundesstaates willen zurückgestanden, heißt es. Sie hätten um der Entwicklung anderer Regionen willen auf gleiche Rechte verzichtet, zugunsten der reicheren Republiken Slowenien und Kroatien unfaire Handelsbedingungen in Kauf genommen – nur um sich dafür als «Unterdrücker», «Unitaristen», «Zentralisten», «Polizisten» beschimpfen zu lassen. In ebendem Jugoslawien, «für dessen Schaffung die Serben die größten Opfer gebracht» hätten, sei ihnen keine Gleichbehandlung zuteilgeworden.
Als gälte es, schon einmal das künftige Verhältnis der Serben zu den anderen jugoslawischen Völkern zu demonstrieren, verlassen die Autoren in diesem zweiten Teil des Memorandums den Boden der Vernunft, auf dem sie sich im ersten Teil so sicher bewegt haben, und brechen in irrationale Anschuldigungen, Übertreibungen und Verschwörungstheorien aus, alle gegen die Albaner im Kosovo gerichtet. Gegenstand ihrer Empörung ist die wachsende Überzahl der Albaner in der autonomen Provinz, die die Serben immer stärker in die Minderheit drängten. Aus jugoslawischer Perspektive hätten dieselben Autoren – als Wissenschaftler, als Kommunisten oder als erfahrene Manager einer multikulturellen Gesellschaft – nach sozialen Ursachen geforscht, vielleicht Vermittlung empfohlen, Minderheitenrechte ausgebaut. Aber sie beziehen die neue Perspektive des serbischen Underdogs und klagen einfach nur maßlos an. Einen «offenen und totalen Krieg» hätten die Albaner den Serben erklärt, «sorgfältig über verschiedene Verwaltungs-, Politik- und Verfassungsreformen hinweg». Leider blickten die Serben diesem «Krieg» noch nicht ins Angesicht und trauten sich nicht, ihn beim Namen zu nennen.
Albaner waren in den Augen der meisten Serben ein urtümliches, etwas rätselhaftes Volk. In Belgrad kannte man die hageren, braun gebrannten Männer, die einen runden, weißen Filzhut auf dem Kopf trugen und mit scheuem Lächeln Kikiriki, Erdnüsse, verkauften. Einige Arrivierte unter ihnen unterhielten auch Eisdielen oder Konditoreien. Sie kamen von weit her, aus dem Kosovo, einer Gegend, die man aus dem Geschichtsunterricht kannte, die aber kaum jemand je besucht hatte. Jetzt geriet das trauliche Bild ins Rutschen. Immer öfter kamen in den Sommermonaten des Jahres 1986 Serben aus dem Kosovo nach Belgrad, gern in ihren bunten Trachten, und führten beredt Klage über Schikanen, sogar Gräuel, die ihnen von den scheinbar so sanften Albanern zugefügt würden. Tatsächlich war die Provinz, über Jahrzehnte serbisch geprägt, in den zehn Jahren zuvor immer albanischer geworden. Die Serben im Kosovo machten nicht einmal mehr ein Siebtel der Bevölkerung aus, die Albaner dagegen mehr als drei Viertel. Anders als früher drängten nun junge Albaner massenhaft in den Staats- und den Parteiapparat; Serben, die meistens kein Albanisch sprachen, trafen auf Beamte, die des Serbischen kaum mächtig waren. Bei den Politikern in Belgrad fanden die Kosovo-Serben mit ihren Petitionen kein Gehör; wohl aber in den Medien.
Als aufgebrachte Serben im Kosovo im Frühjahr 1987, ein halbes Jahr nach der Aufregung um das Memorandum, wieder einmal demonstrierten, sah sich der serbische Präsident Ivan Stambolić schließlich doch genötigt, etwas zu unternehmen. Er schickte den frischgebackenen serbischen KP-Chef Slobodan Milošević, seinen vertrauten politischen Ziehsohn, in die Höhle des Löwen: nach Kosovo polje, einem serbisch besiedelten Ort nahe Prishtina. Zunächst lief alles, wie man es kannte. Dort angekommen, hielt der Emissär eine vermittelnde Rede. Aber die erregten Demonstranten ließen sich nicht beschwichtigen und trotzten dem Mann aus Belgrad für den übernächsten Tag eine Versammlung ab, bei der er Rede und Antwort stehen sollte. Milošević hielt Wort. In der aufgeladenen Atmosphäre im Kulturhaus gab er den Einwohnern in vielem recht. Endlich hörte ihnen einer zu! Die Stimmung kippte zugunsten des Gastes aus Belgrad. Beflügelt vom glücklichen Ausgang des heiklen Termins, wagte der Funktionär vor dem Haus noch ein Bad in der Menge. «Sie schlagen uns!», riefen Demonstranten ihm zu. «Niemand darf wagen, euch zu schlagen!», entgegnete ihnen spontan der KP-Chef. Das serbische Fernsehen schnitt mit und übertrug die Szene anderntags in alle jugoslawischen Haushalte. Der hingeworfene Satz wurde zur Parole einer Bewegung.
Was in diesen Tagen im Kosovo geschah, haben zwei britische Journalisten, Laura Silber von der «Financial Times» und Allan Little von der BBC, anhand zahlreicher Interviews minuziös rekonstruiert.[2] Die Deutung, dass der damals fünfundvierzigjährige, bis dato eher farblose serbische Parteichef Slobodan Milošević an diesem 24. April einfach aus der Situation heraus zum nationalen Führer der Serben wurde, erscheint aus dem Charakter des Politikers heraus plausibel. Der junge Milošević wurde in Jugoslawien zu den Pragmatikern gerechnet, einer Kaste, angeführt von kompetenten, unideologischen «Technomanagern», die im Machtgefüge des undurchsichtigen Selbstverwaltungssystems geschickt agierten. Bald nach seinem Jurastudium war Milošević Generaldirektor von Tehnogas geworden, dem großen Produzenten von Industriegasen in Belgrad. Später wechselte er zur Beobanka. Zeitweise leitete er die Niederlassung der Bank in New York, bis er 1984 mit Protektion seines Förderers Stambolić in die Politik ging. Technokraten wie ihm wurde gegenüber den weitschweifigen, entscheidungsschwachen Partei-Apparatschiks der Vorzug gegeben – von Journalisten, Parteireformern, aber auch an der Basis und unter ausländischen Diplomaten. Sympathie genoss der junge Milošević beim damaligen US-Botschafter und dessen Chef Lawrence Eagleburger, der im State Department in Washington die Jugoslawien-Politik der USA bestimmte.[3]
Die Stimmung, die ihn seit jenem Freitag im April 1987 trug, musste Milošević nicht eigens machen. Als geübter Banker dirigierte er die Verhältnisse ohne Ziel und ohne Plan, allein mit dem sicheren Gespür für den nächsten Schritt. Bald wurden es Riesenschritte. Kein halbes Jahr nach seinem Auftritt in Kosovo polje zettelten Milošević und seine national gestimmten Anhänger eine Palastrevolte an und räumten auf der berühmt gewordenen «Achten Sitzung» der serbischen KP die Versöhnler beiseite, die in der Kosovo-Frage einen Kompromiss mit den Albanern suchten – darunter auch den völlig verdatterten Ivan Stambolić. Dem Triumph der neuen Strömung folgten Säuberungen in der Partei. Milošević prägte für seine Offensive den Terminus «antibürokratische Revolution». Der Begriff war geschickt gewählt. Zum einen knüpfte er an eine Kritik an, die prominente Dissidenten schon früh an der «bürokratischen Elite» geübt hatten. Zum anderen erlaubte er es, vom Nimbus der Reformer im Ostblock zu zehren, die weltweit gerade viel Sympathie genossen. Ein Besuch Michail Gorbatschows in Belgrad im März 1988 kam gerade recht.
Im Sommer – in Slowenien stritt die reformorientierte KP gerade mit der Armeeführung über Verhaftungen im Fall «Mladina», der Zeitschrift des Sozialistischen Jugendverbands – erreichte die serbische Nationalbewegung die Straße. In den autonomen Provinzen Serbiens, deren innere Verhältnisse sie eigentlich nichts angingen, sowie in Montenegro mobilisierten Milošević-Anhänger die serbische Bevölkerung und organisierten sogenannte Meetings, Kundgebungen mit manchmal Hunderttausenden Teilnehmern. Immer wieder erschien der Messias auch persönlich und hielt ambivalente Reden, mit anheizenden und mit beschwichtigenden Passagen. Die Zuhörer jubelten immer dann, wenn es ums Kosovo und um den Stolz der Serben ging. Sprach er, wie jede andere Parteigröße auch, von «Brüderlichkeit und Einheit zwischen den Völkern Jugoslawiens», schwiegen sie. Wer genau zuhörte, konnte sich schon auf bevorstehende Entbehrungen durch Krieg und Sanktionen vorbereiten. «Die Menschen können sich darauf einlassen, in Armut zu leben, aber ohne Freiheit werden sie nie leben wollen», rief der Volksführer und künftige Kriegsherr bei einer Versammlung im Belgrader Stadtteil Ušće aus. «In beide Weltkriege sind wir nackt und barfuß eingetreten, immer in der Überzeugung, für Gerechtigkeit zu kämpfen, und haben beide Kriege gewonnen.» Der ehemalige deutsche Botschafter Horst Grabert, der Milošević noch aus einer Zeit als Stadtparteichef in Belgrad kannte, schickte ihm Goethes Gedicht vom Zauberlehrling, der Geister rief, die er dann nicht wieder loswurde. Eine Antwort bekam er nicht.
Die Bewegung blieb nicht ohne praktische Konsequenzen. In Novi Sad, der Hauptstadt der autonomen, mehrheitlich serbisch besiedelten Provinz Vojvodina, bewarfen Demonstranten ihre konservativen Parteiführer mit Tetrapaks voll Joghurt und Milch, gaben sie so der Lächerlichkeit preis und erzwangen ihren Rücktritt. Als Nächstes war Montenegro an der Reihe, die kleinste Republik in Jugoslawien; auch hier übernahmen Milošević-Anhänger die Macht. Im März 1989 kassierte das serbische Parlament das Autonomiestatut des Kosovo und der Vojvodina. Höhepunkt der nationalen Welle wurde die Rede Miloševićs am 28. Juni 1989, dem sechshundertsten Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld, auf Serbisch: Kosovo polje. Im 19. Jahrhundert schon hatten nationale Romantiker die Schlacht in der Nähe von Prishtina zu einem schicksalhaften Ringen zwischen christlichem Abend- und islamischem Morgenland verklärt und alte Mythen neu belebt. Nun wurden die Mythen zum zweiten Mal populär. Wie ein Gott schwebte Milošević auf das riesige, unwirtliche Brachland in der Nähe von Prishtina, wo sich eine Million Serben versammelt hatten, fünfmal so viele, wie im ganzen Kosovo lebten. Mit der berühmten Gazimestan-Rede, benannt nach der schlichten Gedenkstätte auf dem Feld, zog zwei Jahre vor dem Kriegsausbruch in Slowenien ein erster Hauch von Gewalt durch das Land. «Wieder stehen wir vor Kämpfen und in Kämpfen», sagte Milošević: «Es sind keine bewaffneten, aber auch solche sind nicht ausgeschlossen.»[4]
Nach Krieg riecht es schon im Februar 1989: Serbiens Präsident Slobodan Milošević droht vor seinen Anhängern der albanischen Parteiführung im Kosovo mit ihrer Verhaftung.
In nur zwei Jahren, zwischen April 1987 und März 1989, hatte sich das föderale, national so sorgfältig austarierte Jugoslawien entscheidend verändert. Slobodan Milošević, der neue starke Mann, gebot de facto über die Serben im ganzen Land. Ohne ihn ging nichts mehr. Im achtköpfigen Staatspräsidium verfügte er als Dirigent im Hintergrund über die Hälfte der Stimmen: die Serbiens, dazu die von Montenegro, der Vojvodina und dem Kosovo. Bosnien-Herzegowina gehörte nicht dazu, konnte sich mit seinem knappen Drittel serbischer Bevölkerung aber eine Konfrontation mit dem «serbischen Block» nicht leisten. In Slowenien war der Aufstieg des nationalen Populisten erst mit Misstrauen, dann mit Widerwillen zur Kenntnis genommen worden, in den übrigen drei Republiken, Bosnien, Kroatien, Mazedonien, auch mit Angst. Was, wenn die Welle der Machtdemonstrationen auch sie erreichte? Was hatte Milošević mit Jugoslawien vor?
Zum Showdown kam es im Januar 1990 in Belgrad, auf dem Parteitag des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens. Im brandneuen, hochmodernen Sava-Kongresszentrum an der Donau herrschte zeitweise Bierzeltatmosphäre. Die Anhänger der neuen Macht, viele wettergegerbte Männer unter ihnen, viele mit abgetragenen Anzügen aus den Textilkombinaten des serbischen Südens, schwelgten in Triumphalismus. Schon über das Abstimmungsverfahren ließ sich keine Einigkeit herstellen. Die slowenische Delegation unter Präsident Milan Kučan wollte nach Republiken abstimmen, der serbische Block dagegen nach dem Prinzip «Ein Delegierter – eine Stimme». Mit ihren Positionen machten beide Lager klar, wie sie Jugoslawien künftig regiert zu sehen wünschten: Die Slowenen stellten sich den Staat als lose Konföderation vor, so wie nach der geltenden Verfassung von 1974 oder noch loser. Das von serbischer Seite bevorzugte Abstimmungsprinzip entsprang dagegen einem zentralistischen Konzept. Wie um schon einmal zu zeigen, was das für die Zukunft hieß, stimmte der serbische Block, angeführt von dem Milošević-Vertrauten Borisav Jović, sämtliche slowenischen Anträge erbarmungslos nieder. Müde und deprimiert ließen die Slowenen die Demütigung über sich ergehen. Am dritten Tag schließlich trat mit raschen Schritten Ciril Ribičič ans Rednerpult, ein Mann, der so ganz dem Klischee entsprach, das die Hillbillys im Milošević-Lager sich von einem Slowenen machten: ein schmächtiger Poet und Rechtsprofessor mit akkurat geschnittenem Schnurrbart und offenem Kragen. «Wir verlassen den vierzehnten außerordentlichen Parteitag des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens», sagte Ribičič und trat ab. Alle slowenischen Delegierten packten ihre Mappen zusammen, standen auf und zogen unter Gelächter und höhnischem Applaus aus dem Saal.