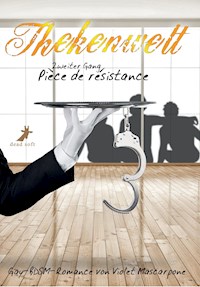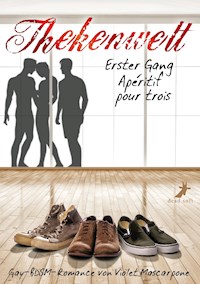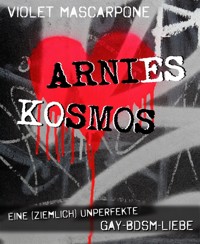
5,99 €
Mehr erfahren.
Arnie ist als Bankangestellter eine Fehlbesetzung, Freunde denkt er sich sicherheitshalber nur aus, und unter die Dusche ginge er am liebsten in Badehosen. Staubflusen sind ihm ebenso verhasst wie Unordnung. Bei ihm hat alles seinen festen Platz, auch seine devot-masochistische Veranlagung, die er vorsichtshalber ganz weit nach hinten drängt.
Bis Lui in sein Leben tritt. Lust und Schmerz bestimmen ihre ungewöhnliche Liebesbeziehung, und Arnie muss herausfinden, ob diese Art von Beziehung auch funktioniert, wenn man eigentlich lieber Feinripp trägt statt schwarzen Latex, ob man den dominanten Partner unbedingt „Herr und Meister“ nennen muss, und zu welchem Zeitpunkt man besser nicht anfängt, die Einzelheiten der submissiven Rolle zu diskutieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Arnies Kosmos
Eine ziemlich unperfekte Gay-BDSM-Liebe
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Violet Mascarpone
Arnies Kosmos
Eine ziemlich unperfekte
Gay-BDSM-Liebe
Cover: frenzy artworks
Foto: shutterstock, Galina Barskaya
© Violet Mascarpone
Impressum
Violet Mascarpone
42289 Wuppertal
Lektorat / Korrektorat: K. Struckmann, Laurenz Widmann
Buchblock und E-Book-Erstellung: www.AutorenServices.de
Das Paperback ist bei CreateSpace Independend Publishing Platform erschienen mit der
ISBN-13: 978-1495351709
Der Roman „Arnies Kosmos“ ist in der heterosexuellen Variante unter dem Titel „Schmerzherz“ beim Cupido Books Verlag erhältlich.
www.cupido-books.com
Die anonymen Glücksspieler
Mit offenem Mund lauschte ich ihren Worten, und ein bisschen fühlte ich mich wie in einer Fernsehsendung, die man selbst synchronisiert. Ich mache das ja immer gerne: Ton aus, und dann in verschiedenen Stimmen den Moderatoren vom Esomatrix-Shopping-Kanal eigene Texte möglichst lippensynchron in den Mund legen. Aber es war die Stimme meiner Mutter. Eindeutig.
„Arnie, vielleicht weißt du es nicht, aber vergiss alles, was sie dir über Mutterliebe erzählt haben. Sie erreicht ihren Gipfel, wenn du acht bist – dann beginnt die erste Phase, in der eine Mutter zwanzig Minuten am Stück telefonieren kann, ohne unterbrochen zu werden. Wenn du nach deinem Abschluss nicht ausziehst, nimmt sie ab achtzehn stetig ab. Gute Chancen, weiterhin geliebt zu werden, bestehen, wenn das Kind mit, sagen wir, spätestens zwanzig auszieht. Aber wenn es mit einundzwanzig noch das freie und erwachsene Leben der Erziehungsberechtigten beeinträchtigt, dann stirbt die Mutterliebe endgültig.“
Ich glotzte sie vermutlich ein wenig dämlich an, und obwohl ich theoretisch der Meister der schlagfertigen Antworten bin, sagte ich, als hätte eine Keule mich am Kopf getroffen: „Was heißt das?“
„Zieh aus! Du bist einundzwanzig. Ich habe es satt, über deine Ordnung zu stolpern und deine Haarprodukte auf meinem Waschbecken stehen zu haben, und ich will mich verdammt noch mal nicht verstecken, wenn ich kiffe! Ich will Männer mit nach Hause bringen. Dutzende! Und Dinge kochen, die ich mag – und nicht du mit deinem Autistengeschmack! Zieh aus! Bitte!!“
„Meine Haarprodukte?“, fragte ich fassungslos.
„Bitte!“ Sie rang mit den Händen und sah sehr erschöpft aus.
Ich persönlich denke ja, sie war mit neunzehn Jahren viel zu jung, als sie mich bekommen hat. Es fehlte ihr die nötige Reife, und ich musste dadurch einen Gegenpol in ihrem Leben darstellen, um sie zu stabilisieren. Ich versuchte immer ein wenig Ordnung in ihr Leben zu bringen, aber sie wurde wütend, wenn ich ihre Stricksachen ordnete oder ihre Bücher farblich einsortierte. Nichtsdestotrotz lebte ich gern mit ihr zusammen. Außerdem bedeutete unsere gemeinsame Wohnung mehr Geld für mich, um mir meine Anzüge und rahmengenähten Schuhe zu finanzieren, die das einzig Erfreuliche an meiner Tätigkeit als Bankkaufmann darstellten. Ich dachte ja, als ich die Lehre begann, bald in einer Art Büro-Loft zu landen und die Geschicke der Welt von dort aus zu lenken, aber in Wirklichkeit saß ich bei der Sparmenia in einem fensterlosen Raum, mit stets lauwarmem Filterkaffee. Das Pulver mussten wir selbst beim Discounter kaufen. Kopieren machte noch den meisten Spaß. Außerdem bin ich für wirtschaftliche Zusammenhänge nur mittelbegabt. Ich atmete immer auf, wenn ich einen Kunden zufällig nicht in den Ruin trieb. Deshalb waren meine Handlungsspielräume recht klein, und ich saß in einer Filiale, in der die Kundschaft meistens nur ihren Scheck vom Sozialamt einlöste oder Bargeld einzahlte. Nicht einmal ausländische Devisen wurden hier getauscht.
„Früher lebten Generationen friedlich miteinander unter einem Dach!“, hielt ich meiner Mutter vor Augen.
Sie schaute mich an, als wäre ich geistig völlig zurückgeblieben.
„Weißt du nicht, wie nett es war, als Max auch noch hier gewohnt hat?“, erinnerte ich sie.
Max ist mein ehemaliger Freund, der oft von zu Hause floh, was dazu führte, dass ich mein Zimmer ein knappes Jahr gerne mit ihm teilte.
„Schön?“ Sie lachte. „Ja, es ist großartig, morgens nicht ins Bad zu kommen, mittags einen leer gefressenen Kühlschrank vorzufinden und, wenn man um zwölf Uhr nachts von der Arbeit kommt, mit Teeniebelangen vollgelabert zu werden! Gibt nichts Schöneres in meinem Leben.“
Sie ist fürchterlich egoistisch. „Frauen in deinem Alter können froh sein, wenn sie von der Jugend an ihrem Leben beteiligt werden.“
Sie steckte sich den Finger in den Hals und machte ein wenig damenhaftes Kotzgeräusch, bevor sie mich fragte: „Warum wohnst du immer noch hier? Gib mir einen nachvollziehbaren Grund! Ich bin mit siebzehn ausgezogen. Und das kam mir schon viel zu spät vor!“
Ich kann es nicht beschwören, aber sie schien der Verzweiflung nahe. „Ich wollte sparen, bis ich mir ein Penthouse kaufen kann“, gab ich meiner Mutter zur Antwort.
„Willst du Geld?“ Ihre Stimme klang hoffnungsfroh. „Ich suche mir ‘nen Zweitjob!“
„Ich kann nicht glauben, dass meine eigene Mutter mich rauswirft!“ In der Tat war ich außerordentlich empört. Ich bin sauber wie eine Katze und ebenso pflegeleicht. Füll den Kühlschrank, lass mir ein wenig Ansprache zuteilwerden, und schon bin ich zufrieden. Sie erhob sich vom Küchenstuhl und zog sich ihre Jacke über. „Du verdienst mehr als ich, Arnie, bitte such dir eine Wohnung. Ich liebe dich, das weißt du, aber ich werde wahnsinnig, wenn du weiter mit mir zusammenlebst und bei jeder Zigarette, die ich rauche, hüstelst und mit einem antiseptischen Lappen hinter mir her wischst. Du solltest über dein Leben nachdenken. Mach eine Therapie, such dir Freunde, mach Sport oder fick endlich mal!“
„Das ist alles gar nicht so einfach!“, protestierte ich.
„Das sagst du schon, seitdem du zwölf bist. Und du hast Recht, es ist alles gar nicht so einfach. Mach Action! Mach irgendwas. Esomatrix-TV kann nicht die Lösung sein.“ Sie nahm mich kurz in den Arm und sagte leise: „Es tut mir leid, dass du wegen mir so geworden bist. Ich hab alles falsch gemacht. Aber jetzt bist du zu alt, als dass wir es ändern könnten.“
„Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Mütter nicht Schuld an der Homosexualität ihrer Kinder sind“, tröstete ich sie und sie seufzte.
„Ich habe eigentlich nicht das gemeint.“
Wusste ich ja. Ich selber bezeichne mich als Individualisten, andere finden mich komisch, obwohl eigentlich eher das Gegenteil zutrifft. Die anderen sind komisch, wenn man es objektiv betrachtet.
„Wo gehst du hin?“, wollte ich wissen, als sie die Wohnungstür ansteuerte. Ich stoppte, als sie sich umdrehte, wie ein wildgewordenes Gorillaweibchen. „Ich bin vierzig Jahre alt! Ich muss nicht sagen, wohin ich gehe!“
Ups. „Weißt du denn so ungefähr, wann du wiederkommst? Nur ungefähr?“, fragte ich ehrlich ganz unverbindlich und verständnis- voll. Ihr Mund öffnete sich und das Letzte, das ich sah, war ihr Mittelfinger, bevor die Tür krachend ins Schloss fiel. Ich fand, sie könnte allmählich wirklich ein wenig erwachsener reagieren, wenn ich harmlose Fragen stellte, und beschloss mir bei einem Bananenjogurt zu überlegen, wie ich sie überzeugen konnte, wenigstens noch so lange bei ihr wohnen zu dürfen, bis ich einen besseren Job gefunden hätte.
Ich taperte zum Kühlschrank und überprüfte – wie immer – erst einmal, ob die wenigen Lebensmittel auch noch innerhalb des Verfallsdatums lagen. Dann schnappte ich mir beruhigt das Milchprodukt der Firma Schneeland. Ich aß jeden Tag genau einen Bananenjogurt. Niemals Erdbeere, nicht Himbeere, nicht zwei oder drei. Meine Verachtung für Maracuja-Pfirsich ist übrigens immer noch ungebrochen. Während des Verzehrs verdeutlichte ich mir stets, dass die kleinen Fruchtstücke in Wirklichkeit harmlose, gezüchtete Pilzkulturen sind. Das erhöht den Ekelthrill beim Essen ungemein und gestaltet jeden Jogurt zu einer Herausforderung, was man allerdings nicht unter seinen Kollegen bei der Sparmenia erwähnen sollte, will man nicht als Exzentriker gelten.
Ich war ohnehin ein „Eine-Sache-Typ“. Zum Beispiel gab es nur genau eine Art Bleistift, den ich für meine täglichen Notizen benutzen konnte; einen einzigen Supermarkt, der mir akzeptabel erschien und einen Pornoclip, den ich wie den Bananenjogurt genau einmal täglich konsumierte. Ich hatte mich in ihn verliebt, obwohl er kurz war, aber alles stimmte daran. Er wurde mir nie langweilig und war zugegebenermaßen nicht gerade die Sahnehaube der Erotikvideos.
Er ist so amateurhaft, dass Menschen mit Stil oder Geschmack sich schaudernd abwenden, weil keiner darin gut aussieht. Und an zwei Stellen verschwinden die Protagonisten sogar komplett aus dem Bild. Bis heute könnte ich den Verstand über die Frage verlieren, was in dieser halben Minute geschehen ist. Ich habe mich sogar beim Amateurkanal angemeldet und Luca37 angeschrieben, um es in Erfahrung zu bringen, aber er hat mir nie geantwortet.
Also schaute ich löffelnd die täglichen fünfzehn Minuten an, um danach den Suchbegriff „Selbsthilfegruppe“ in meinen Computer einzugeben. Ich fragte mich, welcher Selbsthilfegruppentyp ich sein könnte. Krankheiten fielen aus. Dafür war ich zu gesund Phobien? Hmm? Zwangsneurosen? Nein, damit hatte ich ja gar nichts am Hut. Für Frauen gab es jede Menge exotisch klingender Stuhlkreise, und fast wünschte ich mir ein gestörtes Kind, denn für die gab es die meisten Problemfelder, aber soweit war ich noch nicht. Unerfüllter Kinderwunsch? Nur Heteros. Heuschnupfen? Allergiker waren in der Regel Langweiler, die glaubten, ihre geschwollene Katzenhaar-Nase interessiere irgendjemand anderen als sie selbst.
Nein, keine Allergiker, entschied ich. Arbeitssüchtige waren mir fremder als Außerirdische, wo ich doch jede Pinkelpause bei der Bank ins Unendliche ausdehnte. Was redeten Inkontinenzler in einer Selbsthilfegruppe miteinander? Und ob eine Sitzung bei erwachsenen ADHSern wohl so enervierend war wie in meiner Vorstellung?
Das einzig halbwegs Attraktive stellte die Selbstinitiative anonymer Glücksspielabhängiger dar. In meiner Fantasie trafen sich dort eine Menge schwerreicher Männer, die ihre Millionen auf Rot oder Schwarz setzten und ein viel verwegeneres Leben führten als ich in meinen kühnsten Träumen. Ich spiele ja nicht mal SOS-Affenalarm um meiner Ehre willen, weil ich so ein schlechter Verlierer bin. Waren Glücksspieler schwul, tendenziell? Vielleicht sollte ich mich direkt an einen der zahlreichen Homo-Coming-Out-AIDS-Aktivisten-Verbände halten, aber ich bin ein Individualist. Ich mag nicht gruppenweise darüber nachdenken, wie schwul und rechtlos ich bin und irgendwelche Aktionen planen, um mich irgendwo zugehörig fühlen zu müssen. Meine Mutter hat mich mal zu einer Schwulenparade gezwungen und ich war schon ganz gerührt, über ihre fürsorglichen Tendenzen, mein Selbstbewusstsein zu fördern.
„Das nächste Mal komm ich mit, Arnie“, log sie aufmunternd. Also bin ich gegangen. Es könnte doch ganz lustig werden, dachte ich, bis ich es mir dann doch anders überlegte. Schließlich kannte ich da keinen und es begann zu regnen.
Wieder zu Hause, musste ich entdecken, dass ihre plötzliche Sorge um meine schwule Identität ein billiger Trick war, um eine Internetbekanntschaft aus einem One-Night-Stand-Portal zu vertiefen … nun ja, ich möchte nicht ins Detail gehen, wie ich die beiden vorfand. Eltern sollten so etwas nicht tun. Sie sollten damit aufhören, sobald sie Kinder bekommen haben.
Kurzum: Soziales Engagement entspricht nicht meinem energie- sparenden und Fantasiewelten-meißelnden Wesen. Meistens mangelt es mir schon an der notwendigen Motivation, ins Kino zu gehen. Es gab so viel Interessanteres. Zum Beispiel die Anonymen Glücksspieler. Ich würde etwas Neues, Aufregendes lernen und meine Mutter beruhigen können. Obendrein bestand die Chance mit einem Roulette spielenden Supermann durch die Welt ziehen und Abenteuer zu erleben. Als Nächstes informierte ich mich über die Rouletteregeln und lernte sie so gut es ging auswendig, inklusive korrekter Aussprache. Es war ein gutes Gefühl eine Gruppe aufzusuchen, deren Probleme man nicht teilte.
Die Kernproblematik ist nicht, dass ich niemanden abkriegen könnte, wie man das so salopp formuliert. Ich bin keine Schönheit, aber ich bin jetzt auch nicht so abartig, dass niemand mir seinen Pullermann freiwillig einführen würde oder umgekehrt, ich habe nur zwei große Makel, die es mir schwer machen, jemanden zu finden: Ich bin leider Gottes verklemmt, was so weit geht, dass ich am liebsten mit Unterhose baden würde, aber im ironischen Gegensatz dazu innerlich total pervers. Außerdem bin ich sexuell devot, aber das würde ich niemals jemanden gestehen. Das ist so peinlich. Zum Zweiten habe ich überdimensionierte Ansprüche. So weit, so gut. Hohe Ansprüche kann man sich dann leisten, wenn man ihnen selber entspricht, aber nicht, wenn man notorisch faul, einzelgängerisch und ein wenig fixiert auf gewisse Abläufe ist. Ich denke, das sind liebenswerte kleine Macken, aber mein erster und letzter Freund attestierte mir am Ende unseres gemeinsamen Jahres, komplett plemplem zu sein. Was natürlich nicht stimmt. Individualistisch: ja. Verklemmt auch. Ängstlich? Ein wenig, aber nicht verrückt. Keinesfalls.
Ich mag es eben, wenn die Dinge geordnet, nach Größe aufgestellt oder farblich abgestuft sind. Ist das ein Verbrechen? Ich fand auch, mein Haar sollte gut liegen, und damit es das tat, brauchte ich natürlich die zahlreichen Stylingprodukte, die meine Mutter so störten.
Ich begab mich ins Badezimmer, rückte meine Fläschchen dicht aneinander und stellte das Pflegeöl, die Wunderkur und den Haarspitzenstabilisator meiner Mutter demonstrativ vor meine eigenen Produkte, um ihr meinen guten Willen zu zeigen.
Meine Mutter war sehr erleichtert, als ich ihr erzählte, nun eine Therapiegruppe aufsuchen zu wollen. „Was ist es denn für eine?“, wollte sie wissen und ich behauptete: „Ungesellige Postjuvenile bis 25 mit invasiven psychoakuten Stagnationstendenzen.“
„So was gibt es?“
Ich nickte bedächtig.
„Und wann sagtest du, ziehst du konkret aus?“, hakte sie nach.
„Nun – Hartmut, der Gruppenleiter, ein ausgebildeter Sozialtherapeut“, sofort entstand das Bild eines schnauzbärtigen Fünfzigjährigen mit durchgrautem Zopf in Hochwasserhosen in meinem Hirn, „sagte, das vorrangige Ziel sei, ein eigenständiges, sozial eingebundenes Leben zu führen.“ Das wollte sie hören. Die Selbsthilfegruppenforschung hatte mich mutig gemacht, psychologisches Halbwissen selbstbewusst vorzutragen. Ich klang wirklich überzeugend, dafür, dass ich weder ein geselliges noch ein sozial eingebundenes Leben anstrebte.
„Es ist aber nicht so wie damals, als du behauptet hattest, deine Klassenlehrerin habe gesagt, man dürfe dein außerordentlich kreatives Talent und deinen überdurchschnittlichen IQ nicht in die Mittelmäßigkeit zwingen, indem du am Sportunterricht teilnehmen musst? Und anständige Mütter hätten sich schon längst um ein Langzeit-Attest bemüht?“, fragte sie misstrauisch.
Ich wurde rot, als ich an den fingierten Brief dachte, den ich auf einem extra angeschafften Bogen Büttenpapier verfasst hatte, weil ich überzeugt war, Germanistinnen schrieben nur auf handgeschöpftem Papier. Meine Schrift hatte ich schnörkelig verstellt. „Nein. Heute bin ich erwachsener. Ich bin innerlich mehr als bereit, dich zu verlassen. Ich brauche nur noch einen Anstoß von außen. Sagt Hartmut.“
„Gott sei Dank“, murmelte meine Mutter und streifte ihre Pumps ab.
Unter Aufbietung all meiner Disziplin unterdrückte ich den Zwang, sie parallel nebeneinander zu stellen und meine Mutter für die abgewetzten Stellen zu rügen. Ein wenig Lederöl und sie sähen aus wie neu. Wir verabschiedeten uns; sie, um ein Bürogebäude zu putzen und ich, um mich in Hartmuts väterliche Arme nehmen lassen. Ich weiß nicht, wann mir einfiel, an diesem Abend die Anonymen Glücksspieler aufzusuchen, so sehr hatte ich mich bereits auf die Ungeselligen Postjuvenilen bis 25 versteift.
Das ist überhaupt ein weiteres Problem: Ich stelle mir alles viel zu lebhaft vor. So auch die Selbsthilfegruppe, für die ich mir eine neue Krawatte gekauft hatte. Silbergrau mit cremefarbenen Punkten. Ich wollte ja schließlich nicht gegen die Roulettemilliardäre abstinken, die auf Kreuzfahrtschiffen und in eleganten Kasinos ihr Geld verballerten.
Die Anonymen Glücksspieler waren der größte Fehler meines Lebens. In meiner Naivität und auch meiner Distanz zu derartigen Dingen bedachte ich nicht die Existenz von Glücksspielautomaten in Kneipen und Zentren des Abschaums, so genannten Spielhallen, die ich nie betrat. In meinem korrekten Anzug rückte ich ungewollt in den Mittelpunkt des Geschehens der tendenziell ein wenig verlotterten Gruppe. Auch der Selbsthilfe-Club-Raum war alles andere als elegant oder klinisch eingerichtet. Die Wände waren vergilbt und geziert mit motivierenden Postern. An der Wand hing das Bild einer venezianischen Gondel im Sonnenaufgang, unter der stand: „Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.“
Mir drang auch erst hier ins Bewusstsein, dass echte Süchtige ernste finanzielle Probleme schultern müssen, obwohl ich vorher hätte drauf kommen können. So lächelte ich höflich in die Runde und nickte interessiert, während die Anderen über ihren Kampf gegen die Sucht nach dem Spiel an blinkenden Zufallskästen berichteten.
Hartmut hieß Claudia und war sehr verständnisvoll, aber sie trug keinen Schnäuzer, was mir unangenehm auffiel. Mir gegenüber saß ein Mann, der mich unverhohlen musterte. Vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Er trug Schnürturnschuhe mit Löchern, und eine kleine Lücke teilte seine rechte Augenbraue, was ich durchaus charmant fand. Er beteiligte sich nicht am Gespräch, sondern saß schweigend mit verschränkten Armen da. Sein Ohr war so silber-beringt, dass ich mich fragte, ob er beim Gehen den Kopf in die andere Richtung neigte, um das Gewicht auszugleichen. Er sah aus, als besäße er keinen Spiegel, aber wirkte auf seine eigene Art cool. Ich zählte acht Silberringe, und gerade als ich meine Spekulationen über mein Gegenüber gedanklich weiter vertiefen wollte, war ich an der Reihe.
„Magst du etwas über dich erzählen?“ Claudia hatte eine sehr warme und erbauliche Stimme. Ich wollte am liebsten zwanzig bemitleidenswerte Störungen erfinden, um ihr einen kleinen Gefallen zu tun. „Äh.“ Oje. „Also, ich heiße Arnold und meine Mutter will, dass ich endlich ausziehe.“
Mist. Falscher Text. Der Typ gegenüber zog die zerbrochene Braue aufwärts, und die Anderen fragten: „Wie alt bist du denn?“, oder „Du siehst aus, als ob du eine Beschäftigung hast.“
„Ruhe. Jeder darf reden, ohne dass wir ihn unterbrechen.“ Claudia lächelte mich an und ich fuhr fort: „Was nicht geht, weil ich durch meine Spielsucht all mein Geld verloren habe.“ Logisch, oder? Ach so, verständnisvolles Nicken. „Na ja, das war’s auch schon.“
„Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht magst du erst einmal nur ein bisschen zuhören und dann vielleicht ein Stück weit mehr von dir erzählen, Arnold.“
„Ja, das wäre ... also, genau.“ Meine Hände waren schweißnass, als Claudia uns eine Zigarettenpause gönnte.
In der Pause ging ich. Sofort und ohne mich umzuwenden. Ich trat aus dem Ladenlokal. „Ich geh eine Runde um den Block. Ich gewöhne mir gerade das Rauchen ab“, informierte ich die desinteressierte Gruppe mit gespielter Heiterkeit und fügte noch hinzu: „Das war sehr erbaulich für mich. Ganz toll. Ich höre jetzt mal in mich rein, was das mit mir macht.“ Dann bemühte ich mich, ruhig zu gehen, anstatt zu rennen.
Als ich mich in Sicherheit wähnte, atmete ich auf und erstarrte dann zur Salzsäule, weil sich eine Hand auf meine Schulter legte. „Falls du eine günstige Wohnung suchst: hier.“
Langsam drehte ich mich um. Der Ohrringtyp. Konnte der bei all dem Metall im Kopf nicht beim Gehen scheppern, anstatt mich so zu erschrecken? Er streckte mir die Hand entgegen, auf der eine Visitenkarte lag. „Uh. Danke. Äh. Suchst du einen Nachmieter?“
Vermutlich wollte er mich auf seiner Räumungsklage sitzen lassen.
„Nein, ich suche einen Mieter.“
„Was ist das für eine Wohnung?“
„Eine für Verzweifelte“, antwortete er und grinste auf eine gruselig anziehende Weise bösartig. „Aber sehr günstig.“
Dunkle Schatten lagen unter seinen Augen, aber sein Haarschnitt gefiel mir. „Ich denke darüber nach.“
Er lächelte mich an, als glaubte er mir nicht, und wandte sich zum Gehen. Sofort fühlte ich mich schuldig, weil ich nicht wirken wollte, als wäre seine Wohnung mir nicht gut genug. „Also, ich würde sie mir liebend gerne ansehen.“
Er winkte ab. „Melde dich einfach bei Interesse. Ich muss wieder zur Gruppe!“
„Ich heiße übrigens Arnold“, rief ich ihm hinterher, als hätte ich das vorhin nicht schon erwähnt.
„Herzlichen Glückwunsch“, kam es zurück, und tief verwirrt steckte ich die Karte in die Innentasche meines Jacketts.
Die Begegnung mit einem milliardenschweren Glücksspieler hat te ich mir irgendwie anders vorgestellt …
Arnie, der Abenteurer
Jedes Jahr veranstaltet die Abschlussklasse 2007 der Christian-Schleisieper-Realschule ein Klassentreffen, bei dem sich die ehemaligen Schüler benehmen wie Kriegsveteranen und den lieben langen Abend von früher sprechen, als verfügten sie bereits über ein biblisches Alter. „Die gute alte Zeit.“
Christian Schleisieper ist ein lokaler Kinderbuchautor, dessen deprimierende, sozialkritische Geschichten in Deutschbüchern der Jahrgangsstufen sechs und sieben abgedruckt werden. Meistens handeln sie von einem Außenseiter in der Klasse, wahlweise behindert oder zugezogen, und davon, wie er fertig gemacht wird und dann wieder wegzieht, bevor sich irgendetwas zum Guten wenden kann, was alle mit einem schalen Gefühl menschlichen Versagens zurücklässt. Das soll die Schüler zum Nachdenken über Vorurteile bewegen, was aber nicht funktioniert. Manchmal muss man auch die Satzglieder farblich unterstreichen. Oder die unter dem Text ste hende Aufgabe lösen: „Wie könnte es weitergehen? Schreibe einen Brief aus Peters Perspektive.“
Mir ging es in der Bank genauso wie in der Schule. Ich wusste bei beiden Institutionen nicht, was ich da sollte. Und ich wusste auch nicht, was ich bei diesem Klassentreffen sollte, aber einmal hier, konnte ich mich schlecht auf dem Absatz wieder umdrehen. Schon wieder etwas, das mich zum Einzelgänger prädestiniert: Mich langweilen Gespräche. Vor allem in Gruppen, deren Teilnehmer man nicht besonders gut kennt und in denen man sich dann gegenseitig sein Leben nacherzählt, was man so macht und wie viel man in seinem öden Job verdient oder wie viel Quadratmeter wie viel kosten und wer mit wem. Das ist doch immer dasselbe. Alex und Mia sind auseinander, sie ist ausgezogen, und an allem ist er schuld, blabla, und Sören wechselt seine Stelle von Versicherungsgesellschaft a zu b, und je betrunkener man wird, desto erträglicher wird es, und irgendwann knutschen zwei oder drei, die sich hinterher dafür in Grund und Boden schämen, und alle tun, als wäre die Schulzeit etwas ganz Wundervolles gewesen, weil man sich auf der Abschlussfahrt nach Trier unheimlich einen gesoffen und hinterher in den Gemeinschaftsraum der Jugendherberge gekotzt hat.
Ich saß zwischen den anderen und wusste, keiner von denen hatte Esomatrix-TV auf seiner Fernbedienung den ersten Platz zugewiesen oder gab sich im Verschwörungsforum als Annabelle aus, einfach nur, um zu gucken, ob man als Frau anders ankommt. Mittlerweile hatte ich mir auf der Verschwörungstheorien-sind-Müll-Seite einen wortführenden Platz erobert und befand mich im harten Streit um die Frage, ob Reptoide unter uns sind und mit den weltweit führenden Regierungen zusammenarbeiten oder nicht. Ich hatte sogar schon zwei Verehrer gefunden, nachdem ich ein Jugendfoto meiner Mutter als Profilbild benutzte. Ich habe das ein bisschen gephotoshopped, damit man nicht merkt, dass ihr Style nicht unserem Jahrtausend entspricht und man sie nicht auf den ersten Blick wiedererkennt, aber ich fürchte, wenn sie es wüsste, würde sie trotzdem durchdrehen.
Gunnar, Username „Die MatriX“ ist 23 und studiert Physik. Jörg (Jörg666) ist arbeitslos und ein vom Leben enttäuschter Zyniker. Wenn der je erfährt, dass ich nicht Annabelle, sondern Arnie bin, wird er vollends verbittern und den Müll nie wieder runtertragen. Insofern begann die Angelegenheit, mich mittlerweile zu stressen. Schließlich wollte ich niemanden ins Unglück stürzen. Ich hätte meinen Intellekt viel lieber weiter virtuell bewiesen, anstatt hier zwischen Menschen zu sitzen, denen ich früher nichts zu sagen hatte und wahrscheinlich auch in fünfundzwanzig Jahren nicht.
Helene und Donni kamen auf mich zugeschwankt und mit seinem breiten Grinsen fragte er: „Mensch, Arnie, was machst du eigentlich so?“ Er zog sich einen Stuhl heran. Helene, seit Kurzem seine Freundin und ehemalige Klassenkassenverwalterin, setzte sich auf seinen Schoß und blickte mich erwartungsvoll an.
„Ich habe mich für das europäische Weltraumprogramm beworben. Meine Chancen stehen nicht allzu schlecht“, erwiderte ich ernsthaft.
Einen kurzen Moment sahen sie mich verblüfft an und dann lachten sie. „Mein Gott Arnie, du bist ja immer noch so witzig!“
Solange ich nichts aus meinem erbärmlichen Leben erzähle, ist alles gut.
„Weißt du noch, wie du in Christinas Freundebuch geschrieben hast, dein Traumberuf wäre Hausfrau?“ Die Heiterkeit war groß und ich lachte mit, als wäre ich der geborene Entertainer. Das Schlimme ist: Bis heute ist Hausfrau, beziehungsweise Hausmann tatsächlich mein Traumberuf. Und dann das Übliche, ob ich noch mit Max zusammen sei, obwohl jeder wusste, dass nicht – oh wie schade – und ob ich unter meinem Single-Dasein litte. Ich fragte mich, ob ich mit Gunnar dem Physikstudenten prahlen sollte, aber zuckte schließlich nur bedauernd mit den Achseln, denn schließlich stand Gunnar auf mein weibliches Alter Ego, was ja nicht wirklich repräsentativ war. Dann befragte mich Donni noch nach einem Anlagefonds, ich log etwas vor mich hin und hoffte, sein berauschtes Hirn würde es morgen vergessen haben. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Ich nutzte einen unbemerkten Augenblick, um die Veranstaltung zu verlassen, bevor ich weiteren Schaden durch meine saumäßigen Finanzberatungen verursachte.
Meine Mutter lag auf dem Sofa und spielte mit dem Nintendo. Neben ihr das Telefon und ein Glas Wein. Es war halb eins. Da Bürogebäude erst nach Feierabend geputzt werden, hatte sie einen anderen Biorhythmus als ich.
„Und wie war es?“
„Mittel.“ Ich ließ mich neben sie plumpsen.
„Was heißt mittel?“
„Langweilig und trostlos.“
„Versteh ich.“ Ihr Blick klebte an dem Mini-Bildschirm. Eigentlich gehörte der Nintendo aufs Klo.
„Bitte denk daran, den wieder ins Bad zu bringen, wenn du fertig bist.“
Ihre Augen wanderten langsam über den Monitorrand zu mir und ich schwöre, sie froren zu, während sie mich festnagelte: „Was sagt Hartmut eigentlich, wann genau du ausziehen wirst?“
Ich glaube, ich hätte besser nichts gesagt und den Nintendo ohne Aufhebens stillschweigend an seinen Platz zurück getragen. „Hartmut meint, nur noch wenige Wochen und ich habe mich so weit angepasst, den Sprung ins kalte Wasser zu schaffen.“
„Du sollst dich nicht anpassen“, verbat sie mir scharf.
„Nicht?“
„Nein. Du sollst so bleiben, wie du bist, aber dabei glücklich sein. Wenn du dich anpasst, kann ich dich nicht mehr leiden.“
„Aber so kannst du mich auch nicht leiden.“ Versteh einer ihre Logik! Sie überlegte, dann trank sie einen Schluck und sagte: „Ich würde dich anbeten, Arnie, wenn ich ein wenig Abstand von dir hätte. Wirklich. Wenn du jemals von einem Klassentreffen kommst und Spaß hattest, dann streich ich dich aus meinem Testament. Klassentreffen sind nämlich nicht spaßig, sondern die Pest, wie du sehr richtig erkannt hast.“ Sie nickte mir lobend zu. „Ich weiß, es klingt wirklich sehr unmütterlich, aber ich brauche Platz. Es kann nicht sein, dass ich vor Freude hüpfe wie ein Teenager, der sturmfrei hat, wenn du mal weg bist. Mütter sind dafür da, sich so lange um ihre Kinder zu kümmern, bis sie das selbst können. Und du kannst es. Du kannst eine Mikrowelle bedienen, dir Kleidung selbst kaufen, hast ein eigenes Konto und bist geschlechtsreif. Du brauchst mich nicht mehr.“
Ich verstand sie und fragte dennoch vorwurfsvoll: „Kannst du nicht ein bisschen wie andere Mütter sein, deren Lebensinhalt ihre Kinder sind?“
Sie legte den Arm um mich. „Versuch’s doch mal bei deinem Vater.“
Ich seufzte. War das die Lösung? „Du willst mich nur loswerden, um irgendwelche Männer hier anzuschleppen?“
„Jepp“, gab sie ohne zu zögern zu. Ich starrte sie pikiert an und sie antwortete hilflos: „Was denkst du, Arnie? Dass man ein Neutrum wird, nachdem man entbunden hat?“
Na ja, eigentlich dachte ich genau das. „Ich werde nochmal mit Hartmut sprechen, vielleicht gibt es eine gruppendynamische Möglichkeit den Prozess zu beschleunigen.“
Bye bye, Penthouse – hallo einsames Rattenloch. Irgendwie tat nicht nur ich, sondern auch sie mir ein bisschen leid. Ich glaube, Spaß ist in ihrem Leben viel zu kurz gekommen. Allerdings machte mich der Gedanke nervös, wie die Wohnung aussähe, wenn sie alleine lebte. Sie lüftete bestimmt nicht stoßweise, sondern gar nicht oder permanent, und sie trüge auch nie wieder gebügelte Sachen, wenn ich sie nicht nachdrücklich aufforderte, sich endlich um unseren Wäscheberg zu kümmern. Und das mit dem Stricken konnte sie vergessen, bei dem Wollknäuelchaos in ihrem Handarbeitskorb. Früher oder später würde sie angekrochen kommen, weil ihr Leben den Bach herunter ginge und dann müsste Super-Arnie es richten. Ha!
Nach vielen weiteren zähen Tagen bei der Sparmenia drehte ich die Karte von Glücksspiel-Blondie in den Händen. Ich hatte mich eine Woche lang an den Gedanken gewöhnt, eine billige Wohnung für Verzweifelte zu nehmen. Die zeigte ich dann meiner Mutter und sie würde mich vor lauter Mitleid zwingen, den Mietvertrag zu kündigen. Ich hoffte inständig, die Wohnung wäre noch zu haben. Also tippte ich die Nummer.
„Hallo?“ Er klang so gelangweilt, als hätte er mit meinem Anruf gerechnet. Ich neige dazu, solche Kleinigkeiten zu schnell auf mich zu beziehen. Wenn ich einen Raum betrete, in dem zufällig ein paar Leute lachen, vermute ich sofort, den Anlass dafür gegeben zu haben. Das ist eine Vorstufe des Beziehungswahns, der nichts mit Beziehungen zu tun hat, sondern damit, alles mit sich in Beziehung zu setzen.
„Hallo. Hier ist Arnie. Arnold. Ich ... äh, du hast mir die Karte gegeben. Wegen einer Wohnung. Ich habe gerade so viel beim Roulette gewonnen, dass ich sie mir leisten kann, und wollte mich auf diesem Wege erkundigen, ob sie noch zu haben ist.“
„Ja, ist sie. Wann hast du Zeit für einen Besichtigungstermin?“
„Also immer ab fünf. Und am Wochenende.“
„Jetzt?“
„Na ja, eigentlich bin ich jetzt mit … irgendwem verabredet.“
Ich mochte keine spontanen Termine. Ich brauchte mindestens zwei Tage Vorlaufzeit, um mich innerlich vorzubereiten.
„Also jetzt. Kennst du das Cinerotix?“
Wohoho … ich lasse mir doch keine Termine von einem spielsüchtigen Versager diktieren! „Äh. Das Kino?“
„Genau. Sagen wir in einer Stunde?“
„Uhm. Okay.“
Ich war noch nie gut darin, mich zu wehren, wenn jemand meine Einwände selbstsicher ignoriert.
„Sag der Frau an der Kasse, du kommst wegen der Wohnung. Bis gleich.“
„Super! Klar, bis gleich!“ Super? Oh Gott. Es war das Pornokino, ein Relikt aus Zeiten, in denen einem nicht per Mausklick die komplette Welt der Perversionen offenstand. Was hatte ich nur getan? Wie kam ich dazu, zu glauben, es sei eine gute Idee, Metall-Toni anzurufen? Warum habe ich meine Nummer nicht unterdrückt? Wenn ich nicht komme, dann wird er mich jagen und ich muss eine neue Identität annehmen und ein Leben auf der Flucht verbringen. Ein Anflug von Panik ergriff mich. Das ging mir alles zu schnell. Aber nun hatte ich bereits zugesagt, also würde ich mich auch wenigstens kurz blicken lassen.
Metall-Toni hieß Lui. Vielleicht auch nicht, aber er behauptete es. Er lief vor mir das schäbige Treppenhaus hinauf, und ich ballte meine Fäuste, um den weißen Staub auf seiner abgewetzten, schwarzen Jeanshosentasche nicht abzuklopfen. „Die Wohnung ist also im Kino?“
„Ja.“
Hilfe! „Ist das nicht sehr laut?“
„Nein. Nicht sehr.“
„Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist“, zauderte ich.
„Die Wohnung liegt zentral und hat einen Balkon.“ Er schloss sie auf. „Sieh dich um. Ich warte so lange hier im Flur. Wenn du Fragen hast, ruf mich.“
Ich war sehr erleichtert, nicht weiter mit ihm reden oder die braunen Badezimmerfliesen loben zu müssen, von denen mindestens vierzehn gesprungen waren und deren Fugen leicht kariös wirkten. Der kleine Balkon gab die Aussicht auf den trostlosen Kinoparkplatz und die Betonfassade eines Elektronikhandels frei. Eine Miniküchenzeile in genau einem Raum. Zumindest war er hell und frisch gestrichen. Meine Mutter würde zerfließen vor Mitleid und sich in Grund und Boden schämen, mich verjagt zu haben. Perfekt.
Ich löschte das Licht im braunen Ort des Verderbens und drehte mich um, um mit Lui zusammenzuprallen, der mich im Fall fing. Ich sah zu, mich so schnell wie möglich seinem Griff zu entziehen, um nicht wie ein Rentner kurz vorm traditionellen Oberschenkelhalsbruch zu erschienen und unfreiwillig die gut kaschierte Untrainiertheit meines Körpers zu offenbaren. Lui war so drahtig, lässig und verwegen; ich hingegen ein Bankangestellter ohne Interesse an sportlichen Aktivitäten.
„Sorry. Ich wollte dich nicht erschrecken.“
„Und ich wollte dein Badezimmer nicht beleidigen.“
Er sah mich komisch an, und mir fiel auf, dass ich meine Fliesenabneigung gar nicht laut formuliert hatte. „Innerlich“, fügte ich hinzu und er nickte, als wäre es das Normalste der Welt.
„Und gefällt dir die Wohnung?“
„Nein. Aber ich nehme sie trotzdem. Wenn sie genauso billig ist, wie meine Verzweiflung groß.“
Lui lachte. „Wie groß ist denn deine Verzweiflung?“
„Groß genug, um über einem Sündenpfuhl einzuziehen.“
„Für dich als Mieter wären übrigens alle Vorstellungen kostenlos“, erklärte er mir liebenswürdig und unterdrückte ein erneutes Lachen, als er mein entsetztes Gesicht sah.
„Gehört dir das Kino etwa?“
„Ja. Und davor gehörte es meinem Großvater.“
Ich lobte mir seinen Familiensinn.
Dann nannte Metall-Lui mir einen Preis, der so niedrig war, dass ich fast ein schlechtes Gewissen bekam – aber andererseits, wer würde hier schon einziehen?
„Lies dir den Vertrag in Ruhe durch. Und wenn du dich endgültig entschieden hast, ruf mich an.“ Offensichtlich war ich der einzige Interessent.
Am Eingang reichte er mir die Hand. „Du hast übrigens Staub auf der Hose“, machte ich ihn aufmerksam.
„Gut zu wissen, dann muss ich ihn ja nicht erst extra auftragen.“
Er grinste und ließ mich ein paar Sekunden verwirrt zurück, bis ich begriff, dass er einen Witz gemacht hatte und dass es jetzt zu spät zum Lachen war. Meine Beine waren ein bisschen schlotterig, als ich die Straße hinunter ging. Ich hatte es gewagt! Ich war ein Abenteurer, ein Freibeuter, ein echter Kerl. Und außerdem hatte ich festgestellt, dass Lui nicht wie ein staubiger Automatenfreak roch, als ich in ihn gestolpert war, sondern im Gegenteil sehr angenehm und einladend nach Seife ...
Arnie allein zu Hause
Meine Mutter reagierte enthusiastisch, als wir vor dem gammeligen Gebäude standen. „Das Cinerotix! Da war ich früher ständig mit meinen Freundinnen!“
Ich hätte mir so etwas denken können. Auch die Wohnung, die Lui für uns aufschloss, fand sie wahnsinnig toll. „Du musst nicht einmal renovieren! Und was für eine fabelhafte Aussicht. Da kannst du ja wunderbar spannen, wer hier alles ein und ausgeht.“
Wir sahen uns in die Augen. Meine Mutter wusste, wie furchtbar die Wohnung war, aber sie würde nicht nachgeben. „Und sie ist so billig, dass du in drei Jahren endlich in dein eigenes Loft ziehen kannst!“ Sie küsste mich begeistert auf die Wange.
„Wie kannst du mich nur in dieser Höhle leben lassen?“
„Ich habe sie dir nicht ausgesucht, Schätzchen“, entgegnete sie gefährlich freundlich, und schob damit jede Verantwortung für mein verhunztes Leben weit von sich. Lui trollte sich ins Treppenhaus, vermutlich um die familiäre Zusammenkunft nicht zu stören. Ich meinte, seine Augen funkelten vor Vergnügen eine Sekunde lang höllenrot auf, als ich den Vertrag unterschrieb, weil er endlich jemanden gefunden hatte, der krank genug war hier einzuziehen.
„Dann auf gute Nachbarschaft“, besiegelte er den Kontrakt des Grauens.
„Du wohnst auch hier?“
Lui deutete mit dem Daumen auf die Tür gegenüber. „Ja. Und ich bin hier auch der Hausmeister. Falls der Riss in der Decke größer wird, sag einfach Bescheid.“
Wie konnte er mir entgangen sein? Niemals würde ich in eine Wohnung ziehen, deren Dach jede Sekunde einstürzen konnte.
„Wie praktisch“, sagte meine Mutter, anstatt gebührende Angst um meine körperliche Unversehrtheit an den Tag zu legen.
Ich hatte es mit positivem Denken versucht. Und ich glaube auch heute, es funktioniert nicht. Je öfter man sich einredet: Ich bin glücklich, desto mehr fällt einem auf, wie wenig wahr die Aussage ist. Die unheimlich dumpfe Traurigkeit war nicht weg zu affirmieren. In meiner Brust schwappte das Blei der Schwermut, aber ich suggerierte mir: Es ist toll, alleine zu leben, Arnie. Alles ist immer an seinem Platz, und der Kühlschrank ist makellos aufgeräumt, und das Besteck ist nie von Flugrost oder kleinen Wasserflecken übersät. Sei frei, sei ein Kind der inneren Revolution! Tu all die Dinge, die du zu Hause niemals tun konntest. Ruf bei Esomatrix an und lass deine Zukunft erpendeln!
Mein erster Akt der Freiheit bestand darin, zu versuchen, mir in der Wohnung stehend einen herunterzuholen. Nach etlichen Jahren Unter-der-Decke-Gehampel wollte ich nur einmal cool genug sein, meine Sexualität bar jeder Hemmung auszuleben – aber es klappte nicht. Ich konnte es einfach nicht, weil ich mir so dämlich vorkam. Ich konnte nicht stehend masturbieren und auch nicht ohne Bett und ohne Decke. Ich konnte auch mit Max nie nicht im Bett. Draußen in der Natur stand ich Todesängste aus, wegen dieser beängstigenden Dinge, die sie hervorbringt, wie Schnecken und Zecken und Gänse. Tische und Wannen und Mauern, und was den Kreativen noch alles an entspannungsunfreundlichen Orten zur Verfügung steht, sind nichts für mich.
Am besten, das Licht ist aus. Oder maximal sanfte Beleuchtung in Form der beruhigenden Flackrigkeit des Fernsehers. Da kann man dann parallel auch noch zuhören. Das ist Infofickment und hat sich bei Max und mir nach den ersten verklemmten Malen standardisiert. Der Fernseher lief, weil weder seine Eltern noch meine Mutter oder die Nachbarn uns hören sollten, obwohl wir beide sowieso relativ leise waren, weil wir uns nämlich gegenseitig auch nicht sehr gerne lauschten. Das haben wir uns natürlich nicht offen ins Gesicht gesagt, aber man fühlt es ja, als sensibles Wesen. Und als ob ich nicht schon genug mit mir und meinen kleinen Macken zu tun hätte, führte das Ganze dazu, dass gewisse Sendungen nun automatisch eine Erektion bei mir hervorriefen. Zum Beispiel die verblödete Kopfgeldjäger-Doku mit diesem blondierten Vogel, bei der das Vorspiel startete, oder die Stimme von Dörte Rundig von „Runde mit Rundig“, ein eher hausfrauliches Talkshowformat, das darauf folgte.
Letztlich hatte ich mir eine eigene Wohnung wesentlich aufregender vorgestellt, aber jetzt wurde ich depressiv, wenn ich nur daran dachte. Es gab nichts mehr, worauf ich mich freuen konnte, wenn ich der Sparmenia den Rücken zudrehte. Meine Befindlichkeitsdiagramme, die ich allabendlich anfertigte, plus der Notizen spiegeln eine sehr düstere Zeit meines Lebens wider. Manchmal telefonierte ich mit Max (aber irgendwie hatten wir uns nicht mehr so viel zu sagen), jeden Abend mit meiner Mutter und danach saß ich auf meiner Bettkante und nahm mir vor, etwas zu unternehmen, vergaß dann meine guten Vorsätze über einem Computerspiel, sah mir den Pornoclip an und sammelte Gegner und Bewunderer auf AllConspiracy. Das geht so einfach, als Frau; der Besitz einer Vagina scheint jeden anderen Makel umgehend auszumerzen. An diesem Abend war nichts los. Absolut nichts. Auch im Chat nur drei Vierzehnjährige. Selbst der Bananenjogurt konnte mich nicht aufheitern. Ich sah aus dem Fenster und dachte mir:
In allen Häusern leben Menschen. Alle werden geboren und altern und sterben, vermehren sich oder auch nicht, haben ihre Probleme. Ihre Leben sind genauso mühselig wie meins. Nur anders mühselig. Ich fühlte mich mit einem Mal sehr verbunden mit all meinen Brüdern und Schwestern da draußen. In meinem Kopf sind Menschen etwas Tolles, nur in der Realität nicht so sehr. Allerdings führte der Gedanke dazu, mir ein Herz zu fassen und bei Lui, meinem Nachbarn und Vermieter, hereinzuschneien. Ich lugte über den Balkon und sah Licht hinter den dunklen Gardinen. Leider hatte ich die Flasche Wein, die meine Mutter mir nebst allerlei anderen Dingen zum Einzug schenkte, schon am ersten Abend getrunken, sodass ich mir einen Jogurt (den, der am ehesten ablaufen würde) schnappte, um ihn als Gastgeschenk zu überreichen.
Lui schlurfte zur Tür. Das konnte ich so deutlich vor mir sehen, als hätte ich Röntgenaugen. Er öffnete: „Hm?“
„Hier!“ Ich hielt ihm den Jogurt hin. „Statt Blumen. Ich dachte, jetzt, wo wir Nachbarn sind, sollten wir zumindest mal kurz miteinander geredet haben.“
„Komm rein.“
Ich hatte komischerweise nicht damit gerechnet, hereingebeten zu werden. Gedanklich fehlte mir noch die innere Bereitschaft, in seine Wohnung vorzudringen. Aber nun war es zu spät. Wäre er ich, hätte die Antwort, „Wie nett, aber gerade ist es etwas ungünstig“, gelautet.
Das erste Furchtbare an ihm und seiner Wohnung war das Fahrrad, das im Flur stand. Das wird jetzt kein normaler Mensch verstehen, aber ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die gerne Rad fahren, nicht mit mir zurechtkommen. Das ist fast so, wie der Umstand, dass Klassenrowdys niemals mit den Strebern Kontakt haben wollen. Oder Fingernagelstudiotanten nichts mit britischen Adelsdamen, die in ihrer reichlichen Freizeit auf Fasanenjagd gehen.
Das Fahrrad wies Schlammspuren auf. Das hieß, es war nicht einfach dafür gemacht, um beim Bäcker Brötchen zu holen und die Umwelt für die paar Meter nicht zu belasten, sondern, um damit durchs Gehölz zu brausen.
Ich folgte Lui in die Küche. Er nahm sich einen Löffel und winkte mich in sein Wohnzimmer. Seine Wohnung war groß, sehr viel größer als das Loch, in dem ich hauste.
„Ich habe mich schon gefragt, wann du mal vorbei kommst.“
„Echt?“
Er nickte. Ich fragte mich, ob er vielleicht verärgert war, dass ich ihm nicht schon vorher einen Besuch abgestattet hatte, und log: „Ich hatte so viel um die Ohren.“
„Klar.“ Er glaubte mir nicht. Schließlich musste er nur einen Blick über den Balkon zu meinem werfen. Aus meiner Wohnung drangen keine Laute und auf der Treppe hörte man stets nur meine Schritte. Ich fühlte Zufriedenheit, als er begann, den Bananenjogurt zu essen. Das wog das Fahrrad ansatzweise wieder auf.
„Möchtest du auch?“, fragte er, vermutlich, weil ich ihn anstarrte und unbewusst meinen Mund öffnete und schloss, während er aß.
„Nein!“, wehrte ich heftig ab. „Ich hatte heute schon einen.“
„Und mehr als einer geht nicht?“
„Keinesfalls.“
„Verstehe.“
Und dann gab es nichts mehr zu sagen. Ich saß in seinem speckigen Ledersessel, knetete meine Hände, und mit jeder Minute, die verstrich, fühlte ich mich unbehaglicher und nervöser. Lui hingegen wirkte vollkommen entspannt. Er musterte mich, und mir wurde heiß wie einer Ameise unter dem Brennglas, bis ich nicht mehr anders konnte und begann, die verstreuten Zeitschriften und Kugelschreiber und Fernbedienungen auf seinem Wohnzimmertisch zu ordnen. Alles hier war so furchtbar chaotisch. Lui sah mir immer noch schweigend zu, ohne einzugreifen und legte den Kopf schräg. „In meiner Küche sieht es noch schlimmer aus.“
„Allerdings!“, pflichtete ich ihm unbedacht bei und entschuldigte mich umgehend für meine Unhöflichkeit. „Ich meinte nicht, dass es bei dir schlimm aussieht.“
Und dann tat er etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ: Er schmiss den leeren Jogurtbecher hinter sich, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Das war der Moment, in dem ich in Schweiß ausbrach. Lui lächelte sehr freundlich, als wäre nichts geschehen. „Machst du das immer so?“, fragte ich gefasst. Andere Menschen, andere Gewohnheiten. „Ich wollte nur wissen, wie du reagierst.“
Okay. Lui war gruselig. Ein schweigender, unordentlicher, gruseliger Pornokinohausmeisterbesitzer mit Fahrrad und hiermit wäre der Abend beendet.
„Nun ...“ Ich rieb meine schweißnassen Hände und lachte nervös, als ob ich ein ganz Dummer sei. „Ich habe völlig vergessen, dass ich nochmal los muss.“ Ich erhob mich. Meine Krawatte schien sehr eng um meinen Hals zu liegen.
„Wohin?“
Ich erinnerte mich an die Frau, die vor langer Zeit einmal meine Mutter gewesen war, und mich gezwungen hatte, hierhin zu ziehen, und bemerkte, vielleicht ein wenig übertrieben zornig: „Ich bin einundzwanzig, ich muss nicht Bescheid sagen, wohin ich gehe.“
„Du gehst nirgendwohin.“ Er überholte mich und schloss die Wohnungstür ab.
„Was? Ich verstehe nicht recht.“ Mein Herz klopfte heftig. Jetzt war ich dran. Knapp den Deckenriss überlebt und anschließend von meinem Vermieter gemeuchelt. „Ich gehe! Du kannst mich nicht aufhalten!“ Ich versuchte hysterisch, nach dem Schlüssel zu hangeln, der in seiner Hosentasche verschwunden war. Mich packte Todesangst, und mir brach der kalte Schweiß aus.
„Ruhig ...“ Lui bekam meine Oberarme zu fassen, und dann hörte ich ihn sagen: „Ganz ruhig. Das geht vorbei. Vielleicht kommt es dir vor, als würde es das nicht, aber das tut es. Okay? Setz dich ein bisschen aufs Sofa, wir schalten den Fernseher ein, und du denkst an etwas anderes.“
Was zum Teufel sollte das?
„Ich kenne das. Atme einfach ein paar Mal tief durch.“
Mir ging ein Licht auf. Lui hatte mich mit einem Bein im Kasino gewähnt und wollte mich retten. Ein Held, kein Mörder!
„Ja“, gab ich ihm scheinbar widerstrebend Recht. „Es ist nur manchmal so schwer …“ Ich zitterte. Wie wunderbar glaubwürdig. Lui stieß mich sanft aufs Sofa und brachte mir ein kaltes Glas Wasser aus der Küche. Ich versicherte mich unauffällig, ob der Becher auch sauber war, und trank einen kleinen Schluck.
„Geht’s wieder?“ Er setzte sich neben mich und duftete nach Seife.
„Ich glaube … ja. Danke.“ Wir alten Spielsüchtigen verstanden uns halt. Sein Arm an meinem. Mein ungeliebter, einsamer Körper sog seine Nähe auf, wie ein Badeschwamm das Wasser.
„Seit wann spielst du nicht mehr?“, erkundigte ich mich nach einer Weile.
„Ich habe drei Jahre nicht gespielt und hatte vor einem halben Jahr einen herben Rückfall.“ Es klang, als wolle er noch etwas hinzufügen, aber er tat es nicht. Ich biss mir auf die Lippen. „Das tut mir leid.“
„Man ist nie gefeit. Und bei dir?“
„Ich bin akut gefährdet. Wie du siehst.“
Den restlichen Abend versuchte ich nicht zu hüsteln, wenn er seine Zigaretten rauchte, und war froh über den Film, den wir sahen, weil ich so nicht mehr nachdenken musste, worüber wir reden könnten, und hin und wieder lächelte Lui mich an und ich zurück und ich beschloss, meine Spielsucht zukünftig ein wenig weiter auszubauen.
„Soll ich dich vielleicht einschließen?“, bat Lui mir seine Hilfe an, als er mich über den Flur zu meiner Wohnung begleitete.
„Das ist unheimlich nett, aber ich glaub, es geht schon.“
Ich wurde rot, weil die Vorstellung irgendwie pervers war und mein verwurmtes Hirn zu merkwürdigen Gedankengängen anregte. Mir war vorher gar nicht aufgefallen, was für einen hübschen Mund Lui hatte.
„Na dann. Schlaf gut!“
„Danke. Du auch.“
Nachdem ich mir die Zähne geputzt und das Waschbecken blitzsauber gewischt hatte, besprühte ich die fleckigen Fugen erneut mit desinfizierendem Antischimmelschaum, obwohl meine Mutter und ich schon 6-prozentiges Wasserstoffperoxid mit Zahnbürsten in die Ritzen geschrubbt hatten. Aber ohne den Schimmelschutz konnte ich nicht einschlafen.
Dann trug ich einen neuen Wert in mein Befindensdiagramm ein, diesmal einen ganz anständigen und schrieb an Gunnar, der fragte, ob wir nicht mal telefonieren könnten. „Hi Gunnar“, tippte ich und überlegte, warum wir das nicht konnten. „Es gibt ein großes Geheimnis in meinem Leben: Ich bin stumm. Als ich versuchte ein Kind aus einem brennenden Autowrack zu retten, durchschnitt ich meine Stimmbänder an der zerbrochenen Autoscheibe.“ Hmm. Das war gut. Sehr plausibel. Ich änderte großes Geheimnis in düsteres Geheimnis, wünschte ihm eine gute Nacht und legte mich ins Bett. Schade, dass ich nicht wirklich Annabelle war. Und Lui vermutlich nicht homosexuell. So gleicht sich das banale Unrecht des Lebens irgendwie aus. Hoffentlich konnte ich in Zukunft wenigstens ab und an neben ihm auf seiner krümeligen Couch sitzen und nicht alleine sein. Irgendwo hatte ich den kleinen Akkusauger doch noch ...
Erst als ich die Decke bis zur Nasenspitze gezogen hatte, konnte ich mich meiner Gefangener-In-Der-Eigenen-Wohnung-Fantasie wieder widmen. Ich begann mir auszumalen, was der Fantasie-Lui mit einem suchtkranken, wehrlosen Spieler wie mir alles anstellen könnte und es war mein Glück in diesem Fall, über eine bild- und tonreiche Fantasie zu verfügen, denn sie machte das Ganze zu einem außerordentlich anregenden Erlebnis in meiner öden Welt. Aber ich möchte Sie keinesfalls mit meinen abartigen Sexgedanken behelligen. Sie würden das auch gar nicht lesen wollen, glauben Sie mir.
Samstags
Meine Highlights waren inzwischen die Wochenenden, die ich wie ein verstoßener Internatsschüler zu Hause verbringen durfte. Also in meinem wahren Zuhause, nicht im Pornokinoalptraumloch. Meine Mutter hatte Recht gehabt, meine Abwesenheit stimmte sie milder und sie schien sich richtiggehend zu freuen, mich zu sehen. Sie räumte sogar die Wohnung auf, damit sie keine Wutanfälle bekommen musste, wenn ich ordnend eingriff, was ich sehr nett fand.
Wir gingen in den Zoo, um ihn gemeinsam scheiße zu finden. Früher hatte sie mir oft mit dem Zirkus gedroht, wenn ich Dummheiten machte. „Wenn du nicht sofort aufhörst, deine Flummis gegen den Glasvitrinenschrank zu feuern, dann gehen wir in den Zirkus!“
Ich hatte enorme Ängste, wenn ich das bunte Zelt auf dem Platz neben den Stadtwerken sah. Kinder wurden scharenweise hereingeführt, und vermutlich nicht wieder hinaus. Ich wollte sie retten, während ich an der roten Ampel meine Nase an der Seitenscheibe plattdrückte. Mit dreizehn besuchte ich dann endlich einen Zirkus, und zwar mit Tante Kitty, der besten Freundin meiner Mutter. „Du darfst dem Kind doch nicht solche falschen Vorstellungen einimpfen!“, hatte sie geschimpft, und ich war so dankbar, dass sie sich meiner annahm – bis ich in der Aufführung saß. Es gibt Momente, in denen sind dir deine Eltern fremder als eine Bande berusischer Meuterer vom Planeten Xor und andere Momente, da bist du stolz, dass ihr Blut durch deine Adern fließt. Der Schrecken des Zirkus war einer der verbindenden Blut-Momente. Arme gequälte Tiere, stinkende Luftfeuchtigkeit, peinliche Ansagen, schlechte Musik, bei der nach drei Takten enthirnt mitgeklatscht wurde, müde Zauberer und Minuten, die nicht verstreichen wollten.
Als ich dann älter wurde, drohte sie mir mit Musicals. „Geh gefälligst zur Berufsschule, sonst gucken wir uns den König der Löwen an!“ Durch den Zirkus vorgewarnt habe ich nicht ein einziges Mal geschwänzt. Und nachdem wir als berufsschulisches Weihnachtsevent in Starlight Express waren, weiß ich auch warum.
Doch dieser samstägliche Zoobesuch war nett. Besonders mochten wir die Otter. Meiner Mutter zuliebe begleitete ich sie auch ins stinkende Affenhaus. Danach mussten wir uns von so viel Aufregung erholen.
„Arnie“, sagte sie und drückte mir ein buntes Eis in die Hand, während sie zig Süßstofftabletten in ihrem Kaffee versenkte, „du siehst mir grau aus, in letzter Zeit. Ich mache mir Sorgen.“
„Das ist die Vorstufe von Anthrazit. Diesen Winter sehr in, sagt die Vogue.“
„Hahaha. Also … was ich sagen will: Der Mensch ist ein soziales Wesen, ich weiß, es klingt komisch aus meinem Mund, aber so ungern ich es zugebe: Wir brauchen andere Menschen. Du auch.“
„Und wo soll ich die hernehmen?“
„Wenn du endlich mal deine Talente nutzen würdest, könntest du so viel Geld verdienen, dass du dir welche kaufen kannst.“
„Was für Talente?“
„Ich dachte eigentlich, als naturbegabter Lügner und Story-Erfinder wärst du bei der Bank gut aufgehoben. Aber vielleicht könntest du dir dein Talent, blitzschnell Geschichten zu erfinden und sie auch noch im Kopf zu behalten, nutzbar machen.“
Ich schwieg. Ich habe es nicht gerne, ertappt zu werden. Sie fuhr fort, während sie sich eine ihrer unsäglichen Zigaretten ansteckte. „Ich weiß nicht, wo du Freunde herbekommst. Holt ihr euch die heutzutage nicht aus dem Internet? Aber ich denke, du solltest dir klarmachen, dass du erst einmal innerlich bereit sein musst, welche zu wollen. Warum hast du keine Freunde? Weil du Angst hast. Weil dir alles Angst macht.“
„Und sie mich langweilen.“
„Du scheiterst nicht an den Menschen, sondern an dem Unterschied zwischen ihnen und deinen Ansprüchen. Niemand ist permanent ein Feuerwerk des Geistes. Na ja, vielleicht Andy Warhol und solche Gestalten, aber die erträgt ja auch niemand auf Dauer. Überprüfe deinen Anspruch. Du wirst nicht glücklich, wenn du deine Fantasie immer mit der Realität vergleichst; der großen Sehnsucht nachhängst. Niemand wird deinen Ansprüchen gerecht. So ist es nun mal. Das Leben ist langweilig. Aber nur, wenn man es oberflächlich betrachtet. Kapierst du das?“
„Nein.“ Was hatte die Langweiligkeit anderer mit meinen Ansprüchen zu tun?
Sie seufzte. „Lass uns noch die scheißöden Elefanten abklappern.“
Ich konnte damals nichts mit dem anfangen, was sie mir an diesem Nachmittag vermitteln wollte, aber später schon. Es ist wahr, man muss die ganze Scheiße selbst durchmachen, noch nie hat ein mütterlicher Ratschlag etwas verhindern können.
An diesem Abend saß ich auf meinem Balkon. Mangels Bestuhlung hatte ich eine kleine Stelle auf dem Boden, groß genug für meinen Hintern, desinfiziert und ein Kissen darauf gelegt, um ein wenig nachzudenken. Es war ein milder Frühsommerabend und Nachdenken kann etwas sehr Bedrohliches sein. Ich starrte auf die rissige Elektronikfassade, und in unregelmäßigen Abständen kamen sie mir hoch, all die Dinge, die ich machte, und vor allem diejenigen, die ich nicht machte.
Plötzlich hörte ich eine Bewegung der nachbarlichen Balkontür und straffte meinen Rücken.
„Na?“ Lui stützte sich, mit einer Dose Bier in der Hand, aufs Geländer und sah zu mir herab.
„Na?“, fragte ich zurück und war froh, meiner depressiven Zunge überhaupt ein Na entlocken zu können. Er ließ sich ebenfalls nieder, wie mein Spiegelbild, nur getrennt von zwei Lagen Balkongitter. Wir hätten auch zwei Gefängnisinsassen sein können, die zufällig die Zellen nebeneinander belegten. Obwohl, belegte man Zellen? Oder nur Badeliegen und Brötchen? Ich dachte daran aufzustehen, um mit meinem öden Murks an unerwünschten Traurigkeitsgefühlen alleine zu sein, aber dann hätte ich vermutlich endgültig meinen Status als Verrückter konstituiert. Also presste ich lediglich meine Stirn gegen meine angewinkelten Knie, um Lui auszuschließen. Ich war an diesem Abend zu aufgescheuert vom Leben, um mir eine Lügengeschichte auszudenken. An Luis Stelle hätte ich mich diskret zurückgezogen, aber so war er nicht.
„Willst du nicht rüberkommen, anstatt hier vor dich hin zu verzweifeln?“
„Ehrlich gesagt habe ich nicht so gern Publikum beim Verzweifeln.“
Lui erhob sich und dann – ich schwöre es – schwang er sich über den zwanzig Zentimeter breiten, klaffenden Abgrund von Balkon zu Balkon und baute sich vor mir auf. „Ehrlich gesagt ist mir das egal“, imitierte er mich. Nachdem ich mich von dem Schock seines Todessprungs erholt hatte, versuchte ich ihn abzuwimmeln. „Samstagabend. Hast du nicht was vor? Klettern oder Kanu fahren? Oder dir noch ein paar Löcher in den Körper bohren lassen?“
„Du weißt nicht, was man samstagabends macht, oder?“
„Saufen und hoffen, Sex oder die große Liebe oder ein Substitut dafür in einer Bar, auf einer Party oder einem Club finden. Oder angeblichen Spaß mit angeblichen Freunden zu haben, mit denen man ohne Alkohol und Drogen keinen Spaß hat.“
„Brav. Ich merke, theoretisch kennst du dich aus.“
„Ist es so offensichtlich?“ Ich sah meiner Meinung nicht aus, wie der Versager, der ich war. Das weiß ich, weil ich darauf achtete, nicht so auszusehen.
„Es ist empirisch. Du wohnst seit sechs Wochen hier und warst nicht einmal abends weg.“
Das ist das Bauchschmerz-Thema. Ebenso wie Silvester. Silvester ist schlimmer als Weihnachten. Weihnachten ist okay, weil man den Tag mit seiner Familie verbringen kann. Hat man keine Familie, ist das nicht selbstverschuldet, sondern traurig. Silvester ist das Fest der Freunde und der Gradmesser für dein gesellschaftliches Standing. Wenn da nichts geht, Leute, dann habt ihr es nicht geschafft. Ich wollte ihm erklären, weshalb ich nicht ausging, aber er sprach weiter: „Ich weiß, wenn man so im Suchtfilm ist, dann scheut man andere. Man ist froh, mit sich und seiner Sucht und seiner Scham alleine zu sein. Ich nehme an, du spielst viel im Internet?“, erklärte er sich meine Häuslichkeit.
Äh. „Mhm“, gab ich vage zu. Na gut, dann würde ich meine Suchteinsamkeit jetzt für ihn durchbrechen. „Möchtest du was trinken? Oder einen Jogurt?“
„Jogurt wäre gut.“
„Klar. Warte kurz.“
Ich füllte den Jogurt in ein Kristallglas, das ich meiner Mutter geklaut hatte, die ohnehin alles aus Plastikbechern trank und eine Kunststoffanbeterin war. Das Licht brach sich im funkelnden Schliff, und ich lobte mich für meine stilvolle Gastfreundlichkeit. Zuletzt nahm ich einen glänzenden Löffel aus dem Besteckfach und achtete darauf, nur den Griff mit den Händen zu berühren, damit kein Keim auf dem Schippenbereich landete. Ich wusch den Plastikbecher aus und ließ ihn behutsam in den Mülleimer plumpsen.
„Wow.“ Lui nahm das Stielglas und warf einen bewundernden Blick auf Schneelandmilchprodukt Nummer eins meiner Wahl. Kann auch sein, dass der Blick ironisch und nicht bewundernd war.
„Hattest du deine Dosis heute schon?“
Ich hatte mir den Jogurt für den späten Abend aufgespart. Ich, Bananenpilze und Luca37s fünfzehn Minuten.
Ehe ich mich versah, provozierte mein Vermieter einen weiteren Moment der Qual: Er hielt mir den Löffel hin, von dem er bereits selber gegessen hatte. Es tut mir leid, aber ich kann unmöglich vom selben Löffel schleimige Substanzen essen, die bereits speicheldurchnässt sind. Ich lasse niemals jemandem von meinem Apfel beißen, ohne denselben danach umgehend diskret wegzuschmeißen, und Löffel teile ich nie. Nicht einmal mit meiner Mutter, die natürlich jede Menge letzte Vanillepuddings, letzte Jogurts und letzte Schokocremes nur deshalb ergatterte, weil sie meine Löffelphobie auf das Schändlichste auszunutzen wusste.
Aber Lui hatte bei seinem Balkonsprung soeben sein Leben für mich riskiert, und mein Kopf wusste ja, dass nichts passieren könnte, abgesehen von Mundfäulnis und anderen schauerlichen Krankheiten, und so öffnete ich todesmutig meinen Mund und würgte den Happen so schnell wie möglich herunter.
„Stimmt was nicht?“
„Alles bestens“, versicherte ich mit steifen Lippen.
Seine blassblauen Augen durchbohrten mich auf der Suche nach dem Geheimnis meiner Anspannung. „Du magst das nicht besonders.“
„Nein, nicht besonders“, gestand ich kläglich ein.
„Wie machst du das beim Küssen?“
Das war eine folgerichtige Frage. „Ich denke an etwas anderes.“
„Oh.“
„Ich darf nicht allzu lange über die Tatsache zweier sich einspeichelnder Schleimhäute und damit verbundener Zahnbelagdurchmischung nachdenken, dann geht es.“
„Klingt logisch“, gab er zu. Und ich hatte schon Angst, er würde sagen: Klingt gestört. Lui führte mir einen weiteren Löffel Bananenjogurt an die Lippen und lächelte freundlich. Hatte ich nicht gerade gesagt, dass ich das ekelhaft fand? Nicht?
„Na, komm schon.“
Ich erwähnte ja bereits meine Schwierigkeiten, mich direkten Befehlen zu verweigern. Und irgendwie fand ich es auch spannend. Etwas in seinem Blick ließ einen kleinen Draht in meinem Kopf sirren. „Könntest du das jetzt eventuell bitte lassen?“, fragte ich, als er erst sich und dann mir die Keimschleuder in den Mund steckte.
„Ach was, das macht dich doch an.“
Heute bin ich mir sicher, dass das nur ein Witz war, aber da es leider stimmte, reagierte ich auf die arniehafteste aller Möglichkeiten. Ich sprang auf und aus meinem Mund kam der grauenhafte Satz: „Ich bin doch nicht schwul!“ Ich, der niemals ein Geheimnis aus seiner Neigung gemacht hatte! Ich hätte Ja sagen sollen oder vielleicht verführerisch: Uhh … ich glaube, dich macht es an. Oder einfach Nein. Oder sonst irgendwas. Von mir aus auch einen Kasinosuchtanfall vortäuschen.
„Ups“, erwiderte Lui. „War nur ein Scherz.“
„Nichts gegen Leute wie dich ...“ Ich machte es wahrhaftig noch schlimmer. Wieso machte ich das? Was würde Annabelle dazu sagen, die so viel vernünftiger war als Arnie? Ich ließ mich wieder fallen. Auf den Boden und in das Loch meiner tiefsten Verzweiflung. Lui senkte den Kopf und ich dachte, ihn hart getroffen zu haben. Heute weiß ich, dass er den Balkonboden auf eine Weise angrinste, die den merkwürdigen, plötzlichen, nationalen Bodenfrost an diesem Abend erklärte. Sein Gesicht war fast ein wenig schuldbewusst, als er mich ansah und sagte: „Ich wollte dir nicht zu nahe treten.“
„Kein Problem. Ich meine. Es ist sehr nett, dass du … also vielleicht gehst du jetzt doch besser.“
Lui kam dicht an mein Gesicht und eine Sekunde, dachte, hoffte, fürchtete ich, er würde mich küssen wollen, als er seinen Daumen an meine Lippen führte und darüber wischte. „Du hattest da noch Jogurt“, bemerkte er freundlich.
Und dann sprang er wie Batman auf seinen Balkon und wünschte mir einen spaßigen Samstagabend. Meinen Abend verbrachte ich mit den Maya-Kristallschädeln für läppische 258 Euro (Aktionspreis) des Telematrix-Shops. Kristallschädel können Kinder bekommen, erfuhr ich. Sie waren heterosexuell. Genau wie ich.
Mist! Mist …
Arnie heult
Ich musste an Lui denken, als ich in der Mittagspause Irina, die in meinem Kopf den Spitznamen Pfi-Ma-Pest trägt, und Dr. Ogen, den ich tatsächlich immer so nannte, auch außerhalb meines Kopfes, gegenüber saß.
Dr. Ogen macht seinem Namen alle Ehre, obwohl er in Wirklichkeit Christoph Hagemeier heißt und sein Hirn von Montag bis Freitag abschaltet, um am Wochenende zu leben. Wenn er nicht mit Leuten telefonierte oder mit seinem Handy spielte, war er eigentlich ganz lustig. Die Pfi-Ma-Pest und ich teilten uns einen großen Schreibtisch und saßen uns unfreiwillig gegenüber, obwohl sie viel lieber ihre Arbeitszeit mit Lara Klein verbracht hätte. Pfi-Ma-Pest sammelte Plüschtiere, (kotz) und auf ihrem Schreibtisch stand eine Diddl-Maus-Kunststeinfigur, die temperaturbedingt die Farbe wechselte und mir Angst machte. Es macht mir immer noch Angst, in einer Welt zu leben, in der der Erfinder der verkackten, belanglosen, unlustigen Diddl-Maus wahrscheinlich Millionär ist und meine Mutter Büros putzte, anstatt irgendwas zu tun, was ihrem großartigen Verstand entspräche.
Pfi-Ma-Pest aß mittags immer etwas selbst Mitgebrachtes, gerne mal einen vernünftigen Rohkostsalat und danach stets einen Pfirsich-Maracuja-Jogurt, dem sie ihren Namen verdankt. Sie aß ihn nicht einfach, sondern sie verspeiste ihn auf eine Art, die mich so unfassbar wütend machte, dass ich während dieses Vorgangs nicht mit ihr sprechen konnte. Erst zog sie den Deckel ab, dann kratzte sie mit ihrem weißen, schrammeligen Teelöffel, den sie schon in der Schule benutzt hatte, die verdickten Jogurtreste vom zerbeulten Deckel, den sie anschließend akribisch zusammenfaltete. Dann umfuhr sie einmal den Rand des Bechers, wo der hart gewordene Schmu sich sammelt, und steckte sich die gesamte Löffelschaufel genießerisch in den Mund. Mein Puls stieg in diesem Moment. Sodann tunkte Irina den Löffel in den Jogurt, sodass sich auf der metallenen Fläche ein Häuflein türmte, ließ ihn zwischen die Lippen gleiten, um lediglich den Überstand abzusabbeln. Es verblieb eine ebene Jogurtschicht auf dem Löffel, die sie als Nächstes mit geschlossenen Augen auf eine widerlich genießerische Art bis zum Stiel in den Mund schob, um den leeren Löffel kurz ruhen zu lassen und den nächsten Haufen auf dieselbe Weise zu planieren.
So aß man keinen Jogurt. Es war einfach ekelhaft. Heute überwand ich meinen aufkeimenden Hass und fragte: „Irina?“
„Hm?“
„Wischen Heteromänner anderen Heteromännern Jogurt vom Mundwinkel?“