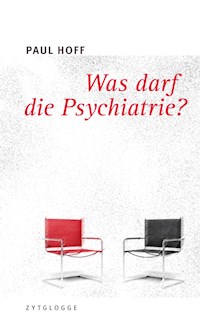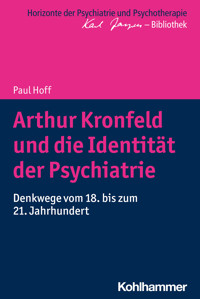
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Was ist Psychiatrie? Der deutsch-jüdische Psychiater und Psychologe Arthur Kronfeld (1886-1941) widmete sein Lebenswerk genau dieser Frage. Als profunder Kenner der Ideengeschichte und scharfsinniger Kritiker forderte er eine eigenständige, "autologische" Psychiatrie, der er auch eine kulturwissenschaftliche Dimension zuwies. Die verblüffenden Parallelen zwischen Kronfelds Denken und den Herausforderungen der Psychiatrie im 21. Jahrhundert machen die sorgfältige Rezeption seiner Texte zur intellektuellen Fundgrube. Über den Blick auf Ankerpunkte wie den Krankheitsbegriff oder den diagnostischen Prozess und anhand von Fallvignetten, die heikle therapeutische Entscheidungen authentisch schildern, veranschaulicht der Autor die Theoriegebundenheit der Psychiatrie sowie die Praxisrelevanz theoretischer Vorannahmen: "Theorie ist Praxis" - so plakativ dies wirken mag, so spürbar wird es im Behandlungsalltag, zu Kronfelds Zeit ebenso wie heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort zur Reihe
Vorwort
1 Einführung: Worum es in diesem Buch geht
Lebenswelt 1 – Aaron B. und die Vertrauenskrise: Warum psychotherapeutische Interventionen schmerzhaft sein können – für Patient/in und Therapeut/in
2 Biographische Skizze
Lebenswelt 2 – Charlotte D. und die Diskriminierung: Wie das Aufeinanderprallen zweier ethischer Prinzipien die Beteiligten an ihre Grenzen führt
3 Was Kronfeld antraf: Theorien und Kontroversen in der Ideengeschichte der Psychiatrie vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert
3.1 Ein personzentrierter Beginn: Die Psychiatrie als »Kind der Aufklärung«
3.2 Macht und Faszination des Irrationalen: Psychiatrie im Zeitalter der Romantik
3.3 Wilhelm Griesinger (1817 – 1868): Psychiatrische Forschung als selbstbewusste empirische, sich ihrer Grenzen stets bewusste Annäherung an das Psychische
3.4 Das biologische Substrat als einzige Realität: Die »Gehirnpsychiatrie« des ausgehenden 19. Jahrhunderts
3.5 Krankheiten und der Wert des Lebens: Degenerationslehre, Eugenik, Sozialdarwinismus
3.6 Sigmund Freud (1856 – 1939) und die Psychoanalyse: Eine ambivalente Provokation für die Psychiatrie
3.7 Emil Kraepelin (1856 – 1926) und Eugen Bleuler (1857 – 1939): Prägende Kliniker zu Beginn des 20. Jahrhunderts
3.8 Karl Jaspers (1883 – 1969) und die neue Differenziertheit im wissenschaftstheoretischen Diskurs um Psychiatrie und Psychologie
Lebenswelt 3 – Streit um die Psychiatrie: Eine fiktive Debatte unter Koryphäen in drei Szenen
4 Was Kronfeld antrieb: Seine zentralen Motive und Ziele
Lebenswelt 4 – Esther F. und der Abstand: Warum psychiatrisches Arbeiten Nähe und Distanz braucht
5 Psychiatrie als »autologische Wissenschaft«: Kronfeld, der Neukantianismus und das Ringen um die Identität des Faches
5.1 »Experimentelles zum Mechanismus der Auffassung«: Die philosophische Dissertation (1912a)
5.2 »Das Wesen der psychiatrischen Erkenntnis« (1920a)
5.2.1 Zur Einführung
5.2.2 Eine gewichtete Synopsis des Werkes
5.3 Die Habilitationsschrift (1927a): »Die Psychologie in der Psychiatrie. Eine Einführung in die psychologischen Erkenntnisweisen innerhalb der Psychiatrie und ihre Stellung zur klinisch-pathologischen Forschung«
Lebenswelt 5 – Gian H. und die Deutungshoheit: Um Personen geht es in der Therapie, nicht um Rollen
6 Psychotherapie ist nicht nur Technik, sondern eine Grundhaltung: Kronfelds Weg zum Personalismus
6.1 Ein fulminanter Einstieg: »Über die psychologischen Theorien Freuds und verwandte Anschauungen. Systematik und kritische Erörterung« (1912b)
6.2 Kronfeld, der praktisch tätige Psychotherapeut: »Psychotherapie. Charakterlehre, Psychoanalyse, Hypnose, Psychagogik« (1924, 2. Auflage 1925)
6.3 Nochmals Kronfeld und Freud: »Der Sinn des Leidens. Das Wesen des Menschen und die Theorien der Neurose« (1931)
6.4 Eine Stoffsammlung und ein Manifest: Das »Lehrbuch der Charakterkunde« (1932) und der Vortrag über Kierkegaard (1932, veröffentlicht 1935)
Lebenswelt 6 – Iris J. und das ärztliche Berufsgeheimnis: Warum eine Behandlungssituation rechtlich klar, ethisch jedoch heikel sein kann
7 Eine Wendung ins Klinische: Kronfelds eigenwillige, aber konsequente Schizophrenielehre (1930)
Lebenswelt 7 – Streit um die Schizophrenie: Noch eine Debatte in drei Szenen
8 Kronfeld und die Psychiatrie als Wissenschaft: Ein kritisches Résumé
Lebenswelt 8 – Konrad L. und die Autonomie: Warum Entscheidungen in der Psychiatrie sowohl richtig wie contre cœur sein können
9 Ein Brückenschlag, der naheliegt: Kronfeld und die Psychiatrie im 21. Jahrhundert
9.1 Eine Vorbemerkung zum Nutzen der psychiatrischen Ideengeschichte
9.2 Zwischen Kronfeld und heute: Orientierungsmarken der Psychiatrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
9.3 Eine Brücke auf sieben Pfeilern
9.3.1 Was ist Psychiatrie? Die Frage nach der Identität einer medizinischen Disziplin
9.3.2 Was ist eine psychische Krankheit? Die Frage der Nosologie
9.3.3 Wie erkenne und bezeichne ich eine psychische Erkrankung? Die Frage der Diagnostik
9.3.4 Wie behandle ich eine psychische Erkrankung? Die Frage der Therapie
9.3.5 Welche Bedeutung haben Person und Interpersonalität für die Psychiatrie? Die Frage des Menschenbildes
9.3.6 Welche Rolle spielt die Psychiatrie in der Gesellschaft? Eine Frage der Balance zwischen Anbiederung und Verweigerung
9.3.7 Wurde das bio-psycho-soziale Modell von der treibenden Kraft zur Floskel? Die Fragen nach einer glaubwürdigen Mehrdimensionalität der Psychiatrie und nach der zukünftigen Rolle der Psychopathologie
9.4 Die wesentlichen Herausforderungen für das heutige Fach Psychiatrie und Psychotherapie
Lebenswelt 9 – Madeleine N. und die »Trauerkrankheit«: Warum psychiatrische Diagnosen mehr sind als technische Begriffe
10 Medizin als Handlung: Eine Schlussbetrachtung
Dank
Literatur
Stichwort- und Personenverzeichnis
Horizonte der Psychiatrie und Psychotherapie –Karl Jaspers-Bibliothek
Herausgegeben von Matthias Bormuth, Andreas Heinz und Markus Jäger
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/horizonte
Der Autor
© Rene Pfluger
Prof. em. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff, 1956 in Ulmen bei Köln geboren. Studium der Humanmedizin und der Philosophie in Mainz und München. Promotionen 1980 (Dr. med.), 1988 (Dr. phil.), Habilitation für Psychiatrie in München 1994. Ärztliche Tätigkeit an den psychiatrischen Universitätskliniken in München (LMU), Aachen und – von 2003 bis zum Altersrücktritt auf Ende Mai 2021 – Zürich. Seither affiliierter Wissenschaftler an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Ambulante Sprechstunde an der Privatklinik Hohenegg, Meilen bei Zürich. Präsident der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Arbeitsschwerpunkte sind psychopathologische, ideengeschichtliche und wissenschaftstheoretische Themen, die als notwendige Grundlage jedes psychiatrischen und psychotherapeutischen Handelns verstanden werden.
Paul Hoff
Arthur Kronfeld und die Identität der Psychiatrie
Denkwege vom 18. bis zum 21. Jahrhundert
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-032994-2
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-032995-9epub: ISBN 978-3-17-032996-6
Vorwort zur Reihe
Psychiatrie und Psychotherapie nehmen im Kanon der medizinischen Fächer eine besondere Stellung ein, sind sie doch gleichermaßen auf natur- wie kulturwissenschaftliche Methoden und Konzepte angewiesen. Bereits vor hundert Jahren wies der Arzt und Philosoph Karl Jaspers darauf hin, dass man sich im psychopathologischen Zugang zum Menschen nicht auf eine einzige umfassende Theorie stützen könne. So warnte er entsprechend vor einseitigen Perspektiven einer Hirn- bzw. Psychomythologie. Viel mehr forderte Jaspers dazu auf, die verschiedenen möglichen Zugangswege begrifflich scharf zu fassen und einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Diese Mahnung zur kritischen Pluralität gilt heute ebenso, werden sowohl auf neurobiologischem als auch auf psychotherapeutischem bzw. sozialpsychiatrischem Gebiet nicht selten dogmatische Positionen vertreten, ohne dass andere Sichtweisen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ausreichend berücksichtigt würden.
Die Reihe »Horizonte der Psychiatrie und Psychotherapie – Karl Jaspers-Bibliothek« möchte die vielfältigen Zugangswege zum psychisch kranken Menschen in knappen Überblicken prägnant darstellen und die aktuelle Bedeutung der verschiedenen Ansätze für das psychiatrisch-psychotherapeutische Denken und Handeln aufzeigen. Dabei können viele Probleme im diagnostischen und therapeutischen Umgang mit den Menschen nur vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden historischen Konzepte verstanden werden. Die »Karl Jaspers-Bibliothek« möchte den Leser dazu anregen, in solch pluralistischer und historisch weiter Horizontbildung den drängenden Fragen in Psychiatrie und Psychotherapie nachzugehen, wie sie die einzelnen Bandautoren entfalten werden. Ziel der Reihe ist hierbei auch, ein tieferes Bewusstsein für die begrifflichen Grundlagen unseres Wissens vom psychisch kranken Menschen zu entwickeln.
Oldenburg/Berlin/KemptenMatthias Bormuth, Andreas Heinz, Markus Jäger
Vorwort
Arthur Kronfeld war ein Freund kerniger Aussagen:
»Theorien sind billig wie Brombeeren. Und doch sind wir gezwungen, uns Gedanken zu machen, – am meisten über das, was uns selbstverständlich erscheint.« (Kronfeld 1930, S. 28)
Heute, 2023, ist die Behauptung des ersten Satzes schlicht falsch: Brombeeren sind alles andere als billig, eher unerschwinglich. Im Berlin der Weimarer Republik, die ihrem – auch für Arthur Kronfeld persönlich – traurigen Ende entgegen ging, mag das anders, mögen Brombeeren tatsächlich billig gewesen sein. Hat Kronfeld also unrecht? Können seine Positionen und Reflexionen nur für die eigene Zeit Geltung beanspruchen? Macht es überhaupt Sinn, sich über 100 Jahre alte Texte zu beugen, wenn es um die fragile Identität der heutigen Psychiatrie geht?
Das vorliegende Buch beruht auf der Überzeugung, die sorgfältige Rezeption des weitgehend in Vergessenheit geratenen Kronfeldschen Werkes werde jenseits zeitgeistiger Besonderheiten fruchtbare Erkenntnisse und weiterführende Fragen für die aktuelle Debatte generieren. Dass solche Stimuli nötig sind, steht für mich außer Frage.
»Theorie ist Praxis« – auch das ist eine hier vertretene Grundhaltung. Um diese paradox klingende Aussage plausibel zu machen, werden die verschachtelten theoretischen Zusammenhänge, um die es gehen wird, mit konkreten, wenn auch schwierigen Situationen aus dem psychiatrisch-psychotherapeutischen Alltag, »Lebenswelten« genannt, verschränkt – ein »Dialog«, der Leserinnen und Leser zu eigener Reflexion anregen möge. Psychiatrie lebt, wie jede offene Wissenschaft, vom Austausch, vom Widerstreit der Argumente. Arthur Kronfeld liebte und pflegte die Debatte, die Kontroverse, nicht selten bis hin zur Polemik. Um Letztere geht es mir nicht, wohl aber um die Ermutigung zu einem kritischen Diskurs. Denn nur er hat – im Gegensatz zu dogmatischen Festsetzungen welcher Provenienz auch immer – das Potential, der Psychiatrie des 21. Jahrhunderts zu einer in Klinik, Forschung und Lehre tragfähigen wissenschaftlichen Identität zu verhelfen.
In diesem Sinne möchte das Buch ein erzählendes, begründete Fragen stellendes Lesebuch sein, kein auf affirmative Vollständigkeit und passive Wissensvermittlung abzielendes Lehrbuch.
Zürich, im Herbst 2023Paul Hoff
1 Einführung: Worum es in diesem Buch geht
»Psychiatry is the most self-doubting specialty: it is concerned with the ambiguities of the social practice of medicine.« (Littlewood 1991)
Ob diese lakonische Feststellung des britischen Anthropologen und Psychiaters Roland Littlewood als Kritik an einer zu wenig reflektierten, zu wenig selbstbewussten Psychiatrie zu verstehen ist oder – so sehe ich es – als ebenso verständnisvolle wie kräftige Aufforderung an das Fach, sich den nicht zu vermeidenden konzeptuellen Herausforderungen aktiv zu stellen, dieser Entscheid sei der Leserin und dem Leser überlassen. Er führt mitten in unser Thema.
Was macht den Kern des Faches Psychiatrie1 aus? Warum ringt die Psychiatrie so sehr mit grundsätzlichen Fragen? Kann sie sich zukünftig als eigenständige Disziplin der akademischen Medizin sowie als klinisches Fach behaupten? Darum wird es in diesem Buch gehen. Zwei Perspektiven werden dabei miteinander verschränkt, die nur auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen.
Zum einen wird mit Arthur Kronfeld ein Autor vorgestellt, der sich vor einem Jahrhundert mit beeindruckender Nachhaltigkeit einer, besser: seiner Aufgabe gestellt hat: Es galt, die Psychiatrie auf eine theoretische Grundlage zu stellen, die die Mehrdimensionalität des Faches wahrt und selbstbewusst gegen vereinfachende Reduktionismen verteidigt, ihm aber zugleich ein tragfähiges wissenschaftliches und therapeutisches Selbstverständnis, eine professionelle Identität, ermöglicht. Zum anderen geht es um den Status der Psychiatrie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, der von einer Fülle grundsätzlicher Herausforderungen gekennzeichnet ist, denen sich tradierte Denkweisen gegenübersehen.
Die Verknüpfung dieser beiden, durch einen Zeitraum von 100 Jahren voneinander getrennten Themenfelder hat nichts Artefizielles an sich, im Gegenteil: Sie bietet sich an, gibt es doch verblüffende Parallelen zwischen den Fragen, die Kronfeld bewegten, und denjenigen, die das Fach aktuell herausfordern. Obwohl wissenschaftlich-methodischer Kontext und sprachlicher Ausdruck sich seither markant geändert haben, können, wie ich zeigen möchte, Kronfeldsche Positionen wesentliche Anstöße geben für die heutigen Debatten um die psychiatrische Diagnostik und Nosologie, um die Mehrdimensionalität des Faches sowie die Rolle der Person in der Psychiatrie.
Allerdings ist hier mit skeptischen Rückfragen zu rechnen:
•
Ist es nicht trivial, nach der Identität einer medizinischen Disziplin zu fragen, die sich doch, unbeschadet aller inhaltlichen Debatten, stets aus der Erkennung, Benennung und Behandlung »ihrer« Erkrankungen speist, hier also aus der Nosologie, Diagnostik und Therapie der psychischen Erkrankungen?
•
Ist es nicht vermessen oder gar überheblich, im Falle eines ständig in Entwicklung begriffenen und stark mit gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen verschränkten Faches wie der Psychiatrie überhaupt nach »der« Identität zu suchen? Beschwört nicht dieser Singular die Gefahr einer intellektuellen Einengung herauf oder, im schlimmsten Fall, einer dogmatischen Erstarrung2?
•
Dient nicht die Rubrizierung der Psychiatrie als medizinische Disziplin in erster Linie der Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen, etwa aus den Bereichen Psychologie oder Pflege, die ebenfalls wesentlich zur Behandlungsqualität und zur konzeptuellen Weiterentwicklung beitragen?
Dieses Buch beruht auf der Überzeugung, die genannten Fragen seien mit einem klaren Nein zu beantworten, allerdings keinem apodiktischen, sondern einem selbst- und methodenkritischen Nein: Was Krankheit und was Gesundheit sei – also der von der ersten Frage implizit als selbsterklärend unterstellte Bezugspunkt – adressiert ein Grundproblem der Medizin, das keineswegs trivial und erst recht nicht »bloß« theoretischer Natur ist. Die zahlreichen denkbaren Antworten entfalten eine nachhaltige, wenn auch oft unterschätzte Wirkung auf das konkrete medizinische Handeln.
Genau um diese Praxisrelevanz theoretischer Konzepte geht es bei der zweiten Frage: Wenn nämlich mit Identität gemeint ist, grundsätzliche Fragen mit einfachen, allenfalls sogar abschließenden Antworten »erledigen« zu können, dann wird das Ziel weit verfehlt, und wir befinden uns im Bereich des Dogmas. Die Geschichte der Medizin – und wahrlich auch diejenige des Faches Psychiatrie – sind reich an Beispielen für solche Fehlentwicklungen. Führen aber die grundlegenden Fragen zu differenzierten, offenen und in einem bestimmten Sinne bescheidenen Antworten, wird die Debatte also nicht beendet, sondern konstruktiv weitergetrieben, dann handelt es sich um einen ernsthaften wissenschaftlichen Diskurs. Eben dieser ist für die Psychiatrie das sprichwörtliche Salz in der Suppe: Sie ist auf ihn angewiesen, denn er prägt ihre Identität.
Arthur Kronfeld verkörpert eindrücklich das Ringen um diese Spannungsfelder. Er hat die zeitgenössische Diskussion angeregt, in mancher Hinsicht geprägt und regelmäßig provoziert. Er kam seinem selbst gesteckten Ziel recht nahe, das »Wesen der psychiatrischen Erkenntnis«3 zu erfassen, einer eigenständigen Psychiatrie den Boden zu bereiten, die er »autologisch« nannte. An einigen Punkten aber stieß er auf Schwierigkeiten oder scheiterte: So ergeht es jeder sorgfältig arbeitenden Wissenschaft.
Das Nachzeichnen psychiatrischer Denkwege vom Zeitalter der Aufklärung bis ins 21. Jahrhundert, die in diesem Buch vorgenommen wird, um Kronfelds Werk systematisch einordnen zu können, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die getroffene Auswahl von Konzepten und Personen folgt subjektiven Schwerpunktsetzungen des Autors. Gleichwohl ist sie nicht beliebig: Die leitende Maxime war, Positionen darzustellen, die sowohl für Arthur Kronfelds Werk wesentliche Bedeutung erlangten als auch das Potential für einen überzeugenden Brückenschlag von Kronfeld zur Psychiatrie des 21. Jahrhunderts besitzen. Aus ähnlichen Gründen und mit Blick auf die Lesbarkeit des Textes beschränken sich die Literaturangaben auf das für die Plausibilität und wissenschaftliche Zuordnung der jeweiligen Argumentation zwingend erforderliche Maß.
Mit Arthur Kronfeld verbindet mich die Überzeugung, dass bei der Entwicklung medizinischer Theorien stets auch deren Chancen und Risiken in der späteren praktischen Umsetzung zu bedenken sind. »Theorie ist Praxis«: Dies mag eine sehr plakative Aussage sein, ganz falsch ist sie nicht. Um eine enge Verflechtung der theoretischen mit der praktischen Ebene zu erreichen, finden sich zwischen den Kapiteln Vignetten, in denen konkrete Herausforderungen des psychiatrisch-psychotherapeutischen Alltags geschildert werden4. Ganz bewusst heißen sie nicht »Fallgeschichten«, sondern »Lebenswelten«5, denn nicht medizinische Dokumentation und Diagnostik sind hier das Ziel (»Ein Fall von ...«), sondern das plastische Hervortreten ebenso typischer wie anspruchsvoller Entscheidungssituationen, die psychiatrisches Arbeiten mit sich bringt. Zwei dieser »Lebenswelten« haben einen speziellen Charakter, da sie die Gestalt fiktiver Streitgespräche über zentrale Themen der Psychiatrie annehmen.6
Der Kapitelabfolge liegt die folgende Struktur zugrunde: Nach einer biographischen Skizze (▸ Kap. 2) wird die psychiatrische Theorienlandschaft dargestellt, die Kronfeld während seines Studiums und in den Assistenzarztjahren antraf (▸ Kap. 3). Dabei kommt deren breiteres, also nicht nur psychiatriebezogenes ideengeschichtliches Umfeld zur Sprache – ein Aspekt, auf den Kronfeld selbst stets besonderen Wert legte. Dem Versuch, die treibenden Motive »hinter« Kronfelds Lebensthema, der Identität der Psychiatrie, herauszuschälen (▸ Kap. 4), folgt die detaillierte, nahe an seinen Texten gehaltene Erarbeitung dreier für Kronfeld zentraler Themen: Die Eigenständigkeit der Psychiatrie – er sprach von ihrer »Autologie« – (▸ Kap. 5), eine personzentrierte Psychotherapie als Grundhaltung und genuiner Bestandteil der Psychiatrie (▸ Kap. 6) sowie sein noch vor der Emigration vorgestelltes, ebenso eigenwilliges wie komplexes Schizophreniekonzept (▸ Kap. 7). Es folgt ein kritisches Résumé von Kronfelds Verständnis der Psychiatrie und der Psychologie als konsequent wissenschaftliche, zugleich jedoch der einzelnen gesunden oder erkrankten Person verpflichtete Fächer (▸ Kap. 8).
Der Brückenschlag zwischen Arthur Kronfelds Denkwelt und den grundsätzlichen Fragen, mit denen sich die heutige Psychiatrie konfrontiert sieht, ist Gegenstand des darauffolgenden Kapitels (▸ Kap. 9). Um im Bild zu bleiben, wird dies anhand von sieben inhaltlichen »Pfeilern« illustriert, auf denen diese »Brücke« ruht. Eine persönliche Reflexion vor dem Hintergrund nicht nur der psychiatrischen Ideengeschichte, sondern auch der eigenen, 40-jährigen Erfahrung in der institutionellen Psychiatrie, schließt das Buch ab (▸ Kap. 10).
Endnoten
1Die medizinische Fachdisziplin sowie der dazugehörige Facharzttitel FMH heißen »Psychiatrie und Psychotherapie«. Aus Gründen der Flüssigkeit des Textes werde ich jedoch zumeist nur von »Psychiatrie« sprechen. Dass »Psychotherapie« stets inkludiert ist, weil es eine ernst zu nehmende Psychiatrie ohne Psychotherapie gar nicht geben kann, ist selbstverständlich. Dies war, wie zu zeigen sein wird, auch eine Grundüberzeugung Arthur Kronfelds.
2Die in diesem Buch angezielte »Identität« der Psychiatrie gründet auf deren Verständnis als personzentrierte und mehrdimensionale wissenschaftliche Disziplin. Der Begriff Identität hat hier also die genau entgegengesetzte Konnotation wie in manchen gegenwärtigen politischen Diskursen, in denen er für plumpe Ausgrenzung und Intoleranz steht.
3So der Titel seines Werkes von 1920, das im Folgenden in den Kapiteln 4, 5 und 8 detailliert zur Sprache kommen wird.
4Alle Vignetten beruhen auf realen Situationen, die mir in der therapeutischen Arbeit der letzten Jahre begegneten. Selbstverständlich wurde der jeweilige Kontext so verfremdet, dass ein Rückschluss auf einzelne Personen ausgeschlossen ist.
5Dieser heute unübliche Begriff darf auch als Reverenz vor Edmund Husserl verstanden werden. Er sprach zwar nicht als Erster von »Lebenswelt«, wies diesem Begriff aber eine zentrale Position in seinem Denken zu. Husserls Bedeutung für eine phänomenologisch orientierte Psychiatrie – und damit für Arthur Kronfeld – kommt in Kapitel 3 zur Sprache.
6Die beiden fiktiven Streitgespräche wurden bereits zu früheren Zeitpunkten, 2013 bzw. 2016, veröffentlicht (Details siehe ▸ Kap. Lebenswelt 3 und ▸ Kap. Lebenswelt 7).
Lebenswelt 1 – Aaron B. und die Vertrauenskrise: Warum psychotherapeutische Interventionen schmerzhaft sein können – für Patient/in und Therapeut/in
Aaron B., ein 54-jähriger, erfolgreicher Unternehmer, und Dr. T., der Psychiater, kannten sich seit 17 Jahren. Sie respektierten einander, und auf eine bestimmte Art mochten sie sich. Was beide verband, war – wenn auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln – das Wissen um die tiefen Spuren, die eine bipolare Störung7 im Leben eines Menschen hinterlassen kann und in Aaron B.s Leben hinterlassen hat.
Als er den Patienten kennenlernte, war Dr. T. ein kurz vor dem Facharztexamen stehender Assistenzarzt in der psychiatrischen Klinik, in die Aaron B. wegen einer schweren manischen Phase gegen seinen Willen mittels einer »fürsorgerischen Unterbringung« (FU)8 eingewiesen worden war. Vorausgegangen war eine notfallmäßige Intervention der Familie beim Hausarzt. Dieser suchte daraufhin den Patienten persönlich auf und gelangte zu der Überzeugung, eine stationäre Behandlung sei unausweichlich. Nachdem der Patient dies aber kategorisch abgelehnt hatte, ordnete der Hausarzt eine fürsorgerische Unterbringung an9. Aaron B. ließ sogar zu, dass dieser ihn selbst in die Klinik begleitete. Jedoch geschah dies unter speziellen Umständen: Angespannt und laut schimpfend, betonte er während der Fahrt immer wieder, er gehe nur mit, um einen Polizeieinsatz zu verhindern. Dies sei aber eindeutig eine Einweisung unter Zwang, »unter illegaler Gewaltanwendung«, wie er sich ausdrückte.
Die stationäre Behandlung hatte acht Wochen in Anspruch genommen. Da zwischen Aaron B. und Dr. T. trotz der schwierigen Zuweisungssituation ein tragfähiges Vertrauensverhältnis entstanden war, konnte die unfreiwillige Unterbringung bereits nach einer knappen Woche durch die Klinik aufgehoben werden. Der Patient erklärte sich zu einer freiwilligen stationären Weiterbehandlung bereit und hielt sich an diese Vereinbarung. Als sich die Entlassung abzeichnete, fragte er den Therapeuten, ob dieser die ambulante Weiterbetreuung in der Klinikambulanz übernehmen könne. So geschah es: Nahezu zwei Jahre lang suchte der Patient regelmäßig den ihm bekannten Therapeuten in der Klinik auf. Als ihm Dr. T. mitteilte, dass er, inzwischen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, in Kürze eine Praxis in derselben Stadt eröffnen werde, bat Aaron B. darum, in diese Praxis wechseln zu können, was Dr. T. sofort zusagte.
Der weitere Krankheitsverlauf gestaltete sich schwierig: In den folgenden 15 Jahren kam es zu sieben schweren manischen Phasen, die jeweils eine erneute stationäre Behandlung erforderlich machten, einmal wieder mittels fürsorgerischer Unterbringung. Die meisten dieser Phasen waren nach acht bis zwölf Wochen fast nahtlos übergegangen in eine resignativ-traurige Verstimmung mit Insuffizienzgefühlen, Ängsten und Selbstvorwürfen. Jedoch hatte keine dieser depressiven Phasen auch nur annähernd die Intensität der ihr jeweils vorausgehenden manischen Episoden.
Der Patient war über all diese Jahre in eine stabile familiäre und soziale Struktur eingebettet: Das von den Eltern ererbte, florierende Möbelgeschäft führte er erfolgreich weiter und baute es aus. Gemeinsam mit seiner Frau, mit der er fast 30 Jahre verheiratet war, hatte er drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, mittlerweile alle erwachsen. Die Familie bekannte sich stets zu dem vom Patienten geleiteten Unternehmen; die Ehefrau bekleidete eine Leitungsfunktion im administrativen Bereich, und die Tochter arbeitete darauf hin, nach dem Abschluss ihres Studiums der Betriebswirtschaft in die Firma einzusteigen, um später die Leitung von ihrem Vater zu übernehmen.
Dieser tragfähige soziale Rahmen hatte entscheidend dazu beigetragen, dass die direkten und indirekten Folgen der Erkrankung im persönlichen Umfeld der Familie wie in der Firma so aufzufangen waren, dass kein nachhaltiger Schaden entstand. Natürlich hatte es während der manischen Phasen heftige Konflikte gegeben, da der Patient hochfliegende, aber völlig unrealistische und daher für das Unternehmen sehr riskante Pläne entwickelte: Ganz im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten tätigte er ohne jede Absprache große Investitionen und zeigte sich gegenüber Argumenten, die nicht auf seiner Linie lagen, uneinsichtig, abweisend und mitunter verbal aggressiv. Die Ehefrau, die nach der ersten schweren Manie ihres Mannes tief verunsichert war und nach der zweiten Episode kurz mit dem Gedanken spielte, sich trotz der damals noch schulpflichtigen Kinder von ihm zu trennen, entschied sich schließlich anders: Sie begann, sich eingehend über die bipolare Erkrankung zu informieren, besuchte Selbsthilfegruppen für Angehörige und organisierte später selbst eine solche Gruppe in ihren Privaträumen.
Trotz der langjährigen, von wechselseitigem Vertrauen geprägten therapeutischen Beziehung gab es einen Punkt, bei dem eine markante Dissonanz zwischen den Auffassungen des Patienten und seines Therapeuten hartnäckig bestehen blieb: Die Einschätzung der, auf die ganze Lebenszeit bezogen, zahlreichen manischen und depressiven Phasen als Ausdruck einer psychischen Erkrankung, einer bipolaren Störung, lehnte der Patient auch nach vielen Jahren rundweg ab. Zwar akzeptierte er die regelmäßigen Termine bei Dr. T. ebenso wie die seit Jahren etablierte medikamentöse Vorbeugung mit einem Lithiumsalz und hielt sich streng an die Vorgaben für die erforderlichen Bestimmungen des Blutspiegels. Dennoch gab es so gut wie keine Therapiestunde, in der der Patient nicht mehr oder weniger deutlich sein Missfallen darüber zum Ausdruck brachte, dass seine, wie er es ausdrückte, »starken Stimmungsschwankungen« als Ausdruck einer Erkrankung aufgefasst würden. Er sei nicht krank. Er habe Hochs und Tiefs wie alle Menschen, es gehe mal aufwärts, mal abwärts. Aber schließlich sei er doch ein erfolgreicher Unternehmer, in der Branche anerkannt und von seiner Familie akzeptiert. Das passe doch überhaupt nicht zum Vorliegen einer schweren psychischen Erkrankung.
Besonders ambivalent äußerte er sich zur Psychiatrie: Er sehe die Bemühungen der Klinik und vor allem des ambulanten Behandlers, ihm zu helfen, und schätze dies sehr wohl. Die Machtfülle jedoch, die die Gesellschaft den psychiatrischen Fachpersonen zugestehe, sei völlig unangemessen, vor allem wenn es um die Verwendung diagnostischer Begriffe, den Einsatz therapeutischer Maßnahmen und deren Erzwingung gegen den Willen der betroffenen Person gehe, um medizinische Zwangsmaßnahmen also. Er halte diese Praxis für unverantwortlich, denn sie verletze Menschenrechte.
Mehrfach hatte Aaron B. nach Abklingen der manischen Phase sämtliche Dokumente der Klinik zur Einsicht verlangt und erhalten. Dies führte meist zu einem umfangreichen Schriftwechsel und zu Anträgen des Patienten, die eigene, in zahlreichen Punkten von der Patientenakte abweichende Darstellung nachträglich in die – er schrieb dieses Wort konsequent in Anführungszeichen – »Krankengeschichte« aufzunehmen, was auch jeweils so geschah. Abgesehen von seiner festen Überzeugung, bei der Einstufung der bei ihm auftretenden Stimmungsschwankungen als »bipolare Störung« handele es sich um eine Fehldiagnose, befürchtete der Patient, durch diese diagnostische Etikettierung, sollte sie je in seinem beruflichen Umfeld bekannt werden, könne die Firma erheblichen Schaden nehmen. Damit aber stehe nicht nur seine eigene Existenz, sondern auch diejenige der Tochter auf dem Spiel. »Das können Sie doch nicht wollen, Herr Dr. T.!« – so ein nicht nur einmal geäußerter Satz des Patienten. Mitunter folgte in gereiztem Ton die Aufforderung an den Therapeuten, alles zu tun, damit ihm die Behandlung der angeblichen Krankheit nicht bedeutend mehr schade als nutze.
Die letzte manische Phase, die inmitten der Coronapandemie schleichend begonnen und sich innerhalb weniger Wochen zum Vollbild eines manischen Syndroms ausgeweitet hatte, stand unter einem besonders ungünstigen Stern: Aaron B. hatte in der Frühphase der Erkrankung ein kleineres Möbelhaus übernommen, ohne dies im Vorfeld mit dem Treuhänder, seiner Frau oder der designierten Nachfolgerin, seiner Tochter, abzusprechen. Alle stellte er triumphierend vor vollendete Tatsachen, was zunächst Konsternation, dann Entrüstung hervorrief. Sofort äußerten Ehefrau und Tochter Aaron B. gegenüber den Verdacht, er sei erneut auf dem Weg in eine Manie: Er sei gesprächiger, ungeduldiger, gereizt, schlafe wenig und neige, in markantem Kontrast zu seinem üblichen unternehmerischen Verhalten, zu erratischen und riskanten Entscheidungen. Der Patient ließ dies in keiner Weise gelten, beschwerte sich lautstark über die Einengung seines Handlungsspielraums, fühlte sich missverstanden und, wie er immer wieder sagte, »in die psychiatrische Ecke gedrängt«.
In der Folgezeit wurde das manische Syndrom immer ausgeprägter. Hektik, Gereiztheit, reduzierte Kommunikation und – in dieser Situation kaum verwunderlich – Misstrauen begannen, das familiäre Klima zu prägen. Die beiden Söhne hatten sich ohnehin schon von der Familie entfernt und mieden nun erst recht den Kontakt, was den Patienten kränkte und bei der Ehefrau sowie der Tochter das Gefühl zunehmender Hilflosigkeit verstärkte. An einem Wochenende eskalierte die Lage: Es kam zu lautstarken verbalen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf der Patient wutentbrannt das Haus verließ und mit seinem Auto zu einem Freund fuhr. Dieser Freund, so seine in Richtung der Ehefrau mehr geschrienen als gerufenen Abschiedsworte, »akzeptiert mich wenigstens, wie ich bin, und erklärt mich nicht einfach für verrückt – so wie Ihr!«
Der Freund, der Aaron B. zwar lange kannte, aber noch nie unmittelbar in einem solchen Zustand erlebt hatte, war völlig überrumpelt. Er wusste allerdings von der laufenden Behandlung bei Dr. T. und konnte den Patienten mit großer Mühe dazu bewegen, sich umgehend bei diesem vorzustellen. Dies geschah noch am selben Abend.
Die Sprechstundentermine hatte Aaron B. in den letzten Wochen, für ihn untypisch, nur unregelmäßig wahrgenommen. Dr. T. war die Verschlechterung des Zustandsbildes bewusst, war er doch von der Familie über die zunehmenden häuslichen Spannungen informiert worden. Das notfallmäßige Gespräch, zu dem der Freund den Patienten an diesem Abend in die Praxis von Dr. T. gefahren hatte, verlief, wie erwartet, schwierig: Dr. T. sei, so der Patient, kaum war er mit seinem Therapeuten allein im Sprechzimmer, »von der Familie manipuliert«, denn offenkundig zähle für ihn das Wort der Angehörigen mehr als dasjenige des eigenen, ihm seit Jahren gut bekannten Patienten. Aaron B. berichtete über zunehmendes Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Er wisse nicht mehr, wem er überhaupt noch vertrauen könne. Auch bezüglich seines Therapeuten sei er da keineswegs sicher.
Dr. T. kam auf einen Vorschlag zurück, den er in den vergangenen Therapiestunden bereits gemacht hatte: Aaron B. solle mit Blick auf seine zunehmende Unruhe und Getriebenheit zusätzlich zu der Lithiumprophylaxe ein Neuroleptikum einnehmen. Dies wies der Patient erneut kategorisch von sich mit der Bemerkung, es müsse wohl genügen, dass er seit Jahren zuverlässig Lithium einnehme, da brauche es definitiv kein zweites Medikament. Er geriet durch dieses Thema derart in Rage, dass er – überraschend aus Sicht von Dr. T., obwohl dieser den Patienten auch in manischen Zuständen kannte – abrupt aufstand, schimpfte und wild gestikulierend die Praxis verließ.
Er musste direkt nach Hause gefahren sein, denn Ehefrau und Tochter informierten Dr. T. sofort darüber, dass der Patient in seinem erregt-misstrauischen Zustand einerseits bedrohlich wirkte, sie sich andererseits wegen seiner trotz verbaler Aggressivität erkennbaren Hilfsbedürftigkeit große Sorgen um ihn machten. Dies gehe bis zu der Befürchtung, er könne sich etwas antun. Schließlich wurde der diensthabende Notfallpsychiater verständigt, der den Patienten noch in derselben Nacht zu Hause aufsuchte, untersuchte und mittels fürsorgerischer Unterbringung in die psychiatrische Klinik einwies. Seine Diagnose lautete »schwere manische Episode mit psychotischen Merkmalen bei bekannter bipolarer Störung«.
Dr. T. blieb während der achtwöchigen stationären Therapie mit Aaron B. telefonisch in Kontakt. Am Austrittstag war dessen Zustand deutlich verbessert, aber noch nicht ganz stabilisiert: Es bestand weiterhin eine leichte Beschleunigung im Denken sowie eine affektive Labilität mit gelegentlicher Gereiztheit. Jedoch war der Patient wieder dialogfähig und akzeptierte, ja wünschte ausdrücklich die ambulante Weiterbehandlung bei Dr. T. Auch erklärte er sich bereit, die von der Klinik verordneten Psychopharmaka regelmäßig einzunehmen.
Für den ersten Termin mit Aaron B. nach seinem Klinikaustritt nahm sich Dr. T. bewusst viel Zeit. Gleichwohl kam es zu einer heiklen Situation, zu einer eigentlichen Vertrauenskrise, die die über Jahre gewachsene und – allen Krisen zum Trotz – stabile therapeutische Beziehung erstmals auf eine wirkliche Belastungsprobe stellte. Dies war der entscheidende Teil des Dialoges:
Dr. T.»Herr B., mir ist nur zu bewusst, dass Sie mit der Einschätzung der Klinik und Ihrer Familie bezüglich Ihres Zustandes in den letzten Wochen ganz und gar nicht einverstanden sind. Lassen Sie uns dennoch nach vorne schauen und planen, wie es nun weiter gehen kann.«
Aaron B.»So einfach geht das nicht! Ich habe Ihnen in all den Jahren vertraut, und irgendwie tue ich das immer noch, aber ich habe ernsthafte Zweifel. Die erneute Einweisung hat mich an den Rand des Ruins gebracht, geschäftlich, meine ich; aber auch familiär ist es sehr schwierig geworden. All dies geschieht nur, weil meine Familie, die Klinik, aber eben auch Sie mir eine psychiatrische Erkrankung andichten und aufzwingen wollen, die ich weder hatte noch habe. Trotzdem möchte ich eigentlich weiter mit Ihnen zusammenarbeiten, denn sie kennen mich gut und haben mir in manchen Krisen sehr geholfen.«(denkt kurz nach, der Tonfall nun erkennbar schroffer)»Ich muss Sie aber nach dieser erneuten schrecklichen Erfahrung einer Zwangseinweisung auffordern, sich definitiv von der Fehldiagnose einer bipolaren Störung zu distanzieren. Sonst kann ich leider die Behandlung bei Ihnen nicht fortsetzen, weil ich Ihnen dann nicht mehr vertrauen kann!«
Dr. T.(wirkt überrascht und betroffen)»Herr B., meine Rolle als Therapeut erfordert Offenheit. Dies gilt auch dann, wenn wir nicht einer Meinung sind. Anlügen werde ich Sie nicht. Nach allem, was in den vergangenen 17 Jahren passiert ist, muss ich sagen, dass die bei Ihnen gestellte Diagnose einer bipolaren Erkrankung korrekt ist.«
Aaron B.(angespannt, setzt zum Protest an)»... aber ...«
Dr. T.(unterbricht ihn)»... bitte lassen Sie mich den Gedanken beenden. Aus meiner Sicht haben sie diese Erkrankung, leider. Aber, Herr B., Sie sind nicht diese Erkrankung! Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen, Wege zu finden, die mit Ihrem Selbstbild und mit Ihrer Lebensplanung vereinbar sind. Genau das sollten wir gemeinsam angehen.«
Aaron B.(bleibt angespannt)»Ich sehe das anders. Ich schätze es zwar, dass Sie ehrlich zu mir sein wollen, aber Sie sind nun einmal im Irrtum. Ohne es zu wollen, schaden Sie mir. Wegen einer sogenannten Diagnose nehmen Sie in Kauf, mich in den Ruin zu treiben. Sie müssen sich mit mir gemeinsam entschieden gegen diese Fehldiagnose wehren, und zwar sofort!«
Dr. T.(zögert)»Lassen Sie uns ...«
Aaron B.(eher ernst als wütend)»Herr Dr. T., ich denke nicht, dass sich mein Vertrauen zu Ihnen wiederherstellen lässt ...«
Eine schwierige Situation: Hier der Patient, der einen schwerwiegenden Vertrauensverlust beklagt und dies dem Therapeuten anlastet, dort der Therapeut im Dilemma, entweder seinem Patienten gegenüber ehrlich zu sein und einen Therapieabbruch zu riskieren oder mit seiner Überzeugung hinter dem Berg zu halten, zu beschönigen, damit aber den Anspruch, stets ein authentisches Gegenüber zu sein, zumindest temporär aufzugeben. Bemerkenswerterweise haben dabei beide Beteiligten, unabhängig von dem konkreten Konflikt, dasselbe Ziel, nämlich die bewährte Arbeitsbeziehung fortzusetzen.
Dr. T. entschied sich für die erstgenannte Option. Er vertrat weiterhin seinen Standpunkt, zwar nicht konfrontativ, aber klar, und nahm mögliche Folgen in Kauf. Aaron B. wiederum brach die therapeutische Beziehung nicht ab. Jedoch standen die folgenden Therapiestunden fast vollständig im Zeichen eines zähen Ringens um den Wiederaufbau von Vertrauen. Die Einbeziehung der Familie lehnte der Patient vorerst ab. Er müsse erst »ins Reine kommen« mit dem Therapeuten und sich selbst. Erfreulicherweise klang das manische Syndrom in den Folgewochen weitgehend ab, ohne dass sich eine depressive Verstimmung einstellte. Aaron B. und Dr. T. gewannen den Eindruck, die Spitze der Vertrauenskrise sei gebrochen. Spuren hatte sie gleichwohl bei beiden hinterlassen, deutliche Spuren sogar: Die therapeutische Beziehung war für mehrere Monate anders als zuvor, fragiler, mit leisen Zweifeln unterlegt, mitunter angespannt.
Meine persönliche Quintessenz
Kern psychiatrischer und psychotherapeutischer Arbeit ist der Dialog. Damit ist weit mehr gemeint als der verbale Austausch. Vielmehr geht es um die dialogisch verfasste therapeutische Beziehung in ihrer ganzen Breite, was neben dem Gesprächsinhalt selbst auch den gegenseitigen Respekt, den körperlichen Ausdruck, etwa Mimik und Stimmmodulation, sowie das Interaktionsverhalten umfasst. Freilich ist auch eine noch so gute therapeutische Beziehung nie Selbstzweck. Sie dient einzig dem Ziel, Befinden und Lebensqualität der betroffenen Person zu verbessern. Dies ist das eigentliche Handwerk der Psychiatrie, und es ist ein anspruchsvolles Handwerk: Da es um persönliche Veränderung geht, bleiben kritische Situationen nicht aus. Deren Spektrum ist weit und reicht von der bloßen Meinungsverschiedenheit über grundsätzliche Divergenzen und, wie bei Aaron B., veritable Vertrauenskrisen bis hin zum Abbruch der Behandlung.
Das therapeutische Arbeitsbündnis muss Freiräume dafür schaffen, dass solch heikle Momente erkannt, benannt und konstruktiv bearbeitet werden können – eine beachtliche Herausforderung, die auch einmal schmerzhaft sein kann, notabene für beide Beteiligten.
Endnoten
7Eine frühere Bezeichnung war »manisch-depressive Erkrankung«.
8Das Schweizerische Zivilgesetzbuch regelt die fürsorgerische Unterbringung in den Artikeln 426 – 439.
9In einigen Schweizer Kantonen, etwa in Zürich, können alle Ärztinnen und Ärzte, die über eine kantonale Praxisbewilligung verfügen – unabhängig also von ihrer Fachrichtung – eine »fürsorgerische Unterbringung« anordnen, die im Falle einer eskalierenden Situation von der Polizei vollzogen werden muss. Selbstverständlich stehen der betroffenen Person Rechtsmittel zur Überprüfung des Entscheides zu, was aber den eigentlichen Akt der Klinikeinweisung nicht verhindern kann. Dazu entwickelte sich in den letzten Jahren eine kontroverse Diskussion (Hoff 2019).
2 Biographische Skizze
Arthur Kronfelds Denkweg steht im Mittelpunkt dieses Buches, nicht seine Biographie. Dennoch ist eine skizzenhafte Annäherung an die wesentlichen Stationen seines Lebens für ein vertieftes Verständnis seines Werkes sinnvoll. Um nicht nur Daten und Fakten aufzuzählen, sondern der Darstellung eine persönliche Färbung zu geben, greife ich im Folgenden auf autobiographische Texte zurück, die Kronfeld anlässlich seiner drei akademischen Qualifikationsarbeiten verfasste.
Über seine frühen Jahre berichtete er im Kontext seiner medizinischen Dissertation von 1910:
»Als Sohn des Justizrates und königl. Notars Dr. Kronfeld und seiner Gattin geb. Liebmann bin ich am 9. Januar 1886 zu Berlin geboren. Ich bin jüdischer Konfession. Von 1895 – 1904 besuchte ich das Sophiengymnasium zu Berlin und erlangte die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst und das Reifezeugnis. Von 1904 – 1909 studierte ich Medizin an den Universitäten Jena, München, Berlin und Heidelberg, bestand 1906 zu Berlin das Tentamen physicum und 1909 zu Heidelberg die ärztliche Staatsprüfung: Das praktische Jahr der Mediziner absolvierte ich an der Großherzoglich Bad. psychiatrischen Universitätsklinik zu Heidelberg und am Städtischen Krankenhause Moabit zu Berlin. Die ärztliche Approbation wurde mir am 1. Juni 1910 erteilt.« (Kronfeld 191010)
Dort schließt 1912 der entsprechende Text aus der philosophischen Dissertation an:
»Am 1. Juni 1910 als Arzt approbiert, wurde ich Assistent an der Großherzogl. psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg. Zur Zeit genüge ich meiner Militärpflicht als einjährig freiwilliger Arzt.
Mit Philosophie und Psychologie habe ich mich seit Beginn meines Studiums autodidaktisch beschäftigt; mit den experimentell-psychologischen Methoden vornehmlich unter Leitung von Herrn Geheimrat Ziehen, Berlin.
Nächst den Werken Immanuel Kants verdanke ich die Fundierung meiner philosophischen Überzeugung und meines psychologischen Wissens den Werken Jakob Friedrich Fries', in die ich durch Nelson, Göttingen, eingeführt wurde; ferner vor allem denen Nelsons, Brentanos, Husserls, und Messers experimentellen Arbeiten.« (Kronfeld 1912a, S. 487)
1913 zog Arthur Kronfeld nach Berlin. Die Gründe dafür sowie die Ereignisse der Folgejahre, einschließlich der Zeit als Soldat im I. Weltkrieg, schilderte er in den biographischen Angaben, die er gemeinsam mit seinem Habilitationsgesuch bei der Berliner medizinischen Fakultät einreichte:
»Im Oktober 1913, als mein Lehrer und Chef Prof. Nissl an jener Krankheit, die ihn später dahinraffte, zuerst längere Zeit darniederlag, verliess ich auf seinen Rat die psychiatrische Klinik – wie er und ich damals annahmen, nur zeitweilig – um meine psychiatrische Ausbildung weiter zu fördern. Durch seine Empfehlung kam ich zu Geh.Rat. Prof. H. Liepmann, damals noch Privatdozent und Oberarzt an der Berliner Städt. Irrenanstalt11 Dalldorf, die mich ab 1. Dezember 1913 als etatsmässigen Assistenzarzt anstellte. Ich lernte dort diejenigen Gebiete und Forschungsweisen der lokalisierenden Hirnpathologie, die mit der Schule Wernickes und besonders mit dem Namen H. Liepmann's verknüpft sind. Dort war ich bis zum Kriegsausbruch.
Am 2. August 1914 folgte ich meiner Mobilmachungsordre und habe den ganzen Krieg als Oberarzt d. Res. an der Front mitgemacht, bis zu meiner Verwundung im Sommer 1917. Danach bekam ich, als nicht mehr frontdienstfähig, eine Aufgabe in einer Kriegslazarettabteilung, wo ich bis zum Kriegsende war.
... Nach einigen früheren harmlosen Verwundungen, während deren ich meinen Truppenteil nicht verliess, wurde ich Mitte 1917 durch Granatsplitter am Kopf ernster verwundet. Ich erhielt das Eiserne Kreuz I. Klasse und II. Klasse, das Militärverdienstkreuz von Mecklenburg-Schwerin und das Verwundetenabzeichen.
Nach meiner Wiederherstellung wurde ich als Nervenfacharzt zur Errichtung einer Nervenstation bei der Kriegslazarettabteilung 40 B (Freiburg i/Br.) kommandiert, die rasch auf 300 Betten anwuchs. Dort erfreute ich mich der neurologischen und internistischen Belehrung von Exz. Bäumler und Geheimrat de la Camp. Ich erhielt ferner vom Feldflugchef den Auftrag, im Anschluss an die Fliegerprüfungskommission Freiburg ... eine experimentell-psychologische Fliegereignungsprüfung zu konstruieren und durchzuführen. Nach dem von mir eingerichteten Verfahren wurden bis zum Kriegsende über 400 Fliegeraspiranten geprüft; eine Denkschrift hierüber habe ich auf Befehl noch vor Kriegsende dem Feldflugchef unterbreitet.
Nach Kriegsende kehrte ich nach Berlin zurück. Prof. Nissl war inzwischen an die Psychiatrische Forschungsanstalt nach München übergesiedelt, klinische Arbeit bei ihm kam nicht mehr in Frage. Geheimrat Liepmann war Direktor der Städt. Irrenanstalt Herzberge geworden. Dortselbst trat ich am 1. Dezember 1918 wieder in meine etatsmässige Assistentenstelle ein.
Inzwischen hatte ich geheiratet. Die Anstaltswohnung war unzulänglich. Auch hatte sich durch den Krieg und die Nachkriegszeit das Vermögen meiner Eltern verloren; zudem war mein Vater schwer erkrankt und arbeitsunfähig; er starb 1921. So stand ich im Sommer 1919 vor der Notwendigkeit, aus dringenden materiellen Gründen, um für mich und die Meinigen zu sorgen, in die ärztliche Praxis zu gehen. Seit dem übe ich in Berlin neurologische12 Praxis aus. Diese sicherte mich zwar materiell, liess mir aber dabei Zeit, um die wissenschaftlichen Bestrebungen der Vorkriegszeit fortzusetzen. Der grösste Teil meiner wissenschaftlichen Arbeiten wurde erst seit diesem Zeitpunkt veröffentlicht.
Der leitende Gedanke meiner psychiatrischen Arbeiten ist der, die Symptomanalyse mit psychologischen Mitteln zu vertiefen. Ich bin der Überzeugung, dass alsdann die Beziehungen der Symptome, ihrer Genese und Gestalt, zu der psychophysischen Persönlichkeit, der Konstitution und Entwicklung des einzelnen Falles sich deutlicher herausstellen, ebenso aber auch die etwaige direkt nosogene Natur bestimmter abnormer Psychismen sich sicherer begründen lässt. In meiner dem Habilitationsgesuch beigelegten Schrift versuche ich, dies Programm meiner bisherigen Veröffentlichungen methodisch zu begründen.« (Kronfeld 1927a, nachgedruckt in Kronfeld 2017)
Nach dem Krieg war Kronfeld demnach in Berlin geblieben13. Die von ihm erwähnte Eheschließung – der Geburtsname seiner Frau war Lydia Quien – fand am 8. August 1918 statt1415. Das Paar hatte, soweit aus den mir zugänglichen Quellen beurteilbar, keine Kinder.
Kronfeld fand Anschluss an die Arbeitsgruppe um Magnus Hirschfeld (1868 – 1935), dem damals bereits ebenso bekannten wie umstrittenen Begründer der Sexualwissenschaft16. An der Gründungsveranstaltung des gleichnamigen Institutes im Juli 1919 hielt er das Eröffnungsreferat über »Gegenwärtige Probleme und Ziele der Sexuologie« (Kronfeld 1919). Er blieb bis 1926 enger Mitarbeiter des Institutes, wobei er neben allen administrativen und organisatorischen Aufgaben die Gelegenheit nutzte, sich im Rahmen seiner eigenen ärztlich-psychotherapeutischen Tätigkeit einen umfassenden Erfahrungsschatz anzueignen. Dies schlug sich unmittelbar und nachhaltig in den späteren Veröffentlichungen nieder (▸ Kap. 5 und ▸ Kap. 6).
1926 eröffnete Kronfeld am Berliner Tiergarten eine psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis, blieb allerdings der wissenschaftlichen Arbeit treu einschließlich einer regen Publikations- und Vortragstätigkeit. Wie er selbst in obigem Zitat berichtet, gelang es ihm kurz darauf, sich aus der Praxis heraus, also ohne feste institutionelle Anbindung, mit einer Arbeit über »Die Psychologie in der Psychiatrie« bei Karl Bonhoeffer (1868 – 1948), dem damaligen Direktor der Klinik für psychische und Nervenkrankheiten an der Charité17, zu habilitieren (Kronfeld 1927a). Vier Jahre später, 1931, erhielt er die Ernennung zum außerordentlichen, also nicht beamteten Professor.
Kronfeld war Mitorganisator der neu etablierten »Allgemeinen ärztlichen Kongresse für Psychotherapie«. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Gründung der »Allgemeinen ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie«, deren Vorstandsmitglied er wurde. Ab 1930 war er einer der Schriftleiter des auch international angesehenen »Zentralblattes für Psychotherapie«.«. All diese Aktivitäten endeten abrupt, als ihm die Nationalsozialisten am 1. 2. 1935 die Lehrbefugnis und damit die wissenschaftliche Arbeitsgrundlage entzogen18.
In den 1920er-Jahren engagierte sich Kronfeld zunehmend gesundheitspolitisch, etwa als Mitglied des »Vereins sozialistischer Ärzte« (Kittel 1986a, 1989). Dabei lagen ihm die systematische Etablierung und die Zugänglichkeit psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlungsangebote im städtischen Raum besonders am Herzen (Schröder 1986).
Zwei Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten sahen sich Kronfeld und seine Frau gezwungen, ins Exil zu gehen, zunächst in die Schweiz. Dort arbeitete er für etwa ein Jahr im Privatsanatorium Les Rives de Prangins, heute Hôpital psychiatrique de Prangins, zwischen Lausanne und Nyon am Genfersee gelegen. Nachdem ihm von den Schweizer Behörden kein Asylstatus zugesprochen worden war, führte eine weitere Emigrationsetappe das Ehepaar nach Moskau19. Kronfeld erhielt hier eine Forschungsprofessur und setzte seine intensive Publikationstätigkeit fort, notabene in russischer Sprache. Nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion im Herbst 1941 scheinen Arthur Kronfeld und seine Frau zu der Überzeugung gelangt zu sein, dass sie trotz Emigration nicht sicher vor Verfolgung seien. Die resultierende Verzweiflung muss so groß geworden sein, dass beide am 16. Oktober 1941 in Moskau Suizid begingen, indem sie eine hohe Dosis eines Barbiturates einnahmen. Viele Details im Vorfeld dieses tragischen Ereignisses harren allerdings noch der historischen Aufarbeitung.
Auch bezüglich der hier referierten biographischen Daten und Zusammenhänge ist ein Caveat geboten: Von Kronfelds wenigen eigenen Berichten abgesehen, stützen sich diese nämlich ausschließlich auf die Sekundärliteratur. Diese jedoch ist weder umfangreich noch genügt sie, vor allem, was Quellennachweise betrifft, in allen Fällen den zu erwartenden methodischen Ansprüchen. Eine umfassende, auf Recherchen an all seinen Wohn- und Arbeitsorten gestützte wissenschaftliche Biographie Arthur Kronfelds steht aus.
Endnoten
10Eine Seitenzahl kann nicht angegeben werden, da dieser Lebenslauf nur in Sonderdrucken des Artikels, nicht aber in der gebundenen Zeitschrift enthalten ist.
11»Irrenanstalt« war seinerzeit ein etablierter terminus technicus – was selbstverständlich nicht bedeutet, dass ihm nicht auch schon damals ein hohes Stigmatisierungs- und Diskriminierungspotential innewohnte.
12Der zu vermutende Grund, warum Kronfeld an dieser Stelle von »neurologischer« Praxis spricht und nicht auf seine psychiatrisch-psychotherapeutische Tätigkeit im Institut von Magnus Hirschfeld hinweist, wird in Fußnote 16 genannt.
13Ebenso lebhafte wie authentische Einblicke in das intellektuelle, gesellschaftliche und politische Klima Berlins während der Weimarer Republik gewähren, aus je unterschiedlicher Warte, die drei jüngst erschienenen Werke von Hummelt (2022), Jähner (2022) und Wildt (2022).
14Diese Angaben sind der Kopie eines nach dem 1. 2. 1935 entstandenen Dokumentes aus dem deutschen Bundesarchiv in Koblenz mit der Signatur R 21/200 11 entnommen, das mein Kollege Dr. med. Yazan Abu Ghazal mir dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat.
15In diesem Dokument wird Kronfelds Religion, ebenso wie diejenige seiner Frau, als »franz. reformiert« angegeben. Ob er tatsächlich konvertiert ist und, wenn ja, welche Rolle allenfalls aus der politischen Lage ableitbare Gründe für diesen Entschluss spielten, wird die zukünftige Forschung zu klären haben.
16