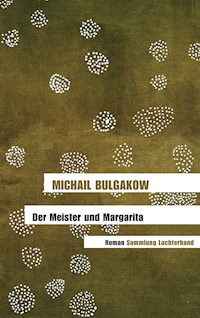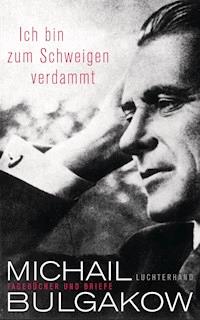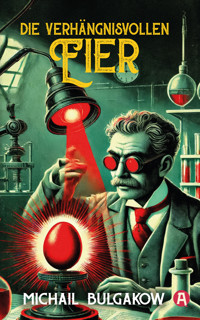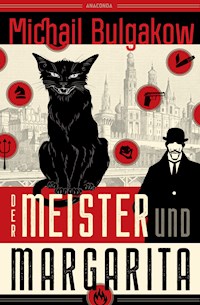5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Autor des Klassikers »Der Meister und Margarita«
Die »Arztgeschichten« gehören zum biographischen Teil des Werks von Michail Bulgakow. Er hat Medizin studiert und war selbst als Landarzt tätig. In den Geschichten schildert er mit großer Genauigkeit und Feinfühligkeit die Situation, in der er sich entscheiden musste, wo seine Berufung liegt: als Arzt in der Auseinandersetzung mit den rauen, teils brutalen Verhältnissen der einfachen Leute? Oder sollte er doch nach Moskau gehen und Schriftsteller werden?
Die Erlebnisse des jungen Mediziners Michail Bulgakow als Landarzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Aufzeichnungen eines jungen Arztes
Das Handtuch mit dem Hahn
Wer noch nie im Pferdewagen öde Feldwege entlanggezockelt ist, dem brauche ich nichts darüber zu erzählen, er begreift es doch nicht. Wer es aber schon erlebt hat, den möchte ich nicht daran erinnern.
Kurz und gut: Für die vierzig Werst, die die Kreisstadt Gratschowka vom Krankenhaus in Murjewo trennen, brauchten der Fuhrmann und ich genau vierundzwanzig Stunden. Kurios genau: Um zwei Uhr nachmittags am 16. September 1917 passierten wir den letzten Kornspeicher am Stadtrand des bemerkenswerten Gratschowka, und um fünf nach zwei am 17. September desselben unvergeßlichen siebzehner Jahres stand ich auf dem vom Septemberregen gepeitschten sterbenden und zerlaugten Gras im Hof des Krankenhauses von Murjewo. Da stand ich und war in folgender Verfassung: die Beine dermaßen steif, daß ich gleich hier im Hof in Gedanken Lehrbücher durchblätterte, stumpf bemüht, mich zu entsinnen, ob tatsächlich eine Krankheit existiert, bei der die menschlichen Muskeln erstarren, oder ob ich das nachts im Dorf Grabilowka nur geträumt hatte. Wie hieß sie auf lateinisch, die verfluchte Krankheit? Jeder Muskel schmerzte unerträglich und erinnerte an Zahnweh. Von den Zehen ganz zu schweigen, sie ließen sich im Stiefel nicht mehr bewegen und lagen reglos wie hölzerne Stummel. Ich gebe zu, in einer Anwandlung von Kleinmut habe ich flüsternd die Medizin verwünscht wie auch die Studienbewerbung, die ich fünf Jahre zuvor beim Rektor der Universität eingereicht hatte. Von oben schüttete es unterdes wie aus einem Sieb. Mein Mantel war vollgesogen wie ein Schwamm. Mit den Fingern der rechten Hand versuchte ich vergeblich, den Koffergriff zu fassen, und spuckte schließlich ins nasse Gras. Meine Finger konnten nichts greifen, und wieder fiel mir, der ich mit allerlei Kenntnissen aus interessanten medizinischen Büchern vollgestopft war, eine Krankheit ein: die Paralyse. Paralysis, sagte ich, weiß der Teufel weshalb, verzweifelt zu mir.
»A-an eure Straßen hier muß man sich erst g-gewöhnen«, sprach ich mit hölzernen blauen Lippen.
Dabei glotzte ich den Fuhrmann böse an, obwohl er eigentlich am Zustand der Straße keine Schuld trug.
»Ach, Genosse Doktor«, antwortete er und konnte die Lippen unter dem blonden Schnurrbärtchen kaum bewegen. »Ich fahr hier schon fünfzehn Jahre und hab mich auch noch nicht daran gewöhnt.«
Ich erschauerte und betrachtete verzagt das zweigeschossige Gebäude mit der abblätternden weißen Farbe, die ungeweißten Balkenwände des Feldscherhäuschens und meine künftige Residenz, ein zweigeschossiges, blitzsauberes Haus mit geheimnisvollen grabesartigen Fenstern, und stieß einen langen Seufzer aus. Sogleich durchzuckte meinen Kopf statt lateinischer Wörter der genießerische Satz, den in meinem von der Kälte und dem Geschaukel benommenen Gehirn ein dicker Tenor mit hellblauen Hüften sang:
Sei mir gegrüßt, ersehntes Obdach …
Leb wohl, leb wohl für lange, goldrotes Bolschoi-Theater, Moskau, Schaufenster … ach, lebt wohl.
Das nächste Mal ziehe ich den Schafpelz an, dachte ich mit wütender Verzweiflung und zerrte steiffingrig an den Kofferriemen. Allerdings ist das nächste Mal schon Oktober, da kann ich gleich zwei Schafpelze anziehen. Und vor einem Monat fahre ich nicht nach Gratschowka. Auf keinen Fall. Überlegen Sie selbst, wir mußten übernachten! Zwanzig Werst hatten wir zurückgelegt und befanden uns in wahrer Grabesfinsternis … Nacht … In Grabilowka mußten wir übernachten … Der Lehrer nahm uns auf …. Heute morgen sind wir um sieben losgefahren … und dann kommt man – du lieber Gott – langsamer als ein Fußgänger vorwärts. Ein Rad kracht in ein Loch, das andere hebt sich in die Luft, der Koffer – rums – auf die Füße … Dann auf die eine Seite, auf die andere, mit der Nase nach vorn, dann mit dem Genick. Und von oben gießt und gießt es, und man friert durch bis auf die Knochen. Hätte ich etwa voraussehen können, daß ein Mensch mitten im grauen und sauren September auf dem Feld frieren kann wie im grimmigsten Winter? Wie sich zeigt, kann er. Und während man eines langsamen Todes stirbt, sieht man immer nur ein und dasselbe. Rechts das bucklige, abgeknabberte Feld, links ein verkümmertes Waldstück, daneben halb zerfallene graue Hütten, fünf oder sechs an der Zahl. Es scheint, als gäbe es keine lebende Seele darin. Schweigen, Schweigen ringsum …
Endlich gab der Koffer nach. Der Fuhrmann beugte sich darüber und schob ihn auf mich zu. Ich wollte ihn am Riemen fassen, doch meine Hand versagte, und mein dickgeschwollener, mir zum Ekel gewordener Weggefährte, vollgestopft mit Büchern und allem möglichen Plunder, plumpste, mir gegen die Beine schlagend, ins Gras.
»Ach, du lie…«, setzte der Fuhrmann erschrocken an, doch ich machte ihm keine Vorwürfe, denn meine Beine taugten ohnehin bloß noch zum Wegschmeißen.
»He, ist da wer? He!« schrie der Fuhrmann und schlug mit den Armen um sich wie ein Hahn mit den Flügeln. »He, ich hab den Doktor hergebracht!«
Da drückten sich Gesichter an die dunklen Fenster des Feldscherhäuschens, eine Tür klappte, dann sah ich einen Mann in zerrissenem Mantel und Stiefeln durchs Gras auf mich zuhumpeln. Respektvoll riß er zwei Schritte vor mir die Schirmmütze vom Kopf, lächelte verschämt und begrüßte mich mit heiserem Stimmchen: »Guten Tag, Genosse Doktor.«
»Wer sind Sie denn?« fragte ich.
»Jegorytsch bin ich«, stellte er sich vor, »der hiesige Wächter. Wir warten ja schon so auf Sie.«
Sogleich ergriff er den Koffer, schulterte ihn und trug ihn weg.
Ich stakste hinter ihm her, erfolglos bemüht, die Hand in die Hosentasche zu schieben, um das Portemonnaie hervorzuholen.
Der Mensch braucht eigentlich sehr wenig. Vor allem braucht er ein wärmendes Feuer. Beim Aufbruch in die Einöde von Murjewo hatte ich mir, das fiel mir jetzt ein, noch in Moskau vorgenommen, mich würdevoll zu geben. Mein jugendliches Aussehen hatte mir schon auf den ersten Schritten das Dasein vergällt. Jedem mußte ich mich vorstellen: »Doktor Soundso.« Und jeder zog unweigerlich die Augenbrauen hoch. »Wirklich? Ich dachte, Sie wären Student.«
»Nein, ich bin schon fertig«, antwortete ich dann mürrisch und dachte: Ich muß mir eine Brille zulegen, jawohl. Aber diese Anschaffung hatte keinen Zweck, denn meine Augen waren gesund und noch nicht von Lebenserfahrung getrübt. Da mich somit keine Brille vor freundlich herablassendem Lächeln schützte, trachtete ich, mir achtunggebietendes Gehaben anzugewöhnen. Ich versuchte, gemessen und gewichtig zu sprechen, hastige Bewegungen nach Möglichkeit zu vermeiden und nicht zu rennen wie ein Dreiundzwanzigjähriger, der die Universität gerade hinter sich hat, sondern zu gehen. Doch wie ich nun nach vielen Jahren weiß, gelang mir das sehr schlecht.
Gerade jetzt brach ich diesen meinen ungeschriebenen Verhaltenskodex. Zusammengekrümmt und in Socken saß ich da, nicht in meinem stillen Kämmerlein, sondern in der Küche, und drängte mich wie ein Feueranbeter hingerissen und leidenschaftlich an die im Herd lodernden Birkenscheite. Links von mir stand mit dem Boden nach oben ein Zuber, darauf lagen meine Schuhe, ein kahlgerupfter Hahn mit blutigem Hals und daneben der Haufen seiner bunten Federn. Ich hatte nämlich noch im Zustand der Erstarrung eine ganze Reihe von Handlungen ausgeführt, die das Leben von mir forderte. Die spitznasige Axinia, Jegorytschs Frau, war von mir in das Amt meiner Köchin eingesetzt worden. Demzufolge war unter ihren Händen der Hahn gestorben. Ich sollte ihn essen. Ich hatte mich mit allen bekannt gemacht. Der Feldscher hieß Demjan Lukitsch, die Hebammen hießen Pelageja Iwanowna und Anna Nikolajewna. Ich hatte einen Rundgang durch das Krankenhaus gemacht und mich restlos davon überzeugt, daß es überaus reich mit Instrumenten versehen war. Genauso restlos überzeugt mußte ich zugeben (natürlich nur im stillen), daß die Bestimmung vieler der jungfräulich glänzenden Instrumente mir gänzlich unbekannt war. Ich hatte sie, ehrlich gesagt, noch nie gesehen, geschweige denn in der Hand gehalten.
»Hm«, brummte ich vielsagend, »Sie haben ja ein hübsches Instrumentarium. Hm …«
»Gewiß doch«, versetzte Demjan Lukitsch behaglich, »alles dank den Bemühungen Ihres Vorgängers Leopold Leopoldowitsch. Er hat ja von früh bis spät operiert.«
Da brach mir kalter Schweiß aus, und ich blickte wehmütig auf die spiegelnden Schränkchen.
Danach gingen wir durch die leeren Krankenzimmer, in denen ohne weiteres vierzig Personen unterzubringen waren.
»Bei Leopold Leopoldowitsch waren es manchmal auch fünfzig«, tröstete mich Demjan Lukitsch, und Anna Nikolajewna, eine Frau mit grauem Haarkranz, fügte zu allem Überfluß hinzu:
»Doktor, Sie sind noch so jung, so jung … Geradezu erstaunlich, wie ein Student sehen Sie aus.«
Ach du Donner, dachte ich, die sind sich ja alle einig, wirklich wahr!
Und trocken knurrte ich durch die Zähne:
»Hm … nein … das heißt, ja, ich bin noch jung …«
Dann stiegen wir hinunter in die Apotheke, und ich sah, hier fehlte allenfalls Vogelmilch. In den beiden ziemlich dunklen Räumen roch es kräftig nach Kräutern, und in den Regalen fand sich alles, was man wollte. Es gab sogar patentierte ausländische Mittel, und ich brauche nicht hinzuzufügen, daß ich noch nie von ihnen gehört hatte.
»Hat alles Leopold Leopoldowitsch bestellt«, berichtete Pelageja Iwanowna stolz.
Dieser Arzt muß ein Genie gewesen sein, dachte ich, durchdrungen von Hochachtung für den geheimnisvollen Leopold, der das stille Murjewo verlassen hatte.
Der Mensch braucht nicht nur wärmendes Feuer, er muß sich auch einleben. Den Hahn hatte ich längst aufgegessen. Jegorytsch hatte mir einen Strohsack gestopft und ein Laken darübergebreitet, und im Arbeitszimmer meiner Residenz brannte die Lampe. Ich saß da und blickte wie verzaubert auf die dritte Errungenschaft des legendären Leopold: den vollgestopften Bücherschrank. Allein über Chirurgie fand ich bei flüchtigem Zählen an die dreißig Bände in russischer und deutscher Sprache. Und über Therapie! Und die fabelhaften Atlanten der Hautkrankheiten!
Der Abend rückte näher, ich lebte mich ein.
Ich bin gänzlich unschuldig, dachte ich immer wieder qualvoll, ich habe ein Diplom, habe fünfzehn Einsen. Ich habe schon in der Hauptstadt zu verstehen gegeben, daß ich als zweiter Arzt gehen möchte. Aber nein. Man hat gelächelt und gesagt: »Leben Sie sich ein.« Nun lebe dich mal ein! Und wenn ein Bruch gebracht wird? Wie soll ich mich mit dem einleben? Und vor allem, wie wird sich der Patient mit dem Bruch unter meinen Händen fühlen? Im Jenseits wird er sich einleben. (Es lief mir kalt den Rücken hinunter.)
Und vereiterte Blinddarmentzündung? Ha! Und Diphtherie bei den Dorfkindern? Und wenn ein Luftröhrenschnitt angezeigt ist? Aber auch ohne Luftröhrenschnitt werde ich mich nicht eben wohl fühlen. Und … und die Geburten? Die habe ich ganz vergessen! Regelwidrige Lagen. Was mach ich dann? Na? So was von Leichtsinn! Ich hätte dieses Revier ablehnen müssen. Unbedingt. Hier hätte ein neuer Leopold hergehört.
In Schwermut und Dämmerlicht durchschritt ich das Zimmer. Wenn ich auf gleicher Höhe mit der Lampe war, sah ich in der grenzenlosen Finsternis der Felder mein bleiches Gesicht neben dem Lampenlicht im Fenster.
Ich bin wie der falsche Demetrius, dachte ich dümmlich und setzte mich wieder an den Tisch.
Zwei Stunden lang quälte ich mich in meiner Einsamkeit, bis meine Nerven die selbst fabrizierten Ängste nicht mehr ertragen konnten. Da beruhigte ich mich langsam und schmiedete sogar Pläne.
So ist das … Die Sprechstunde soll jetzt kaum besucht sein. In den Dörfern wird Flachs gebrochen, die Wege sind unpassierbar. Gerade jetzt werden sie dir einen Bruch bringen, dröhnte eine rauhe Stimme in meinem Gehirn, wegen eines Schnupfens (einer leichten Krankheit) kommt bei dem Schlamm keiner, aber einen Bruch, den schleppen sie an, verlaß dich drauf, lieber Collega Doktor.
Nicht dumm, die Stimme, was? Ich schauderte.
Schweig, fuhr ich die Stimme an, es muß ja nicht gleich ein Bruch sein. Was soll die Neurasthenie? Wer A sagt, muß auch B sagen.
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, antwortete die Stimme boshaft.
So ist das … Das Arzneibuch behalte ich bei mir. Wenn ich was verschreiben muß, kann ich beim Händewaschen nachdenken. Das Buch wird aufgeschlagen neben dem Aufnahmebuch liegen. Ich werde wirksame, doch einfache Medikamente verschreiben. Na, zum Beispiel Natrium salicylicum, 0,5 je Pulver, dreimal täglich …
Dann kannst du auch Soda verschreiben! antwortete mein innerer Gesprächspartner mit unverhohlenem Spott.
Wozu denn Soda? Ich werde auch Ipecacuanha-Aufguß verschreiben, hundertachtzigfach verdünnt. Oder zweihundertfach. Bitte sehr.
Und obwohl in dieser Einsamkeit unter der Lampe kein Mensch Ipecacuanha von mir verlangt hatte, blätterte ich sogleich ängstlich das Arzneibuch durch, sah unter Ipecacuanha nach und las dann mechanisch, daß es auf der Welt »Insipin« gibt. Das sei nichts anderes als »Chinindiglycolsäureester«. Ich erfuhr, daß es nicht nach Chinin schmeckt. Aber wozu dient es? Und wie verschreibt man es? Ist es ein Pulver? Hol’s der Teufel!
Insipin hin, Insipin her, aber was mache ich bei einem Bruch? beharrte die Angst in Gestalt der inneren Stimme.
In die Wanne setzen, verteidigte ich mich wütend. In die Wanne. Und dann den Bruch zurückzudrängen versuchen.
Es ist ein eingeklemmter, mein Lieber! Was zum Teufel soll da ein Wannenbad! Ein eingeklemmter Bruch, sang die Angst mit dämonischer Stimme. Da mußt du schneiden.
Nun gab ich auf und hätte fast geweint. Und ich schickte ein Flehen in die Dunkelheit vor dem Fenster: Alles, bitte nur keinen eingeklemmten Bruch.
Die Müdigkeit sang:
Leg dich schlafen, unglückseliger Äskulap. Schlaf dich aus, am Morgen siehst du weiter. Beruhige dich, junger Neurastheniker. Schau doch, die Dunkelheit vor den Fenstern ist ruhig, die erkaltenden Felder schlafen, es gibt keinen Bruch. Am Morgen siehst du weiter. Lebst dich ein. Schlafe. Lege den Atlas weg. Jetzt kapierst du sowieso kein Jota mehr. Der Bruchhals …
Wie er hereingestürzt war, konnte ich mir nicht einmal vorstellen. Der Türriegel hatte geklirrt und Axinia etwas gepiepst. Und vor dem Fenster war ein Wagen vorübergeknarrt.
Er war ohne Mütze, trug eine offenstehende Pelzjoppe, hatte einen ungepflegten Kinnbart und irr blickende Augen.
Er bekreuzigte sich, fiel auf die Knie und bumste mit der Stirn auf den Fußboden. Das galt mir.
Jetzt ist es aus, dachte ich trübsinnig.
»Nicht doch, nicht doch, nicht doch!« murmelte ich und zog an dem grauen Ärmel.
Sein Gesicht verzerrte sich, und er stammelte, sich verschluckend, als Antwort:
»Herr Doktor … Herr … Die einzige, die einzige … Die einzige!« Er schrie es plötzlich mit jugendlich klangvoller Stimme, so daß der Lampenschirm erzitterte. »Ach, du unser Herrgott … Ach …« Gramvoll rang er die Hände und schlug wieder mit der Stirn gegen die Dielenbretter, als wolle er sie zertrümmern. »Wofür? Wofür die Strafe? Womit haben wir dich erzürnt?«
»Was ist denn passiert?« rief ich und fühlte mein Gesicht kalt werden.
Er sprang auf die Füße, wankte und flüsterte:
»Herr Doktor, was Sie wollen … Ich geb Ihnen Geld … Sie kriegen Geld, soviel Sie wollen. Soviel Sie wollen. Ich bring Ihnen Lebensmittel … Daß sie bloß nicht stirbt. Bloß nicht stirbt. Wenn sie ein Krüppel bleibt, macht nichts. Macht nichts!« schrie er zur Decke hinauf. »Wir füttern sie durch, haben genug.«
Axinias bleiches Gesicht schwebte im schwarzen Türrechteck. Bangigkeit umschlang mein Herz.
»Was ist denn? So reden Sie doch!« schrie ich unbeherrscht.
Er verstummte, dann flüsterte er, als teile er mir ein Geheimnis mit, und seine Augen wurden bodenlos tief dabei:
»Sie ist in die Flachsbreche gekommen …«
»Flachsbreche?« fragte ich zurück. »Was ist das?«
»Flachs, sie haben Flachs gebrochen, Herr Doktor«, erklärte Axinia flüsternd, »die Flachsbreche … Flachs wird damit gebrochen …«
Es geht schon los. Schon. Oh, warum bin ich hergekommen! dachte ich entsetzt.
»Wer denn?«
»Meine Tochter«, antwortete er flüsternd, dann schrie er: »Helfen Sie!« Wieder warf er sich zu Boden, und seine gleichlang geschnittenen Haare fielen ihm über die Augen.
Die Lampe mit dem verbogenen Blechschirm brannte hell. Ich sah das Mädchen auf dem frisch duftenden weißen Wachstuch des Operationstisches liegen und vergaß den Bruch.
Ihr heller, etwas rötlicher Zopf hing verfilzt vom Tisch. Der Zopf war von gigantischer Länge, er reichte bis zum Fußboden. Der Kattunrock war zerfetzt, das Blut darauf von verschiedener Farbe – bräunliche und fettig rote Flecke. Das Licht der Blitzlampe kam mir gelb und lebendig, ihr Gesicht papiern, ihre Nase spitz vor.
Ihr gipsweißes, regloses Gesicht war von wahrhaft seltener Schönheit. Ein solches Antlitz sieht man nicht oft.
Im Operationssaal herrschte wohl zehn Sekunden lang völliges Schweigen, doch durch die geschlossene Tür war zu hören, wie der Bauer immer wieder dumpfe Schreie ausstieß und mit dem Kopf gegen den Fußboden bumste.
Er ist verrückt geworden, dachte ich. Die Schwestern werden ihm schon was eingeben … Wie kommt er zu einer so schönen Tochter? Allerdings hat er regelmäßige Gesichtszüge … Die Mutter muß schön gewesen sein … Er ist wohl Witwer …
»Ist er Witwer?« flüsterte ich mechanisch.
»Ja«, antwortete Pelageja Iwanowna leise.
In diesem Moment zerriß Demjan Lukitsch mit einer jähen, gleichsam wütenden Bewegung ihren Rock vom Saum bis zum Bund. Was ich nun erblickte, übertraf meine Erwartungen. Das linke Bein war eigentlich nicht mehr da. Vom zerschmetterten Knie abwärts nur blutiges Gefetze und zerquetschte rote Muskeln, weiße Knochensplitter starrten spitz nach allen Seiten. Das rechte Bein war im Unterschenkel gebrochen, und zwar so, daß beide Knochenenden durch die Haut spießten. Dadurch lag ihr Fuß leblos, wie abgetrennt und zur Seite gedreht.
»Ja«, sagte der Feldscher leise und fügte nichts mehr hinzu.
Ich löste mich aus meiner Erstarrung und griff nach ihrem Puls. Er war an dem kalten Handgelenk nicht zu tasten. Erst nach einigen Sekunden fand ich das kaum spürbare Pochen. Dann setzte es aus, ich warf einen Blick auf ihre blau werdenden Nasenflügel und die weißen Lippen … und wollte schon sagen: Ex …, doch ich hielt mich glücklicherweise zurück … Wieder das Pochen, dünn wie ein Fädchen.
So also erlischt ein zerfetzter Mensch, dachte ich, da ist nichts mehr zu machen.
Doch plötzlich sagte ich rauh und erkannte meine eigene Stimme nicht:
»Kampfer.«
Da beugte sich Anna Nikolajewna an mein Ohr und raunte:
»Wozu, Doktor? Quälen Sie sie nicht. Wozu jetzt noch spritzen? Gleich bleibt sie weg … Sie können sie nicht retten.«
Wütend und finster drehte ich mich nach ihr um und sagte:
»Ich hatte um Kampfer gebeten.«
So daß Anna Nikolajewna errötend mit beleidigter Miene zum Tischchen eilte und eine Ampulle aufbrach.
Der Feldscher schien den Kampfer auch zu mißbilligen. Nichtsdestoweniger griff er rasch und geschickt nach der Spritze und drückte das gelbe Öl unter die Schulterhaut.
Stirb. Stirb schneller, dachte ich, stirb. Was soll ich sonst mit dir machen?
»Gleich stirbt sie«, flüsterte der Feldscher, als hätte er meine Gedanken erraten. Er schielte nach dem Laken, schien es sich aber anders überlegt zu haben: zu schade, das Laken blutig zu machen.
Doch in wenigen Augenblicken würden wir sie ohnehin zudecken müssen. Sie lag da wie ein Leichnam, aber sie starb nicht.
In meinem Kopf wurde es plötzlich hell, wie unter dem Glasdach unseres fernen Anatomiehörsaals.
»Noch mehr Kampfer«, krächzte ich.
Wieder injizierte der Feldscher gehorsam das Öl.
Am Ende stirbt sie nicht? dachte ich verzweifelt. Am Ende muß ich … Es wurde immer heller in meinem Gehirn, und plötzlich wußte ich ohne alle Lehrbücher, ohne Ratschläge, ohne Hilfe – und die Gewißheit, daß ich es wußte, war fest wie Eisen –, daß ich jetzt gleich zum erstenmal in meinem Leben an einer Sterbenden eine Amputation vornehmen mußte. Sie würde mir unter dem Messer wegbleiben. Ach, sie würde unter dem Messer sterben. Sie hatte doch gar kein Blut mehr! Zehn Werst lang war Blut aus dem zerschmetterten Bein geströmt, und man konnte nicht einmal wissen, ob sie jetzt noch etwas fühlte oder hörte. Sie schwieg. Ach, warum stirbt sie nicht? Was wird mir der verzweifelte Vater sagen?
»Alles fertigmachen zur Amputation«, sagte ich mit fremder Stimme zum Feldscher.
Die Hebamme sah mich mit irrem Blick an, aber der Feldscher hatte ein Fünkchen Mitgefühl in den Augen, hastig legte er die Instrumente zurecht. Unter seinen Händen begann die Spiritusflamme zu summen …
Eine Viertelstunde verging. Mit abergläubischem Entsetzen hob ich das kalte Lid und blickte in das erloschene Auge. Ich kann nichts ausrichten. Wie soll ein halber Leichnam leben? Unaufhaltsam liefen mir salzige Schweißtropfen unter der weißen Kappe hervor über die Stirn, und Pelageja Iwanowna wischte sie mit Mull weg. Mit den Blutresten trieb jetzt auch Coffein durch die Adern des Mädchens. War es notwendig gewesen, dieses zu injizieren, oder nicht? Anna Nikolajewna strich sanft über die kleine Schwellung auf dem Schenkel des Mädchens. Das Mädchen lebte.
Ich nahm das Skalpell und bemühte mich, jemand nachzuahmen (einmal hatte ich auf der Universität eine Amputation gesehen). Jetzt flehte ich das Schicksal an, sie möchte in der nächsten halben Stunde nicht sterben. Soll sie nachher im Bett sterben, wenn ich mit der Operation fertig bin …
Statt meiner arbeitete nun mein gesunder Menschenverstand, angetrieben von der ungewöhnlichen Situation. Geschickt wie ein erfahrener Fleischer zog ich mit dem Skalpell einen Kreisschnitt um den Oberschenkel, die Haut klaffte auseinander, kein Tröpfchen Blut trat aus. Was mache ich, wenn die Gefäße zu bluten anfangen? dachte ich und schielte wie ein Wolf auf den Haufen Gefäßklemmen. Ich durchtrennte ein riesiges Stück Frauenfleisch und ein Gefäß in der Form eines weißlichen Röhrchens, doch noch immer kein Tropfen Blut. Ich klemmte die Ader ab und machte weiter. Überall, wo ich Adern vermutete, setzte ich Klemmen an. Arteria …, arteria …, verdammt, wie heißt sie noch? Der Operationsraum glich dem einer Klinik. In schweren Trauben hingen die Klemmen heraus. Mit Hilfe von Mull wurden sie samt dem Fleisch aufwärts gedrückt, und nun ging ich daran, mit einer spiegelblanken, kleinzähnigen Säge den freigelegten runden Knochen durchzusägen. Daß sie nicht stirbt? Erstaunlich … Oh, wie zählebig ein Mensch doch ist!
Der Knochen fiel ab. In Demjan Lukitschs Händen verblieb, was einmal ein Mädchenbein gewesen. Fleischfetzen und Knochensplitter! All das wurde beiseite geworfen, und nun lag auf dem Operationstisch ein junges Mädchen, gleichsam um ein Drittel verkürzt, mit zur Seite gebogenem Stumpf. Warte noch ein bißchen, stirb nicht, dachte ich flehentlich. Halt aus, bis du im Bett liegst, laß mich wohlbehalten herauskommen aus diesem entsetzlichen Vorfall in meinem Leben.
Die Gefäße wurden abgebunden, dann nähte ich mit großen Stichen die Haut fest … doch ich hielt wieder inne und legte, einer Eingebung folgend, ein Drain, das ich mit einem Mulltupfer verschloß. Der Schweiß floß mir in die Augen, und ich hatte ein Gefühl, als wäre ich im Dampfbad.
Ich verschnaufte. Warf einen schweren Blick auf den Stumpf und das wächserne Gesicht.
»Lebt sie?« fragte ich.
»Sie lebt«, flüsterten der Feldscher und Anna Nikolajewna. »Sie wird schon noch ein Minütchen leben«, raunte mir der Feldscher lautlos, nur mit den Lippen ins Ohr. Dann stockte er und riet mir taktvoll: »Das andere Bein sollten Sie vielleicht so lassen, Doktor. Wissen Sie, wir wickeln Mull herum, sonst schafft sie es nicht bis zum Bett. Was meinen Sie? Immer noch besser, wenn sie nicht auf dem Operationstisch stirbt.«
»Bringt Gips«, antwortete ich heiser, von einer unbekannten Kraft gedrängt.
Der ganze Fußboden war weiß bekleckert, wir alle schwitzten. Das halbtote Mädchen lag reglos. Das rechte Bein war eingegipst, und an der Bruchstelle des Unterschenkels klaffte ein Fensterchen, das ich in einer Eingebung offengelassen hatte.
»Sie lebt«, krächzte der Feldscher verwundert.
Nun wurde sie aufgehoben, unter dem Laken zeichnete sich eine gigantische Einbuchtung ab – ein Drittel ihres Körpers blieb im Operationssaal zurück.
Schatten bewegten sich im Korridor, die Nachtschwestern huschten hin und her, und ich sah eine zerzauste Männergestalt unter trockenem Geheul die Wand entlangschleichen. Sie brachten den Mann hinaus. Es wurde still.
Ich wusch mir im Operationssaal die bis zum Ellbogen blutigen Arme.
»Doktor, Sie haben wohl schon viele Amputationen gemacht?« fragte plötzlich Anna Nikolajewna. »Sehr, sehr gut. Nicht schlechter als Leopold …«
Aus ihrem Mund klang das Wort »Leopold« immer wie »großer Meister«.
Unter gesenkten Brauen hervor blickte ich in die Gesichter. Sowohl in Demjan Lukitschs als auch in Pelageja Iwanownas Augen sah ich Respekt und Verwunderung.
»Hm … ich … Sehen Sie, erst zwei …«
Warum habe ich gelogen? Das ist mir heute unbegreiflich. Das Krankenhaus wurde still. Ganz still.
»Wenn sie stirbt, holt ihr mich sofort«, befahl ich halblaut dem Feldscher, und er antwortete nicht »gut«, sondern respektvoll: »Zu Befehl.«
Ein paar Minuten darauf saß ich neben der grünen Lampe im Arbeitszimmer der Arztwohnung. Das Haus schwieg.
Mein bleiches Gesicht spiegelte sich im tiefschwarzen Fensterglas. Nein, ich bin kein falscher Demetrius, und sehen Sie, ich bin irgendwie gealtert. Die Falte über der Nasenwurzel … Gleich wird man klopfen und sagen: Sie ist tot …
Ja, ich gehe hin und sehe sie mir noch einmal an … Gleich klopft es …
Es klopfte. Zweieinhalb Monate später. Draußen glänzte einer der ersten Wintertage.
Er trat ein.
Erst jetzt sah ich ihn mir genauer an. Ja, er hatte wirklich regelmäßige Gesichtszüge. War etwa fünfundvierzig Jahre alt. Die Augen strahlten.
Dann raschelte es … auf zwei Krücken humpelte ein einbeiniges junges Mädchen von bezaubernder Schönheit herein, sie trug einen weiten Rock mit rotem Bortensaum.
Sie blickte mich an, ein rosiger Hauch stieg ihr in die Wangen.
»In Moskau … in Moskau …« Ich schrieb die Adresse auf. »Dort macht man Ihnen eine Prothese, ein künstliches Bein.«
»Küsse ihm die Hand«, sagte plötzlich der Vater.
Ich war so verwirrt, daß ich ihr statt der Lippen die Nase küßte.
Sodann band sie, an den Krücken hängend, ein Bündel auf, und heraus fiel ein langes schneeweißes Handtuch mit einem kunstlos eingestickten roten Hahn. Dies also hatte sie bei den Visiten unterm Kissen versteckt. Richtig, ich erinnere mich, auf dem Nachttisch lagen Fäden.
Die stählerne Kehle
Nun war ich also allein. Rings um mich Novemberfinsternis mit stöberndem Schnee, das Haus verweht, in den Schornsteinen heulte es. Die vierundzwanzig Jahre meines Lebens hatte ich in einer riesigen Stadt verbracht, und ich hatte geglaubt, der Schneesturm heule nur in Romanen. Jetzt stellte sich heraus, er heulte tatsächlich. Die Abende hier waren ungewöhnlich lang, die Lampe mit dem blauen Schirm spiegelte sich im schwarzen Fenster, und ich starrte träumend auf den Lichtfleck zu meiner Linken. Ich träumte von der Kreisstadt, vierzig Werst von mir entfernt gelegen. Am liebsten wäre ich von meinem Revier dorthin geflüchtet. Dort gab es Elektrizität, dort waren vier Ärzte, mit denen man sich beraten konnte, auf jeden Fall war es nicht so beängstigend. Aber die Flucht war ganz unmöglich, und zuzeiten begriff ich selber, daß dies Kleinmut war. Weshalb hatte ich denn an der medizinischen Fakultät studiert?