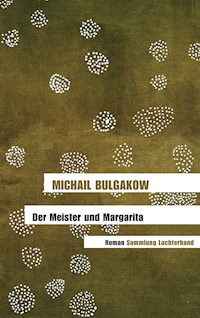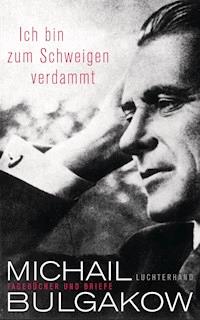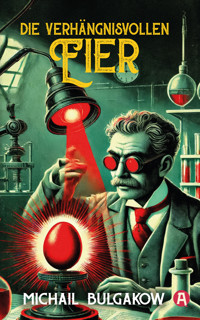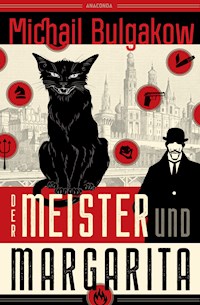4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aionas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Arzt. Eine abgelegene Provinz. Medizin zwischen Leben und Tod.
Frisch von der Uni, voller Theorie, aber ohne Erfahrung – so landet ein junger Arzt in einem einsamen russischen Dorf, umgeben von Schnee, Dunkelheit und Patienten, die ihm alles abverlangen. Mit skalpellgenauer Präzision schildert Michail Bulgakow die Herausforderungen, Zweifel und schockierenden Erlebnisse eines Mediziners, der sich in einer Welt voller Unwissenheit und Aberglauben behaupten muss.
Echt, schonungslos und voller schwarzem Humor
Bulgakows autobiografisch inspirierte Erzählungen bieten einen fesselnden Einblick in die Medizin des frühen 20. Jahrhunderts – mal dramatisch, mal skurril, immer mit seinem unverkennbaren, ironischen Stil. Die Mischung aus gnadenloser Realität und groteskem Humor macht dieses Werk zu einem zeitlosen Klassiker.
Jetzt als eBook – mit Vorwort und navigierbarem Inhaltsverzeichnis
Ob für Medizinfans, Bulgakow-Liebhaber oder Freunde literarischer Meisterwerke – Aufzeichnungen eines jungen Arztes begeistert mit seiner Intensität, seinem Witz und seiner ungeschönten Ehrlichkeit. Tauchen Sie ein in die Welt eines Arztes, der nicht nur Leben retten, sondern auch sich selbst beweisen muss!
„Michail Bulgakow ist einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts – sein Werk gehört zum Besten, was die russische Literatur zu bieten hat.“ — Salman Rushdie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michail Bulgakow
Aufzeichnungen
eines jungen Arztes
Erzählungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Russischer Original-Titel:Sapiski junogo wratscha (1925/27)Übersetzung: Anton MillerCoverdesign: Karl A. Fiedler
aionas Verlag, Böhlaustr. 9, 99423 Weimar1. Auflage, 2025ISBN Printversion: 978-3-96545-057-8 ISBN eBook: 978-3-96545-061-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Manchmal wirft uns das Leben mitten ins kalte Wasser – und manchmal ist dieses Wasser mit Schnee und Blut vermischt. „Aufzeichnungen eines jungen Arztes“ ist eine literarische Momentaufnahme genau dieses Sprungs: ein junger, unerfahrener Mann wird von der Theorie direkt in die raue Praxis geworfen und muss sich beweisen, während um ihn herum Winterstürme toben, Patienten sterben oder geheilt werden und die dünne Grenze zwischen Leben und Tod immer wieder ins Wanken gerät.
Dieses Buch ist kein heroisierender Arztroman, keine sentimentale Erinnerung an eine „gute alte Zeit“. Es ist roh, humorvoll, melancholisch – und manchmal fast schon grausam ehrlich. Michail Bulgakow, der selbst als junger Arzt in den abgelegenen Weiten Russlands praktizierte, schöpft hier aus eigener Erfahrung. Man spürt jede Unsicherheit, jede stille Panik, aber auch jedes triumphale Aufatmen, wenn eine rettende Diagnose gestellt oder eine Operation geglückt ist. Es ist ein Werk voller Leben – im besten und im bittersten Sinne.
Die Erzählungen spielen in einem abgeschiedenen Landkrankenhaus inmitten der russischen Provinz, weit entfernt von der pulsierenden Metropole Moskau, in der Bulgakow einst studierte. Hier gibt es keinen Fortschritt, keine anderen Ärzte, die helfen könnten – nur unendliche Schneelandschaften, primitive Ausrüstung und Bauern, die ihrem Arzt misstrauen oder für einen Halbgott halten.
Der junge Doktor, gerade erst den Hörsälen der Universität entronnen, wird über Nacht zum einzigen Hoffnungsträger einer ganzen Region. Sein Wissen ist frisch, sein Selbstvertrauen zerbrechlich, seine Patienten ungeduldig. Da ist das kleine Mädchen mit Diphtherie, das in seinen Händen beinahe stirbt. Da ist die Frau, die ohne ihn verbluten würde. Und da ist der Moment, in dem er zum ersten Mal ein Skalpell ansetzt – und nicht sicher ist, ob er damit rettet oder zerstört.
Diese Geschichten sind keine Romantisierung des Arztberufs. Sie sind ein Dokument der Angst, des Wachsens, des Versagens – und des Lernens. Bulgakows große Stärke ist sein Humor – ein trockener, manchmal bitterer, manchmal grotesker Humor, der selbst in den düstersten Momenten eine absurde Leichtigkeit bewahrt. Der junge Arzt ist oft überfordert, seine Patienten sind misstrauisch oder fatalistisch, und der Alltag in der Landklinik gleicht manchmal einer Tragikomödie.
Diese Mischung aus Tragik und Komik ist typisch für Bulgakow. Selbst in der tiefsten Dunkelheit des russischen Winters blitzt immer wieder ein ironisches Lächeln auf.
Doch „Aufzeichnungen eines jungen Arztes“ ist mehr als nur eine Sammlung von Anekdoten. Es ist auch die Geschichte eines Mannes, der sich selbst sucht und langsam findet. Der junge Arzt beginnt voller Ehrgeiz, muss bald erkennen, dass medizinisches Wissen nicht dasselbe wie Erfahrung ist. Jede neue Operation ist eine Prüfung, jede Fehldiagnose ein potenzielles Todesurteil. Die Einsamkeit der Provinz, die Ungewissheit, die Schuldgefühle – all das nagt an ihm.
Bulgakows Sprache ist schlicht, aber eindringlich. Er braucht keine großen Metaphern, keine pathetischen Szenen. Seine Sätze sind klar, seine Dialoge lebendig, seine Atmosphäre so dicht, dass man das Knirschen des Schnees unter den Stiefeln des Arztes zu hören meint.
Mit fast dokumentarischer Präzision schildert er seine Fälle, doch immer mit einem tiefen Gespür für die absurden, grotesken und tragischen Nuancen des Lebens. Sein Stil ist lakonisch, aber voller Emotion – er packt den Leser nicht mit Dramatik, sondern mit Wahrhaftigkeit.
In den Begegnungen mit den einfachen Menschen auf dem Lande wird auch Bulgakows kritischer Blick auf die gesellschaftlichen Umbrüche der Zeit spürbar. Die naive Vorstellung der Bolschewiki vom „neuen Menschen“ steht hierin krassem Gegensatz zur Wirklichkeit: Statt formbaren, revolutionären Individuen begegnet der junge Arzt Bauern, die an Aberglauben, Misstrauen und jahrhundertealten Traditionen festhalten. Ihre tiefe Skepsis gegenüber medizinischen Fortschritten und staatlicher Kontrolle macht Bulgakows eigene Zweifel an der Ideologie der Sowjets greifbar.
Sein Werk bleibt mit seiner einzigartigen Mischung aus Realismus und fast surrealer Intensität bis heute ein eindrucksvolles literarisches Dokument über Angst, Mut und die Unvereinbarkeit ideologischer Träume mit der rauen Wirklichkeit des Lebens.
Das Handtuch mit dem Hahn
Wenn jemand noch nie mit einer Pferdekutsche über abgelegene Feldwege gereist ist, kann ich ihm nichts darüber erzählen – er würde es ohnehin nicht verstehen. Und dem, der es erlebt hat, erspare ich lieber die Erinnerung daran.
Kurz gesagt: Die vierzig Werst1, die die Kreisstadt Gratschowka vom Krankenhaus in Murjewka trennen, legten wir mit der Kutsche an genau einem Tag zurück. Noch genauer: Am 16. September 1917 um zwei Uhr nachmittags passierten wir an der Grenze dieser eigenwilligen Stadt den letzten Speicher und am 17. September, um fünf nach zwei, stand ich im Hof des Krankenhauses von Murjewka – auf regennassem, matschigem Gras, das in der Septembernässe allmählich erstarb.
Ich stand da wie versteinert. Meine Beine waren so steif, dass ich im Geiste durch die Seiten meiner Lehrbücher blätterte und mich mühsam zu erinnern versuchte, ob es tatsächlich eine Krankheit gibt – oder ob ich es nur geträumt habe –, bei der die Muskeln eines Menschen versteinern. Wie hieß diese verfluchte Krankheit noch gleich auf Lateinisch? Jeder Muskel schmerzte unerträglich – mit bohrender Qual fast wie bei Zahnschmerzen. Über meine Zehen in den Stiefeln will ich gar nicht erst sprechen – sie waren reglos, lagen leblos da wie Holzstümpfe.
In einem Moment der Schwäche verfluchte ich insgeheim die Medizin genauso wie meine Studienbewerbung, die ich vor fünf Jahren an den Universitätsrektor gerichtet hatte. Von oben rieselte der Regen wie durch ein feines Sieb. Mein Mantel hatte sich wie ein Schwamm vollgesogen. Vergeblich versuchte ich, mit den Fingern meiner rechten Hand den Koffergriff zu greifen, gab schließlich auf und spuckte auf das nasse Gras. Meine Finger konnten nichts mehr halten. Da drängte sich – randvoll mit Wissen aus zahllosen medizinischen Büchern – eine Krankheit in meinen Kopf: Lähmung.
Lähmung, dachte ich verzweifelt, ohne zu wissen, warum. „A…an eure Straßen“, murmelte ich mit bläulich gefrorenen Lippen, „mu-muss man sich… gewöhnen…“ Dabei stierte ich den Kutscher finster an, als trüge er die Schuld an diesen Wegen.
„Ach, Herr Doktor“, seufzte der Kutscher und bewegte unter seinem hellen Schnurrbart kaum die Lippen, „seit fünfzehn Jahren fahre ich hier – aber daran gewöhnt habe ich mich nie.“
Ein Schaudern durchzuckte mich. Ich blickte auf das zweistöckige Gebäude mit der sich abschälenden weißen Farbe, auf die ungekalkten Holzwände des Feldscherhäuschens und auf meine zukünftige Unterkunft – ein blitzsauberes zweistöckiges Haus mit gespenstisch dunklen Grabesfenstern. Ich seufzte tief. In diesem Moment durchzuckte mich, statt lateinischer Begriffe, ein süßer Gedanke, den ein imaginärer Tenor mit „blauen Schenkeln“ in meinem durchgefrorenen, erschütterten Geiste sang: „Sei gegrüßt… heilige Stätte…“
Lebwohl, lebwohl auf lange Zeit, golden schimmerndes Bolschoi-Theater, Moskau, leuchtende Schaufenster… Ach, lebwohl…
Beim nächsten Mal werf‘ ich mir einen Schafspelz über, dachte ich voller Trotz und versuchte mit steifen Fingern, die Gurte meines Koffers zu lösen. Auch wenn es beim nächsten Mal schon Oktober sein wird… ich werfe mir sogar zwei Schafspelze über! Aber vor einem Monat fahre ich auf keinen Fall zurück nach Gratschowka… Überlegt doch mal… Wir mussten sogar übernachten! Zwanzig Werst hatten wir hinter uns, dann standen wir auf einmal in der dunklen, feuchten grabesstillen Nacht… in Grabylowka mussten wir bleiben. Ein Lehrer nahm uns auf. Und heute Morgen, um sieben, ging es weiter… und dann fährt man… mein Gott… langsamer als ein Fußgänger. Ein Rad krachte in ein Loch, das andere hob sich in die Luft, der Koffer schlug mir auf die Beine – bumm… dann kippte er zur Seite, dann zur anderen, dann mit der Nase nach vorne, dann mit dem Hinterkopf. Von oben nieselte es unaufhörlich, und die Knochen froren. Hätte ich je gedacht, dass ein Mensch mitten im grauen, feuchten September so erbärmlich frieren kann, als wäre tiefster Winter? Und doch, es ist möglich. Während man langsam dahinsiecht, sieht man immer nur das Gleiche: Rechts ein buckliges, karges Feld, links ein spärliches Wäldchen, hier und dort fünf oder sechs graue, windschiefe Hütten. Und keine lebende Seele darin. Stille, nichts als Stille ringsum…
Der Koffer gab schließlich nach. Der Kutscher stemmte sich mit dem Bauch dagegen und schob ihn mir direkt vor die Füße. Ich wollte nach dem Griff greifen, doch meine Hand gehorchte mir nicht mehr, und mein aufgequollenes, verhasstes Gepäckstück – vollgestopft mit Büchern und allerlei Kram – patschte ins nasse Gras und schlug gegen meine Beine.
„Ach, du… Herr…“, begann der Kutscher erschrocken, doch ich winkte nur ab. Meine Beine waren nicht mehr zu gebrauchen.
„He, ist da jemand? He!“, rief der Kutscher und klatschte mit den Händen, als wolle er einen Hahn aufscheuchen. „He, der Doktor ist da!“
In den dunklen Fenstern des Feldscherhäuschens tauchten Gesichter auf, drückten sich an die Scheiben, eine Tür schlug auf, und ich sah eine Gestalt in einem zerlumpten Mantel und abgetragenen Stiefeln über das Gras auf mich zuhinken. Hastig zog er seine Mütze, blieb zwei Schritte vor mir stehen, lächelte schüchtern und begrüßte mich mit heiserer Stimme: „Guten Tag, Genosse Doktor.“
„Wer sind Sie?“, fragte ich.
„Jegorytsch“, stellte sich der Mann vor. „Der Wächter hier. Wir haben schon sehnsüchtig auf Sie gewartet…“
Ohne weitere Worte schnappte er sich meinen Koffer, schwang ihn auf die Schulter und trug ihn davon. Ich hinkte hinter ihm her und versuchte vergeblich, meine Hand in die Hosentasche zu schieben, um mein Portemonnaie hervorzukramen.
Im Grunde braucht ein Mensch nicht viel. Und vor allem braucht er ein wärmendes Feuer. Bevor ich mich in die Einöde von Murjewka aufmachte, nahm ich mir in Moskau vor, mich würdevoll zu verhalten. Mein jugendliches Aussehen machte mir von Anfang an das Leben schwer. Ständig musste ich mich vorstellen: „Doktor Soundso.“ Und unweigerlich folgte jedes Mal dieselbe Reaktion – hochgezogene Augenbrauen, ein skeptischer Blick und die Frage: „Tatsächlich? Ich hätte Sie für einen Studenten gehalten.“
„Nein, ich habe mein Studium abgeschlossen“, antwortete ich mürrisch und dachte: Ich brauche eine Brille, das ist es. Aber eine Brille zu kaufen war sinnlos. Meine Augen waren gesund, noch nicht vom Leben getrübt. Und weil ich mich nicht mit einer Brille gegen diese wohlwollend belustigten Blicke schützen konnte, versuchte ich, mir eine Haltung anzutrainieren, die Respekt einflößen sollte. Ich bemühte mich, langsam und gewichtig zu sprechen, impulsive Bewegungen zu vermeiden, nicht zu rennen wie ein gewöhnlicher 23-Jähriger, der frisch von der Universität kam, sondern zu schreiten. Rückblickend, nach all den Jahren, weiß ich: Es gelang mir sehr schlecht.
In diesem Moment aber ließ ich jede Fassade fallen. Ich saß zusammengesunken in der Küche, nur in Socken, und streckte meine Hände wie ein Feueranbeter sehnsüchtig den glühenden Birkenholzscheiten im Ofen entgegen.
Zu meiner linken Hand, auf einen Bottich mit dem Boden nach oben, standen meine Stiefel, daneben ein gerupfter Hahn mit blutiger, nackter Kehle und ein Haufen seiner bunten Federn.
In meinem erstarrten Zustand hatte ich es tatsächlich zustande gebracht, eine Reihe von Handlungen zu vollbringen, die das Leben von mir verlangte. Die spitznasige Aksinja, Jegorytschs Frau, hatte ich kurzerhand zur Köchin ernannt, mit der Folge, dass der Hahn unter ihren Händen sogleich sein Leben ließ – er sollte mein Abendessen werden.
Ich hatte alle kennengelernt. Der Feldscher hieß Demjan Lukitsch, die Hebammen hießen Pelageja Iwanowna und Anna Nikolajewna. Ich hatte das Krankenhaus besichtigt und festgestellt, dass es über ein beeindruckendes Instrumentarium verfügte. Gleichzeitig musste ich mir (natürlich nur für mich) eingestehen, dass ich von der Bestimmung vieler dieser glänzenden, makellosen Instrumente überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte sie nicht nur nie benutzt, sondern, um ehrlich zu sein, einige davon noch nie gesehen.
„Hm“, murmelte ich bedeutungsvoll, „ein wirklich exzellentes Instrumentarium. Hm…“
„Aber ja“, bemerkte Demjan Lukitsch zuckersüß, „das verdanken wir Ihrem Vorgänger, Leopold Leopoldowitsch. Der hat von früh bis spät operiert.“
Kalter Schweiß rann mir über die Stirn, und mein beklommener Blick fiel auf die spiegelnden, glänzenden Schränke. Dann gingen wir durch die leeren Krankenzimmer. Ohne Probleme konnten sie vierzig Patienten aufnehmen.
„Bei Leopold Leopoldowitsch lagen manchmal sogar fünfzig“, tröstete mich Demjan Lukitsch.
Anna Nikolajewna, eine Frau mit einem Kranz aus ergrautem Haar, fügte mit sanfter Verwunderung hinzu: „Sie sehen so jung aus, Herr Doktor, so unglaublich jung… Wirklich erstaunlich. Fast noch wie ein Student.“
Verdammt nochmal, dachte ich. Haben die sich abgesprochen, oder was?
Ich brummte trocken zwischen den Zähnen: „Hm… nein, ich… also ich… ja, jugendlich…“
Dann gingen wir hinunter in die Apotheke. Sofort erkannte ich, dass es dort an nichts fehlte – außer vielleicht an Vogeleiermilch. In den zwei verdunkelten Räumen roch es intensiv nach Kräutern, und auf den Regalen stapelten sich Arzneien. Sogar ausländische, patentierte Präparate waren dabei – und es erübrigt sich zu sagen, dass ich von keinem einzigen je gehört hatte.
„Das hat Leopold Leopoldowitsch bestellt“, verkündete Pelageja Iwanowna stolz.
Dieser Leopold war wirklich ein genialer Mensch, dachte ich und empfand tiefen Respekt vor diesem rätselhaften Mann, der Murjewka längst verlassen hatte.
Der Mensch braucht neben wärmendem Feuer noch etwas anderes: Er muss sich einleben. Der Hahn war längst verspeist, Jegorytsch hatte mir ein Strohlager hergerichtet und mit einem Laken überzogen, und in meiner Residenz brannte im Arbeitszimmer eine Lampe. Ich saß da und starrte wie gebannt auf das dritte Meisterwerk des legendären Leopolds: einen Schrank, der bis zum Bersten voller Büchern war. Flüchtig zählte ich etwa dreißig Bände chirurgischer Handbücher in russischer und deutscher Sprache. Und erst zur Therapie! Wunderschöne dermatologische Atlanten! Der Abend brach herein, und ich begann, mich einzuleben.
Ich trage keine Schuld, dachte ich hartnäckig und gequält. Ich habe ein Diplom, fünfzehn Mal Bestnote. Ich warnte damals in der großen Stadt, dass ich nur als Assistenzarzt arbeiten möchte. Aber nein, sie lächelten und sagten: ‚Sie leben sich ein.‘ Na, hier hast du dein ‚Einleben‘. Und wenn sie einen Patienten mit Leistenbruch bringen? Wie soll ich mich da eingewöhnen? Und vor allem – wie wird sich der Patient fühlen, wenn er mit seinem Bruch unter meinen Händen liegt? Der wird sich gewiss auf der anderen Welt einleben.
Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken.
Und ein eitriger Blinddarm? Oh Gott! Und Diphtherie bei den Dorfkindern? Wann genau ist eine Tracheotomie notwendig? Aber auch ohne Tracheotomie sitz ich in der Falle… Und… und… Geburten! Ich habe alles über Geburten vergessen! Fehllagen des Kindes. Was muss ich da tun? Was?
Wie leichtsinnig ich doch war! Ich hätte dieses Angebot ablehnen sollen. Das hätte ich tun müssen. Sie hätten sich doch irgendeinen anderen Leopold besorgen können.
In dieser düsteren Stimmung wanderte ich durch das schwach beleuchtete Arbeitszimmer. Als ich die Lampe passierte, tauchte mein blasses Gesicht neben winzigen Lichtpunkten der Lampe im Fensterspiegel auf, hinter dem sich die grenzenlose Finsternis der Felder erstreckte.
Ich sehe aus wie ein falscher Dmitri, dachte ich dumm und sank wieder an den Tisch.
Zwei Stunden lang quälte ich mich in Einsamkeit, bis meine Nerven der von mir selbst erschaffenen Angst nicht mehr standhielten. Doch schließlich beruhigte ich mich – ja, ich schmiedete sogar Pläne.
Also gut… Die Zahl der Patienten sei im Moment gering, hieß es. In den Dörfern brach man Flachs, die Wege waren unpassierbar…
Gerade deswegen werden sie dir einen Bruch bringen, donnerte eine strenge Stimme in meinem Kopf. Denn bei solchen Wegen kommt niemand wegen eines Schnupfens – der ist harmlos. Aber einen Leistenbruch, den werden sie hierherschleppen, darauf kannst du dich verlassen, lieber Kollege Doktor.
Die Stimme war nicht dumm. Mir schauderte.
Halt den Mund, fauchte ich sie an. Es muss ja nicht gleich ein Bruch sein. Was für eine Neurasthenie! Wer die Kutsche nimmt, soll nicht sagen, er könne sie nicht führen.
Wer sich als Pilz ausgibt, wandert in den Korb, höhnte die Stimme boshaft.
Also gut… Ich werde mein Nachschlagewerk nicht aus der Hand legen. Wenn ich etwas verschreiben muss, kann ich während des Händewaschens darüber nachdenken. Das Buch wird offen direkt auf dem Patientenregister liegen. Ich verschreibe nützliche, aber nicht komplizierte Rezepte. Zum Beispiel: Salicylsäure 0,5, ein Pulver, dreimal täglich…
Soda kannst du verschreiben!, spottete mein innerer Kritiker.
Was hat Soda damit zu tun? Ich werde auch die Einnahme von Ipecacuanha verschreiben… auf einhundertachtzig Milliliter. Oder auf zweihundert. Bitte sehr.
Obwohl niemand von mir verlangte, dass ich mich in dieser einsamen Nacht unter der Lampe mit Ipecacuanha beschäftigte, blätterte ich feige im Rezeptbuch, überprüfte die Dosierung – und las dabei mechanisch mit, was es mit „Insipin“ auf sich hatte. Dieses Insipin war nichts anderes als Sulfat der Etherchinindiglykolsäure… Es stellte sich heraus, dass es keinen Chiningeschmack hatte! Aber wozu war es da? Und wie verschrieb man es? War das ein Pulver? Zum Teufel mit ihm!
Insipin hin oder her – aber was mache ich bei einem Leistenbruch? Die Angst ließ nicht locker, sprach mit beharrlicher Stimme. Ich setze den Patienten in ein Bad, verteidigte ich mich wütend. In ein Bad. Und versuche, den Bruch einzurenken.
Eingeklemmt, mein Engel!, raunte die Angst. Was für ein Bad, zum Teufel! Eingeklemmt! Du musst operieren… Da gab ich auf. Ich war kurz davor, in Tränen auszubrechen. Flehend starrte ich in die Dunkelheit: Alles, nur keinen eingeklemmten Leistenbruch.
Die Müdigkeit summte leise: „Leg dich schlafen, du unglückseliger Eskulap. Schlaf dich aus, und morgen kannst du weitersehen. Beruhige dich, du junger Neurastheniker. Sieh nur – wie friedlich draußen die Dunkelheit ist, die kalten Felder schlafen. Es gibt keinen Leistenbruch. Morgen kannst du weitersehen. Du wirst dich einleben… Schlaf… Leg den Wälzer beiseite… Du kapierst jetzt ohnehin keinen Deut mehr. Der Bruchhals…
Wie er hereingestürmt war, bemerkte ich gar nicht. Ich erinnere mich nur, wie der Riegel an der Tür klackte, Aksinja erschrocken quiekte – und draußen knirschte ein Wagen vorüber. Er stand da, ohne Mütze, im offenen Schafspelz, mit verfilztem Bart und wahnsinnigen Augen. Er bekreuzigte sich, fiel auf die Knie und schlug mit der Stirn auf den Boden – vor mir. Ich bin verloren, dachte ich verzweifelt.
„Was soll das, was soll das denn!“, murmelte ich und zog an seinem grauen Ärmel.
Sein Gesicht verzog sich schmerzerfüllt, und er stieß stockende Worte hervor: „Herr Doktor… Herr… die Einzige, die Einzige… die Einzige!“
Plötzlich brach seine Stimme jugendlich hell hervor, so laut, dass der Lampenschirm zitterte.
„Ach, Herrgott… Ach…“
Er rang verzweifelt die Hände und begann erneut, seine Stirn gegen die Dielen zu schlagen, als wollte er sie zerschmettern.
„Warum? Warum diese Strafe? Womit haben wir gesündigt?“
„Was? Was ist passiert?!“, rief ich, während mein Gesicht kalt wurde.
Er sprang auf, stürzte auf mich zu und flüsterte: „Herr Doktor… was immer Sie wollen… Ich gebe Ihnen Geld… Nehmen Sie, so viel Sie wollen. So viel Sie wollen. Wir liefern Ihnen Lebensmittel… Nur, dass sie nicht stirbt. Nur, dass sie nicht stirbt. Sie soll verkrüppelt bleiben – meinetwegen! Meinetwegen!“ Er schrie es zur Decke hinauf. „Zum Leben reicht es, es reicht.“
Aksinjas bleiches Gesicht erschien im dunklen Türrahmen. Ein Gefühl der Verzweiflung legte sich um mein Herz.
„Was? Was? Reden Sie!“, rief ich verzweifelt.
Er verstummte und flüsterte, als wäre es ein Geheimnis. Seine Augen wurden bodenlos tief.
„In die Flachsbreche geraten…“
„In die Flachsbreche… die Flachsbreche?“, wiederholte ich. „Was ist das?“
„Die Maschine zum Flachsbrechen… Herr Doktor…“, erklärte Aksinja leise. „Die Flachsbreche… zum Brechen des Flachses…“
„Und das zum Einstieg! Auch das noch. Oh, warum bin ich hergekommen!“, dachte ich entsetzt.
„Wer?“
„Meine Tochter“, antwortete er flüsternd und schrie dann: „Helfen Sie!“
Er sank wieder nieder, und sein im Halbrund geschnittenes Haar fiel ihm über die Augen. Die Sturmlaterne mit dem schiefen Blechschirm brannte heiß, mit zwei flackernden „Hörnern“.
Auf dem Operationstisch, auf einer weißen, frisch riechenden Wachstuchdecke, sah ich sie – und der Gedanke an den Bruch, der mich zuvor so gequält hatte, verblasste augenblicklich. Ihr helles, leicht rötliches Haar hing in einer verfilzten, trockenen Strähne vom Tisch herunter. Ihr geflochtener Zopf war kolossal und reichte bis zum Boden. Ihr Kleid aus grobem Baumwollstoff war zerrissen, und das Blut darauf hatte verschiedene Schattierungen – ein dunkler Fleck, ein fettiger, ein leuchtend roter.
Das Licht der Lampe schien seltsam lebendig, während ihr Gesicht mit einer spitzen, reglosen Nase totenbleich war. Auf diesem weißen, wie aus Gips geformten Gesicht lag eine außergewöhnliche, erloschene Schönheit. Solche Gesichter sieht man nur selten.
Im Operationssaal herrschte etwa zehn Sekunden lang absolute Stille. Doch hinter der geschlossenen Tür war dumpfes Schluchzen und das rhythmische Schlagen eines Kopfes auf den Dielenboden zu vernehmen. „Er ist wahnsinnig geworden“, dachte ich. „Die Pflegerinnen geben ihm bestimmt etwas zu trinken… Warum ist sie so schön?