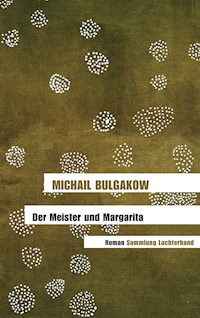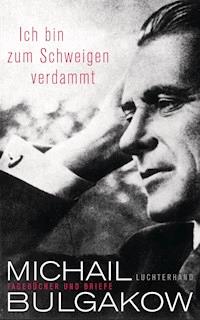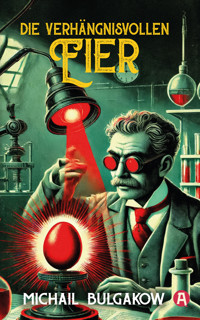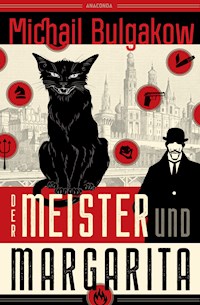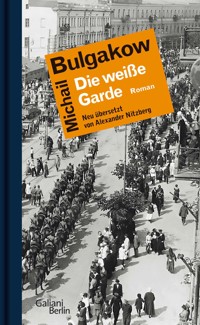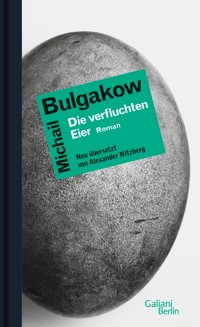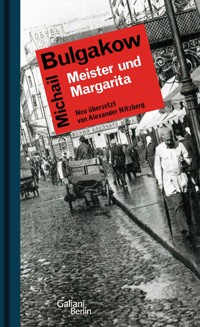
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kongenial neu übersetzt: Meister und Margarita. Bulgakows Meisterwerk und das Lieblingsbuch ganzer Generationen – so frech, klug, aberwitzig und frisch wie nie zuvor Ohne Frage: Michail Bulgakows Meister und Margarita ist Kult! Schon als der Roman – 26 Jahre nach dem Tod des Autors – stark zensiert erstmals in den 60er Jahren erschien, lernten viele seiner Landsleute ihn auswendig; heimlich angefertigte Kopien der herausgestrichenen Stellen kursierten und die verhexte Wohnung Nr. 50 in der Sadowaja – der zentrale Handlungsort des Romans, von dem aus der Teufel namens Woland, der Riesenkater Behemoth und viele andere die Stadt Moskau auf den Kopf stellen – wurde zur Pilgerstätte. Und bis heute ist die Zahl der Verehrer für den inzwischen in den Kanon der Weltliteratur als Geniestreich und Meisterwerk der russischen Moderne aufgenommenen Roman unendlich groß: Ob Mick Jagger, Anna Netrebko, Wladimir Kaminer, Maximilian Brückner, Alina Bronsky, Gabriel García Márquez – sie alle haben Meister und Margarita verschlungen. Kaum ein anderes Buch hat ganze Generationen so geprägt, viele der Fans sagen: bis heute. Radikal modern übersetzt Alexander Nitzberg diese aberwitzige Satire auf ein erstarrtes System und übertriebenen Atheismus. Ein Großstadtroman, magisch, verrückt und gegenwärtig. Und in eine Sprache übertragen, die vor allem eins ist: frisch und zupackend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Michail Bulgakow
Meister und Margarita
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Michail Bulgakow
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Michail Bulgakow
Michail Bulgakow lebte von 1891 bis 1940. Er studierte Medizin, war Autor, Dramatiker, Übersetzer und Theaterregisseur. Berühmt geworden sind seine Romane und Erzählungen (u.a. »Die weiße Garde«, »Das hündische Herz«) sowie Theaterstücke (u.a. »Die Tage der Turbins«). Ab 1930 wurden die Werke Bulgakows in der Sowjetunion nicht mehr veröffentlicht, Bulgakow stellte mehrfach Ausreiseanträge, die ihm aber verwehrt wurden. Als er mit 49 Jahren starb, hatte er die letzten zwölf Jahre an seinem Lebenswerk »Meister und Margarita« geschrieben.
Der Übersetzer: Der Lyriker und Übersetzer Alexander Nitzberg wurde 1969 in Moskau geboren. Er lebt in Wien. Seine Übersetzungen (u.a. von Daniil Charms, Anna Achmatowa, Anton Tschechow, Wladimir Majakowski, Edmund Spenser) und seine eigenen Gedichtbände (zuletzt: »Farbenklavier«, 2012) wurden viel beachtet und mehrfach ausgezeichnet.
Die Autorin des Nachworts:Felicitas Hoppe wurde 1960 in Hameln geboren und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Zu ihren Veröffentlichungen zählen u.a. »Pigafetta« (1999), »Paradiese Übersee« (2003), »Johanna« (2006), »Iwein Löwenritter« (2008) und »Hoppe« (2012). Zuletzt wurde sie 2012 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Kongenial neu übersetzt: Meister und Margarita
Bulgakows Meisterwerk und das Lieblingsbuch ganzer Generationen – so frech, klug, aberwitzig und frisch wie nie zuvor!
Ohne Frage: Michail Bulgakows Meister und Margarita ist Kult! Schon als der Roman – 26 Jahre nach dem Tod des Autors – stark zensiert erstmals in den 60er Jahren erschien, lernten viele seiner Landsleute ihn auswendig; heimlich angefertigte Kopien der herausgestrichenen Stellen kursierten und die verhexte Wohnung Nr. 50 in der Sadowaja – der zentrale Handlungsort des Romans, von dem aus der Teufel namens Woland, der Riesenkater Behemoth und viele andere die Stadt Moskau auf den Kopf stellen – wurde zur Pilgerstätte. Und bis heute ist die Zahl der Verehrer für den inzwischen in den Kanon der Weltliteratur als Geniestreich und Meisterwerk der russischen Moderne aufgenommenen Roman unendlich groß: Ob Mick Jagger, Anna Netrebko, Wladimir Kaminer, Maximilian Brückner, Alina Bronsky, Gabriel García Márquez – sie alle haben Meister und Margarita verschlungen. Kaum ein anderes Buch hat ganze Generationen so geprägt, viele der Fans sagen: bis heute.
Radikal modern übersetzt Alexander Nitzberg diese aberwitzige Satire auf ein erstarrtes System und übertriebenen Atheismus. Ein Großstadtroman, magisch, verrückt und gegenwärtig. Und in eine Sprache übertragen, die vor allem eins ist: frisch und zupackend.
Inhaltsverzeichnis
Collagen
Motto
Erster Teil
Kapitel 1 Reden Sie nie mit Unbekannten
Kapitel 2 Pontius Pilatus
Kapitel 3 Der siebte Beweis
Kapitel 4 Die Verfolgung
Kapitel 5 Es war einmal im Gribojedow
Kapitel 6 Schizophrenie, wie bereits gesagt
Kapitel 7 Die nicht geheuere Wohnung
Kapitel 8 Poet versus Professor
Kapitel 9 Korowjews Faxen
Kapitel 10 Nachrichten aus Jalta
Kapitel 11 Der doppelte Iwan
Kapitel 12 Schwarze Magie nebst ihrer Enthüllung
Kapitel 13 Der Auftritt des Helden
Kapitel 14 Dem Hahn sei Dank!
Kapitel 15 Der Traum des Nikanor Iwanowitsch
Kapitel 16 Die Hinrichtung
Kapitel 17 Ein verrückter Tag
Kapitel 18 Erfolglose Besucher
Zweiter Teil
Kapitel 19 Margarita
Kapitel 20 Azazellos Crème
Kapitel 21 Der Flug
Kapitel 22 Im Schein der Kerzen
Kapitel 23 Der Große Satansball
Kapitel 24 Die Erhebung des Meisters
Kapitel 25 Der Statthalter versucht Judas von Kirjath zu retten
Kapitel 26 Die Bestattung
Kapitel 27 Das Ende der Wohnung Nr. 50
Kapitel 28 Korowjews und Behemoths letzte Streiche
Kapitel 29 Das Schicksal der Helden ist besiegelt
Kapitel 30 Es wird Zeit!
Kapitel 31 Auf den Spatzenbergen
Kapitel 32 Vergebung und der letzte Trost
Epilog
Anhang
Verwendete Ausgaben
Ein Buch mit sieben Buckeln
Die Entdeckung und ihre Folgen
Die Legendenbildung
Margarita – das Ideal einer Liebenden?
Der Meister – das Ideal eines Dissidenten?
»Pontius Pilatus« – ein verbotenes Buch?
Die Anti-Helden
Der Roman als Dichtung
Die ungewöhnliche Sprache
Der Geist der Moderne
Die Sprache der Moderne
Der Satzbau
Die Dialoge
Die Stilregister der Personen
Die Charakterisierung über das Sprechen
Die Initiation des Helden
Die Personen- und Ortsnamen
Ein unabgeschlossenes Werk
Die Textlage
Die Inkohärenz
Problematisches und Gescheitertes
Ein unlektoriertes Meisterwerk
Der Buchstabe und der Geist
Leser, mir nach – du bist frei!
Zu den Collagen
Danksagung
Collagen
Arbat
Arbat
Twerskaja
… Nun gut, wer bist du denn?[1]
– Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Johann Wolfgang Goethe, »Faust«
Erster Teil
Patriarchenteich
Kapitel 1Reden Sie nie mit Unbekannten
Es war Frühling, eine heiße Dämmerstunde am Patriarchenteich[2]. Zwei Herren zeigten sich.[3] Der erste im grauen Sommeranzug. Ein brünetter Vierziger, klein, rundlich, beglatzt. Seinen recht ansehnlichen Hut hielt er zusammengedrückt in der Falte. Das glattrasierte Gesicht zierte eine überdimensionale dunkle Hornbrille. Der zweite ein junger Mann. Breite Schultern, struppiges rotes Haar unter einer weit nach hinten gezogenen Schirmmütze mit Schachmuster. Kariertes Hemd, zerknitterte weiße Hose, schwarze Latschen.
Bei dem Ersten handelte es sich um keinen Geringeren als um Michail Alexandrowitsch Berlioz, den Redakteur einer Literaturzeitschrift von Format[4] und Vorstandsvorsitzenden der wohl größten Moskauer Autorenvereinigung, abgekürzt Massolit.[5] Bei seinem jungen Begleiter um den Dichter Iwan Nikolajewitsch Ponyrjow, welcher sich hinter dem Pseudonym Besdomny[6] – »obdachlos« – verbarg.
Im Schatten aufgrünender Linden angelangt, eilten die Schriftsteller geradewegs zu dem bunten Büdchen mit der Aufschrift »Bier und Säfte«.
Nun wäre es angebracht, auch schon die erste Absonderlichkeit dieses unseligen Maiabends zu erwähnen: Nicht nur am Büdchen, nein, auf der gesamten Allee, die parallel zur Malaja Bronnaja[7] verlief, war nicht ein einziger Mensch zu sehen. Zu einer Stunde, die jedes Luftholen schier unmöglich zu machen schien und die Sonne, die ganz Moskau zum Sieden gebracht hatte, aus dem trockenen Dunst herausfallen und irgendwo abseits vom Gartenring[8] verschwinden ließ, suchte keine Sterbensseele Zuflucht unter diesen Bäumen, erholte sich niemand auf dieser Parkbank, war die Allee wie ausgestorben.
– Einen Sprudel –, verlangte Berlioz.
– Hammer nicht –, sagte die Frau aus dem Büdchen und setzte weiß Gott warum eine beleidigte Miene auf.
– Oder Bier? –, erkundigte sich Berlioz mit einem Frosch im Hals.
– Kriegen wir ers’ am Abend rein –, antwortete die Frau.
– Was habt ihr dann? –, fragte Berlioz.
– Aprikosenbrause, is’ aber schon warm –, sagte die Frau.
– Von mir aus, nur her damit, her damit! …
Die Aprikosenbrause schwoll an zu üppig gelbem Schaum, schon roch’s nach Shampoo. Die Schriftsteller tranken aus und wurden augenblicklich vom Schluckauf geschüttelt. Sie zahlten und setzten sich, das Gesicht zum Teich, den Rücken zur Bronnaja.
Da ereignete sich sogleich auch die nächste Absonderlichkeit, welche diesmal ganz allein Berlioz betraf: Sein Schluckauf legte sich schlagartig, das Herz machte einen Ruck und versank für einen Augenblick irgendwo, um dann wieder emporzutauchen, freilich mit einem stumpfen Stachel darin. Und urplötzlich wurde er von grundloser, aber so heftiger Furcht ergriffen, dass er auf der Stelle losrennen wollte, bloß fort vom Patriarchenteich. Er starrte beklommen umher, fragte sich, was ihm denn solch einen Mordsschrecken eingejagt hatte, wurde bleich und wischte sich die Stirn mit einem Tuch. »Nanu, was war denn das?«, dachte er. »Sieht mir ja überhaupt nicht ähnlich … Aber das Herz … kann einem … schon üble Streiche spielen … Zu viel Aufregung … Schick sie doch allesamt zum Teufel und ab nach Kislowodsk[9] …«
Da verdichtete sich die heiße Luft, und aus eben dieser Luft wob sich ein Herr zusammen – von äußerst merkwürdiger Gestalt, übrigens. Auf dem kleinen Kopf ein Reitercap. Karierter Anzug, gestutzt – nur halt aus Luft gemacht … Der Statur nach ein Lulatsch, aber unvorstellbar hager, in den Schultern schmal, und die Visage, nebenbei bemerkt, rattenfrech.
Durch die Art, wie Berlioz’ Leben verlaufen war, hatte er mit außergewöhnlichen Phänomenen bisher wenig am Hut. Er wurde noch bleicher, bekam Glubschaugen. »Das gibt es nicht! …«, dachte er, sichtlich irritiert.
Doch leider gab es das sehr wohl. Und der lange durchschimmernde Kerl vor ihm baumelte freischwebend hin und her.
Da packte Berlioz ein solches Entsetzen, dass er die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, war alles vorbei: Vom Spuk keine Spur, der Karierte verschwunden, und mit ihm auch der stumpfe Stachel im Herzen.
– Pfui Teufel! –, rief der Redakteur. – Weißt du, Iwan, um ein Haar hätte ich jetzt einen Hitzschlag bekommen! Hab schon beinahe halluziniert … –, er versuchte zu lächeln, doch in seinen Augen zuckte noch immer die Sorge, und die Hände zitterten. Aber allmählich wurde er wieder ruhiger, fächelte sich mit dem Tuch etwas Luft zu, sagte recht fit: – Tja, dann –, und setzte die vom Brausetrinken unterbrochene Rede fort.
Diese Rede handelte (wie sich später herausstellen sollte) von Jesus Christus. Der Redakteur hatte nämlich beim Dichter für die nächste Buchedition seiner Zeitschrift ein großes antireligiöses Poem[10] in Auftrag gegeben. Ein solches Poem hatte Iwan Nikolajewitsch denn auch geschrieben, sogar in Rekordzeit, nur dass es den Redakteur überhaupt nicht zufriedenstellte. Die Hauptperson des Poems, nämlich Jesus, war von Besdomny in sehr dunklen Farben gezeichnet worden, und dennoch musste nach Meinung des Redakteurs das gesamte Werk neu geschrieben werden. Und so hielt nun der Redakteur dem Dichter eine Art Vorlesung über Jesus, um den grundsätzlichen Fehler des Dichters aufzuzeigen.
Schwer zu sagen, was genau die Ursache für Iwan Nikolajewitschs Scheitern gewesen war – mangelndes Vorstellungsvermögen oder vollkommene Unkenntnis der Materie – aber sein Jesus wirkte quicklebendig, ganz und gar existent, wenn auch versehen mit allen möglichen schlechten Charakterzügen.
Jetzt wollte Berlioz dem Dichter klarmachen: Es kommt nicht darauf an, wie Jesus als Mensch ist, böse oder gut, sondern einzig darauf, dass es ihn als Person überhaupt nicht gibt. Alle Erzählungen über ihn sind Hirngespinste, Mythen eben.
Nun war ja der Redakteur ein überaus belesener Mann. Im Verlauf seiner Rede wies er einleuchtend auf die alten Geschichtsschreiber hin, den berühmten Philo von Alexandrien[11] zum Beispiel, oder den hochgebildeten Flavius Josephus[12]: Mit keinem Wort hatten sie Jesus erwähnt. Als solider Kenner belehrte Michail Alexandrowitsch den Dichter über jene Passage aus den allseits bekannten »Annalen« des Tacitus[13] (Buch fünfzehn, Kapitel vierundvierzig), wo der Kreuzestod Jesu gestreift wird. Auch sie – nichts weiter als eine Fälschung späterer Zeit.
Der Dichter, für den diese Mitteilungen des Redakteurs allesamt Neuland waren, hörte Michail Alexandrowitsch aufmerksam zu, richtete auf ihn seine lebhaften grünen Augen und wurde nur hie und da vom Schluckauf geplagt, wobei er murmelnd die Aprikosenbrause verfluchte.
– Es gibt keine östliche Religion –, sagte Berlioz, – in der ein Gott ohne die obligatorische unbefleckte Geburt zur Welt käme. So haben die Christen nichts Neues erfunden und ihren Jesus, den es in Wirklichkeit gar nicht gab, auf gleiche Weise erschaffen. Und genau darauf sollte der Hauptakzent gesetzt werden …
Berlioz’ hoher Tenor hallte in der leeren Allee. Und je weiter sich Michail Alexandrowitsch in Abgründe wagte, in die sich nur ein besonders gebildeter Mensch hineinwagen würde, ohne Angst, sich den Hals zu verrenken, desto mehr erfuhr der Dichter an interessanten und nützlichen Details: vom altägyptischen Osiris[14], dem gütigen Gott, dem Sohn des Himmels und der Erde, vom phönizischen Tammuz[15], von Marduk[16] und sogar von dem weniger bekannten grimmigen Gott Vitzliputzli[17], der seinerzeit bei den Azteken in Mexiko ziemliches Ansehen genossen hatte.
Und just in dem Augenblick, in dem Michail Alexandrowitsch dem Dichter über Vitzliputzli erzählte und wie dieser von den Azteken aus Teig geknetet worden war, zeigte sich in der Allee der erste Mensch.
Später, als es, ehrlich gesagt, nichts mehr zu retten gab, legten diverse behördliche Stellen eigene Beschreibungen dieses Menschen vor. Die Unterschiede sind in höchstem Maße verblüffend: Er sei kleinwüchsig, habe Goldzähne und humpele auf dem rechten Bein. Oder riesengroß, habe Platinkronen und humpele auf dem linken Bein. Oder aber er sei – wie es so schön heißt – »ohne besondere Kennzeichen«.
Es bleibt festzustellen, dass keine dieser Beschreibungen etwas taugt.
Zunächst: Der Besagte humpelte nicht und war weder klein noch riesenhaft, sondern einfach nur hochgewachsen. Was seine Zähne betrifft, so waren sie rechts mit Gold- und links mit Platinkronen versehen. Er trug einen teuren grauen Anzug und ausländische Pantoletten von exakt gleicher Farbe. Das graue Barett war keck auf die Seite gezogen, der Spazierstock mit schwarzer Pudelschnauze[18] unter den Arm geklemmt. Vom Aussehen her – ein Mittvierziger. Mit irgendwie krummem Mund. Glattrasiert. Braunhaarig. Das rechte Auge schwarz, das linke kurioserweise grün. Die Brauen dunkel, doch die eine saß höher als die andere. Alles in allem: ein Ausländer.
Nachdem er die Bank mit dem Redakteur und dem Dichter passiert hatte, schielte der Fremde in deren Richtung, blieb stehen und machte es sich plötzlich auf einer benachbarten Bank bequem, keine zwei Schritte von den Freunden entfernt.
»Ein Deutscher«, sagte sich Berlioz.
»Ein Engländer«, dachte Besdomny. »Boah, dass dem nicht zu heiß wird in seinen Handschuhen!«
Währenddessen betrachtete der Fremde die großen Häuser, die den Teich im Quadrat umsäumten. Offenbar sah er die Gegend zum ersten Mal und war interessiert.
Sein Blick ruhte jetzt auf den oberen Etagen, die das gebrochene und für Michail Alexandrowitsch nun auf ewig entschwindende Sonnenlicht blendend spiegelten, und glitt dann hinab, dorthin, wo sich die Scheiben bereits vorabendlich trübten. Aus irgendeinem Grund grinste er gönnerhaft, kniff die Augen zusammen, stützte die Hände auf den Stock, das Kinn auf die Hände.
– Also, du, Iwan –, sprach Berlioz, – hast zum Beispiel sehr gut und sehr bissig Jesu Geburt skizziert, die Geburt eines Gottessohns. Der Witz aber ist, dass es bereits vor Jesus eine stattliche Reihe von Gottessöhnen gab, wie etwa den phönizischen Adonis[19], den phrygischen Attis[20] und den persischen Mithras[21]. Nur dass keiner von ihnen jemals gelebt hat, einschließlich Jesus. Es ist darum wichtig, dass du, anstatt die Geburt und die Krippenszene zu schildern, absurde Gerüchte über diese Geburt beschreibst … Sonst sieht es, dank deiner Erzählung, so aus, als wäre er wirklich geboren worden! …
An dieser Stelle unternahm Besdomny einen Versuch, den quälenden Schluckauf loszuwerden und hielt den Atem an, was dazu führte, dass er umso quälender und umso lauter aufschlucken musste. Da verschlug es auch Berlioz die Worte, denn auf einmal erhob sich der Fremde und schritt geradewegs auf die Schriftsteller zu.
Sie schauten verwundert.
– Ich bitte Sie vielmals um Vergebung –, sagte der Ankömmling mit Akzent, aber fehlerfrei, – dass ich, ohne Sie erst zu kennen, so dreist bin … Allein der Gegenstand Ihrer gelehrten Unterhaltung war derart faszinierend, dass ich …
Dabei zog er galant das Barett, und den Freunden blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen und sich zu verbeugen.
»Nein, wohl eher ein Franzose …«, sagte sich Berlioz.
»Vielleicht ein Pole?«, dachte Besdomny.
Hier sei bemerkt, dass Besdomny den Fremden sofort ausgesprochen widerlich fand, wogegen er Berlioz eher gefiel, oder nein … nicht gefiel, sondern … sagen wir mal … ihn etwas neugierig machte.
– Darf ich Platz nehmen? –, fragte höflich der Fremde, und die Freunde rückten irgendwie unwillkürlich auseinander. Der Fremde setzte sich geschickt zwischen die beiden und beteiligte sich sogleich an deren Gespräch:
– Habe ich richtig gehört, Sie behaupten, dass Jesus nicht existierte? –, erkundigte sich der Fremde und richtete auf Berlioz sein linkes grünes Auge.
– Sie haben ganz richtig gehört –, antwortete Berlioz bescheiden, – das waren meine Worte.
– Ach, das ist ja interessant! –, rief der Ausländer.
»Was zum Teufel kümmert’s den?«, dachte Besdomny und machte ein finstres Gesicht.
– Und Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner einer Meinung? –, fragte der Unbekannte, sich nach rechts zu Besdomny wendend.
– Aber hundert Pro![22] –, bestätigte jener als Liebhaber geblümter Rede.
– Das ist ja entzückend! –, rief der ungebetene Gast aus, blickte sich weiß Gott weshalb verstohlen um und sagte, wobei er seine ohnehin tiefe Stimme senkte: – Entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, doch ich habe verstanden, Sie glauben darüber hinaus auch nicht an Gott? – Er machte erschrockene Augen und fügte hinzu: – Ich schwöre, ich werde es niemandem weitererzählen.
– Ganz recht, wir glauben nicht an Gott –, antwortete Berlioz, leicht belustigt über die Angst des Touristen, – aber das dürfen wir frei heraus bekennen.
Der Ausländer lehnte sich auf der Bank zurück und fragte, vor lauter Neugier fast piepsend:
– Dann sind Sie wohl … Atheisten?!
– Ja, wir sind Atheisten –, lächelte Berlioz, während Besdomny verärgert dachte: »Dass der auch nicht lockerlässt, dieser hergereiste Gockel!«
– Na, das ist ja reizend! –, rief der sich wundernde Fremde und ließ den Kopf kreisen, mal den einen, mal den anderen Literaten betrachtend.
– In unserem Land ist der Atheismus kein Grund zum Staunen –, sagte Berlioz mit diplomatischem Takt, – ein Großteil unserer Bevölkerung hat seit Langem und sehr bewusst damit aufgehört, den Ammenmärchen von Gott noch Glauben zu schenken.
Nun aber legte der Fremde folgende Nummer hin: Er stand auf, schüttelte dem verblüfften Redakteur die Hand und sagte dabei:
– Ich möchte Ihnen meinen innigsten Dank aussprechen!
– Wofür ’n das? –, fragte Besdomny und stutzte.
– Für diese überaus wichtige Information, die mir, einem Reisenden, außerordentlich interessant erscheint –, erklärte mit bedeutungsschwanger erhobenem Zeigefinger der komische Fremde.
Die überaus wichtige Information hatte auf den Reisenden offenbar wirklich einen starken Eindruck gemacht, denn er ließ den Blick ängstlich über die Häuser schweifen, als befürchte er, in jedem Fenster mindestens einen Atheisten vorzufinden.
»Nein, er ist doch kein Engländer …«, sagte sich Berlioz, und Besdomny dachte: »Woher kann der eigentlich so gut Russisch? Das ist außerordentlich interessant!«, und machte schon wieder ein finstres Gesicht.
– Doch gestatten Sie mir eine Frage –, begann nach unruhigem Schweigen der ausländische Gast, – wohin mit den Gottesbeweisen? Von denen gibt es ja bekanntlich ganze fünf![23]
– Je nun! –, bedauerte Berlioz. – Leider sind alle diese Beweise keinen Pfifferling wert und von der Menschheit längst ad acta gelegt. Sie werden mir doch zustimmen, dass es im rationalen Bereich keinen Beweis für die Existenz Gottes geben kann.
– Bravo! –, rief der Ausländer. – Bravo! Sie haben exakt den Gedanken des unermüdlichen alten Immanuel[24] hierzu wiederholt. Was aber macht der Verrückte? – Erst widerlegt er gnadenlos alle fünf, um dann, wie sich selber zum Spott, einen sechsten zu fabrizieren!
– Der Beweis von Kant –, lächelte feinsinnig der gebildete Redakteur, – ist ebenfalls wenig überzeugend. Nicht umsonst sagte Schiller, Kants Überlegungen könnten nur Knechten genügen[25], während Strauß[26] über diesen Beweis nur müde lächeln konnte.
Berlioz redete weiter und sagte sich dabei: »Wer ist das? Und warum spricht er so fabelhaft Russisch?«
– Diesen Kant müsste man eigentlich am Schlafittchen packen und für derlei Beweise nach Sibirien[27] schicken! –, brummte Iwan Nikolajewitsch vollkommen unvermittelt.
– Iwan, bitte! –, murmelte Berlioz konfus.
Aber der Vorschlag, Kant nach Sibirien zu schicken, hatte den Ausländer kein bisschen verblüfft, ihn vielmehr hellauf begeistert.
– Genau! Genau! –, rief er aus, und das grüne, Berlioz zugewandte Auge erglänzte. – Da gehört er auch hin! Was hab ich beim Frühstück auf ihn eingeredet! »Mit Verlaub, mein lieber Professor, welch ein Schmarrn! Also, nicht dass es dumm wäre, ganz im Gegenteil, nur eben viel zu abgehoben! Die Leute werden Sie auslachen.«
Berlioz machte große Augen. »Beim Frühstück? … Mit Kant? … Was faselt er bloß?«, fragte er sich.
– Dennoch –, sprach der Fremdländer, unbeirrt von Berlioz’ Staunen, zum Dichter, – ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ihn nach Sibirien zu schicken, aus dem einfachen Grund, weil er seit über hundert Jahren an einem Ort weilt, der wesentlich weiter entfernt liegt als Sibirien. Ihn dort herauszuholen, ist freilich ganz und gar ausgeschlossen, das können Sie mir glauben!
– So ein Pech! –, bemerkte der kampflustige Dichter.
– Das meine ich auch! –, sagte der Fremde mit dem glänzenden Auge und setzte seine Ausführungen fort: – Doch am meisten quält mich die Frage: Wenn es nun Gott nicht gibt, wer, möchte ich wissen, lenkt die Geschicke des Menschen und überhaupt dieser Welt?
– Na, der Mensch selbst –, sagte Besdomny eilig und sichtlich verärgert über diese zugegebenermaßen ein wenig abstruse Frage.
– Bei allem Respekt –, entgegnete sanft der Unbekannte, – doch um irgendetwas lenken zu können, brauchte man, meines Erachtens, einen klaren Plan für eine halbwegs vernünftige Frist. Also gestatten Sie mir die Frage, wie der Mensch etwas lenken kann, wenn er – ganz zu schweigen von seiner Unfähigkeit, einen wie auch immer gearteten Plan für die lächerlich kurze Frist von nur, sagen wir, tausend Jahren zu erstellen – nicht in der Lage ist, seinen eigenen morgigen Tag im Voraus zu verwalten? Im Ernst –, jetzt wandte der Fremde sich Berlioz zu, – Sie fangen schon morgen an, sich und andere zu lenken und anzuleiten, kommen sozusagen gerade langsam in Fahrt und haben auf einmal … hehe … ein Lungensarkom … –, hierbei musste der Ausländer genießerisch lächeln, als löse allein der Gedanke an ein Lungensarkom in ihm pure Freude aus, – ja, ein Sarkom –, ließ er sich das klangvolle Wort wiederholt auf der Zunge zergehen und kniff wie ein Kater die Augen zusammen, – und da hat Ihr Lenken ein Ende! Das Schicksal der anderen interessiert Sie nicht mehr, nur noch das eigene. Die Angehörigen sind auf einmal unehrlich zu Ihnen. Schon fühlen Sie: Es ist etwas im Busch – und laufen zu schlauen Ärzten, dann zu Quacksalbern, machen womöglich selbst vor Wahrsagerinnen nicht halt. Doch sie alle – die Ersten, die Zweiten wie auch die Letzten – sind natürlich vollkommen machtlos, verständlicherweise. Der Schluss von all dem ist tragisch: Eben glaubte er noch irgendetwas zu lenken, nun aber liegt er ganz starr in einer hölzernen Kiste. Und die Mitmenschen merken, er ist zu gar nichts mehr nütze und jagen ihn durch den Kamin. Aber es kann ja noch schlimmer kommen: Eben beschließt er, nach Kislowodsk zu verreisen –, der Fremde sah durch die Augenschlitze Berlioz an, – ist ja auch keine große Sache, nicht wahr? Doch ist er nicht einmal dazu mehr fähig, weil er aus Gott weiß welchem Grund plötzlich ausrutscht und – schwups! – unter eine Trambahn gerät! Sie werden mir doch nicht erzählen wollen, er habe es selber so beschlossen? Wäre es nicht eher angebracht, dahinter etwas anderes zu vermuten, das mit ihm abgeschlossen hat! –, und der Fremde prustete sonderbar los.
Mit größter Aufmerksamkeit hatte Berlioz dem unschönen Bericht vom Sarkom und der Trambahn gelauscht, und auf einmal quälten ihn beunruhigende Gedanken. »Es ist kein Ausländer … es ist kein Ausländer …«, sagte er sich, »vielmehr ein höchst seltsames Subjekt … Wer aber ist’s, wenn ich fragen darf? …«
– Ich sehe, Sie möchten gern rauchen? –, sprach der Unbekannte ganz unerwartet Besdomny an. – Welche Marke ziehen Sie vor?
– Als könnt ich’s mir aussuchen! –, versetzte grimmig der Dichter, dem die Zigaretten ausgegangen waren.
– Welche Marke? –, wiederholte der Unbekannte.
– Nascha Marka,[28] na und? –, antwortete Besdomny genervt.
Der Unbekannte zog augenblicklich ein Zigarettenetui aus der Tasche hervor und bot es Besdomny an:
– Nascha Marka.
Der Redakteur und der Dichter waren nicht so sehr von der Tatsache beeindruckt, dass sich darin ausgerechnet Nascha Marka befand, sondern vor allem vom Etui selbst. Es war ungeheuer groß, aus schwerem Gold, und auf dem Deckel erglänzte beim Öffnen mit blauem und weißem Schimmer ein diamantenes Dreieck.
Hierüber dachten die Literaten jeder auf seine Weise. Berlioz: »Also doch ein Ausländer!«, und Besdomny: »Den Teufel aber auch! …«
Der Dichter und der Besitzer des Etuis steckten sich Zigaretten an, während Berlioz als Nichtraucher ablehnte.
»Man müsste ihm erwidern«, beschloss Berlioz, »ja, Menschen sind nun mal sterblich, das bestreitet auch keiner, und dennoch ist …«
Und konnte nichts davon sagen, weil der Fremde das Wort ergriff:
– Ja, Menschen sind nun mal sterblich, aber das allein wäre halb so schlimm. Wirklich übel ist nur, dass sie manchmal von jetzt auf gleich sterblich sind – das ist der Trick dabei! – und nicht einmal sagen können, was sie heute Abend zu tun gedenken.
»Das Ganze klingt irgendwie unplausibel …«, überlegte Berlioz und holte zum Gegenschlag aus:
– Also, das scheint mir doch reichlich übertrieben! Was ich heute Abend zu tun gedenke, ist mir einigermaßen klar. Dies alles natürlich vorausgesetzt, mir fällt auf der Bronnaja kein Ziegelstein auf den Kopf …
– Ein Ziegelstein –, unterbrach der Fremde mit dem Brustton der Überzeugung, – wird einem nie und nimmer – einfach so aus heitrem Himmel – auf den Kopf fallen. Und was speziell Sie anbetrifft, glauben Sie mir: Er kann Ihnen nicht gefährlich werden. Sie sterben eines anderen Todes.
– Und Sie wissen vielleicht auch, welchen? –, fragte Berlioz mit selbstverständlicher Ironie, womit er sich nur umso mehr in dieses völlig absurde Gespräch verstrickte, – und sind so freundlich, es mir zu verraten?
– Aber gern –, sagte der Unbekannte. Er maß Berlioz mit dem Blick, als wollte er ihm ein Kostüm nähen, nuschelte etwas, wie: »Eins, zwei … Merkur im zweiten Haus … der Mond ist fort … sechs – ein Unglück … der Abend – sieben …«, und verkündete laut und froh: – Ihnen wird der Kopf abgeschnitten!
Besdomny glotzte den respektlosen Fremden wild und hasserfüllt an, und Berlioz fragte mit schiefem Lächeln:
– Und von wem? Von unseren Feinden? Von Interventen?[29]
– Nein, nichts dergleichen –, erwiderte der andere, – von einer russischen Frau, einer Komsomolzin[30].
– Hmm … –, murrte Berlioz, gereizt durch das Bubenstück des Fremden, – Sie verzeihn, das klingt ziemlich unwahrscheinlich …
– Auch ich bitte vielmals um Verzeihung –, gab der Ausländer zur Antwort, – und dennoch ist es so. Ich formuliere die Frage anders: Was werden Sie heute Abend tun, wenn’s kein Geheimnis ist?
– Ich mache gar kein Geheimnis daraus: Als Erstes gehe ich zu mir nach Hause, auf die Gartenstraße, und dann um zehn findet in der Massolit eine Besprechung statt, und ich führe den Vorsitz.
– Nein, das ist absolut ausgeschlossen –, entgegnete der Fremde mit Nachdruck.
– Und wieso?
– Wieso? –, erwiderte der Fremde und blickte mit zusammengekniffenen Augen zum Himmel, wo in Vorahnung der Abendkühle lautlose Krähen ihre Kreise kritzelten,[31] – weil Annuschka das Sonnenblumenöl bereits gekauft hat. Und nicht nur bereits gekauft, sondern es auch schon verschüttet hat. Die Besprechung fällt also aus.
Nun wurde es unter den Linden verständlicherweise still.
– Pardon, ich verstehe nicht –, fragte Berlioz nach einer Pause mit einem Blick auf den lauter Unsinn schwatzenden Ausländer, – was denn für Sonnenblumenöl … Und wer um alles in der Welt ist Annuschka?
– Was für Sonnenblumenöl? –, sagte plötzlich Besdomny, der sich offenbar vorgenommen hatte, dem ungeladenen Gast den Krieg zu erklären. – Hatten Sie, Freundchen, schon mal die Gelegenheit, eine Klinik für Geistesgestörte aufzusuchen?
– Iwan! … –, stieß Michail Alexandrowitsch leise aus.
Doch der Fremde schien überhaupt nicht beleidigt und lachte nur heiter.
– Aber gewiss! Und zwar oft! –, verkündete er vergnügt, ohne indes sein gar nicht fröhliches Auge vom Dichter abzuwenden. – Bin schon ziemlich herumgekommen! Leider habe ich es verpasst, mir vom Professor erklären zu lassen, was Schizophrenie ist. Sie müssen es ihn schon selbst fragen, lieber Iwan Nikolajewitsch!
– Woher kennen Sie meinen Namen?
– Ich bitte Sie, lieber Iwan Nikolajewitsch! Wer kennt Sie nicht? – Bei diesen Worten zog der Fremde die gestrige Ausgabe der Literaturnaja Gaseta[32] aus der Tasche heraus, und Iwan Nikolajewitsch konnte gleich auf der Titelseite sein Bild erkennen und darunter ein von ihm höchstpersönlich verfasstes Gedicht. Doch dieser Beweis der eigenen Berühmtheit und Popularität, der ihn erst gestern so sehr beglückt hatte, gereichte dem Dichter diesmal nur wenig zur Freude.
– Sie entschuldigen –, sagte er, und sein Gesicht verdunkelte sich, – könnten Sie hier einen kleinen Augenblick warten? Ich hätte jetzt gerne kurz meinen Kumpel gesprochen.
– Nur keine Umstände! –, rief der Fremde. – Es ist so angenehm hier unter den Linden. Und ich bin, nebenbei bemerkt, überhaupt nicht in Eile.
– Jetzt hör mir gut zu, Mischa –, begann der Dichter eilig im Flüsterton, nachdem er Berlioz zur Seite geführt hatte, – der ist überhaupt kein Tourist, der ist ein Spion. Ein russischer Emigrant, der sich bei uns eingeschlichen hat. Frag ihn sofort nach seinen Papieren, sonst haut er noch ab …
– Meinst du wirklich? –, hauchte Berlioz besorgt und dachte sich dabei im Stillen: »Verdammt, er hat recht! …«
– Wenn ich’s dir doch sage –, zischte ihm der Dichter ins Ohr, – er macht absichtlich einen auf deppert, um irgendwas auszuhorchen. Du hast doch gehört, wie der Russisch kann –, der Dichter redete und schielte zum Fremden hinüber, dass er nicht wegkäme, – los, gehen wir und halten ihn auf, sonst haut er noch ab …
Und der Dichter ergriff Berlioz am Arm und zog ihn zur Bank. Der Fremde saß nicht, sondern stand neben ihr und hielt in der Hand irgendein Büchlein mit dunkelgrauem Einband, einen festen Umschlag aus gutem Papier und eine Visitenkarte.
– Ich bitte vielmals um Vergebung, aber im Eifer unseres Disputs habe ich es ganz versäumt, mich Ihnen vorzustellen. Hier meine Karte, mein Pass sowie die Einladung nach Moskau als Sachverständiger –, sagte der Unbekannte und sah die beiden Literaten durchdringend an.
Diese wurden gleich verlegen. »Zum Teufel, er hat’s gehört …«, dachte Berlioz und gab mit einer höflichen Geste zu verstehen, dass es nicht nötig sei, die Papiere vorzuzeigen. Doch während der Ausländer sie dem Redakteur immer wieder unter die Nase rieb, gelang es dem Dichter, auf dem Kärtchen das in ausländischen Lettern gedruckte Wort »Professor« und die Namensinitiale »W«[33] zu erblicken.
– Sehr angenehm –, murmelte verschämt der Redakteur, und der Ausländer steckte die Papiere wieder ein.
Somit war der Kontakt wiederhergestellt, und alle drei nahmen erneut auf der Bank Platz.
– Sie sind als Sachverständiger zu uns eingeladen worden? –, fragte Berlioz.
– Ja, als Sachverständiger.
– Und Sie sind … ein Deutscher? –, erkundigte sich Besdomny.
– Sie meinen mich? … –, antwortete mit einer Gegenfrage der Professor und kam auf einmal ins Grübeln. – Ja, ich denke, ich bin ein Deutscher …[34] –, sagte er.
– Sie sprechen ganz schön doll Russisch –, bemerkte Besdomny.
– Oh, ich bin überhaupt polyglott und beherrsche unglaublich viele Sprachen –, antwortete der Professor.
– Und was ist Ihr Fachgebiet? –, erkundigte sich Berlioz.
– Ich bin Spezialist für schwarze Magie.
»Du meine Güte! …«, schoss es Michail Alexandrowitsch durch den Kopf.
– Und … und aus diesem Grund hat man Sie zu uns eingeladen? –, fragte er stotternd.
– Ja, aus diesem –, sagte der Professor und erklärte sich: – Hier wurden in der Staatsbibliothek Originalhandschriften eines Grimoires[35] von Gerbert d’Aurillac[36] aus dem zehnten Jahrhundert entdeckt. Und die soll ich jetzt entziffern. Ich bin nämlich der einzige Experte weltweit.
– Ah! Sie sind also ein Geschichtler? –, fragte Berlioz, sichtlich erleichtert und mit Respekt.
– Ich bin ein Geschichtler –, bestätigte der Wissenschaftler und fügte so mir nichts, dir nichts hinzu: – Heute Abend kommt es hier auf dem Square zu einer überaus interessanten Geschichte!
Und wieder einmal waren der Redakteur und der Dichter aufs Höchste verblüfft, der Professor jedoch winkte sie näher, und als sich die beiden zu ihm beugten, flüsterte er:
– Sie sollten wissen: Jesus hat sehr wohl existiert.
– Sehen Sie mal, Herr Professor –, erwiderte Berlioz mit erzwungenem Lächeln, – wir respektieren Ihre enormen Kenntnisse, vertreten aber in dieser Frage einen anderen Standpunkt.
– Es bedarf keiner anderen Standpunkte –, entgegnete der seltsame Professor, – er hat existiert, und Schluss, aus.
– Dennoch müsste man’s doch irgendwie beweisen … –, begann Berlioz.
– Man muss auch gar nichts beweisen –, antwortete der Professor und wurde leiser, wobei sein Akzent auf einmal verschwunden war: – Ganz einfach: Im weißen Gewand, blutig umbordet[37], trat mit schlurfendem Reiterschritt am frühen Morgen des vierzehnten Tages im Frühlingsmonat Nisan[38] …
Kapitel 2Pontius Pilatus
Im weißen Gewand, blutig umbordet, trat mit schlurfendem Reiterschritt am frühen Morgen des vierzehnten Tages im Frühlingsmonat Nisan unter das Dach der Säulenhalle zwischen zwei Flügeln des Palastes von Herodes dem Großen der Statthalter Judäas Pontius Pilatus.
Wenn es etwas gab, was der Statthalter hasste, dann den Geruch von Rosenöl. Nun, dieser Tag versprach nichts Gutes, denn seit dem Sonnenaufgang roch es danach. Für den Statthalter verströmten alle Zypressen und Palmen des Gartens Rosenaroma, und zum Ruch des Ledergeschirrs und des Schweißes der Eskorte mischte sich jene verfluchte rosige Brise. Von den hinteren Flügeln des Palastes, den Quartieren der ersten Kohorte der Legio XII Fulminata[39], die mit dem Statthalter zusammen nach Jerschalajim[40] gekommen war, wurden durch die obere Gartenanlage in die Säulenhalle feine Rauchschwaden hereingeweht. Und sogar der leicht bittere Dunst, der erkennen ließ, dass die Garköche der Centurien nunmehr angefangen hatten, das Mittagsmahl zu bereiten, verband sich mit demselben fettigen Rosenduft.
»Ihr Götter, ihr Götter, warum straft ihr mich nur? … Ja, ohne Zweifel! Da ist es schon wieder, das unbesiegbare, schreckliche Siechtum … Hemicrania[41], wovon der halbe Kopf schmerzt … Dagegen ist kein Kraut gewachsen … davor ist keine Rettung in Sicht … Ich versuche, den Kopf nicht zu bewegen …«
Auf das Bodenmosaik vor dem Brunnen war schon ein Sessel gestellt. Darin nahm der Statthalter blindlings Platz und streckte die Hand zur Seite aus. In diese Hand legte der Sekretär voller Hochachtung ein Stück Pergament hinein. Unfähig, der schmerzhaften Gesichtskrämpfe Herr zu werden, streifte der Statthalter nun das Schreiben mit schrägem flüchtigem Blick, gab das Pergament dem Sekretär zurück und brachte mühsam hervor:
– Der Häftling ist doch von Galiläa? Wurde der Fall an den Tetrarchen[42] weitergeleitet?
– Wurde er, Statthalter –, sagte der Sekretär.
– Und? Ich verstehe nicht recht …
– Er hat sich geweigert, über den Fall zu entscheiden, und verlangt für das Todesurteil des Synedrions[43] Eure Absegnung –, erklärte der Sekretär.
Der Statthalter zuckte mit der Wange und sagte leise:
– Man bringe den Häftling her.
Und sogleich führten zwei Legionäre durch die Gartenanlage unter die Säulen der Galerie einen Mann von ungefähr siebenundzwanzig Jahren und stellten ihn vor den Statthalter. Dieser Mann trug eine ziemlich alte und zerschlissene blaue Robe. Auf dem Kopf ein weißes Tuch, mithilfe eines Riemens um die Stirn befestigt, die Hände hinter dem Rücken gebunden. Unter dem linken Auge hatte der Mann eine dicke Beule, und in einem Mundwinkel war die Haut aufgeplatzt und das Blut geronnen. Der Hereingeführte betrachtete den Statthalter mit lebhafter Neugier.
Jener schwieg eine Weile und fragte dann leise auf Aramäisch:
– Dann hast du also das Volk angestiftet, den Tempel von Jerschalajim zu zerstören?
Dabei saß der Statthalter wie versteinert, allein seine Lippen rührten sich schwach beim Aussprechen der Wörter. Der Statthalter saß wie versteinert, um seinen vom Höllenschmerz flammenden Kopf auf gar keinen Fall zu bewegen.
Der Mann mit den gebundenen Händen beugte sich etwas vor und begann zu reden:
– Guter Mensch! Glaub mir …
Doch der Statthalter, immer noch starr und seine Stimme keinen Deut hebend, unterbrach ihn auf der Stelle:
– Guter Mensch? Das sagst du zu mir? Du irrst dich. In Jerschalajim wird an allen Ecken getratscht, ich sei eine grimmige Bestie, was auch wirklich zutrifft. – Und ergänzte im gleichen Tonfall: – Centurio Rattenschreck zu mir.
Auf der Galerie schien es dunkler geworden zu sein, als Centurio Marcus von der ersten Centurie, besser bekannt als Rattenschreck, vor den Statthalter trat. Rattenschreck war einen Kopf höher als der größte Soldat der Legion und so breitschultrig, dass er die noch niedrig stehende Sonne ganz und gar überschattete.
Der Statthalter wandte sich an den Centurio auf Lateinisch.
– Der Delinquent nennt mich einen guten Menschen. Führt ihn für einen Moment hinaus, bringt ihm bei, wie er mich anzusprechen hat. Aber alles noch dran lassen.
Und jedermann, bis auf den reglosen Statthalter, blickte Marcus Rattenschreck nach, der dem Häftling mit einem Wink zu verstehen gab, dass er ihm folgen soll.
Auch sonst blickte jedermann Rattenschreck nach, ganz gleich, wo dieser sich zeigte, und zwar wegen seiner Statur. Und diejenigen, die ihn zum ersten Mal sahen, noch deshalb, weil sein Gesicht verunstaltet war: Der Streitkolben eines Germanen hatte einst seine Nase zertrümmert.
Die Stiefel von Marcus schlugen schwer auf dem Mosaikboden auf, der Gefesselte ging lautlos hinterher, und in der Säulenhalle trat eine tiefe Stille ein. Schon war zu hören, wie die Tauben in der Gartenanlage an der Galerie girrten, während das Wasser im Brunnen ein gewitztes erquickliches Lied sang.
Der Statthalter verspürte einen Wunsch: sich hoch raffen, die Brise gegen seine Schläfe wehen lassen und so verharren. Aber auch das wird nicht helfen.
Nachdem Rattenschreck nun den Gefangenen aus der Säulenhalle in den Garten geführt hatte, nahm er dem Legionär, der vor dem Sockel einer Bronzestatue postiert war, die Peitsche ab, holte ganz sachte aus und versetzte dem Häftling einen Hieb auf die Schultern. Die Bewegung des Centurio war eher lässig und mühelos gewesen, doch der Gefesselte stürzte blitzartig zu Boden, als hätte man ihm die Beine abgehackt, verschluckte sich an Luft, die Farbe wich von seinem Gesicht, und der Sinn erlosch in den Augen. Leicht wie einen leeren Sack schwang Marcus mit links den Gefallenen hoch, stellte ihn auf die Beine und sagte näselnd, wobei er die aramäischen Wörter schlecht aussprach:
– Den römischen Statthalter nur mit »Hegemon« anreden. Ansonsten nichts sagen. Strammstehen. Verstanden, oder soll’s noch mehr geben?
Der Gefangene taumelte, hatte sich aber schon wieder gefasst: Die Gesichtsfarbe war zurückgekehrt. Er atmete auf und erwiderte heiser:
– Ich habe verstanden. Schlage mich nicht.
Eine Minute später stand er erneut vor dem Statthalter.
Es erklang dessen kraftlose, kranke Stimme:
– Name.
– Wessen? –, reagierte der Häftling beflissen, wobei sein gesamtes Wesen von Bereitschaft zeugte, nur vernünftige Antworten zu geben und keinerlei Zorn mehr zu wecken.
Der Statthalter sagte gedämpft:
– Mein eigener ist mir bekannt. Stell dich nicht dümmer an, als du bist. Dein Name.
– Jeschua[44] –, beeilte sich der Gefangene.
– Und wie noch geheißen?
– Ha-Nozri.
– Und du stammst woher?
– Aus der Stadt Gamala[45] –, sagte der Häftling. Und ein Nicken seines Kopfes deutete an: Dort, fern, auf der rechten nördlichen Seite gibt es auch wirklich eine Stadt Gamala.
– Wer bist du dem Blut nach?
– Ich weiß nicht genau –, erwiderte rasch der Gefangene. – Ich habe keine Erinnerung an meine Eltern. Mir wurde erzählt, mein Vater sei Syrer gewesen …
– Wo ist dein fester Wohnsitz?
– Ich habe keinen festen Wohnsitz –, sagte der Häftling verlegen, – ich ziehe von Stadt zu Stadt.
– Das lässt sich treffender formulieren. Mit anderen Worten: ein Landstreicher –, sprach der Statthalter und fragte: – Verwandte?
– Keine. Ich bin allein in der Welt.
– Kannst du lesen und schreiben?
– Kann ich.
– Und beherrschst noch eine weitere Sprache, außer Aramäisch?
– Ja. Griechisch.
Schon hob sich das geschwollene Lid, die vom Schleier des Leids verhüllte Pupille starrte den Häftling an. Die andere blieb bedeckt.
Pilatus begann auf Griechisch:
– Dann hast du also vorgehabt, das Tempelgebäude zu zerstören, und das Volk dazu angestiftet?
Jetzt gewann der Gefangene seine Lebhaftigkeit zurück, der Blick wirkte nicht mehr eingeschüchtert. Auf Griechisch antwortete er:
– Nein, guter … –, ein jäher Schrecken durchfuhr die Augen des Häftlings, hatte er sich doch beinahe versprochen. – Nein, Hegemon, in meinem gesamten Leben habe ich niemals daran gedacht, das Tempelgebäude zu zerstören oder jemanden zu dieser sinnlosen Tat anzuregen.
Verwunderung zeigte sich im Gesicht des Sekretärs, der am niedrigen Tisch gekrümmt saß und die Aussagen mitschrieb. Er hob den Kopf, beugte ihn aber sogleich wieder über das Pergament.
– Zum Feiertag strömen in dieser Stadt ganze Horden unterschiedlichsten Volks zusammen. Darunter sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Meuchelmörder –, sprach der Statthalter monoton, – manchmal auch Lügner. Du, zum Beispiel. Hier steht es doch schwarz auf weiß: Hetzte das Volk auf, den Tempel zu zerstören. So bezeugen’s die Menschen.
– Diese guten Menschen –, sagte der Gefangene, fügte eilig hinzu: – Hegemon –, und redete weiter: – sind ungebildet und bringen meine Worte ganz durcheinander. Überhaupt befürchte ich immer mehr, dass diese Wirrnis noch lange Zeit anhalten wird. Und alles nur, weil er das, was ich sage, falsch aufschreibt.
Ein Schweigen trat ein. Jetzt blickten beide kranken Pupillen mühsam den Häftling an.
– Ich wiederhole, und zwar zum letzten Mal: Hör auf, dich verrückt zu stellen, Halunke –, sagte Pilatus eintönig weich, – von dem, was du sagst, ist nicht viel aufgeschrieben worden, doch dies wenige reicht aus, um dich an den Galgen zu bringen.
– Nein, nein, Hegemon –, ereiferte sich der Häftling in der Absicht, wirklich zu überzeugen, – es geht einer umher mit einem Stück Ziegenpergament und schreibt und schreibt unaufhörlich. Aber einmal warf ich einen Blick in sein Pergament und bekam einen heftigen Schrecken. Denn nichts von dem, was darin geschrieben steht, hätte ich jemals gesagt. Ich flehte ihn an: Um Gottes willen, verbrenne dein Pergament! Doch er konnte es mir noch entreißen und eilte fort.
– Er heißt wie? –, fragte Pilatus angeekelt und fasste mit der Hand an die Schläfe.
– Levi Matthäus –, erklärte der Gefangene gern, – er war Steuereintreiber. Ich traf ihn zum ersten Mal an einem Weg in Bethphage[46], dort, wo der Feigengarten endet, und kam mit ihm ins Gespräch. Anfangs schien er abweisend, beleidigte mich sogar, glaubte jedenfalls, mich zu beleidigen, indem er mich einen Hund nannte –, hier musste der Häftling schmunzeln, – ich meinerseits sehe nichts Schlimmes an dem Tier, um mich von dem Wort gekränkt zu fühlen …
Der Sekretär unterbrach das Schreiben und schaute voll heimlichen Staunens, nein, nicht den Häftling, vielmehr den Statthalter an.
– … doch nachdem er mich angehört hatte, taute er langsam auf –, redete Jeschua weiter, – warf endlich das Geld auf den Weg und sagte, er würde mit mir ziehen …
Pilatus lächelte schief mit einer Wange, legte seine gelben Zähne frei und sprach, mit dem ganzen Rumpf zum Sekretär gewandt:
– Oh Jerschalajim! Was erfährt man nicht alles in dieser Stadt! Hörst du? Ein Steuereintreiber warf das Geld auf den Weg!
Wie darauf reagieren? Also hielt es der Sekretär für angebracht, Pilatus’ Lächeln zu erwidern.
– Er sagte nämlich, das Geld sei ihm von jetzt an verhasst –, erklärte Jeschua die seltsamen Handlungen Levi Matthäus’ und fügte hinzu: – Und seitdem ist er mein Begleiter.
Noch immer die Zähne fletschend, blickte der Statthalter den Häftling an, danach die Sonne, die unabwendbar hinaufschwebte, über die Reiterstatuen des Hippodroms hinweg, welcher tief unten, weit entfernt auf der rechten Seite lag, und dachte plötzlich im Anfall von Übelkeit weckender Qual, die einfachste Sache wäre jetzt wohl: Den kauzigen Missetäter von der Galerie fortscheuchen. Dazu nur zwei Wörter aussprechen: »Hängt ihn«. Die Eskorte fortscheuchen. Aus der Säulenhalle ins Innere des Palastes treten. Das Zimmer abdunkeln lassen. Aufs Lager sinken. Kaltes Wasser verlangen. Mit klagender Stimme Banga[47], den Hund, herbeirufen. Zusammen mit ihm die Hemicrania beweinen. Und Gift. Der Gedanke daran blühte verlockend und kurz im kranken Kopf des Statthalters auf.
Mit trübem Blick schaute er den Gefangenen an, schwieg eine Weile und fragte sich schmerzhaft, warum in der gnadenlosen Jerschalajimer Sonnenhitze dieser Häftling mit zerschlagenem Gesicht da vor ihm steht und was für unnütze Fragen ihm noch zu stellen sind.
– Levi Matthäus? –, fragte der Kranke heiser und schloss die Augen.
– Ja, Levi Matthäus –, wehte die hohe, ihn quälende Stimme an ihn heran.
– Was genau aber hast du dem Volk auf dem Markt vom Tempel erzählt?
Die Stimme des Antwortenden schien sich in Pilatus’ Schläfe hineinzubohren, eine schier unerträgliche Qual, und die Stimme sprach:
– Ich, Hegemon, lehrte, der Tempel des alten Glaubens würde zerfallen, doch ein neuer Tempel der Wahrheit würde erstehen. Ich redete so, damit es deutlicher wäre.
– Warum hast du Landstreicher das Volk auf dem Markt empört, indem du von Wahrheit sprachst, von welcher du keinen Schimmer besitzt? Was ist denn Wahrheit?
Und der Statthalter dachte: »Ihr Götter! Ich stelle lauter unnütze Fragen bei dem Verhör … Mein Verstand versagt mir den Dienst …« Und wieder erschien vor ihm eine Schale mit dunklem Nass. »Ach, gebt mir, ach, gebt mir doch Gift …«
Und wieder vernahm er die Stimme:
– Die Wahrheit ist zunächst einmal, dass du Kopfschmerzen hast. So starke Kopfschmerzen, dass du kleinmütig sterben willst. Es zehrt an deinen Kräften, mich anzusehen, geschweige denn mit mir zu sprechen. So werde ich, ohne es zu wollen, zu deinem Henker, was mich sehr traurig macht. Du bist nicht einmal mehr fähig, an irgendetwas zu denken, und träumst nur von deinem Hund, dem offenbar einzigen Wesen, an dem du noch hängst. Doch deine Qualen sind gleich zu Ende, dein Kopfschmerz legt sich.
Der Sekretär blieb mitten im Satz stehen, machte große Augen und starrte den Häftling an.
Pilatus hob den zermarterten Blick zum Gefangenen und sah die bereits recht hoch über dem Hippodrom stehende Sonne. Ihr Strahl war inzwischen in die Säulenhalle gedrungen und schlich sich langsam an die abgetragenen Sandalen von Jeschua heran. Jener versuchte, dem Sonnenlicht auszuweichen.
Da richtete sich der Statthalter auf, fasste den Kopf mit den Händen, und sein gelbliches glattrasiertes Gesicht offenbarte blankes Entsetzen. Doch er unterdrückte es sogleich mit einem herrischen Willensimpuls und ließ sich zurück in den Sessel fallen.
Der Häftling setzte indes seine Ansprache fort, während der Sekretär längst aufgehört hatte mitzuschreiben und nunmehr wie eine Gans den Hals reckte, bemüht, sich kein einziges Wort entgehen zu lassen.
– Siehst du, schon ist alles vorbei –, sagte der Häftling und schaute Pilatus wohlwollend an, – ich bin außerordentlich froh darüber. Ich würde dir raten, Hegemon, den Palast für eine Weile zu verlassen und dir ein klein wenig die Füße zu vertreten. Irgendwo in den Vororten, und sei es auch nur in einem der Gärten dort auf dem Ölberg. Es wird gewittern … –, der Gefangene wandte sich etwas ab und blickte zur Sonne, die ihn blendete, – … aber später, am Abend. Ein Spaziergang täte dir wirklich gut, und ich würde dich gern begleiten. Ich habe da ein paar neue Gedanken, die, wie ich meine, auch dich interessieren könnten. Ich möchte sie mit dir teilen, zumal du überaus klug wirkst.
Der Sekretär wurde bleich wie der Tod und ließ die Rolle zu Boden fallen.
– Dein Unglück ist –, redete der Gefesselte, von niemandem aufgehalten, – du bist viel zu verschlossen und hast den Glauben an die Menschen ganz eingebüßt. All seine Zuneigung einem Hund zu schenken, nicht wahr, wohin soll das führen? Nein, Hegemon, dein Leben ist mehr als dürftig –, und der Sprechende wagte zu lächeln.
Der Sekretär dachte nur noch an eines: Soll er seinen Ohren trauen oder nicht? Er musste es schließlich. Wie absonderlich wird wohl der Jähzorn des reizbaren Statthalters ausfallen – angesichts dieser ungeheuerlichen Dreistigkeit des Gefangenen? Schwer zu sagen, obwohl er den Statthalter kennt.
Nun erklang die gebrochene, heisere Stimme des Statthalters, die in Latein sprach:
– Löst ihm die Fesseln.
Ein Legionär der Eskorte schlug mit dem Speer auf, reichte ihn einem anderen, näherte sich dem Häftling und band dessen Hände los. Der Sekretär aber hob die Rolle vom Boden. Erst einmal nicht mitschreiben. Sein Staunen in Zaum halten. Ganz gleich was da kommen mag.
– Gib zu –, fragte Pilatus leise auf Griechisch, – du bist ein mächtiger Arzt?
– Nein, Statthalter, ich bin kein Arzt –, antwortete der Häftling und rieb sich vergnügt die mitgenommene, angeschwollene, scharlachfarbene Hand.
Pilatus runzelte die Stirn. Sein strenger und schroffer Blick stach wieder und wieder auf den Gefangenen ein. Dieser Blick war auch nicht mehr getrübt, sondern wie einst voller Blitze.
– Ich habe dich nicht gefragt –, forschte Pilatus, – ob du am Ende auch noch Latein beherrschst?
– Das tue ich –, erwiderte der Häftling.
Die gelblichen Wangen des Pilatus färbten sich, und er fragte auf Latein:
– Woher wusstest du das mit dem Hund?
– Ganz einfach –, antwortete der Gefangene auf Latein, – du hast mit der Hand Bewegungen in der Luft gemacht –, der Häftling ahmte die Geste des Statthalters nach, – so als wolltest du jemanden streicheln, und die Lippen …
– Ja –, sagte Pilatus.
Sie schwiegen. Dann fragte Pilatus auf Griechisch:
– Also bist du ein Arzt?
– Nein, nein –, sagte der Gefangene lebhaft, – glaub mir, ich bin kein Arzt.
– Nun, gut. Es ist dein Geheimnis. Sei’s drum. Mit unserer Angelegenheit hat es nur am Rande etwas zu tun. Du behauptest also, du hättest niemanden aufgerufen, den Tempel zu zerstören oder … niederzubrennen oder … auf sonstige Art zu vernichten?
– Ich sage es dir noch einmal, Hegemon: Ich habe keinen zu solcherlei Handlungen aufgerufen. Sehe ich etwa aus wie ein Schwachsinniger?
– Du siehst in der Tat nicht aus wie ein Schwachsinniger –, sprach der Statthalter leise und lächelte irgendwie unheilvoll, – und nun schwöre, dass dem nicht so war.
– Und worauf soll ich schwören? –, fragte sehr eifrig der Losgebundene.
– Auf dein Leben, zum Beispiel –, sagte der Statthalter. – Dafür ist es auch höchste Zeit, denn schließlich hängt es an einem seidenen Faden.
– Du glaubst doch nicht, Hegemon, du hättest es aufgehängt? –, fragte der Häftling. – Denn wenn du das glaubst, dann täuschst du dich sehr.
Pilatus erbebte und antwortete durch die Zähne:
– Immerhin kann ich den Faden durchtrennen.
– Auch darin täuschst du dich –, versetzte der Häftling mit strahlendem Lächeln und streckte die Hand aus, um sich vor der Sonne zu schützen. – Eines steht fest, und du wirst mir zustimmen müssen: dass ihn nur jener durchtrennen kann, der ihn aufgehängt hat.
– Ja, ja –, grinste Pilatus, – jetzt hege ich keinen Zweifel daran, dass all die müßigen Gaffer von Jerschalajim dir auf Schritt und Tritt folgten. Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, doch hängt sie recht gut. Ist es übrigens wahr: Du kamst nach Jerschalajim durch das Tor von Susa[48] gezogen? Rittlings auf einem Esel? Und begleitet vom Pöbel, der dich wie einen Propheten umjubelte? –, dabei wies der Statthalter auf eine Schriftrolle hin.
Der Häftling sah den Statthalter verdutzt an.
– Ich habe doch gar keinen Esel, Hegemon –, sagte er. – Ich kam nach Jerschalajim durch das Tor von Susa, das ist allerdings wahr. Freilich zu Fuß und begleitet von Levi Matthäus und niemandem sonst. Und keiner hat mich umjubelt, weil mich damals in Jerschalajim noch keiner kannte.
– Aber vielleicht kennst ja du –, fragte Pilatus weiter, ohne den Blick vom Gefangenen abzuwenden, – einen, der Dysmas heißt? Außerdem einen Gestas[49]? Und schließlich einen gewissen Bar-Rabban[50]?
– Nein, diese guten Menschen kenne ich nicht –, erwiderte ihm der Häftling.
– Wirklich?
– Wirklich.
– Und jetzt sage mir doch, warum du die ganze Zeit diesen Ausdruck verwendest: »gute Menschen«? Nennst du am Ende jeden so?
– Jeden –, gab der Häftling zur Antwort, – es gibt in der Welt keine bösen Menschen.
– Das höre ich zum ersten Mal –, sagte Pilatus und schmunzelte, – aber vielleicht habe ich einfach zu wenig Lebenserfahrung! … Du brauchst den Rest nicht mitzuschreiben –, wandte er sich an den Sekretär, obwohl jener von sich aus nicht mitschrieb, und sagte weiter zum Häftling: – Stand das in irgendeinem griechischen Buch, das du gelesen hast?
– Nein, das ist meine eigene Erkenntnis.
– Und die verkündest du?
– Ja.
– Nehmen wir doch den Centurio Marcus, genannt Rattenschreck. Ein guter Mensch?
– Ja –, sprach der Gefangene, – nur sehr unglücklich. Seitdem gute Menschen ihn derart verunstaltet haben, ist er grausam und roh. Ich möchte wissen, wer ihm das angetan hat.
– Oh, das will ich dir liebend gern verraten –, sagte Pilatus, – denn ich war dabei. Die guten Menschen fielen über ihn her, wie Hunde über einen Bären. Die Germanen verbissen sich ihm in Hals, Arme und Beine. Der Manipel mit seinem Fußvolk saß in die Klemme. Und wäre nicht die Turma[51] mit ihren Reitern – und zwar unter meinem Kommando – gegen die Flanke geprallt, dann hättest du, Philosoph, jetzt keine Gelegenheit mehr, Rattenschreck kennenzulernen. Es war die Schlacht bei Idistaviso[52], im Tal der Jungfrauen.
– Wenn man doch einmal mit ihm reden könnte –, bemerkte der Gefangene plötzlich verträumt, – ich bin mir gewiss: Er würde sich von Grund auf ändern.
– Ich vermute –, entgegnete Pilatus, – der Legat unserer Legion hätte wenig Freude daran, wenn du mit irgendeinem seiner Offiziere oder Soldaten redetest. Im Übrigen wird das auch gar nicht geschehen – muss sagen: zu jedermanns Glück –, und der Erste, der dafür sorgt, bin ich selbst.
In diesem Moment flatterte in die Säulenhalle flugs eine Schwalbe herein. Sie beschrieb einen Kreis unter der goldenen Decke, kam nieder und streifte mit ihrer spitzen Schwinge schon beinahe das Antlitz der kupfernen Statue in einer der Nischen. Dann verschwand sie hinter dem Kapitell. Vielleicht hatte sie vorgehabt, dort ein Nest zu bauen.
Doch während sie flog, bildete sich im nunmehr klaren und leichten Kopf des Statthalters eine Formel – mit folgendem Wortlaut: »Der Hegemon hat den Fall des umherziehenden Philosophen Jeschua – auch bekannt als Ha-Nozri – eingehend untersucht. Der Tatbestand eines Rechtsbruchs liegt nicht vor. So konnte insbesondere keine Verbindung zwischen den Handlungen Jeschuas und den jüngsten Unruhen in Jerschalajim festgestellt werden. Der umherziehende Philosoph ist ganz offenbar geistesgestört. In Anbetracht dessen wird der Statthalter das Todesurteil des Kleinen Synedrions nicht bestätigen. Weil jedoch die närrischen, phantasmagorischen Reden Ha-Nozris in Jerschalajim Anstoß erregen könnten, entfernt der Statthalter Jeschua aus Jerschalajim und ordnet an, ihn in Caesarea Stratonis[53] am Mittelmeer einzukerkern, das heißt, in des Statthalters eigener Residenz.« Er brauchte es nur noch dem Sekretär zu diktieren.
Die Schwingen der Schwalbe schnauften über dem Kopf des Hegemons. Der Vogel flitzte ans Brunnenbecken und eilte ins Freie hinaus. Der Statthalter hob den Blick zum Gefangenen – neben ihm eine strahlende Wolke von Staub.
– Ist das alles, was gegen ihn vorliegt? –, fragte der Statthalter den Sekretär.
– Nein, leider nicht –, gab der Sekretär überraschenderweise zur Antwort und reichte Pilatus ein weiteres Pergament.
– Was denn noch? –, fragte Pilatus mit Stirnrunzeln.
Nachdem er das ihm übergebene Schriftstück gelesen hatte, veränderte sich sein Gesicht noch mehr. War das dunkle Blut in den Hals, in den Kopf gestiegen? War etwas anderes geschehen? Doch hat seine Haut ihre gelbe Farbe verloren, wurde bräunlicher, und die Augen wirkten wie eingebrochen.
Das Blut war an alldem schuld: Es strömte, es trommelte gegen die Schläfen. Und das Sehvermögen, was ereignete sich mit ihm? Der Kopf des Häftlings driftete fort, während an seiner Stelle ein neuer erstand. Ein kahler Kopf und darauf eine goldene Krone mit spärlichen Zacken. Die Stirn – ein einziges rundes Geschwür[54], das die Haut zerfraß und von Balsam beschmiert war. Ein zahnloser, eingefallener Mund, eine schlaffe und launische Unterlippe. Jetzt schwanden die rosafarbenen Säulen der Galerie, die Jerschalajimer Dächer in der Ferne, hinter den Gärten. Und alles rings ertrank im üppigsten Grün der Capreischen Blüten. Und das Gehör – wie sonderbar: Es erlauschte von weit her Drommeten, gedämpft und drohend. Und dann, überaus deutlich, eine näselnde Stimme selbstherrlich die Worte dehnen: »Paragraph: Majestätsbeleidigung[55] …«
Die Gedanken schwirrten – sprunghaft, abrupt, lauter Abstrusitäten: »Bin verloren! …«, und dann: »Wir sind alle verloren! …« Und darunter ein gänzlich absurder: an die Unsterblichkeit, seltsamerweise unerträglich und trostlos.
Pilatus riss sich zusammen, vertrieb den Spuk, zwang seinen Blick zurück auf die Galerie. Und wieder zeigten sich ihm die Augen des Häftlings.
– Sag mal, Ha-Nozri –, begann der Statthalter und schaute Jeschua eigenartig an: Der Gesichtsausdruck des Statthalters war streng, doch die Augen nervös. – Hast du irgendwann einmal vom großen Caesar geredet? Antworte: Hast du? … Oder … hast du … nicht … – Pilatus zog das Wort »nicht« etwas mehr in die Länge, als bei Vernehmungen üblich. Sein Blick trug Jeschua einen Gedanken zu, welchen er dem Gefangenen gleichsam einflößen wollte.
– Die Wahrheit zu sagen ist leicht und angenehm –, bemerkte der Häftling.
– Ich will gar nicht wissen –, versetzte Pilatus mit gepresster, garstiger Stimme, – ob es dir angenehm oder unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Denn du wirst sie mir wohl oder übel sagen müssen. Und sagst du sie mir, leg jedes Wort fein hübsch auf die Goldwaage, wenn du dem sicheren und vor allem qualvollen Tod entgehen willst.
Niemand weiß, was mit dem Statthalter von Judäa geschehen war, doch er wagte es, seine Hand zu heben, gewissermaßen um sich vor dem Sonnenlicht abzuschirmen, und warf hinter dieser Hand – wie hinter einem schützenden Schild – dem Häftling einen bedeutungsschwangeren Blick zu.
– Nun –, sagte er, – kennst du einen gewissen Judas von Kirjath[56]? Und was genau hast du ihm vom Caesar erzählt, wenn du ihm überhaupt etwas vom Caesar erzählt hast?
– Es war so –, fing der Häftling mit Freude an zu berichten, – vorgestern Abend lernte ich am Tempel einen jungen Mann kennen. Er nannte sich Judas und war aus Kirjath. Er lud mich in sein Haus in der Unteren Stadt ein und gab mir zu speisen …
– Ein guter Mensch? –, fragte Pilatus, und ein teuflisches Feuer funkelte in seinen Augen.
– Ein sehr guter Mensch, und sehr wissbegierig –, bestätigte der Gefangene, – er zeigte großes Interesse an meinen Gedanken und empfing mich in aller Gastlichkeit …
– Hat sogar Leuchter angezündet … –, brachte Pilatus durch die Zähne im Ton des Häftlings hervor, wobei seine Augen glänzten.
– Ja, richtig –, sagte Jeschua, ein wenig verwundert darüber, wie wohlunterrichtet der Statthalter war, – er bat mich, ihm meine Sichtweise auf die Staatsmacht darzulegen. Diese Frage hatte ihn stark beschäftigt.
– Was hast du ihm nun gesagt? –, fragte Pilatus. – Oder wirst du mir weismachen wollen, es sei dir schon wieder entfallen? –, doch Pilatus’ Stimme klang bereits weniger hoffnungsvoll.
– Unter anderem habe ich gesagt –, erzählte der Häftling, – dass jede Staatsmacht die Menschen knechtet. Doch es kommt eine Zeit, in der es keine Macht geben wird, keine Caesaren oder sonstigen Herrscher. Und der Mensch tritt ein in das Reich der Gerechtigkeit und der Wahrheit, das aller Gewalt entbehrt.
– Und weiter!
– Und weiter nichts –, sagte der Häftling. – Es kamen auf einmal Menschen hereingelaufen. Sie fesselten mich und steckten mich ins Gefängnis.
Der Sekretär, bemüht, sich kein Wort entgehen zu lassen, kritzelte rasch die Sätze aufs Pergament.
– Es gibt und gab in der Welt keine größere oder schönere Macht als die des Kaisers Tiberius! –, Pilatus’ kranke und angeschlagene Stimme wuchs empor.
Aus irgendeinem Grund sah der Statthalter nun den Sekretär und die Eskorte hasserfüllt an.
– Und du, verrückter Verbrecher, bist der Letzte, der über sie zu urteilen hat! – Und Pilatus schrie auf: – Die Eskorte fort von der Galerie! – Und ergänzte, zum Sekretär gewandt: – Lass mich mit dem Verbrecher allein. Es handelt sich um eine Staatsangelegenheit.
Die Eskorte erhob ihre Speere und schritt, maßvoll mit den beschlagenen Caligen[57] klappernd, von der Galerie in den Garten. Der Eskorte folgte der Sekretär.
Das Schweigen dort auf der Galerie wurde eine Zeit lang nur vom Gesang des Brunnenwassers gestört. Pilatus sah die flüssige Schale über dem Röhrchen schwellen, ihren Rand sich krümmen und in winzigen Rinnsalen niederströmen.
Als Erster ergriff der Gefangene das Wort:
– Ich merke schon: Was ich dem Jüngling aus Kirjath sagte, zieht irgendwie böse Folgen nach sich. Auch befürchte ich, Hegemon, dass ihm ein Unglück geschieht, und er tut mir aufrichtig leid.
– Und ich denke –, entgegnete ihm der Statthalter mit seltsamem Lächeln, – es gibt noch jemanden in der Welt, und der sollte dir wesentlich mehr leidtun als Judas von Kirjath, weil es ihm sehr viel schlimmer ergehen wird als Judas! … Aber wie dem auch sei: Marcus Rattenschreck, ein überzeugter und eiskalter Schlächter, die Leute, die, wie ich sehe –, der Statthalter zeigte auf Jeschuas entstelltes Gesicht, – dich für all deine Predigten prügelten, Dysmas und Gestas, zwei Wegelagerer, die zusammen mit ihren Spießgesellen vier Soldaten erdolchten, und schließlich Judas, ein schmutziger Denunziant – sie alle sind gute Menschen! Nicht wahr?
– Ja –, gab der Häftling zur Antwort.
– Und das Reich der Wahrheit wird kommen?
– Wird kommen, Hegemon –, sagte Jeschua tief überzeugt.
– Es wird niemals kommen! –, schrie plötzlich Pilatus mit einer so schrecklichen Stimme, dass Jeschua zurückwich. So schrie Pilatus vor vielen Jahren im Tal der Jungfrauen seinen Reitern zu: »Haut sie! Haut sie! Der große Rattenschreck sitzt in der Falle!« Jetzt strapazierte er sogar noch mehr seine vom Kommandieren arg angeschlagene Stimme und brüllte, damit auch jeder im Garten ihn deutlich hörte: – Verbrecher! Verbrecher! Verbrecher!
Und, wieder leiser geworden, fragte er:
– Jeschua Ha-Nozri, glaubst du an irgendwelche Götter?
– Gott ist nur einer –, erwiderte Jeschua. – An ihn glaube ich.
– Dann bete zu ihm! Und bete gut! Wobei es dir aber … –, Pilatus’ Stimme erlosch, – nicht wirklich mehr hilft. Hast du ein Weib? –, fragte Pilatus voll unerklärlicher Wehmut, ohne zu wissen, wie ihm geschah.
– Nein, ich bin allein.
– Verfluchte Stadt … –, brummte Pilatus scheinbar grundlos, zuckte die Achseln, als wäre ihm kalt, und rieb sich die Hände, ganz so, als wollte er sie waschen, – … hätte man dich vor deinem Treffen mit Judas von Kirjath erstochen, es wäre wohl besser gewesen.
– Lass mich doch einfach laufen, Hegemon –, bat plötzlich der Häftling, und seine Stimme klang besorgt. – Ich sehe, man will mich töten.
Pilatus’ Gesicht verzog sich im Krampf. Dann richtete er auf Jeschua seine geschwollenen, mit roten Äderchen übersäten Augen und sprach:
– Unglücklicher! Meinst du im Ernst, ein Vertreter des Römischen Reiches würde einen Mann freilassen, der das verkündet, was du verkündest? Ihr Götter, ihr Götter! Soll ich vielleicht so enden wie du? Nein, deine Gedanken teile ich nicht! Und darum höre: Solltest du von diesem Moment an auch nur ein Wort zu jemandem sagen, dann sieh dich vor! Jawohl, dann sieh dich vor!
– Hegemon …
– Mund halten! –, brüllte Pilatus und warf einen wütenden Blick der Schwalbe nach, die erneut auf die Galerie geflitzt war. – Her zu mir! –, rief Pilatus.