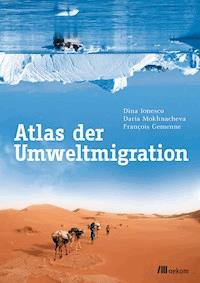Dina IonescoDaria MokhnachevaFrançois Gemenne
Atlas
der Umweltmigration
Aus dem Englischen übertragen vonBarbara Steckhan, Sonja Schuhmacher undGabriele Gockel, Kollektiv Druck-Reif
Die Karten im Atlas der Umweltmigration wurden nach der Vorlage von Karten der United Nations Geospatial Information Section (2012) angefertigt. Für die Richtigkeit der verwendeten Bezeichnungen und der Darstellungen auf diesen Karten wird keine Gewähr gegeben; sie repräsentieren weder die Meinung des Sekretariats der Vereinten Nationen noch der Internationalen Organisation für Migration über den rechtlichen Status der Länder, Territorien, Städte oder Gebiete und der zugehörigen Behörden oder über Grenzen und Ausdehnungen.Die in dieser Publikation präsentierten Grafiken und Materialien reflektieren nicht die Ansichten der Internationalen Organisation für Migration, der Partner des Buches oder die irgendeiner bestimmten Regierung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Deutsche Erstausgabe 2017© 2017 Dina Ionesco und Daria Mokhnacheva (IOM) und François GemenneFranzösische Originalausgabe mit dem Titel »Atlas des Migrations Environnementales«Englische Originalausgabe mit dem Titel »The Atlas of Environmental Migration«All Rights ReservedAuthorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.© der deutschen Ausgabe oekom verlag, München 2017Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Waltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Laura Kohlrausch, oekom verlagKorrektorat: Maike SpechtUmschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.deUmschlagfoto: © Robert Szymanski, shutterstock (o.); © Emmanuelle Combaud, fotolia (u.)Innenlayout + Satz: Ines Swoboda, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96006-178-6
Quelle: Grafik basiert auf Zeichnung von Philippe Rekacewicz, veröffentlicht in »The Atlas of Environmental Migration« und »Atlas des migrations environnementales«, beide 2016.
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vor dem Klima auf der Flucht
Vorworte zur englischen und französischen Ausgabe
Hilfe für Umweltmigranten: ein neuer Imperativ
Das Potenzial ausschöpfen
Abkürzungen und Akronyme
Migration und Umweltmigration heute
Einleitung
Eine lange Geschichte
Eine politische Frage
Eine Welt in Bewegung
Forschungsgeografie
Zahlen und Prognosen
Katastrophen und Flucht
Erzwungen oder freiwillig?
Migrationspfade
Zeiträume
Rückkehrmigration
Umsiedlung
Immobilität
Wohlstandsmigration
Faktoren der Umweltmigration
Einleitung
Geophysikalische Katastrophen
Überschwemmungen, Stürme und Erdrutsche
Dürren, Extremtemperaturen und Flächenbrände
Zerstörung der Ökosysteme
Anstieg der Meeresspiegel und gefährdete Küstenregionen
Unfälle in Industrieanlagen
Infrastruktur und Land Grabbing
Die regionalen Auswirkungen des Klimawandels
Ein multikausales Phänomen
Individuelle Faktoren
Herausforderungen und Chancen
Einleitung
Das Ende der traditionellen Migration
Zirkuläre Migration
Entwicklung, Adaption und Risikomanagement
Demografischer Druck in Risikozonen
Urbanisierung
Sicherheit und Konflikt
Massenflucht steuern
Wahrung der Menschenrechte
Individuelle Bewältigungsstrategien
Geschlecht und Migration
Steuerungsmaßnahmen und politische Lösungen
Einleitung
Die Kosten der Umweltmigration
Die Finanzierung von Maßnahmen
Völkerrecht
Aufbau eines neuen Rechtsrahmens
Regionale Rechtsrahmen
An den Schnittstellen internationaler Politik
Regionale politische Prozesse
Internationale Organisationen
Migration und nationale Anpassungsmaßnahmen
Die Verbindung von Mobilität und Katastrophenmanagement
Migration, Anpassung und Entwicklung
Glossar
Literatur
Dank
Über die Autoren
Liste der konsultierten Experten
Fotonachweise
Vor dem Klima auf der Flucht
Der Klimawandel verändert die Welt. Längst sind seine Folgen keine abstrakten Herausforderungen mehr. Dieser Atlas führt dies eindrucksvoll vor Augen. Er hilft zu verstehen und einzuordnen. Lange schon richten die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor ihr Augenmerk auf diejenigen, die von den Veränderungen am stärksten betroffen sind. Das sind meist die Menschen, die in den Ländern des Südens ohnehin in Armut, Not und Ausgrenzung leben. Immer mehr Menschen sind von der zunehmenden Wüstenbildung, dem Anstieg der Meeresspiegel, von Überschwemmungen oder Dürre betroffen. Auch die Zahl extremer Wetterereignisse nimmt zu. Insbesondere in den Ländern des südlichen Afrika, in Asien oder Mittel- und Südamerika ereignen sich Naturkatastrophen häufiger und mit zunehmender Heftigkeit. Sie treffen hier oft auf besonders arme und verwundbare Regionen, wo es an Möglichkeiten und Mitteln fehlt, sich vor den Gefahren angemessen zu schützen oder sich an sie anzupassen.
Besonders Leidtragende sind oft die ohnehin Armen und Marginalisierten in den sogenannten Entwicklungsländern, deren Widerstands- und Anpassungsfähigkeiten begrenzt sind.
Nach Angaben des Norwegischen Flüchtlingsrats und des International Displacement Monitoring Center wurden seit 2008 im Durchschnitt 26,4 Millionen Menschen jährlich in der Folge von Umwelt- und Klimaveränderungen aus ihrer Heimat vertrieben, die meisten innerhalb der armen Länder des Globalen Südens. Allein aufgrund extremer Wetterereignisse mussten im Jahr 2015 mehr als 14,7 Millionen Menschen in 113 Staaten ihr Zuhause verlassen.
Brot für die Welt und Misereor unterstützen Betroffene vor Ort gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen durch Katastrophenvorsorge und Anpassungsmaßnahmen. Denn extreme und unvorhersehbare klimatische Bedingungen wirken sich beispielsweise stark auf Fischerei und Landwirtschaft aus, die die Existenzgrundlage vieler besonders verletzlicher Menschen bilden. Gleichzeitig setzen wir uns auch mit Lobby- und Advocacyarbeit für die Rechte der Menschen ein, die von Umweltveränderungen und Naturkatastrophen besonders betroffen sind. Gemeinsam treten wir dafür ein, dass Umwelt- und Klimaveränderungen durch die globale Erderwärmung international als Ursachen von Flucht und Migration mehr Anerkennung erfahren. Es braucht für die Betroffenen effektive, rechtlich verbindliche Schutzmechanismen auf nationaler Ebene und über internationale Grenzen hinweg.
Eine verlässliche Aussage darüber, wie viele Menschen tatsächlich aufgrund der Klimawandelfolgen zu Flucht und Migration gezwungen werden, ist schwer möglich. Denn Klima- und Umweltveränderungen sind selten der einzige Grund, das Lebensumfeld zu verlassen. Ursachen dafür können auch der fehlende Zugang zu Land und zu Bildungs- oder Gesundheitsdienstleistungen oder mangelnde Einkommensmöglichkeiten sein. Der Klimawandel verstärkt all diese Gründe und macht auch gewaltsame Konflikte wahrscheinlicher.
Menschen, die aufgrund von Klimawandelfolgen gezwungen sind wegzuziehen, werden nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht als Flüchtlinge anerkannt. Sie haben keinen internationalen Anspruch auf Flüchtlingsschutz oder Unterstützung.
Doch Schutzrechte für die Betroffenen von klima- und umweltbedingter Flucht sind dringend notwendig – für Verbesserungen der Rechtssituation und der Lebensbedingungen der Geflüchteten. Diskussionen über eine mögliche Erweiterung der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) oder eine neue Konvention für Klimaflüchtlinge versprechen momentan jedoch nur wenig Ergebnisse; nicht zuletzt, weil es an politischem Willen der Staaten mangelt.
Dennoch gibt es einige positive Entwicklungen. So ist ein Lichtblick die im Oktober 2015 verabschiedete Nansen-Schutzagenda, die von 109 Staaten unterstützt wird. Sie ist das Ergebnis einer mehrjährigen Konsultation zwischen Ländern, um vom Klimawandel Vertriebene international besser zu schützen. Die Nansen-Schutzagenda bietet praktische Handlungsempfehlungen für den konkreten Umgang mit Entwurzelten und verknüpft humanitäre Hilfe, Menschenrechte, Flüchtlingsschutz, Migration und Anpassung, Risikominderung und Entwicklung. Fortgesetzt wird die Arbeit zur Verwirklichung der Schutzagenda in der neuen »Platform on Disaster Displacement«, die im Mai 2016 ins Leben gerufen wurde.
Auch in der Präambel des Klimavertrags von Paris wird darauf verwiesen, dass Staaten ihren Verpflichtungen gegenüber Migrantinnen und Migranten und anderen besonders verletzlichen Gruppen in der Folge des Klimawandels dringend nachkommen müssen. Im Rahmen der Klimaverhandlungen wird mittlerweile über den Umgang mit unvermeidbaren Schäden und Verlusten gerungen. Dafür wurde ein eigener Mechanismus geschaffen. Das Executive Committee dieses »Warschau-Mechanismus« befasst sich auch mit klimabedingter Vertreibung.
Hohe Erwartungen wurden im Herbst 2016 auch durch die New Yorker Erklärung geweckt. Mit ihr haben es sich alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zur Aufgabe gemacht, zwei globale Pakte zu erarbeiten: einen »Global Compact für sichere, geordnete und reguläre Migration« und ein »umfassendes Rahmenwerk für Flüchtlinge«. Dafür geben sie sich bis Ende 2018 Zeit. Es geht darum, dass alle Verantwortung für Menschen übernehmen, die fliehen müssen. Umwelt- und Klimaveränderungen werden explizit genannt. Diese betroffenen Menschen gilt es zu schützen und zu unterstützen.
Nicht alle, die unter den veränderten Wetterbedingungen leiden, können es sich leisten, sich selbst und ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Um größere Distanzen zurücklegen zu können, braucht es vor allem Ressourcen, über die viele der Betroffenen aufgrund von Armut und Ausgrenzung gar nicht verfügen. Kinder, Frauen, alte und kranke Menschen sind besonders häufig gezwungen zu bleiben. Außerdem ist Migration vielerorts streng reguliert oder sogar verboten. Um die vom Klimawandel und Naturkatastrophen Betroffenen zu unterstützen, müssen deswegen zunächst Risikogebiete und besonders gefährdete Haushalte identifiziert werden. Sie müssen in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen die Klimawandelfolgen gestärkt werden, indem die Risiken erkannt und Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden – zum Beispiel, indem dürreresistentes Saatgut in der Landwirtschaft verwendet wird oder nachhaltige Deichsysteme zum Umgang mit großen Wassermassen errichtet werden. Wichtig sind Entwicklungsprogramme, die die allgemeine Widerstandsfähigkeit der Betroffenen stärken.
Doch gerade weil es schon heute vielerorts nicht mehr möglich ist, Schäden und Verluste infolge des Klimawandels durch Schutz und Anpassungsvorkehrungen vorzubeugen, brauchen die besonders Verwundbaren Unterstützung. Diese kann die Begleitung notwendiger Umsiedlungen einschließen. Wichtig ist jedoch bei all diesen Maßnahmen, dass die Betroffenen nicht nur informiert, sondern einbezogen und beteiligt werden. Ihre Rechte und Bedürfnisse müssen an erster Stelle stehen. Brot für die Welt und Misereor unterstützen deshalb auch innovative Maßnahmen zur Klimaanpassung für besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen, durch die beispielsweise für Kleinbauernfamilien neue Möglichkeiten der Trinkwassererschließung oder zusätzliche Einkommen entwickelt werden.
Um die negativen Folgen des Klimawandels zu bremsen, muss an erster Stelle die globale Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius, besser noch unterhalb 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Dazu ist die drastische Minderung der Treibhausgasemissionen unverzichtbar. Humanitäre Hilfe muss als kurz- und mittelfristiges Instrument zum Überleben akuter Krisen und Notlagen gestärkt werden. Für Anpassungsstrategien in besonders betroffenen Ländern oder Regionen ist neben finanzieller auch technische Unterstützung nötig. Selbst wenn sich der Anteil von öffentlichen Mitteln für Anpassungsmaßnahmen bis zum Jahr 2020 verdoppelt, bedeutet dies, dass dann immer noch weniger als 20 Prozent der internationalen Klimafinanzierungsmittel für Anpassung vorgesehen sind. Es gibt bisher auch keine völkerrechtlich bindenden Verpflichtungen für die Bereitstellung von Klimafinanzierung für den Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten. Diese Gerechtigkeitslücke muss geschlossen werden. Ein Fonds ähnlich dem »Grünen Klimafonds«, der auch Mittel für Klimaschäden verpflichtend bereitstellt, könnte Abhilfe schaffen.
Migration muss als legitime und in vielen Fällen existenzielle Überlebensstrategie akzeptiert und ermöglicht werden. Das ist auch im Sinn der Agenda 2030, in der sich die Staatengemeinschaft verpflichtet, »eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen [zu] erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik«. Internationale Migration muss im Einklang mit den Menschenrechten reguliert werden. Das kann die Staatengemeinschaft gewährleisten, indem Völkerrecht respektiert wird und legale Migrationsmöglichkeiten für vom Klimawandel vertriebene Menschen geschaffen werden. Es ist daher wichtig, dass die Staaten, aus denen die betroffenen Menschen kommen, mit jenen Lösungen erarbeiten, in denen sie Aufnahme suchen.
Die Folgen des Klimawandels und mit ihnen die Umweltmigration sind eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dieser Atlas verdeutlicht dies eindrücklich.
Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und gute Anregungen für die weitere Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Dr. Klaus SeitzLeiter der Abteilung Politik,Brot für die Welt
Dr. Bernd BornhorstLeiter der Abteilung Politik undGlobale ZukunftsfragenMisereor
Hilfe für Umweltmigranten: ein neuer Imperativ
Gegenwärtig sind wir Zeugen menschlicher Mobilität in einem nie da gewesenen Ausmaß. Von den 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten befinden sich über 1 Milliarde innerhalb oder außerhalb ihres Landes auf der Wanderung – mit anderen Worten: einer von sieben.
Diese Mobilität hat vielfältige, miteinander zusammenhängende Ursachen: Armut, die Suche nach besseren Lebensmöglichkeiten, die Ungleichheit zwischen Nord und Süd, Konflikte, Mangel an Arbeitsplätzen, die demografischen Entwicklungen und die digitale Revolution – aber auch Umweltfaktoren, vor allem Naturkatastrophen und der Klimawandel, mit anderen Worten die Faktoren, die Gegenstand des Atlas der Umweltmigration sind.
Im Jahr 2015 wurden über 19 Millionen Menschen aufgrund von Naturkatastrophen zu Binnenflüchtlingen, eine Zahl, bei der die allmähliche Umweltzerstörung oder Dürren noch nicht berücksichtigt sind.
Menschliche Migration steht seit jeher in Zusammenhang mit der Umwelt, doch das politische Bewusstsein für diesen Zusammenhang ist relativ neu. Wir wissen inzwischen, dass zu den Ursachen der gegenwärtigen Migrationskrise auch Phänomene wie der Klimawandel und seine Folgen gehören, also Bodendegradation, häufigere und extremere unvermittelt auftretende Ereignisse, Wüstenbildung, Wasserknappheit und wiederkehrende Dürren.
Wir wissen auch, dass zukünftig eine erhebliche Anzahl von Menschen vom Anstieg der Meeresspiegel, von Küstenerosion, Versauerung der Meere und Bodenversalzung betroffen sein werden und sie unter Umständen mit Migration darauf reagieren. All diese Widrigkeiten und die damit einhergehende Verzweiflung bewegt Menschen, die oft Opfer krimineller Schleppernetze werden, dazu, unter Lebensgefahr Meere und Wüsten zu überwinden.
Im Jahr 2014 begaben sich etwa 220.000 Migranten mit ungeklärtem Status auf den Weg über das Mittelmeer nach Europa, 2015 waren es bereits 1 Million – eine Rekordzahl im Vergleich zu früheren Jahren. Leider brach das Jahr 2015 noch einen weiteren Rekord: Im Mittelmeer kamen 3772 und weltweit 5393 Menschen bei der Flucht ums Leben. Bei alledem darf man nicht vergessen, dass Flüchtlingsströme ein globales Phänomen sind: Es gibt sie im Golf von Aden, in der Karibik zwischen Haiti und dem Süden Floridas, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sowie in Südasien, um nur einige Beispiele zu nennen.
Angesichts dieser Situation ist keine Zeit mehr nur für Trauer und Bedauern. Es ist Zeit zu handeln. Dazu aber müssen wir zunächst mehr über die komplexen Zusammenhänge zwischen menschlicher Mobilität, Umwelt und Klimawandel wissen. Anschließend gilt es, eine Reihe von falschen Annahmen zu revidieren.
Allzu oft ist von erzwungener Flucht lediglich im Zusammenhang mit Naturkatastrophen die Rede. Der menschliche Preis, den sie fordern, bleibt natürlich weiterhin erschreckend und viel zu hoch, doch unter ihrem Eindruck vergessen wir leicht die Mobilität als Folge einer allmählichen Umweltzerstörung und die vielen Betroffenen, die nicht über die Mittel für eine Migration als Überlebensstrategie verfügen.
Allzu oft vernachlässigen wir auch die tatsächliche Situation im Herkunftsland oder in dessen einzelnen Regionen sowie die Süd-Süd-Dimension der Umweltmigration und entwerfen alarmierende Szenarien, die der Realitätsprüfung kaum standhalten. Oder aber wir ignorieren den Umweltaspekt, der sich aufgrund der engen Verknüpfung mit anderen – beispielsweise wirtschaftlichen – Ursachen nur äußerst schwer isoliert betrachten lässt.
Und immer noch vergessen wir oft, dass viele individuelle Faktoren die persönliche Entscheidung beeinflussen und die Migration alles andere als eine mechanische Reaktion ist.
Und schließlich ignorieren wir allzu oft den positiven Beitrag, den Migranten zur Wirtschaft ihrer Herkunfts- oder Zielregionen und -länder leisten. Gleiches gilt für die Vorteile, die Migration mit sich bringt, und die Rolle der Migranten bei den Bemühungen um Anpassung an den Klimawandel.
Was mir vorschwebt, ist eine Welt, in der das Potenzial der Migration erkannt und geschätzt wird, in der Menschen, die nicht ab- oder auswandern wollen, aber auch die Möglichkeit offensteht, in ihrer Region oder in ihrem Land zu bleiben. Migration kann auf effektive und respektvolle Art gesteuert, geplant, erleichtert und organisiert werden. Maßnahmen zum Schutz betroffener Bevölkerungen dienen der Prävention, sind aber auch ein Aspekt des effektiven Managements der durch Umweltveränderungen ausgelösten Migration. Wir können beispielsweise mehr legale Migrationswege eröffnen, die Mobilität durch Programme zur Rückkehr- und Saisonmigration verbessern und befristete Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) ist davon überzeugt, dass Migration in Anbetracht der demografischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Realität unausweichlich, für die Prosperität der Länder zugleich aber auch notwendig und sogar wünschenswert ist, vorausgesetzt, sie wird mit Bedacht gesteuert und findet unter Respektierung der Menschenrechte statt.
Doch Umweltmigration ist nicht nur ein Thema für die Migrationspolitik. Sie hat auch Folgen für eine Vielzahl anderer Politikfelder, insbesondere für Entwicklung, humanitäre Hilfe, Katastrophenrisikominderung, urbanes und Landmanagement und natürlich für den Klimaschutz, dem dieser Atlas eine besondere Bedeutung zumisst. Die »Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung« und das »UN-Sendai-Rahmenwerk zur Katastrophenvorsorge«, beide 2015 verabschiedet, erkennen Migranten offiziell als wichtige Gruppe an und betonen nicht nur ihre Vulnerabilität, sondern auch ihre besonderen Stärken.
Seit 2010 würdigen die Nationen die Bedeutung der menschlichen Mobilität, wie sich in mehreren Entscheidungen bei Klimaverhandlungen zeigt. Die Erwähnung der Migrantenrechte im bei der COP21 (2015) ausgehandelten Pariser Abkommen stellt in dieser Hinsicht einen historischen Schritt nach vorn dar. Nun gilt es, Mobilitätsfragen auch in die weiteren kollektiven Klimaschutzmaßnahmen und deren Finanzierung einzubeziehen, wollen wir die Hauptursachen angehen und es Migranten ermöglichen, sich als verantwortliche, pflichtbewusste und engagierte Beteiligte am Kampf gegen den Klimawandel Geltung zu verschaffen. Die IOM hat in dieser Hinsicht ebenfalls Fortschritte erzielt, seit ihre Mitgliedsstaaten die Schaffung einer Abteilung gebilligt haben, die sich dem Thema Migration, Umwelt und Klimawandel widmet und die Anfang 2015 ihre Arbeit aufgenommen hat. All dies sind klare Hinweise darauf, dass der Zusammenhang zwischen Umwelt- und Migrationsfragen inzwischen erkannt wird. Wir können es uns nicht mehr leisten, die – für unsere Zeit konstitutive – menschliche Mobilität als Bestandteil der kollektiven Anstrengungen zum Schutz unseres Planeten zu ignorieren.
Die Veröffentlichung des Atlas der Umweltmigration ist Bestandteil unseres Bemühens um die Verbreitung fundierter und ausgewogener Informationen über die Migration in unserer Zeit. Er ist Ergebnis der mehr als 20-jährigen konzentrierten Arbeit der IOM unter Beteiligung von Forschern und Professoren zu Fragen der Umweltmigration und spiegelt den gegenwärtigen Kenntnisstand wider. Zugleich ist er Ausdruck einer Sichtweise, die Migranten und ihre Gemeinschaften in den Mittelpunkt der gegenwärtigen Betrachtungen rückt. Wir müssen notleidende und von plötzlichen oder sich allmählich entwickelnden Katastrophen getroffene Migranten, die ihr Heim und ihre Angehörigen verlassen haben, schützen und unterstützen. Und wenn sie sich als verantwortliche Akteure an der Entwicklung ihrer Herkunfts- oder Zielregion und an Anpassungsmaßnahmen beteiligen, müssen wir ihnen zur Seite stehen.
Um die Lücken aufzuzeigen, die es zu füllen gilt, vermitteln uns die Autoren des Atlas mit vorbildlicher Redlichkeit nicht nur die vorhandenen Kenntnisse über Umweltmigration, sondern benennen auch das, was wir noch nicht wissen. Indem sie die klimatischen und ökologischen Wirklichkeiten zugleich in den Blick nehmen, tragen die Autoren dazu bei, mehr Licht auf die vielfältigen Zusammenhänge zwischen diesen Feldern zu werfen.
All diese Themen in einem Atlas zusammenzufassen – eine Arbeit, die Präzision und Kreativität erfordert – ist eine mutige Entscheidung, denn es bedarf der Fähigkeit, hochkomplexe Sachverhalte zu vereinfachen und grafisch darzustellen. Ich schätze mich glücklich, dass ich dieses Unterfangen unterstützen konnte, und möchte meine Anerkennung für die gemeinsame Arbeit der drei Autoren zum Ausdruck bringen, die ihre wissenschaftliche und internationale Erfahrung hier eingebracht haben.
Der Atlas der Umweltmigration ist daher meiner Meinung nach mehr als ein Buch.
Er ist auch das Resultat unserer Bemühungen, auf die Bedeutung der Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Mobilität hinzuweisen und planvolle und effektive Antworten auf die durch diese Art der Migration entstehenden Herausforderungen auf politischer Ebene wie auch in der breiten Öffentlichkeit zu fördern.
Und schließlich ist der Atlas auch Ausdruck unserer Zusammenarbeit mit Partnern. Zum einen mit der akademischen Welt: Forscher, Kartografen und Studenten haben einen großen Anteil an seiner Entstehung. Zum anderen mit einem breiten Spektrum von Akteuren, die an der Konzeption und Realisierung beteiligt waren, entweder indem sie ihre Kenntnisse und Expertise zur Verfügung gestellt haben oder durch finanzielle Unterstützung: Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, der öffentliche wie der private Sektor und vor allem das Verlagswesen. Ihnen allen bin ich ausgesprochen dankbar, dass sie bereit waren, sich in dieses Abenteuer zu stürzen.
Ich hoffe sehr, dass dieser Atlas zur Verbreitung des gegenwärtigen Wissens über Umweltmigration beiträgt und sich für alle als nützlich erweisen wird.
William Lacy SwingGeneraldirektor der InternationalenOrganisation für Migration
Das Potenzial ausschöpfen
Lange Zeit ignoriert, gelangen die Themen Migration und Umweltzerstörung unter dem Druck der Ereignisse mehr und mehr auf die politische Tagesordnung. Dass dies für die beiden Themen gleichzeitig gilt, ist nicht weiter überraschend.
Klimawandel und Umweltzerstörung treffen die ländliche arme Bevölkerung der Erde zuerst und zugleich am härtesten. Drei Viertel der Landbewohner sind arm, und 86 Prozent können ohne Land nicht überleben. Weltweit sind mindestens 1,5 Milliarden Menschen auf die Bewirtschaftung degradierter, scheinbar von unbeherrschbaren Kräften gestresster Böden angewiesen. In einer Zeit des drastischen Klimawandels, in der die Erde austrocknet und die Meeresspiegel steigen, wird sich der Kampf um lebensnotwendige Ressourcen verschärfen, und Gemeinschaften werden sich auflösen. Die saisonale Migration, die sich schon heute als Reaktion auf dürftige Ernten beobachten lässt, wird sich womöglich zur dauerhaften Migration ausweiten, wenn Ernten ganz ausbleiben oder eine Dürre zuschlägt.
Lösungen für diese Probleme, die lediglich auf dem Gedanken der Eindämmung beruhen, führen zu beispielloser Armut, Verletzung der Menschenrechte und noch mehr erzwungener Migration. Die Folgen solcher nicht ganzheitlich angelegter Maßnahmen sind die dramatisch angestiegene Zahl an Todesopfern unter den Migranten und das zunehmende Leid auf dem Meer, in den Wüsten und entlang der Ländergrenzen. Wenn nicht beides ausreichend berücksichtigt und rechtzeitig angegangen wird, sind soziale Unruhen und ein Anstieg der Gewalt die unweigerliche Folge.
Doch durch entschlossene Maßnahmen, bei denen die Abhängigkeit der Menschen von ihrem Land im Mittelpunkt steht, können wir alle schützen. Wir können gefährdete Gemeinschaften dabei unterstützen, ihre Böden zu sanieren, bevor ihre Lage ausweglos wird; wir können Regierungen dabei helfen, Landrechte zu sichern, neue Arbeitsplätze für saisonale Migranten zu schaffen und die Möglichkeiten für landgebundene Investitionen zu erweitern. Indem wir die Degradationstendenz umkehren, schaffen wir Alternativen, fördern den sozialen Zusammenhalt und beseitigen zumindest einige Auslöser für Radikalisierung und Konflikte.
Gerade langsam einsetzende Ereignisse wie Wüstenbildung, Bodendegradation und Dürren ermöglichen es uns, zu planen und einzugreifen. Für eine Vermeidung umweltbedingter Flucht und Massenmigration sind die Schaffung resilienter Gemeinschaften und die Sicherung der natürlichen Ressourcen, von denen sie abhängig sind, unabdingbar. Es kann einfach sein und muss nicht viel kosten, das Land vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Zu einem rechtzeitigen Eingreifen gehört aber auch, die Stärken der Migranten selbst zu nutzen. Migranten besitzen eine Reihe äußerst wertvoller Fähigkeiten. Mit den richtigen Anreizen kann man sie dazu bewegen, zu investieren und damit geschädigte Ökosysteme wie auch ganze Gemeinschaften zu stabilisieren. Die Heimatüberweisungen der Migranten in das subsaharische Afrika belaufen sich auf etwa 40 Milliarden Dollar jährlich. Es könnte viel erreicht werden, wenn diese Gelder nachhaltig investiert würden. Nehmen wir beispielsweise Äthiopien: Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 15 Millionen Hektar degradierte und entwaldete Böden wieder produktiv zu machen – das ist ein Sechstel der gesamten Landfläche. Heimatüberweisungen an die Familien in Höhe von durchschnittlich 500 Dollar pro Jahr wurden gewöhnlich für kurzfristige Konsumbedürfnisse wie Nahrungsmittel verwendet. In ländlichen Gebieten fließt dieses Geld jedoch inzwischen zunehmend in die Rückzahlung von Schulden oder wird investiert, um die Resilienz der Böden gegen den Klimawandel zu stärken. Zurückkehrende Migranten führen neue, klimaresiliente Methoden der Landwirtschaft ein. Auf diese Weise werden Arbeitsplätze für die ländliche Jugend geschaffen, die sonst vielleicht selbst abwandern würde.
Auch Senegal fördert Maßnahmen und Programme, mit denen Investitionen aus der Dispora in Landentwicklungsprojekte gelenkt werden, ist man sich der Zusammenhänge zwischen Bodendegradation und Migration sowie des Potenzials dieser Zahlungen für die Entwicklung nur allzu bewusst. Die Regierung und die zuständigen Behörden sorgen für das geeignete Umfeld, um Unternehmer aus dem Kreis der Migranten anzulocken, etwa durch günstige Kredite und Landnutzungskonzessionen. Bislang ist die Nachfrage der Diaspora nach Investitionen im Land beeindruckend.
Wenn wir an solche Erfolge anknüpfen und uns unvoreingenommen dem Zusammenhang zwischen Migrations- und Umweltfragen stellen, können wir das enorme Potenzial der Migranten nutzen, um die Resilienz der Gemeinschaften in ihrem Herkunftsland zu festigen. Der Atlas der Umweltmigration schärft unser Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Migration und ökologischen Entwicklungen. Die entsprechenden Dynamiken zu erkennen und Lösungen dafür zu finden, bevor noch mehr Menschenleben und Ressourcen unwiederbringlich verloren gehen, ist entscheidend für uns alle und für unsere gemeinsame Zukunft.
Monique BarbutGeschäftsführerin der Konventionder Vereinten Nationenzur Bekämpfung der Desertifikation
Abkürzungen und Akronyme
ACHR American Convention on Human Rights (Amerikanische Menschenrechtskonvention)
ADB Asian Development Bank (Asiatische Entwicklungsbank)
ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Bolivarianische Allianz für die Völker unseres Amerika)
AOSIS Alliance of the Small Island States (Allianz der Kleinen Inselstaaten)
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Verband Südostasiatischer Nationen)
AU African Union (Afrikanische Union)
AUC African Union Commission
BBC British Broadcasting Corporation
BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Zentralbank Westafrikanischer Staaten)
BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMU Stiftung für Bevölkerung, Migration und Umwelt (BMU)
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UN-Antifolterkonvention)
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; auch kurz: Frauenkonvention)
CEDEM Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations, Universität Lüttich
CEGIS Center for Environmental and Geographic Information Services, Bangladesch
CERPOD Centre d’Etudes et de Recherche en Population pour le Développement in Bamako
CHRR Center for Hazards and Risk Research, Columbia University
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical (Internationales Zentrum für tropische Landwirtschaft)
CIESIN Center for International Earth Science Information Network, Columbia University
CIFOR Center for International Forestry Research (Internationales Forschungszentrum für Forstwirtschaft)
CO2 Kohlenstoffdioxid
COHRE Centre on Housing Rights and Evictions
COIN Climate Outreach Information Network
COP Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-Klimakonferenzen)
COST European Cooperation in Science and Technology (Initiative für Europäische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik)
CPI Climate Policy Initiative
CRC Convention on the Rights of the Child (Übereinkommen über die Rechte des Kindes)
CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
CRS Convention on the Reduction of Statelessness (UN-Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit)
CSSP Convention relating to the Status of Stateless Persons
CVF Climate Vulnerable Forum
CVM Climate Vulnerability Monitor
DCCED Department of Commerce, Community and Economic Development, Alaska
DECCMA »Deltas, Vulnerability and Climate Change: Migration and Adaptation« (Projekt)
DFID UK Government’s Department for International Development (Ministerium für Internationale Entwicklung, GB)
DRC Democratic Republic of the Congo (Demokratische Republik Kongo)
DRM Disaster risk management (Katastrophenrisikomanagement)
DRR Disaster Risk Reduction (Katastrophenrisikoverminderung)
DTM Displacement Tracking Matrix (Informationssystem der IOM zur Beobachtung von Vertreibungen)
EAC East African Community (Ostafrikanische Gemeinschaft)
EACH-FOR Environmental Change and Forced Migration Scenarios (Szenarien des Umweltwandels und von Zwangsmigrationen)
EC European Commission (Europäische Kommission)
ECLAC United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik)
ECOWAS Economic Community of West African States (Westeuropäische Wirtschaftsgemeinschaft)
EJ Atlas Atlas of Environmental Justice
ELI Environmental Law Institute
EM-DAT Emergency Events Database (Internationale Katastrophendatenbank)
EPA Ghana Ghana Environmental Protection Agency (Umweltschutzbehörde Ghana)
EU Europäische Union
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen)
FEMA Federal Emergency Management Agency
Foresight Foresight Project of the United Kingdom Government Office for Sciences
GCF Green Climate Fund
GEF Global Environment Facility
GFMD Global Forum on Migration and Development (Globales Forum für Migration und Entwicklung)
GIS Geographic Information System (Geografisches Informationssystem)
GMG Global Migration Group
HBS Heinrich-Böll-Stiftung
HFA Hyogo Framework for Action (Internationaler Aktionsplan zur Katastrophenvorsorge)
IAI Inter-American Institute for Global Change Research
IASC Inter-Agency Standing Committee (Ständiger interinstitutioneller Ausschuss)
IASS Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte)
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung)
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte)
ICMPD International Centre for Migration Policy Development
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen)
ICRPD International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, UN-Behindertenrechtskonvention)
IDDRI Institut du développement durable et des relations internationales (Institut für nachhaltige Entwicklung und internationale Beziehungen)
IDM International Dialogue on Migration
IDMC Internal Displacement Monitoring Centre
IDP Internally Displaced Person (Binnenflüchtling)
IFAD International Fund for Agricultural Development (Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung)
IFPRI International Food Policy Research Institute
IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Internationale Rotkreuz- und Rot-halbmond-Bewegung)
IGAD Intergovernmental Authority on Development (Internationale Entwicklungsbehörde)
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
ILC International Law Commission (Völkerrechtskommission)
ILO International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation)
IO International Organization (Internationale Organisation)
IOM International Organization for Migration (Internationale Organisation für Migration)
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat)
ISSA International Social Security Association (Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit, IVSS)
ISSP Institut Supérieur des Sciences de la Population, University of Ouagadougou
IT Informationstechnologie
IUCN International Union for Conservation of Nature (Internationale Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen)
kBq Kilobecquerel
KNMI Koninklijk Nederlands Meteoro-logisch Instituut (Königlich Niederländisches Meteorologisches Institut)
LIENSs Laboratoire Littoral Environnement et Sociétés, Université de La Rochelle
MCII Munich Climate Insurance Initiative
MDG Millennium Development Goals (Milleniumsentwicklungsziele)
MECC Migration, Environment and Climate Change
MECLEP Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy
MICIC Migrants in Countries in Crisis Initiative
MRS Migration Research Series
NAP National Adaptation Plan (Nationaler Anpassungsplan)
NAPA National Adaptation Programme of Action (Nationaler Aktionsplan zur Anpassung)
NASA-SEDAC National Aeronautics and Space Administration’s Socioeconomic Data and Applications Center
NGI Norwegian Geotechnical Institute
NGO Non-Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation)
NI Nansen-Initiative
NRC Norwegian Refugee Council (Norwegischer Flüchtlingsrat)
NWRD National Water Resources Database, Bangladesch
OAS Organization of American States (Organisation Amerikanischer Staaten)
OAU Organization of African Unity (Organisation für Afrikanische Einheit)
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Amt für die Koordination humanitärer Angelegenheiten)
ODA Official Development Aid (Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit)
ODI Overseas Development Institute
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OECD DAC OECDs Development Assistance Committee (OECD-Ausschuss für Entwicklungshilfe)
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
PPGG Programa de Pós-Graduação em Geografa (Postgraduiertenprogramm Geografie an der PUC Minas)
PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad (Nationales Sozialprogramm, Mexiko)
PUC Minas Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Päpstliche Universität von Minas Gerais, Brasilien)
RCP Regional Consultative Process on Migration
RESAMA Rede Sul Americana para as Migrações Ambientais (Südamerikanisches Netzwerk für Umweltmigration)
RSE Recognized Seasonal Employers Programme (Offizielles Saisonarbeitsprogramm Neuseeland)
SAARC South Asian Association for Regional Cooperation (Südasiatische Vereinigung für regionale Kooperation)
SADC Southern African Development Community (Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika)
SDGs Sustainable Development Goals (Ziele nachhaltiger Entwicklung)
SIDS Small Island Developing States (Kleine Inselentwicklungsländer)
SLM Sustainable Land Management (Nachhaltige Landbewirtschaftung)
SOAS School of Oriental and African Studies, University of London
SRES Special Report on Emissions Scenarios (Sonderbericht über Emissionsszenarien)
TCLM Temporary and Circular Labour Migration Programme, Kolumbien
TPMA Thematic Programme on Migration and Asylum
TPS Temporary Protection Status (Temporärer Schutzstatus)
UDHR Universal Declaration of Human Rights (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)
UN United Nations (Vereinte Nationen)
UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity (Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt)
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification (Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, UN-Wüstenkonvention)
UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs (Sozial- und Wirtschaftsprogramm der Vereinten Nationen)
UNDP United Nations Development Programme (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)
UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa)
UNEP United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
UNEP/GRID-Geneva United Nations Environment Programme Global Resource Information Database, Genf
UNESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik der Vereinten Nationen)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Rahmenkonvention der Vereinten Nationen über Klimaänderungen)
UNGA United Nations General Assembly (UN-Generalversammlung)
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen)
UNICEF United Nations Children’s Fund (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)
UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction (Internationale Strategie der Vereinten Nationen zur Katastrophenvorsorge)
UNU-EHS United Nations University Institute for Environment and Human Security (Universität der Vereinten Nationen, Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit)
UP Unió de Pagesos de Catalunya (Katalanischer Bauernverband)
USAID United States Agency for International Development (Behörde der Vereinigten Staaten für Internationale Entwicklung)
UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
V20 Vulnerable Twenty Group of Ministers of Finance (Finanzminister der 20 am stärksten vom Klimawandel bedrohten Staaten)
WB World Bank (Weltbank)
WCDRR World Conference on Disaster Risk Reduction (UN-Weltkonferenz zur Minderung von Naturkatastrophen)
WFP World Food Programme (Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen)
WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen)
WMO World Meteorological Organization (Weltorganisation für Meteorologie)
WWF
Kapitel 1
Migration und Umweltmigration heute
In den ersten Theorien zur Migration, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, wurden Umweltbedingungen mitbedacht. Aber dieser Faktor geriet schnell in Vergessenheit – ein Zustand, an dem sich bis Anfang der 1990er-Jahre nichts änderte.
In der Migrationspolitik von heute hat dieses Versäumnis Narben hinterlassen. Sie gründet immer noch in einem binären Verständnis von Migration, das noch aus der Nachkriegszeit stammt: Entweder sehen sich Migranten aus politischen Gründen zur Flucht gezwungen, suchen also Schutz im Ausland, oder sie machen sich aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig auf den Weg, und ihre Aufnahme liegt allein in der Verantwortung der Staaten. Dieser Binarismus trat im Sommer 2015 mit dem Zustrom von Flüchtlingen – insbesondere aus Syrien – nach Europa und der daraus resultierenden Asylkrise deutlich zutage. Regierungen und Medien beeilten sich, den Unterschied zwischen Flüchtlingen (politisch) und Migranten (wirtschaftlich) zu unterstreichen, als müsste man Menschen kategorisieren, um einen Teil aufzunehmen und den anderen Teil, deren Migrationsprojekt und Anwesenheit unrechtmäßig sei, abzuschieben. Es ist jedoch eine anerkannte Tatsache, dass eine solche Unterscheidung der Realität der Migrationsdynamik, in der politische, wirtschaftliche und Umweltfaktoren verwoben sind, nicht standhält.
Seit die Umweltmigration Mitte der 2000er-Jahre in den Vordergrund gerückt ist, ist diese Dichotomie hinfällig. Es stellte sich dabei nicht nur heraus, dass der Umweltfaktor einfach nicht berücksichtigt worden war, als nach dem Zweiten Weltkrieg Einwanderungs- und Flüchtlingsgesetze geschaffen wurden, ungeachtet der Tatsache, dass dieses Phänomen uralt ist, sondern auch, dass Migration eine Lösung für die Anpassung an den Klimawandel darstellen könnte – ein Aspekt, der die traditionelle Trennlinie zwischen erzwungener und freiwilliger Migration infrage stellt.
Ein polymorphes Konzept
Der Klimawandel brachte die »Wiederentdeckung« der Umwelt als bestimmenden Faktor der Migration, und zwar von dem Augenblick an, in dem man darin – zu Recht – eine große Bedrohung für menschliche Bevölkerungen sah, die sich zuallererst in Form massiver Wanderungsbewegungen manifestieren werde. Obwohl dieses Phänomen bereits 1948 und in den 1970er-Jahren wissenschaftlich untersucht wurde, begann eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema erst in den 1990er-Jahren nach dem Erscheinen eines vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 1985 in Auftrag gegebenen Berichts. Ab Mitte der 2000er-Jahre wurden die Auswirkungen des Klimawandels Realität, und die Welt wurde von mehreren großen Naturkatastrophen erschüttert. Umweltmigration steht seither auf der Agenda aller Migrationsstudien.
Hinter dem Oberbegriff »Umweltmigration« verbergen sich jedoch unzählige verschiedene Dynamiken. Zu den Umweltmigranten gehören Dorfbewohner in Bangladesch, die ihr Land wegen wiederholter Überschwemmungen aufgeben müssen, ebenso wie amerikanische Rentner, die nach Florida ziehen, um die Sonne zu genießen. Und die Bewohner kleiner pazifischer Inseln, die ihr Land verlassen, ehe der Anstieg der Meeresspiegel ihre Heimat unbewohnbar macht, zählen ebenso dazu wie Haitianer, die in einem Lager leben, weil ihre Häuser durch ein Erdbeben zerstört wurden. Man kann argumentieren, das Einzige, was diese Migrationsbeispiele gemeinsam hätten, sei der Bezug zur Umwelt. Umweltmigration kann erzwungen oder freiwillig, vorübergehend oder dauerhaft sein und innerhalb eines Landes stattfinden oder nationale Grenzen überschreiten. Dabei darf aber die Kehrseite nicht vergessen werden: die erzwungene Immobilität vieler Bevölkerungsgruppen, die den Folgen von Umweltveränderungen nicht entkommen können. Der Begriff »Umweltmigration« deckt eine solche Bandbreite unterschiedlicher Situationen ab, dass er zuweilen unzureichend erscheint und durch den Begriff »Mobilität« ersetzt wird. Der Begriff »Mobilität« ist weniger umstritten, denn er umfasst verschiedene Formen der Wanderung und verweist auf die Migrationsfähigkeit. Damit lässt sich auch die äußerst unscharfe Unterscheidung zwischen erzwungener und freiwilliger Migration umgehen.
Unabhängig von der empirischen Wirklichkeit sind diese Begriffe auch politische Konstrukte, die hilfreich dabei sind, die wachsende Tragweite von Umweltschäden als Migrationsfaktor zu beleuchten. Es geht weniger darum, eine bestimmte Kategorie von Migration zu etablieren, als darum – wie es dieser Atlas tut –, die Aufmerksamkeit auf einen vernachlässigten Faktor zu lenken, dessen Bedeutung in Zukunft zunehmen wird.
Eine heikle Definition
Wie können Umweltmigranten also definiert werden? Da eine juristische Definition fehlt oder jedenfalls eine international anerkannte, wird häufig auf die IOM-Definition zurückgegriffen: Umweltmigranten sind »Personen oder Personengruppen, die aufgrund plötzlicher oder fortschreitender deutlicher Veränderungen der ihr Leben beeinflussenden Umwelt- und Lebensbedingungen gezwungen sind oder sich veranlasst sehen, ihr Zuhause zu verlassen, sei es zeitweise oder permanent, und die sich innerhalb ihres Heimatlandes oder über dessen Grenzen hinaus bewegen«.
Über diese bewusst weit gefasste Formulierung, die alle Typen von Bevölkerungsbewegungen umfassen soll, wird in der Wissenschaft diskutiert, weil sie per definitionem sehr viele Menschen einschließt, eine Tatsache, die bestimmte Regierungen beunruhigen und veranlassen könnte, künftig weniger Geld bereitzustellen.
Geht man davon aus, dass jede Migration multikausal ist, sollte dann die Definition alle umfassen, die aus Umweltgründen wandern – auch jene, deren Entscheidung zur Migration nur am Rande durch Umweltgründe beeinflusst wurde? Oder nur jene, für die Umweltschäden der ausschlaggebende Faktor sind? Sollte sie nur Fälle der erzwungenen Migration abdecken oder alle Formen der Mobilität? Und wie steht es mit der erzwungenen Immobilität?
All diese Fragen sind nicht rein methodologischer, sondern auch politischer Natur, denn Charakter und Wortwahl der Definition haben Einfluss auf die Lösungen. Derzeit geht niemand das Wagnis ein, eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung zu treffen, und jeder gibt sich mit der Mehrdeutigkeit einer Definition zufrieden, die absichtlich breit und flexibel formuliert ist.
Zahlen und Worte
Der erste Teil des Atlas der Umweltmigration widmet sich zunächst den Schätzungen zur derzeitigen Zahl der Umweltmigranten und den verschiedenen Prognosen, die aufgestellt wurden. Auf welchen Methoden und Modellen beruhen diese Schätzungen und Prognosen? Welche Migrationsformen werden berücksichtigt, und wie genau wird hier gemessen? Nach welchen Kriterien werden sie unterschieden? Dabei wird deutlich, dass sich die Forschung zu diesen Fragen in den vergangenen Jahren zwar erheblich weiterentwickelt hat, aber auch, wie komplex die Gleichung wird, wenn Migrations-, Umwelt- und Klimavariablen miteinander verbunden werden. Unterstrichen wird damit auch, wie schwierig es ist, klare Migrationskategorien aufzustellen und sie in der Praxis zu unterscheiden.
Verschiedene Migrationsformen
Quelle: Entworfen von F. Gemenne, © IOM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Boissière, 2015.
Eine lange Geschichte
In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es zahlreiche Beispiele für Wanderungen, die mit Umweltveränderungen und -katastrophen zusammenhingen.
1755 zerstörte das Erdbeben von Lissabon einen Großteil der Stadt und löste Massenwanderungen in andere Teile Portugals aus, wobei einige der Geflüchteten später nach Lissabon zurückkehrten. Die Dust-Bowl-Migration in den USA ist ein weiteres klassisches Beispiel für eine Massenwanderung im Zusammenhang mit Umweltereignissen, obwohl solche Ereignisse nicht, wie es häufig geschieht, vom breiteren sozioökonomischen Kontext losgelöst betrachtet werden können. Die damaligen Staubstürme als Folge von Dürren und ungeeigneten Anbaumethoden förderten die Bodenerosion und dezimierten die Anbauflächen, sodass Tausenden Farmern aus Oklahoma, Texas und Arkansas nichts anderes übrig blieb, als ihre Farm zu verkaufen und nach Westen zu ziehen. Die ökologischen »Schub«-Faktoren für die Migrationsentscheidung lagen auf der Hand, aber sie standen im weiteren Kontext der Weltwirtschaftskrise und unzureichender Anbaumethoden. Die Aussichten auf ein besseres Leben in Kalifornien spielten zudem eine große Rolle als »Sog«-Faktor.
Mit 2,5 Millionen Migranten, von denen 200.000 nach Kalifornien zogen, war die Dust-Bowl-Migration die bedeutendste Wanderungsbewegung in den Vereinigten Staaten. Trotz der historischen Tragweite des Ereignisses wurde die Rolle von Umweltveränderungen als Schubfaktor für Migration weitgehend übersehen, bis die Folgen des Klimawandels sichtbar wurden.
»Lissabon in Ruinen«, Kupferstich von J. A. Steißlinger, 18. Jahrhundert, mit freundlicher Genehmigung des Nationalmuseums Lissabon.
Nicht nur der Klimawandel
Dennoch darf man nicht vergessen, dass für die Umweltmigration nicht nur der Klimawandel ausschlaggebend ist. Im Gegenteil, Umweltbedingungen waren stets für die Verteilung der Bevölkerung auf dem Planeten maßgebend. Vor rund 45.000 Jahren wurde Europa dank seines günstigen Klimas und seiner reichen Ressourcen durch den modernen Menschen besiedelt. Dieser bevorzugte dabei die Küsten- und Deltaregionen, weil hier der Boden fruchtbarer war. Wahrscheinlich wird also der Klimawandel als gewaltige globale Umweltzerstörung die Verteilung der Erdbevölkerung ebenfalls beeinflussen. Wenn Umweltbedingungen wesentliche Erklärungsfaktoren für historisches Siedlungsverhalten sind, ist davon auszugehen, dass Bodendegradation, Störung von Ökosystemen und Ressourcenverknappung aufgrund des Klimawandels diese Siedlungsmuster verändern werden.
Große demografische Veränderungen
Schwere Katastrophen und die durch sie ausgelösten Fluchtbewegungen haben auch das demografische Muster bestimmter Städte und Regionen dramatisch verändert. Manche Regionen wurden nahezu menschenleer: Der Untergang des Reiches von Akkade (im heutigen Irak) um 2200 v. Chr. stand mit schweren Dürren im Gebiet vom Ägäischen Meer bis zum Indus in Zusammenhang. Dürren waren auch für den Niedergang der Anasazi-Kultur in Nordamerika im 13. Jahrhundert verantwortlich: Ganze Dörfer und Regionen wurden damals aufgegeben. In Grönland verschwanden die im 15. Jahrhundert entstandenen Nordmännersiedlungen, weil sie der Kleinen Eiszeit nicht standhielten.
Andere Regionen erlebten wegen Umweltschäden erhebliche demografische Verschiebungen: Die Bevölkerung Irlands wurde wegen der Großen Hungersnot von 1845 bis 1852 um ein Viertel reduziert; über zwei Millionen Menschen flohen, viele siedelten sich in den Vereinigten Staaten an.
Trotz ihrer historischen Bedeutung sind solche Beispiele für Wanderungsbewegungen kaum bekannt und dokumentiert, was den Glauben geweckt haben mag, es handle sich bei der durch den Klimawandel ausgelösten Migration um eine neue Migrationsform. Die Geschichte beweist das Gegenteil.
Atmosphärische bodennahe Lufttemperatur und globaler Meeresspiegelanstieg seit 50.000 v. Chr.
Quelle: Bintanja et al. (2005), © IOM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Stienne, 2015.
Migration und Umwelt in der Menschheitsgeschichte
Quelle: Bintanja et al. (2005), © OIM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Stienne, 2015.
Eine politische Frage
Obwohl die Umweltmigration als Forschungsgegenstand relativ neu ist, wird die Debatte von zahlreichen gegensätzlichen Standpunkten und Perspektiven bestimmt, die unterschiedliche politische Vorstellungen widerspiegeln. Der Begriff »Umweltmigration« ist somit auch ein politisches Konstrukt, das nicht immer mit der empirischen Realität übereinstimmt.
Erste Studien zu dem Thema wurden durch die Kluft zwischen einer alarmistischen (oder maximalistischen) und einer skeptischen (oder minimalistischen) Perspektive bestimmt. Die alarmistische Perspektive, die hauptsächlich von Umweltexperten und NGOs vertreten wird, sah in der Migration als unvermeidliches Nebenprodukt des Klimawandels eine sich anbahnende humanitäre Katastrophe. Inzwischen nehmen Migrationsforscher eine skeptischere Haltung ein und erklären, Migration sei immer multikausal und eine neue Kategorie der »Umweltmigration« sei überflüssig. Bei dieser Auseinandersetzung handelte es sich nicht nur um einen akademischen Streit, beide Seiten vertraten unterschiedliche politische Programme: Die »Alarmisten« wollten die Politiker auf die Bedrohungen durch den Klimawandel aufmerksam machen, während die Skeptiker besorgt waren, eine neue Migrationskategorie könne Regierungen aufschrecken und sie zu einer noch restriktiveren Einwanderungspolitik veranlassen. Die alarmistische Perspektive setzte sich jedoch durch; bald wurden Umweltmigranten das menschliche Gesicht des Klimawandels, und Migration galt als seine unvermeidliche Folge. Insbesondere Bewohner von kleinen Inselstaaten, die durch den Anstieg der Meeresspiegel bedroht sind, waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Politik Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriff.
Eine kopernikanische Wende