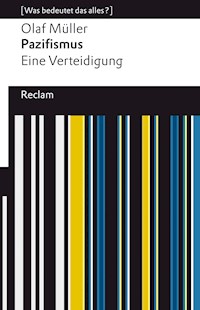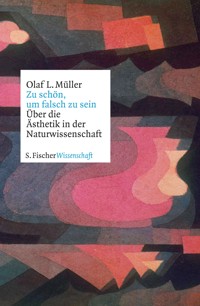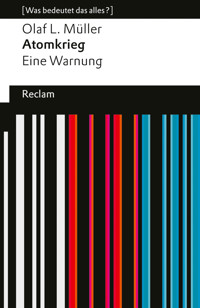
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Selbstauslöschung der Menschheit – die atomare Gefahr Seitdem die Supermächte große Kernwaffenarsenale besitzen, ist die Menschheit bedroht: Wir können unsere gesamte Zivilisation in kürzester Zeit auslöschen und den Planeten in eine radioaktive Ödnis verwandeln. Es hängt von allen außenpolitischen Akteuren ab, wie wahrscheinlich ein Atomkrieg wird. Wir sollten die äußerste Gefahr nicht ignorieren: Durchdachte Sorgen, so der Essay, sind etwas anderes als Panik oder German Angst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Olaf L. Müller
Atomkrieg
Eine Warnung
Reclam
Dem Oberstleutnant Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow (1939–2017) dankbar gewidmet
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEKNr.962 324
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71 254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71 254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMSUNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun.GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962390-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014595-1
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Erstes Kapitel: Vorverständigungen
1. Einleitung: Die Warnung vor einer großen Gefahr
2. Vom Unterschied zwischen Angst, Furcht, Sorge und Panik
3. Wenn über einer Stadt die Bombe explodiert
4. Zur Explosion mehrerer Atombomben über Deutschland
Zweites Kapitel: Spiel mit dem Feuer
1. Ob die Atmosphäre der Erde womöglich in Flammen aufgehen wird?
2. Experimente können anders ausgehen als gedacht
3. Drei zu einer Million
4. Erste Überlegungen zur Abschreckungstheorie
Drittes Kapitel: 1962 und 1983 – zwei Mal um ein Haar die Apokalypse
1. Die Kubakrise
2. Flexible Reaktion, Eskalationsdominanz, Selbstabschreckung
3. Reagan und seine Pläne für einen Raketenschutzschirm (SDI)
4. Um Mitternacht am 27. September 1983: Die gefährlichste Stunde des Kalten Krieges
Viertes Kapitel: Die Atomkriegsgefahr steigt
1. Nach dem Alarm ist vor dem Alarm
2. Wie würde Putin auf einen Fehlalarm reagieren?
3. Russlands Säbelgerassel und seine offizielle Nukleardoktrin
4. Die ukrainische Herbstoffensive 2023 als Auslöser für einen Atomschlag?
Fünftes Kapitel: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch
1. Über die Nah- und Fernfolgen eines kleinen russischen Atomschlags in der Ukraine
2. Die Verhandlungen der Ukraine mit Russland im Frühjahr 2022
3. Ein Preis, den der Westen nicht zahlen wollte
4. Ausblick: Hoffnungen und Sorgen aus Gegenwart und Zukunft
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Erstes Kapitel: Vorverständigungen
1. Einleitung: Die Warnung vor einer großen Gefahr
Dies Buch ist nichts anderes als eine Warnung; ich warne davor, die Möglichkeit eines Atomkriegs in der näheren Zukunft auf die leichte Schulter zu nehmen. Eine solche Warnung hat nur dann Sinn, wenn drei Thesen plausibel sind.
Erstens: Der Atomkrieg ist keine fernstehende Möglichkeit, sondern eine echte, reale Gefahr, und zwar genau jetzt. Und auch morgen. Und nächstes Jahr. Und in drei, vier Jahren.
Zweitens: Bräche er aus, so wäre das die Urkatastrophe der Menschheit. Selbst wenn sie ihn überlebte, wäre danach nichts mehr, wie es war; unsere Zivilisation wäre nicht wiederzukennen und unsere Kultur kaputt.
Drittens: Die Verantwortlichen einschließlich ihrer Berater und der öffentlichen Meinung unterschätzen das Risiko eines Atomkriegs. Jedenfalls tun sie – obwohl es machbar wäre – nicht genug, um die Wahrscheinlichkeit seines Ausbruchs nachhaltig zu senken; im Gegenteil, wieder und wieder nehmen sie einen Anstieg dieser Wahrscheinlichkeit in Kauf.
Auf welchem Wege begründet man derartige Thesen? Für die erste These stütze ich mich auf Krisen aus dem vorigen Jahrhundert, in denen es beinahe zum Atomkrieg gekommen wäre. Wie sich bei der Betrachtung dieser Krisen zeigen wird, war es jedes Mal pures Glück, soll heißen: bloßer Zufall, dass die Atomwaffen am Ende nicht zum Einsatz kamen. In jedem der Fälle entstand allergrößte Gefahr durch eine ungünstige Verkettung von technischen und menschlichen Fehlleistungen, auf die unsere Theorien zum Atomwaffeneinsatz nicht vorbereitet waren. Diese Theorien – in denen auf unterschiedliche Weise mit dem Gedanken einer rationalen Abschreckung operiert wird – haben also Mängel; die Mängel der Theorien lassen sich durch eine Analyse ihrer inneren, verrückten Rationalität und durch Vergleich mit der irrationalen, jeder Vernunft spottenden Krisenwirklichkeit enthüllen.
Und da wir auch im gegenwärtigen Jahrhundert mit solchen Theorien der Abschreckung operieren, drängt sich folgender Schluss auf: Jede neue Krise zwischen den Atommächten kann abermals neue Gefahren technischer und menschlicher Fehlleistungen heraufbeschwören, an denen die gültigen Theorien zum Atomwaffeneinsatz zu scheitern drohen. Selbstredend könnten wir auch bei der nächsten und übernächsten Gelegenheit Glück haben, also erneut durch Zufall ungeschoren davonkommen. Aber unser Vorrat an Glück dürfte irgendwann erschöpft sein.
Die zweite These lässt sich einfacher begründen: Dass ein Atomkrieg der Zukunft eine Katastrophe wäre, ergibt sich aus dem, was über die Wirkungen von Atombombenexplosionen bekannt ist. Nicht jeder kriegerische Einsatz einer Atomwaffe wäre das Ende von allem; einem übertriebenen Alarmismus sollten wir widerstehen. Doch wenn wir hochrechnen, was bei den ersten beiden Bombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 geschehen ist, und wenn wir dabei die gegenwärtige Größe der Atomwaffenarsenale berücksichtigen, dann wird deutlich: Wir reden über eine nie da gewesene Dimension der Verheerung ganzer Landstriche, Länder, Erdteile. Sollten wir hinwiederum im begrenzten Atomkrieg weit unter dieser unvorstellbaren Zerstörung bleiben, so würde sich unsere Erde trotzdem in einen allzu unwirtlichen Ort verwandeln.
Die dritte These betrifft die Gegenwart und ist besonders verstörend: Statt die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs zu senken, nehmen wir derzeit sehenden Auges ihre Erhöhung in Kauf; dies werde ich anhand des Ukrainekriegs dartun. Dass sich die Atomkriegsgefahr seit dem Überfall russischer Truppen auf ein souveränes, friedliches Nachbarland dramatisch erhöht hat, ist zuallererst die Schuld des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Doch wie der Westen auf dies Verbrechen reagiert hat und noch reagiert, muss man mit Blick auf die Atomkriegsgefahr riskant finden. Ich werde diese Behauptung nicht durch ein allgemeines Lamento zu unterfüttern versuchen, sondern auf konkrete Fehlentscheidungen hinweisen, die gefährlich waren und den Fehlern aus früheren Krisen ähneln.
Dieser Teil meiner Überlegungen ist aus zwei Gründen heikel. Einerseits geht es um einen Konflikt aus der jüngsten Zeit, über den wir noch nicht genug wissen. Selbst wenn ich mich hauptsächlich auf derzeit unstrittige Fakten stütze (oder jedenfalls auf Fakten, die sogar von Andersdenkenden nicht bestritten werden), könnte uns die künftige Geschichtsschreibung diese oder jene Faktenbehauptung aus der Hand schlagen. Ein solches Risiko läuft jeder, der sich zu laufenden Konflikten äußert. Gegen das Risiko hilft nur eines: Sorgfalt, Sorgfalt, Sorgfalt.
Andererseits ist es deshalb heikel, beim Ukrainekrieg mit der Sorge vor Atomschlägen zu kommen, weil man sich damit leicht dem Vorwurf aussetzt, Putins Geschäft zu betreiben oder auf seine atomaren Drohungen hereinzufallen. Hierüber tobt ein Glaubenskrieg, der sich mit objektiven Gründen schwerlich entscheiden lässt.
Unabhängig davon ist es vielleicht am besten, wenn ich gleich zu Beginn offenlege, vor welchem Hintergrund ich diesen Essay verfasse, und die Grenzen nenne, die ich mir dabei auferlege.
Und zwar habe ich an anderer Stelle für einen – pragmatischen – Pazifismus plädiert.1 Das vorliegende Buch ist aber keine pazifistische Warnung vor dem Atomkrieg, denn ich habe meinen Pazifismus für die Zwecke der bevorstehenden Überlegungen ausgeklammert; er bildet ausdrücklich keine Voraussetzung dessen, was ich hier ausführen werde.
In der Tat dürfte es so gut wie jeder Pazifist unserer Zeit angebracht finden, vor dem Atomkrieg zu warnen; auf dem Boden des Pazifismus sind Warnungen vor dem Atomkrieg leicht zu haben. Aber man muss kein Pazifist sein, um die Berechtigung solcher Warnungen anzuerkennen. Sie sind für den Nicht-Pazifisten freilich weniger eingängig, und das bedeutet, dass ich es mir in meiner Argumentation alles andere als einfach mache, wenn ich einen größeren, weltanschaulich ungebundenen Adressatenkreis anzusprechen versuche und dafür auf die Voraussetzung des Pazifismus verzichte.
Voraussetzen werde ich etwas weniger Kontroverses, und zwar eine besonders vorsichtige Art und Weise, mit riesigen Risiken umzugehen: Angesichts außergewöhnlich drastischer Gefahren, deren Wahrscheinlichkeit klein, aber letztlich unbekannt ist, sind wir gut beraten, sogar mit dem Äußersten zu rechnen. Einerseits sollten wir jede denkbare Quelle einer solchen Gefahr auf dem Radar haben und ein feines Sensorium für ihre allerersten Anzeichen entwickeln; hier hilft uns ein sensibles Zusammenspiel aus Vernunft, Angst und Sorge. Andererseits gilt es, die Wahrscheinlichkeit für die fragliche Gefahr zu mindern, so gut es geht.
Diese Haltung einer vorausblickenden Vorsorglichkeit ist nicht immer und überall angemessen – und sie ist auch nicht jedermanns Sache. Viele finden es schön, riskant zu leben. Beim Thema Atomkrieg ist freilich davon abzuraten.
2. Vom Unterschied zwischen Angst, Furcht, Sorge und Panik
Seitdem sich die beiden Supermächte im Kalten Krieg große Arsenale an Kernwaffen verschafft haben, also seit Mitte der 1950er Jahre, schwebt eine Gefahr über der Menschheit, die uns in ein neues Zeitalter katapultiert hat: Wir sind imstande, innerhalb weniger Stunden die gesamte Zivilisation auszulöschen und unseren Planeten in eine radioaktiv verseuchte Ödnis zu verwandeln.
Wie ernst müssen wir diese Gefahr heute nehmen? Läuft es auf Panik hinaus oder auf wohlbegründete Vorsicht, in den gegenwärtigen Krisen und Kriegen für betonte Zurückhaltung zu plädieren – anstatt so zu tun, als bestünde keinerlei Anlass zur Besorgnis?
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Atomkriegsgefahr keine vorgegebene Konstante ist; sie verändert sich im Laufe der Zeit. Ob sie sinkt oder steigt, hängt von politischen Entwicklungen ab, die sich beeinflussen lassen. Nach dem Ende der Sowjetunion beispielsweise war die Atomkriegsgefahr weit geringer als in den spannungsreichen Jahren zuvor – und als heute.
Solange es Atomwaffen gibt, ist diese Gefahr niemals gleich null, doch kommt es darauf an, sie möglichst kleinzuhalten. In den letzten Jahren ist sie wieder angewachsen, und es ist höchste Zeit, den Trend umzukehren. Wir wären schlecht beraten, wenn wir die Augen vor der alleräußersten Gefahr verschlössen; präzise durchdachte Sorgen sind etwas anderes als Panik oder German Angst.
Wie unterscheiden sich Angst, Furcht, Sorge und Panik voneinander? Wer panisch reagiert, ist gegenüber dem rationalen Denken unempfänglich. Dass wir solche Gemütszustände besser aus unserem Leben heraushalten sollten, versteht sich von selbst. Panik ist kein guter Ratgeber.
Eine Angst hingegen kann einen rationalen Kern enthalten. Dort, wo sie aufkommt, weist sie uns oft genug auf Gefahren hin, die wir unter- oder halbbewusst registriert haben, aber nicht hinreichend beachten. Daher wird uns in Selbstverteidigungskursen nahegelegt, unsere Ängste (etwa nachts auf dunkler Straße) nicht zu unterdrücken, sondern aufmerksam zu prüfen. Angst kann unsere Aufmerksamkeit in die richtige Richtung lenken.
Psychologen reden in diesem Zusammenhang oft von Furcht anstelle von Angst, doch werde ich mich dieser fachsprachlichen Unterscheidung nicht anschließen.
Zwar verweisen wir in abstrakteren, theoretischeren Zusammenhängen auch alltagssprachlich mit dem Begriff der Angst auf zuweilen diffuse, jedenfalls irrationale, übertriebene oder gar therapiebedürftige Gemütszustände, von denen wir unter dem Begriff der Furcht punktgenaue, begründete, angemessene, gesunde Gemütszustände abgrenzen. Doch kommt beim tagtäglichen Reden der Begriff der Furcht (als Substantiv) in konkreten Zusammenhängen kaum vor. Es wäre seltsam zu sagen: »Sie hatte nach Jahren mangelnder Zahnpflege verständlicherweise Furcht vor dem Zahnarzt« oder »Angesichts seiner lausigen Vorbereitung hatte er mit Recht Furcht vor der Klassenarbeit«. Mit »Angst« anstelle von »Furcht« hinwiederum verstoßen dieselben Sätze kein Stück gegen das Sprachgefühl. Interessanterweise kann in denselben Zusammenhängen – ohne nennenswerte Änderung der Bedeutung – das reflexive Verb »sich fürchten« an die Stelle von »Angst haben« treten.
Wer so wie ich meint, dass die Sprache mitdenkt, wird sich also an der Rede von der Angst vor dem Atomkrieg nicht stören – und wird zugeben, dass mit dieser Redeweise rein sprachlich kein Vorwurf der Diffusität, Übertreibung, Irrationalität oder Therapiebedürftigkeit verbunden zu sein braucht.
Panikattacken, Furchtzustände und Angstanfälle sind zunächst einmal Widerfahrnisse; sie kommen über uns. Wir sind ihnen passiv ausgesetzt, sind nicht in erster Linie ihre Urheber. Da reagiert gleichsam etwas in uns – sei es auf einen überraschenden äußeren Reiz, sei es auf eine Information, die uns bedrängt, aus der Ruhe bringt oder zu bedrohen scheint. Je nach Dramatik der Situation und je nach Qualität des Nervenkostüms können wir aufkommende Panik, Angst oder Furcht manchmal besser, manchmal schlechter einhegen, aber unser Einfluss darauf ist prinzipiell begrenzt.
Anders bei der Sorge: Hier schalten wir den rationalen Suchscheinwerfer ein, um ebenso aktiv wie präzise Ausschau zu halten nach möglichen Gefahrenquellen, die es alsdann einzeln zu bewerten, gegebenenfalls auszuschalten oder zumindest halbwegs abzudichten gilt. Die Rationalität steht bei diesem Vorgang im Vordergrund, ist jedoch selten allein ausschlaggebend.
Denn ohne eine Erlebnisdimension der besorgten Unruhe, der kontrollierten Angst, ja sogar der gut gezügelten Panik kommt selbst die rationalste Sorge kaum vom Fleck und läuft sogar Gefahr, sich selber durch rasche Rationalisierungen auszuschalten: Es ist nur zu leicht, irgendeinen besorgten, aber angstfreien Gedanken um des lieben Seelenfriedens willen kurzerhand durch einen beruhigenden Gegengedanken zu neutralisieren – und das auch dann, wenn der Gegengedanke an den Haaren herbeigezogen ist. Unsere Vernünftelei ist eine Meisterin darin, sich selber auszutricksen.
Sobald echte Angst im Spiel ist, fällt uns eine solche Neutralisierung ungleich schwerer. Wir sind als Menschen offenbar dann am stärksten, wenn der rationale Pol unserer Persönlichkeit mit seinem emotionalen Gegenpol harmonisch zusammenarbeitet, in einem gleichberechtigten Geben und Nehmen. Das jedenfalls bildet eine der Voraussetzungen, auf die ich mich in meinem Gedankengang stützen werde; man könnte sie, um ein großes Wort zu bemühen, als »humanistisch« bezeichnen.
In der Tat steht hinter meinem Gedankengang insgesamt ein humanistisches Weltbild. Demzufolge sind wir Menschen frei, unser Schicksal in die Hand zu nehmen und die Katastrophe abzuwenden. Sollten wir darin scheitern, so wäre es schade um die Menschheit.
Es ist dem Scharfsinn der Philosophen verblüffend schwergefallen, zwingend darzulegen, warum es schlimm wäre, wenn die Menschheit eher früh als spät von der Bühne des Universums abträte.1 Als Mensch aber wiederhole ich für den Fall eines verfrühten Abgangs der Menschheit: Es wäre schade um uns.
3. Wenn über einer Stadt die Bombe explodiert
Damit wir uns beim Thema Atomkrieg nicht gleich von Anfang an der Panik hingeben, einem unguten Extrem an Emotionalität, möchte ich mit einer kühl rationalen Erinnerung an die bekannten Wirkungen einzelner Atomexplosionen beginnen. Diese Wirkungen sind naturwissenschaftlich gut erforscht und an die hundert Male im Experiment erkundet worden.
Wenn eine Bombe gezündet wird wie vor Jahrzehnten in 600 Metern Höhe über Hiroshima, dann entsteht im Zentrum der Explosion ein gigantischer Lichtblitz, genauer gesagt, ein doppelter Impuls elektromagnetischer Strahlung, der für die Hitzewirkung der Bombe verantwortlich ist und sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. In unmittelbarer Umgebung der Explosion verdampft alles; in größerer Entfernung entzündet die Hitzestrahlung der Bombe sämtliche brennbaren Gegenstände: Über Hiroshima wurde ein Feuersturm erzeugt, der alles einäscherte. Diese thermische Wirkung einer Atomexplosion macht grob ein Drittel ihrer Gesamtenergie aus.1