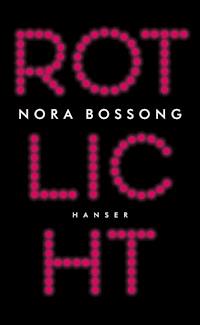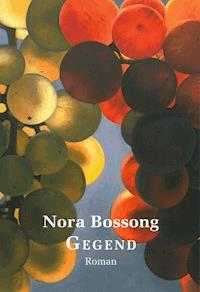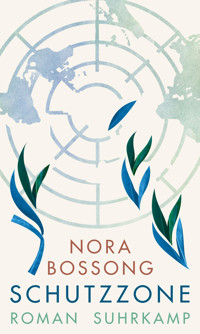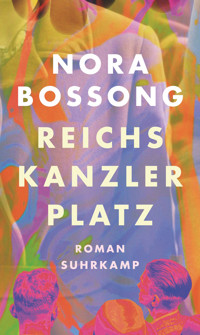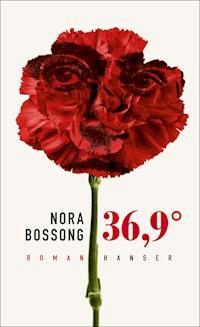15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob in ihren preisgekrönten Romanen, Reportagen oder Essays – Nora Bossongs Texte führen stets mitten hinein in die schmerzhaft relevanten Problemfelder unserer Zeit. Wo andere vorschnelle Urteile fällen oder sich auf sich selbst zurückziehen, schaut sie genau hin, hört teilnahmsvoll zu und stellt Fragen: nach kolonialer Schuld und globaler Gerechtigkeit, nach den Herrschaftsansprüchen des Westens und der Natur des Bösen. Mit analytischem Scharfsinn und sprachlicher Kraft entlarvt sie falsche Idealisierungen und populistischen Kulissenzauber, warnt vor Geschichtsvergessenheit und wachsender Demokratiemüdigkeit. Sie reist zu den Gelbwestenprotesten in Paris, zu den Gegnern des deutschen Kohleausstiegs in Jänschwalde, zu den Gedenkfeiern zum 25. Jahrestag des Völkermords in Ruanda und zum Prozess gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher in Den Haag – und sie zeigt, dass sich Versöhnung zwar nicht verordnen lässt, unser Bemühen darum aber nie nachlassen darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Nora Bossong
Auch morgen
Politische Texte
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Die verwaltete Erinnerung
Menschenrechte für rechte Menschen
Was sind schon fünfundzwanzig Jahre?
Gerechtigkeit für die Welt
Das Gestern im Heute
Vier Versuche über das Böse
I
Der Spieler. Über Variationen des Teufels
II
Du und ich. Über Variationen des Guten
III
Hinter dem Spion. Über Variationen der Distanz
IV
Wohin geht das Böse? Über Variationen des Pakts
Jugend, ewige
I
II
III
IV
Feuerlöscher und Barrikaden
Erzählung vom wüsten Land
I
II
III
IV
V
Die zerlöcherte Region
Ein Tag wird kommen
Trost der Wolken
Die Sehnsucht nach dem Anderen
Vom Trost der Wolken
In
GOD
we trust
Nachweis der Erstdrucke
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Die verwaltete Erinnerung
Menschenrechte für rechte Menschen
»Direitos Humanos são para humanos direitos.« Dieser so schön elliptisch geschwungene Satz beschäftigt mich, seitdem ein Freund mir davon erzählte. Übersetzt aus dem Portugiesischen heißt er so viel wie: Menschenrechte sind für rechte Menschen, oder auch: für rechtschaffene, für passende, für die richtigen Menschen.
Menschenrechte für rechte Menschen. Was aber ist das denn, der rechte, richtige Mensch? Geäußert hat diesen Satz der brasilianische General Augusto Heleno im Oktober 2019 in einem Interview. Heleno war unter anderem für den UN-Blauhelmeinsatz in Haiti verantwortlich, so kamen wir auf ihn. Mein letzter Roman Schutzzone war gerade erschienen, wir saßen im Hamburger Frühherbst bei einem Bier zusammen und sprachen darüber, was diese Weltinstitution namens UN noch sein könne und was aus all den Hoffnungen geworden sei, für die diese Institution steht oder eben stand.
Ihre Blauhelme nennt man auch Friedenstruppen, und sie könnten unseren, ich glaube, allgemeinmenschlichen Wunsch nach Frieden verkörpern, eine Art Engelsheerscharen für eine Zeit, in der man zu genau weiß, dass Engel immer wieder nicht gekommen sind, wenn sie hätten eingreifen müssen, nicht nur um Leben, sondern um das grundlegend Menschliche zu retten.
Auf Haiti hatten die Friedenstruppen in einem Quartier mit dem schönen Namen Cité Soleil, einem Slum von Porte-au-Prince, in nur wenigen Stunden 22 000 Kugeln verschossen. Einige dieser Kugeln trafen Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, andere trafen Unbeteiligte. Es sollen bis zu siebzig Menschen gestorben sein, darunter auch Kinder. Die Operation Iron Fist sei ein Massaker gewesen, meinen Menschenrechtsgruppen. Sie sei ein Erfolg gewesen, meint Heleno.
Seit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 hat es immer Mittel und Wege gegeben, diese zwar anzuerkennen, aber doch bitte schön nicht für alle. Immer wieder haben sich Ideologien von rechts wie von links ihren richtigen Menschen geschaffen. Sie haben aussortiert, wer diesem Richtigen nicht entsprach. Der Mensch ist aber nicht zuerst richtig, er ist vor allem Mensch, fehlbar, verletzlich, hilflos, sanft, oft mittelmäßig und, ja, mitunter sogar böse oder sagen wir boshaft, eigennützig, nachtragend und rachsüchtig. Genau davon erzählt Literatur, sie erzählt nicht vom richtigen Menschen, sondern vom Menschen. Sie erzählt von all jenen, die daran scheitern, die richtigen Menschen zu sein, oder zum Scheitern verdammt werden, sie erzählt auch von jenen, die das Richtige zu definieren versuchen, in ihrem Wunsch nach Ordnung, Gewalt und Herrschaft. Literatur erzählt davon, wie Menschen an sich selbst scheitern oder zugrunde gehen, und, ja, manchmal werden sie auch glücklich aneinander, zumindest für den Moment. Ganz sicher muss sie gerade nicht definieren, was der richtige Mensch ist, auch wenn es das gibt in Romanen, Gedichten, Essays, die dann aber vielleicht eher ideologisch als literarisch zu nennen wären. Sie muss Menschen nicht definieren, sondern darf sie zeigen in ihrer ganzen Zerrissenheit, in ihrer Verlorenheit zwischen dem, was mutmaßlich richtig, und dem, was mutmaßlich falsch ist. Literatur darf zweifeln, und sie darf auch verzweifeln. Sie ist nicht verpflichtet, Hoffnung zu geben, auch wenn es schön ist, wenn sie das kann.
Und ich gebe zu: Als ich die Arbeit an meinem letzten Roman beendet hatte, in dem ich mich mit dem wiederholten Scheitern der UNO im Anblick schlimmster Gräueltaten befasst hatte, mit Ohnmacht, persönlicher und institutioneller, mit dem, was innerhalb kürzester Zeit an Vernichtung möglich ist zwischen Menschen, und mit dem so hartnäckigen Umstand, dass offensichtlich immer wieder geschieht, was nie wieder geschehen sollte, Kriegsverbrechen und Völkermord, plus jamais, never again, dass es mir mit der Zeit so viel mehr eine menschliche Konstante zu sein schien als unsere Fähigkeit zum Frieden, da war es mit meiner Hoffnung vorbei. Ich war vollständig leer. Ich kultivierte keine leere Hoffnung, ich gab das Prinzip Hoffnung gänzlich auf. Sie war einfach verbraucht, bis ins Letzte, die Hoffnung darauf, dass das menschliche Miteinander nicht vor allem aus dem Zufügen von Leid besteht. Und auch, wenn es im Vergleich klein wirken mag: Auch die Hoffnung in die Literatur und ihre Kraft, die mal eine transformatorische, mal eine aufklärerische, mal eine tröstende ist, gab ich verloren.
»Die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler«, hat Antonio Gramsci einmal bemerkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, ich glaube, sie hat Schüler, aber die Geschichte lehrt eben nicht nur dieses: Nie wieder, sie lehrt für die, die es möchten, Umsturz, Unterdrückung, Überlegenheit, Indoktrination. Sie unterrichtet Revolutionstheorie, Willkürherrschaft, Massenmord und wie sich all das als legitim behaupten lässt. Sie unterrichtet, dass man wunderbar von Menschenrechten sprechen kann, von Freiheit, Würde und Gleichheit aller, wenn man nur eben sortiert, wem diese Rechte, die Würde und die Freiheit zustehen und wem nicht, wer gar nicht unter den Begriff des Menschen zu fassen ist oder weshalb der Mensch als Einzelner misshandelt werden darf, wenn dies dem Kollektiv oder der Partei dient.
Während der Recherche zu meinen Büchern und Reportagen habe ich immer wieder beeindruckende Menschen getroffen, aber ich habe auch viel Zynismus, Geltungshunger und Selbstherrlichkeit kennengelernt. Einige haben sich selbst gern als Weltretter gesehen, dabei nur falsche Hoffnung verkauft, weil der Handelspreis dafür gerade gut stand. Andere haben weggesehen. Wieder andere haben gezielt Hass geschürt. Mit Worten kann so vorzüglich gelogen und manipuliert werden, und immer wieder ist im Namen des Richtigen nichts anderes geschehen, als eigene Machtansprüche durchzusetzen auf Kosten anderer Menschen, ihrer Hoffnungen, ihrer Wünsche und ihrer Unversehrtheit.
Hoffnung sei gar nicht so gut, wie wir immer meinten, hat mir einmal eine Freundin gesagt. Sie binde nur Energie, und wir hielten uns an etwas, das gar nicht mehr mit der Wirklichkeit in Bezug stünde. Ja, das mag sein, und von den drei Stufen, die ich gelernt habe als berufliche Entwicklung innerhalb der UNO (aber sicher nicht nur da), vom Idealismus zum Pragmatismus zum Zynismus, halte ich den Pragmatismus in der Wirklichkeit vielleicht sogar für die beste Stufe. Doch das literarische Denken hat gerade die Kraft, das, was auf der planen Fläche der Wirklichkeit geschieht, zu übersteigen und zu durchdringen. Sie kann Utopien schaffen, ja, allerdings ist mein Wunsch danach vorsichtiger geworden. Sie hat vor allem die Kraft, uns ins Herz zu sehen ebenso wie dorthin, wo alles, was wir mit dem Herzen verbinden, aufhört, in die Abgründe und auf die Versteinerungen unserer Gefühle wie unseres Denkens.
Und sie blickt damit auch auf das, was zwischen uns liegt und was uns zugleich verbindet. Sie kann in das sehr intime Miteinander von zwei Menschen schauen ebenso wie auf die Dienstvorschriften, Funktionszusammenhänge, die Säle der Menschenrechtsausschüsse von Parlamenten und Vereinten Nationen und nicht zuletzt auf die Menschenrechte selbst, ihre mutmaßliche Universalität und darauf, dass sie davon abhängig sind, wer sie liest, wer sie hört, wer sie anwendet, gelten lässt, und für wen.
Es steckt eine Doppelbödigkeit ja auch in den Beschlüssen, in der Ambivalenz oder Dialektik der Werte, auch jener, die wir als große Errungenschaften ansehen. Wenn man mit den Menschenrechten die Menschen zu definieren beginnt, beginnt man auch das zu definieren, was nicht dazugehört, nicht dazugehören soll. Oder wie es Toni Morrison beschreibt: »Die Menschenrechte, zum Beispiel, ein Organisationsprinzip, auf das die Nation sich gründete, waren unausweichlich an den Afrikanismus gekoppelt. Seine Geschichte, sein Ursprung wird ständig mit einem anderen verführerischen Konzept verbunden: der Hierarchie der Rassen. […] Das Konzept der Freiheit entstand nicht in einem Vakuum. Nichts rückte die Freiheit derart ins Licht wie die Sklaverei – wenn sie sie nicht überhaupt erst erschuf.«
Wie verlassen wir dieses Dilemma? Vielleicht können wir das Dilemma nicht lösen, und damit will ich nicht sagen, dass ich es gutheiße, nur will ich meinen, dass die Lösung weder jene ist, die Menschenrechte aufzukündigen, ihre Universalität allein als westliche Hegemonie anzuprangern, noch ist die Lösung jene, abzuleugnen, dass Menschen immer wieder den Wunsch entwickeln, richtiger zu sein als andere. Ich glaube allerdings, niemand ist gänzlich unversehrt, so wenig, wie irgendjemand gänzlich gut oder eben »richtig« und »passend« ist, es gibt nur einige, womöglich viele, die ihre eigene Unversehrtheit vorgeben oder ihr vollkommen schattenloses Dasein, ihren festen Stand auf der ganz und gar richtigen Seite.
Darum ist die Literatur, die mich interessiert, jene, die von der uns je eigenen Fähigkeit zur Verletzlichkeit wie zur Verletzung berichtet, und ich glaube, davon berichtet Literatur meistens, ich glaube, genau das ist es, was ein paar von uns zu dieser doch höchst merkwürdigen Tätigkeit drängt, tagaus tagein allein am Schreibtisch zu sitzen und mit Schattenfiguren durch die Welt zu gehen, Figuren, die eben auch aus unserem eigenen Dunkel entspringen. Literatur berichtet nicht davon, wie wir passende Menschen sind, sondern von unseren Widrigkeiten, Fehlbarkeiten und Verwundbarkeiten, und eben darum kann sie, auch wenn sie nicht immer schön und hoffnungsfroh ist, uns ein Halt sein.
Was sind schon fünfundzwanzig Jahre?
Um mich das Paradies, ungefähr. Die letzten beiden Badenden haben vor der Dämmerung den Pool verlassen, viele Hotelgäste sind ohnehin nicht mehr da, an der fast verlassenen Bar läuft ein französisches Chanson, und in einen der Flechtstühle gelehnt höre ich der Männerstimme zu:
Qui saura, qui saura, qui saura,
Qui saura me faire vivre d'autres joies
Je n'avais qu'elle sur terre
Et sans elle ma vie entière,
Je sais bien que le bonheur n'existe pas.
Vielleicht, weil die Stimmung am Vorabend des Gedenktags still ist, vorsichtig, eher wie die Stunden nach einem Fest, wenn die Besucher abgereist und die Gartenzelte abgebaut sind, vielleicht, weil es dennoch tags nicht so erdrückend leise war, wie ich gedacht hatte, in der Innenstadt von Kigali schlängelten sich die Mototaxis wie gewöhnlich an den Autos vorbei, gingen die Menschen ihren Wochenendeinkäufen nach, vielleicht, weil mir keine Vorstellung davon gelingt, wie man einen Tag begeht, an dem vor fünfundzwanzig Jahren der größte Völkermord nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann, dem die internationale Gemeinschaft über Wochen tatenlos zusah, oder vielmehr sah sie weg, und vielleicht auch, weil ein Satz, der mir immer wieder in den Sinn kommt, ebenfalls auf Französisch ist: »Dans ces pays-là, un génocide n'est pas trop important«, »in diesen Ländern ist ein Genozid nicht besonders wichtig«, vielleicht werde ich deshalb dieses leichtfüßig schmachtende Chanson nicht mehr los:
Vous dites que je sortirai de l'ombre,
J'aimerais bien vous croire oui
mais mon coeur y renonce …
Der Satz über den Genozid stammt vom damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand, und das Chanson wurde von Mike Brant gesungen. Dass Moshe Brand der eigentliche Name des Sängers ist und er zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde als Sohn einer Auschwitzüberlebenden, lese ich am nächsten Vormittag, meinen Laptop auf den Knien, über mir läuft der Fernseher. Ruanda sei eine Familie, erklärt Präsident Paul Kagame vor den Kameras im Kongresszentrum, dessen Kuppel ich in der Ferne durch mein Fenster sehen kann. Aus dem Nachbarzimmer dringt lautes Stöhnen, Sex gegen die staatlich verordnete Pflicht des Erinnerns, ein schmaler Riss in der Trauerflagge, die über dem ganzen Land hängt. »Existieren in einem Zustand anhaltenden Gedenkens«, so nennt Kagame es in seiner Rede, und er spricht von der jungen Generation, die den Völkermord nicht mehr selbst erlebt hat, von den fast sechzig Prozent der Ruander, die erst nach den hundert Tagen auf die Welt kamen, in denen sich das Land in eine menschengemachte Hölle verwandelte. Die Einigkeit über alle Gräben hinweg, über das Schweigen der einen und die Verzweiflung der anderen, das ist es, was in diesen Tagen wie ein Mantra wiederholt und beschworen wird, als Grundlage dafür der Generationenwechsel nach einem Vierteljahrhundert, aber was sind schon zweieinhalb Jahrzehnte. Etwas mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Befreiung von Auschwitz, im Jahr 1972, wurde Brants Chanson zu einem großen Erfolg. Drei Jahre später sprang der Sänger aus dem sechsten Stock eines Pariser Hauses und nahm sich so das Leben.
Es sind die beiläufigen Fragen, die man so dahinsagt, um nicht auf die Politik zu sprechen zu kommen, auf die Vergangenheit, um niemanden in Verlegenheit zu bringen oder weil man gerade nicht nachgedacht hat und alles mit einer unverfänglichen Leichtigkeit meint:
Und welche Sprache sprichst du mit deinen Eltern?, fragt eine Bekannte ihren jungen Mitarbeiter.
Eltern habe er nicht mehr.
Es sind die Fragen aus Anteilnahme, ob geheuchelt oder aufrichtig, Fragen aus Höflichkeit vielleicht nur noch, fünfundzwanzig Jahre danach:
Und hast du Verwandte verloren?, fragt eine andere Bekannte meinen Begleiter.
Nein, ist nach kurzem Zögern seine Antwort, und in dieser Antwort teilt sich das Land wieder, teilt sich in jene, deren Eltern den Genozid geschehen ließen oder selbst töteten, und jene, deren Eltern ihn nicht überlebten oder ein Leben fortsetzten, das aus kaum mehr bestand als Verlust und Flashbacks, den plötzlich wiederkehrenden Sekunden, Minuten, Stunden, in denen das geschah, was das Land und in dem Land die Zeit erstarren ließ, so und ähnlich wird es mir umschrieben, und man kann eher aufzählen als erzählen von diesen Momenten, erstarrt in den Dingen, die übrig geblieben sind:
Die profanen Plastikbottiche in der Kirche in Nyamata, darin die Knochen wie gesammeltes Brennholz.
Die Kleiderberge auf den Bänken im Kirchenraum, in den die Menschen geflohen sind, um Schutz zu suchen, aber den gab es nicht.
Die Heilige Maria Muttergottes, die in hellblauem Gewand auf einem Sockel an der Wand über all das wacht.
Die Sohle eines Flipflops, Kindergröße.
Die weißen Fliesen im unterirdischen Massengrab.
Der Grashüpfer in der Vitrine mit den gespaltenen Schädeln.
Der ausgetretene Teppich in der ehemaligen Präsidentenresidenz. Im Garten, hinter dem Swimmingpool mit brackigem Wasser, die Flugzeugteile, eine zerstörte Turbine, ein Bruchstück aus einer Bordwand.
Die Residenz, eher Bungalow als Palast, ist mittlerweile ein Kunstmuseum, doch auf meiner Eintrittskarte ist handschriftlich visit airplane remains vermerkt, als wisse die Frau, die die Quittung ausgestellt hat, ganz genau, weshalb ich eigentlich hier bin, weshalb jene Touristen kommen, die keine Gorillas sehen wollen.
Für den Abschuss des Flugzeugs, bei dem der ruandische Präsident Juvénal Habyarimana, sein burundischer Amtskollege Cyprien Ntaryamira und einige Besatzungsmitglieder am 6. April 1994 ums Leben kamen, wurden regierungsnahe Militärangehörige ebenso wie die Tutsi-Miliz RPF und damit der Kreis um Kagame verdächtigt, geklärt ist er bis heute nicht. Auf den Tod Habyarimanas folgten damals die ersten Gewaltwellen, die sich immer weiter und tiefer durch das Land schlugen, ein kühl geplanter, umfassend vorbereiteter Völkermord an jenen, in deren Pässe das Wort Tutsi gestempelt war, auch wenn viele westliche Beobachter darin lieber einen plötzlich ausgebrochenen Blutrausch hatten sehen wollen, um der Pflicht des Eingreifens zu entgehen.
Während des Walk to Remember ist die Stadt abgesperrt, angehalten wie in einem Dornröschenschlaf. Menschen blicken aus den Nebenstraßen zu unserem Marsch herüber. An der Spitze geht Präsident Kagame, begleitet von den internationalen Besuchern, dem belgischen Premierminister Charles Michel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dem jungen französischen Parlamentarier Hervé Berville. Der in Ruanda geborene Franzose wurde von Präsident Macron geschickt, um in der verwickelten Beziehung zwischen Frankreich und Ruanda halbwegs diplomatisch die Einladung Kagames weder anzunehmen noch auszuschlagen.
Ich gehe am Ende des Zugs, direkt vor dem Sanitäterwagen, um mich herum junge Leute mit den offiziellen Gedenk-T-Shirts, kwibuka25. Gerade noch unterhielten sie sich über die besten Modeläden in Kigali, jetzt gehen wir schweigend. Uns entgegen rennen zwei Journalisten, die schnell noch eine andere Perspektive für ihre Bilder suchen, ansonsten bleibt es ruhig, die Gerüchte über mögliche Angriffe von in Uganda sich formierenden Milizen bewahrheiten sich nicht, und wir laufen ins Stadion ein, verteilen uns auf die Ränge, die bereits überfüllt sind, aber immer noch drängen weitere Menschen nach.
In einem Land, das zu klein ist, um einander aus dem Weg zu gehen, das vor allem aus Dörfern besteht, in denen jeder über jeden Bescheid weiß, mag gemeinsame Erinnerung überlebensnotwendig sein. Aber schon in den Flüchtlingslagern hinter den Landesgrenzen, in denen noch immer viele darauf warten, endlich nach Hause zurückkehren zu können, interessiert man sich nicht dafür, dass die Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi von der ruandischen Regierung offiziell nicht mehr erwünscht ist. Einige in den Lagern sind untergetauchte génocidaires von 1994, einige würden den Heimweg auch mit Waffengewalt erzwingen. Wie sollten diese Menschen sich an dasselbe erinnern wie die Angehörigen der Toten?
Auch wenn die Regierung die Erinnerung als etwas Einigendes glauben machen will, ist sie vermutlich das Trennendste, was dieses Land hat. Auf dem Rasen dreht sich eine gewaltige Flammeninstallation, dort unten, wo einmal mehrere tausend Menschen bei den UNAMIR-Soldaten Schutz suchten, die ihr Hauptquartier in und um das Stadion aufgebaut hatten. Junge Menschen verlesen Zeugenberichte, später wird eine Art Werbefilm gezeigt werden, in dem Prominente wie Bill Clinton Grußworte nach Ruanda schicken. Deutschland hält sich zurück bei dieser Trauerfeier.
Dabei war das Deutsche Reich bis 1919 Kolonialmacht in Ruanda, und vielleicht, um die alte Schuld ein wenig zu kompensieren, war Deutschland noch im Jahr vor Ausbruch des Völkermords einer der bedeutendsten Geldgeber. Allerdings ist auch das nicht nur ein ruhmreiches Kapitel, sondern beinhaltet einige düstere Förderungsentscheidungen, etwa der Unterstützung des Senders RTLM durch die Konrad-Adenauer-Stiftung, über den die Genozid-Propaganda bis in die abgelegensten Dörfer drang. Wer von den deutschen Entscheidungsträgern kannte schon Kinyarwanda? Gute Absichten verkehren sich zu leicht in ihr Gegenteil, wenn sie auf nur oberflächlichem Interesse fußen.
Schaut man sich die Tagesschau vom 9. April 1994 an, erfährt man etwas von der Evakuierung der Europäer aus Kigali und davon, wie jene zurückgelassen werden, die vom Mordplan unmittelbar bedroht sind. Bald war in den deutschen Nachrichten die Verunreinigung von Babynahrung wieder wichtiger als die Unruhen in Ruanda. In den USA riefen besorgte Bürger bei ihren Abgeordneten an, um sich über das Wohlergehen der Berggorillas zu informieren, verloren aber kein Wort über die Menschen. Als die internationale Gemeinschaft endlich, nach Wochen des Tötens, die Unruhen als Völkermord bezeichnete und sich zum Einschreiten genötigt sah, war die Bundesregierung schnell darin, die Bitte um militärische Unterstützung abzulehnen.
In unseren Händen halten wir Kerzen, zum Teil kaum mehr als Stummel, da deutlich mehr Menschen als vorgesehen im Stadion sitzen und als Kerzen vorrätig sind. Über uns gehen die Scheinwerfer aus, zehntausende Lichter erleuchten den Abend, eine Mischung aus katholischer Messe und Popkonzert, aber statt Qui saura von Mike Brant wird das offizielle Lied zum 25. Jahrestag gespielt. Wie soulig man das Wort jenoside singen kann, irritiert mich erst, aber warum sollte Gedenken aufrichtiger sein, nur weil wie bei den Moorsoldaten ein Militärmarsch darunterliegt?
Das Lied werde ich noch oft hören, im Bus zum Beispiel, mit dem ich von Huye nach Kigali zurückfahre, an einer Gedenkstätte vorbei und an noch einer, als wäre das ganze Land ein Genozidmuseum. Im Fernseher über dem Fahrersitz wird das Musikvideo im Wechsel mit einer Doku zum Völkermord gezeigt, wir fahren hundertdreißig Kilometer, einmal durchs halbe Land, durch Dörfer, an Plantagen vorbei, überholen uralte Schwerlaster, die mit zehn Stundenkilometern die Hügel hinaufächzen, und wieder beginnt das Lied von vorne.
Ich werde von den sieben Männern hören, die angeblich verhaftet wurden, weil sie sich in der Trauerwoche bei der Übertragung eines Fußballspiels amüsierten. Von dem Lehrer werde ich hören, der einer Schülerin sagte, ohne den Völkermord wäre sie nie so weit gekommen, ohne die Förderung für die Angehörigen der Genozidopfer. Auch er sei daraufhin verschwunden. Vielleicht nur Gerüchte, aber sie klingen glaubwürdig, wenn man sich an die Paranoia der Expats gewöhnt und das Schweigen in der Trauerwoche noch nicht zu übersetzen, aber zu verstehen gelernt hat.
Natürlich ist das nicht die einzige Geschichte, die man über das Land erzählen kann, über den Musterschüler internationaler Entwicklungspläne. Ruanda, das ist auch der Gebärdendolmetscher, der im staatlichen Fernsehen die Nachrichten für die gehörlosen Zuschauer übersetzt. Es ist das Haus der Westerwelle Foundation, hip und schick wie in Berlin-Mitte, in dem sich junge Start-up-Unternehmer treffen. Es ist das neue VW-Werk. Es ist die weltweit größte Beteiligung von Frauen im Parlament. Es ist der ordentlich gestutzte Rasen, die asphaltierte Straße, die Zebrastreifen auch noch in den kleinen Dörfern, die solide Stromversorgung, eine zumindest in der Hauptstadt leidlich gut funktionierende Internetverbindung, wenn man auch nicht weiß, wie viele Menschen die E-Mails mitlesen. Ruanda ist eines der stabilsten Länder der Region, und diese Stabilität hat ihren Preis.
Als das Flutlicht wieder angeht, ziehen einige europäische Journalisten mit ihrer Ausrüstung über den grell angestrahlten Rasen wie eine geschlagene Mannschaft. Die Bilder sind gemacht. Aus den Stadionrängen über mir höre ich noch die Schreie der Frauen, die einholt, was sie damals gesehen haben.
Am Montag blicke ich in die stechend blauen Augen eines Soldaten, der am Rednerpult steht, vor den Einschusslöchern, die noch immer zu sehen sind in der Wand des Flachdachbaus. Von der Veranstaltung im Kamp Kigali Memorial habe ich nur durch Zufall erfahren, am Freitag, als hier noch geschweißt wurde, ich durch die Ausstellung ging, die erst heute eröffnet wird, und mich ein älterer Mann bat, etwas ins Gästebuch zu schreiben.
Unter einem Zelt sitzen die Ehrengäste, Juncker, Michel, ein ruandischer Minister und einige mehr, von einem Absperrband getrennt stehen etwa zwei Dutzend Zuschauer, und einige Militärangehörige warten unter einem Baum. In die zehn Stelen für die zehn hier gefallenen belgischen Soldaten sind ihre Lebensjahre als Lücken in den Stein geschnitten. Ist die Erinnerung an die ruandische Kolonialzeit in Deutschland fast verblasst, erinnert man sich in Belgien noch etwas besser an die Zeit seit 1919, als diese Gegend hier im Versailler Vertrag von einem Teil Deutsch-Ostafrikas in ein dem Völkerbund unterstelltes, von Belgien verwaltetes Mandat umgeschrieben wurde, erinnert sich zumal an jene Soldaten, die fünfundsiebzig Jahre später, zweiunddreißig Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes erschossen wurden, als sie die ruandische Premierministerin in der Nacht nach dem Flugzeugabsturz schützen sollten.
Mein Begleiter entschuldigt sich, dass er so reglos im Schatten bleibe. Er habe Angst vor Soldaten, fügt er hinzu, ich werfe ihm einen Blick zu, der beruhigend sein soll, aber wohl nur hilflos wirkt, und frage mich, warum ich gerade jetzt, als eine junge Frau, vermutlich die Tochter eines der gefallenen Soldaten, vor Weinen zu zittern beginnt, selbst die Tränen unterdrücken muss, warum mir die Szene so viel näher geht als jene im Stadion, wo ich nur Überwältigung, aber keine Trauer spürte. Weil die Zeichen und Rituale mir hier bekannter sind, wie bei einer Beerdigung und nicht wie bei einem Popkonzert? Weil Trauer erst möglich ist, wenn das Trauma nicht mehr alles überlagert? Weil zehn Tote fassbar sind, aber eine Million, das ist zu groß, das ist nur noch eine Zahl? Oder gibt es doch andere Gründe, jenen verwandt, wegen denen 1994 das Interesse so leicht wieder auf europäische Babynahrung gelenkt werden konnte, Gründe, über die ich mich gern erhaben glaubte und aufgrund derer ich mich vielleicht doch leichter wiedererkenne in der jungen Belgierin, die leise um jemanden trauert, als in der Ruanderin, die plötzlich aufschreit, weil alle schrecklichen Erinnerungen zurückkommen?
Die Ehrengäste verlassen nach und nach die Ausstellung, gehen wieder zu ihren neben dem Haus geparkten Limousinen, um zum Flughafen zu fahren, zurück nach Europa zu reisen. Auf den Stühlen liegen noch die Namenszettel, der von Jean-Claude Juncker ist verrutscht, morgen wird von ihrem Besuch nichts mehr zu sehen sein, nur die Einschusslöcher bleiben, wie seit fünfundzwanzig Jahren.
Gerechtigkeit für die Welt
»Ich hoffe, dass Sie mich jetzt besser kennen.« Mit ruhiger Stimme spricht der Angeklagte am 30. August 2018 zum vorerst letzten Mal vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. »Dass Sie jetzt wissen, dass der Terminator, der Ihnen vom Ankläger präsentiert wurde, nicht ich bin.« »Ce n'est pas moi«, wie es im Französischen protokolliert wird. »Das bin ich nicht.«