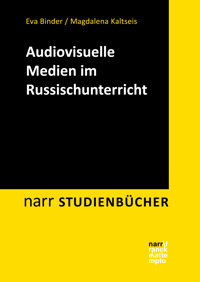
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch zeigt das Potenzial audiovisueller Medien für den Russischunterricht an Schulen, Hochschulen und Universitäten auf und unterstützt Russisch-Lehrende dabei, audiovisuelle Medien in ihrem Unterricht einzusetzen. Es bietet fundierte und konzise Informationen über die zeitgenössische russischsprachige Medienlandschaft und ihre vielfältigen Formate. Die Auswahl an Medienbeispielen umfasst Kino- und Spielfilme, das russische Fernsehen - hier insbesondere die Formate TV-Talkshow und TV-Serie - sowie aus dem Bereich aktueller Internet-Formate die beiden YouTuber Jurij Dud' und Il'ja Varlamov. Neben Überblicksdarstellungen werden Möglichkeiten zur Förderung der Sprach- und Medienkompetenz präsentiert und eine kritische Rezeption dieser Medien angeregt. Die im Buch enthaltenen Übungen und kommunikativen Aufgaben werden als Arbeitsblätter zusätzlich online zur Verfügung gestellt, sodass sie direkt im Unterricht eingesetzt werden können. Sie decken alle sprachlichen Niveaustufen von A1 bis C1 ab - von Anfänger:innen bis zu fortgeschrittenen Lernenden und Herkunftssprecher:innen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Binder / Magdalena Kaltseis
Audiovisuelle Medien im Russischunterricht
Dr. Eva Binder ist Slawistin an der Universität Innsbruck mit Schwerpunkt auf russischer Kultur- und Medienwissenschaft.
Dr. Magdalena Kaltseis ist Slawistin an der Universität Innsbruck mit Schwerpunkt auf russischer Sprachwissenschaft und Fachdidaktik.
Diese Publikation wurde gefördert durch die Universität Innsbruck: den Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen – kulturelle Konflikte“, die Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät und das Osteuropazentrum.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395126
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-8233-8512-7 (Print)
ISBN 978-3-8233-0530-9 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer über die Jahre gewachsenen, inspirierenden und fruchtbaren Zusammenarbeit. Diese begann zunächst in Form von gemeinsamen Filmabenden und anschließenden Beiträgen für die Zeitschrift Praxis Fremdsprachenunterricht Russisch (PFU), die 2020 eingestellt wurde. Aufgrund der entstandenen Lücke, vielmehr noch aber aufgrund unserer ungebrochenen Leidenschaft für russischsprachige audiovisuelle Medien und deren Aufbereitung für den Russischunterricht haben wir uns dazu entschlossen, ein gemeinsames Buchprojekt zu realisieren, das die Medienwelt Russlands in ihrer Breite abbilden sollte.
Die Teamarbeit war geprägt von Höhen und Tiefen, wobei der Beginn von Russlands großangelegter Invasion der Ukraine im Februar 2022 den absoluten Tiefpunkt markiert und nicht zuletzt auch unser Buchprojekt infrage gestellt hat. Gleichzeitig hat die Aggression der Russischen Föderation und die damit einhergehende Militarisierung der russischen Sprache unseren Blick geweitet und unsere Perspektive von russischen auf russischsprachige Medien verschoben. In dieser prekären Situation war es wichtig, die Sprache als das zu sehen, was sie für viele Menschen in erster Linie ist: ein Kommunikationsmittel, das innerhalb der Sprecher:innengemeinschaft sowie als Sprache der inter- bzw. transnationalen Kommunikation zum gegenseitigen Austausch und Verständnis dient. Das bedeutet, dass Russisch mehr ist als Russland. Gleichzeitig sind wir aber gerade angesichts der russischen Aggression gefordert, einen kritisch-reflektierten Umgang mit der russischen Sprache und Kultur zu entwickeln. Das bedeutet einerseits, die koloniale russische „Brille“ im Hinblick auf den postsowjetischen Raum abzulegen und andererseits, auf jegliche Art romantisierend-stereotypisierender Perspektiven auf Russland zu verzichten.
Die Arbeit am vorliegenden Buch beinhaltete nicht zuletzt auch das Vorstellen der jeweiligen medialen Beispiele und das Erproben der Arbeitsaufgaben in unterschiedlichen Settings. Neben der Präsentation auf Fachtagungen und Lehrer:innenfortbildungen konnten wir einige Medienbeispiele in unseren Lehrveranstaltungen mit Studierenden an der Universität Innsbruck ausprobieren und anschließend diskutieren. Dieser Austausch auf wissenschaftlicher und praktischer Ebene sensibilisierte uns für unterschiedliche Blickwinkel und emotionale Reaktionen und trug zur Verbesserung, Verfeinerung und Präzisierung der Arbeitsaufgaben bei. Gleichzeitig konnten wir in diesem Prozess unser eigenes Verständnis der gewählten Medienbeispiele vertiefen und sind allen, die uns dabei begleitet haben, insbesondere aber den Studierenden für ihr Mitwirken und ihre Anregungen dankbar.
Auch wenn viele Etappen der Zusammenarbeit und des Austauschs im Buch nicht direkt sichtbar werden, wie zum Beispiel das gemeinsame Ansehen von Filmen, die zahlreichen Besprechungen und Überarbeitungen sowie Phasen des kollaborativen Schreibens, so zeigt sich doch an den Inhalten und an unserem didaktischen Herangehen, dass wir beide unsere fachspezifische Expertise einfließen lassen konnten. Sichtbar machen möchten wir an dieser Stelle aber jene Personen, die uns bei diesem Buchprojekt tatkräftig unterstützt haben. So sind wir Svitlana Pidoprygora sowie Anna Moravskaya für die akribische Durchsicht und sprachliche Korrektur der russischsprachigen Teile dankbar. Danken möchten wir des Weiteren Hanna Niederkofler, die dieses Buch auf seine formale und sprachliche Korrektheit hin übeprüft hat. Unser Dank gilt zudem Marijana Milošević und Georg Gierzinger, die die von ihnen entwickelten Arbeitsaufgaben zu je einem Medienbeispiel für diese Publikation zur Verfügung gestellt haben sowie unserem studentischen Mitarbeiter Alexander Löffler, der die Landkarten für die Arbeitsaufgaben zu den Reisereportagen von Il’ja Varlamov gestaltet hat. Schließlich bedanken wir uns beim Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“, bei der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät sowie beim Osteuropazentrum der Universität Innsbruck für die finanzielle Unterstützung.
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass wir unser Buch über audiovisuelle Medien im Russischunterricht selbst als „Medium“ verstehen, nämlich im unmittelbaren Wortsinn als vermittelndes Element zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen uns Wissenschaftlerinnen und unseren Leser:innen und Nutzer:innen – den Praktiker:innen an Schulen, Hochschulen und Universitäten und ihren Sprachlernenden. Wir freuen uns daher über Erfahrungsberichte zum Einsatz der Audiovisuellen Medien im Russischunterricht.
Eva Binder und Magdalena Kaltseis Innsbruck, im Jänner 2025
1Einleitung
Bilder von der Welt und von uns selbst gehören zu unserem Alltag und sind ein untrennbarer Teil unserer kulturellen Praktiken. Wir denken und kommunizieren in und mit Bildern, nehmen die Welt durch Bilder wahr, setzen unsere Erinnerungen aus Bildern zusammen. Durch die Digitalisierung der vergangenen beiden Jahrzehnte erleben wir zusätzlich eine zunehmende Präsenz audiovisueller Medien. So zentral sie für unser Alltagsleben geworden sind, so selbstverständlich sollten sie in den Unterricht integriert werden. Umso mehr noch, als audiovisuelle Medien einen untrennbaren Teil der Lebenswelt und kommunikativen Praktiken junger Menschen darstellen – von der passiven Rezeption von Filmen, TV-Serien und YouTube-Formaten bis hin zur aktiven Bildproduktion in den sozialen Medien. Umgelegt auf den (Fremd)Sprachenunterricht würde dies bedeuten, dass authentische, d. h. von einer und für eine bestimmte Sprecher:innengemeinschaft erstellte audiovisuelle Medien gezielt im Unterricht eingesetzt werden sollten. Gleichzeitig stellen diese Medien die Lehrkräfte aber vor enorme Herausforderungen, sehen sich diese doch einerseits mit einer unüberschaubaren Fülle konfrontiert, während andererseits ihre kurze Aktualitätsspanne in keinem Verhältnis zur aufwändigen Aufbereitung für den Unterricht zu stehen scheint. Die Herausforderungen und Potenziale, die der Einsatz audiovisueller Medien im (Fremd)Sprachenunterricht mit sich bringt, sollen daher einleitend kurz skizziert werden.
(Fremd)Sprachenunterricht: Wenn wir den ersten Teil des Wortes Fremdsprachen in Klammern setzen, dann möchten wir damit auf die Problematik des Begriffs aufmerksam machen, der in einer plurilingualen und multikulturellen Welt nicht mehr zeitgemäß erscheint. Der Begriff hat eine ideologische Komponente und impliziert unweigerlich „Fremdheit“ bzw. „Andersheit“. Auch häufig verwendete Alterativbegriffe wie „Zweit-/Drittsprache“ sind aufgrund der (wertenden) Reihung von Sprachen nicht ideal, weshalb in Kanada, Großbritannien und Australien vermehrt der Terminus additional language bzw. langue additionelle für jede zusätzlich zur „Erstsprache“ (L1) erlernte Sprache benutzt wird. Der Begriff additional language verweist auf die Philosophie eines inklusiven Sprachenlernens, da er den Fokus auf sprachliche Vielfalt anstatt auf eine wertebehaftete Zuschreibung („fremd“) legt.
1.1Potenziale und Herausforderungen audiovisueller Medien im (Fremd)Sprachenunterricht
Der Einsatz audiovisueller Medien im (Fremd)Sprachenunterricht stellt einen wichtigen Pfeiler der Förderung des interkulturellen Lernens dar. Obwohl die Sprache in audiovisuellen Medien für Lernende schwierig erscheint, sind Filme, Interviews oder YouTube-Clips authentische Materialien, die von einer Sprecher:innengemeinschaft produziert und rezipiert werden. Medien sind das Mittel, mithilfe dessen sich eine Gesellschaft oder nationale Gemeinschaft über sich selbst verständigt. Den Lernenden Einblicke in russischsprachige Medien in und außerhalb von Russland sowie in die entsprechenden medialen Praktiken zu vermitteln, bedeutet daher, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas über die russischsprachigen Menschen und ihre kulturellen Praktiken zu erfahren, sich ihnen anzunähern.
Da wir die Welt und uns selbst immer stärker über audiovisuelle Medien wahrnehmen und erfahren, erscheint es umso wichtiger, dass wir uns ihrer Funktionsweisen bewusst werden und diese auch den Schüler:innen bzw. (Fremd)Sprachenlerner:innen bewusst machen. Dabei gilt in Bezug auf Russland wie auf alle anderen Länder oder Sprecher:innengemeinschaften auch, dass ein Film oder Medium immer nur eine bestimmte Sichtweise auf etwas zeigt, die es dann im Unterricht zu reflektieren gilt. Das bedeutet gleichzeitig, dass man mit einem einzigen Film oder Medium nur sehr wenig erreicht. Mit dem wiederholten Einsatz unterschiedlicher audiovisueller Medien im Laufe mehrerer Unterrichtsjahre gibt man den Lernenden dagegen die Möglichkeit des Vergleichs und vervielfältigt ihre audiovisuellen Perspektiven auf ein Land, eine Gesellschaft, eine Sprache. So wie es nicht das eine Bild von Russland bzw. von Ländern, in denen Russisch gesprochen wird, gibt, so gibt es auch nicht den einen Film oder das eine Medium. Die Funktionsweisen audiovisueller Medien bewusst zu machen und kritisch zu hinterfragen, stellt damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Medienkompetenz (media literacy) dar.
Ein wesentlicher Faktor der Medienwelt, in der wir leben, ist, dass wahrscheinlich niemals zuvor derart viele Informationen, Texte und Materialien gleichzeitig zur Verfügung standen und laufend neu produziert werden. Dabei stehen insbesondere junge Menschen vor dem Problem, dass sie nicht unterscheiden können, was wichtig und unwichtig, wissenswert und nicht wissenswert, komplex und banal ist. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, die Schüler:innen bzw. (Fremd)Sprachenlerner:innen dabei zu unterstützen, diese Entscheidungen – insbesondere auch in Bezug auf die unbekannte, anderssprachige Medienlandschaft – treffen zu lernen. Die wiederholte und bewusste Auseinandersetzung mit audiovisuellen Medien im (Fremd)Sprachenunterricht leistet damit gleichzeitig auch einen Beitrag zur Förderung der Lerner:innenautonomie, indem sie die Lerner:innen ermutigt, selbstständig und kritisch Medienangebote zu wählen.
1.2Ziele und Zielgruppen des Buches
Wie die einleitenden Überlegungen zeigen, kann und soll der Einsatz audiovisueller Medien im modernen (Fremd)Sprachenunterricht weit mehr leisten, als nur die sprachlichen Fertigkeiten zu schulen. Mit Blick auf existierende Lehrmaterialien für den Russischunterricht lässt sich jedoch festhalten, dass das Potenzial audiovisueller Medien bisher zu wenig genutzt wird. So sind die wenigen vorhandenen Publikationen häufig veraltet und bleiben ebenso häufig auf (sowjetische) Spielfilme konzentriert. Darüber hinaus lässt sich die Tendenz beobachten, dass die Integration audiovisueller Medien in den Unterricht einseitig erfolgt, indem die Konzentration auf dem Sprach- und Hörverständnis liegt, während die Lernenden nichts oder kaum etwas über das Medium selbst erfahren.
Das vorliegende Buch soll daher dazu beitragen, die vorhandene Lücke im Bereich der (Fremd)Sprachendidaktik Russisch zu schließen und richtet sich an Russischlehrende an Schulen, Hochschulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Wenn wir von audiovisuellen Medien im Russischunterricht sprechen, dann gehen wir von einem breiten, zeitgemäßen Verständnis audiovisueller Medien aus und berücksichtigen neben dem traditionellen Kino- bzw. Spielfilm der vergangenen zwei Jahrzehnte auch das Fernsehen sowie aktuelle Internet-Formate. Den jeweiligen Kapiteln über die ausgewählten medialen Beispiele vorangestellt sind einleitende, informative Leitkapitel, die die Besonderheiten des jeweiligen Mediums herausarbeiten. Auf diese Weise wollen wir die Lehrenden gleichermaßen über audiovisuelle Medien in russischer Sprache informieren wie ihnen für den Unterricht aufbereitete, konkrete Beispiele mit Arbeitsaufgaben an die Hand geben. Dabei diskutieren wir in einem ersten Schritt die einzelnen medialen bzw. filmischen Beispiele in einem breiten und jeweils spezifischen kulturellen, medialen, gesellschaftlichen und politischen Kontext. Anschließend zeigen wir Einsatzmöglichkeiten im Russischunterricht anhand von Übungen und kommunikativen Aufgaben auf.
Es sind damit drei Ziele, an denen wir uns orientieren, um audiovisuelle Medien im Russischunterricht als Lernressource besser nutzbar zu machen: Erstens sollen Russischlehrende dabei unterstützt werden, audiovisuelle Medien in ihrem Unterricht einzusetzen, indem sie fundierte und konzise Informationen über die zeitgenössische russische bzw. russischsprachige Film- und Medienlandschaft erhalten. Zweitens wollen wir Möglichkeiten zur Förderung der Sprach- und Medienkompetenzen der Sprachlernenden aufzeigen und drittens eine kritische Rezeption von audiovisuellen Medien anregen, die idealerweise zur selbstständigen Mediennutzung der Sprachlernenden führt.
1.3Die einzelnen Kapitel im Überblick
In Kapitel 2 stellen wir die spezifischen (medien)didaktischen Überlegungen, die den hier präsentierten Aufgaben zugrunde liegen, vor und geben praktische Hinweise für die Nutzung des Buches im Russischunterricht.
Die Breite der audiovisuellen Medien mit ihren unterschiedlichen Inhalten, Formensprachen und Formaten werden in drei großen Blöcken bzw. Kapiteln (3–5) abgebildet. Kapitel 3 widmet sich dem traditionellen Erzählformat des Kino- bzw. Spielfilms – mit Beispielen aus der russischsprachigen Filmproduktion der vergangenen zwei Jahrzehnte, die so gewählt sind, dass sie ein möglichst breites Spektrum an inhaltlich und formal unterschiedlichen Filmen abdecken. Den Auftakt zum Kapitel über das traditionelle Erzählformat des Kino- bzw. Spielfilms bilden drei Kurzfilme: VYVODY1(2014, Anastasija Možegova), BEZ SLOV (2010, Ivan Šachnazarov) und NAČAL’NIK (2009, Jurij Bykov). Hierbei handelt es sich um studentische Abschlussarbeiten der Moskauer Filmhochschule VGIK, die thematisch und ästhetisch sehr unterschiedlich sind. Während in VYVODY die Gespräche zwischen einem Taxifahrer und seinen Kund:innen festgehalten werden, zeigt BEZ SLOV die Begegnung zweier Soldaten im Zweiten Weltkrieg und kommt dabei ganz ohne Worte aus. Der in schwarz-weiß gedrehte NAČAL’NIK spielt in der russischen Provinz der Gegenwart und wirft Fragen nach Recht und Gerechtigkeit auf.
Im Anschluss an die Kurzfilme präsentieren und diskutieren wir – chronologisch nach dem Produktionsjahr angeordnet – sieben Kinofilme von Arthouse-Produktionen bis hin zum russischen Mainstream. Als ersten Film haben wir den vielfach ausgezeichneten Debütfilm VOZVRAŠČENIE (2003) des national und international bekannten Regisseurs Andrej Zvjagincev gewählt, der von einem Brüderpaar erzählt, dessen Vater nach jahrelanger Abwesenheit zur Familie zurückkehrt. Anhand dieses Films können (stereotype) männliche Rollenbilder hinterfragt und das autoritäre Verhalten des Vaters thematisiert werden.
Der zweite vorgestellte Film, RUSALKA (2007, Anna Melikjan), ist ein zeitgenössisches Großstadtmärchen, das auf humorvolle Weise das Erwachsenwerden einer jungen Frau schildert. RUSALKA bietet nicht nur Einblicke in die russische Lebenswelt der 2000er Jahre, sondern auch die Möglichkeit, die Konsumwelt kritisch zu hinterfragen.
Im Mittelpunkt des patriotischen Sportfilms LEGENDA №17 (2012, Nikolaj Lebedev) steht der bekannte sowjetische Eishockeyspieler Valerij Charlamov. Dieser Film ist für sportbegeisterte Lernende genauso geeignet wie für eine Reflexion über den Zusammenhang zwischen Sport einerseits und Patriotismus, Populärkultur und Politik andererseits.
Ein wichtiges Auswahlkriterium bestand darin, Filme zu präsentieren, die in unterschiedlichen geografischen Regionen angesiedelt sind und Fragen ethnischer und regionaler Identitäten und Konflikte aufwerfen. Der Film GEOGRAF GLOBUS PROPIL (2013, Aleksandr Veledinskij) handelt von einer Rafting-Tour ins Uralgebirge, die eine Schulklasse gemeinsam mit ihrem Geografielehrer unternimmt. Am Beispiel dieses Ausflugs können die Rezipient:innen über Handlung und Figuren die Entwicklung der Jugendlichen hin zu mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung verfolgen. Wir thematisieren anhand dieses Films daher Fragen der Lerner:innenautonomie und präsentieren konkrete Möglichkeiten, um diese im Unterricht zu fördern.
Der estnisch-georgische Antikriegsfilm MANDARIINID (2013, Zaza Urushadze) zeigt in Form und Inhalt die Sinnlosigkeit des Mordens aufgrund interethnischer Konflikte auf. Im Unterricht eignet sich MANDARIINID vor allem dazu, dem bildungspolitischen Auftrag der Friedens- und Demokratieerziehung nachzukommen. So bestärkt der Film handlungsleitende gesellschaftliche Werte wie Toleranz, Solidarität und Humanismus.
Um Konflikte geht es auch im Film UČENIK(2016, Kirill Serebrennikov). Dieser spielt in einer russischen Schule abseits von den großen urbanen Zentren und behandelt ein brisantes Thema: die gefährliche Dynamik des religiösen Fanatismus. UČENIK gibt Einblicke in die gesellschaftlichen Stimmungen im Russland der 2010er Jahre und stellt religiösen Fundamentalismus als Problem der Zeit heraus, weshalb sich für den Schulunterricht ein fächerübergreifender Einsatz des Films anbietet.
Den Abschluss des Kapitels über Kino- bzw. Spielfilme bildet HYTTI NRO 6 (2021, Juho Kuosmanen), der die Zugreise einer finnischen Studentin von Moskau nach Murmansk zeigt und die Geschichte zweier Außenseiter im Russland der späten 1990er Jahre erzählt. Für Lerner:innen besonders wertvoll ist er aber gerade deshalb, weil im Film die Rolle der russischen Sprache als Kommunikationsmittel, das kulturelle und soziale Barrieren überwindet, auf anschauliche und humorvolle Weise vermittelt wird.
Kapitel 4 widmet sich dem Fernsehen in Russland. Dabei konzentrieren wir uns auf die Formate TV-Talkshow und TV-Serie. Das Fernsehen stellt bis heute das wichtigste Massenmedium in Russland dar, und Talkshows nehmen auf den staatlichen Fernsehkanälen eine zentrale Stellung ein. Ein Thema, das wir in Bezug auf das Fernsehen besonders beleuchten, stellt die politische Propaganda dar, die nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, sondern bereits seit Jahren von den russischen Staatsmedien lanciert wird. Um zu vermitteln, wie russische TV-Propaganda aussieht und wie wirkungsvoll sie ist, haben wir einen kurzen Sendungsausschnitt der politischen Talkshow 60 MINUT didaktisch aufbereitet, in dem unter dem Motto „Grenzen der Toleranz“ (Granicy tolerantnosti) liberale westliche Werte abgehandelt werden. Die bereitgestellten Aufgaben zielen darauf ab, gemeinsam mit den Lernenden die formalen Mittel der Talkshow zu analysieren und die ideologischen Aussagen herauszuarbeiten. Da in dem kurzen Fragment unterschiedliche, ideologisch äußerst relevante Themen von den vielpropagierten traditionellen Werten bis hin zum Verhältnis Russlands zum kollektiven Westen miteinander verknüpft werden, eignet sich gerade dieser Sendungsausschnitt dafür, die Lernenden auf den illiberalen, antiwestlichen politischen Diskurs aufmerksam zu machen, der über das russische Staatsfernsehen seit Jahren verbreitet wird.
Als zweites Beispiel haben wir uns für die Mode-Talkshow MODNYJ PRIGOVOR entschieden, die bis 2022 eine überaus populäre Show auf dem Pervyj kanal war und die 2023 auf NTV unter dem neuen Titel MODNYJ VS NARODNYJ wieder auf Sendung gegangen ist. Seit 2024 wird die Talkshow jedoch wieder unter dem bekannten Titel MODNYJ PRIGOVOR vom Pervyj kanal produziert. Die ausgewählte Folge und die dazu vorgestellten Arbeitsaufgaben zielen thematisch darauf ab, im Unterricht Fragen genderspezifischer Rollenbilder zu diskutieren und über kulturelle Stereotype zu reflektieren.
Neben TV-Talkshows erfreuen sich in Russland auch Serien großer Beliebtheit beim Publikum. Als Beispiel für eine breit rezipierte und öffentlich diskutierte TV-Serie stellen wir ZULEJCHA OTKRYVAET GLAZA vor, die auf dem 2015 erschienenen gleichnamigen Debüt-Roman der tatarisch-russischen Autorin Guzel’ Jachina basiert. Buch und Serie spielen zur Zeit der Entkulakisierung der 1930er Jahre und erzählen die Geschichte einer tatarischen Bäuerin, die in ein stalinistisches Arbeitslager in Sibirien deportiert wird und sich dort zu einer starken und emanzipierten Frau entwickelt. Für die Behandlung im Unterricht haben wir eine Schlüsselszene aus Roman und TV-Serie ausgewählt, die wir einander gegenüberstellen, um die Lernenden für die medienspezifischen Ausdrucksmöglichkeiten von Literatur und Film zu sensibilisieren. Abgesehen davon ist die Serie thematisch interessant, denn sie eignet sich zur Vermittlung von Wissen über die Geschichte der Sowjetunion (die stalinistischen Repressionen) wie auch über Russland als multinationalem Staat (Tatarstan).
Schließlich nähern wir uns in Kapitel 5 dem Internet an, das mit seinen Informations- und Unterhaltungsplattformen das Medienverhalten und die Weltwahrnehmung junger Menschen wesentlich stärker bestimmt als Kino und Fernsehen das heute tun. In Russland kommt die Besonderheit hinzu, dass das Informations- und Unterhaltungsangebot im Internet eine Alternative zu den staatlich kontrollierten Medien bildet – eine Situation, die sich seit der Liquidierung der letzten großen unabhängigen Medien im Februar und März 2022 noch einmal drastisch verschärft hat. Da es unmöglich ist, das Internet aufgrund der Fülle von Akteur:innen, der großen Bandbreite an Formaten und der Dynamik von Plattformen und Social-Media-Kanälen in seiner Gesamtheit abzubilden, nähern wir uns diesem Bereich über die Vorstellung einzelner Akteure an, die Millionen von Followern und Views auf YouTube und Instagram für sich verbuchen können. Zum einen ist dies der bekannte Interviewer Jurij Dud’ und sein YouTube-Kanal vDud’. Zum anderen stellen wir den Blogger und Aktivisten Il’ja Varlamov vor, der auf seinem YouTube-Kanal varlamov Reportagen über Städte und Länder aus der ganzen Welt auf ansprechende Art und Weise präsentiert.
Im Film- und Medienverzeichnis werden alle im Buch erwähnten audiovisuellen Medien alphabetisch nach Originaltitel aufgelistet. Deutsche, englische, anderssprachige Verleihtitel oder, wenn es keinen internationalen Titel des Mediums gibt, von den Autorinnen angefertigte Übersetzungen der russischen Originaltitel werden nicht im Buchtext, sondern im Film- und Medienverzeichnis angeführt. Ergänzend dazu enthält das Film- und Medienverzeichnis Informationen zum Produktionsland bzw. den Produktionsländern sowie zum Produktionsjahr bzw. den Produktionsjahren. Bei den YouTube-Formaten werden der YouTube-Kanal und das Datum der Veröffentlichung angegeben.
Die Arbeitsmaterialien für den Unterricht stehen in der eLibrary zum Download zur Verfügung. Sie enhalten die gesamten im Buch abgedruckten Aufgabenstellungen zum jeweiligen Medienbeispiel. Die Downloadmöglichkeit wird jeweils am Beginn der Präsentation der Einsatzmöglichkeiten des konkreten Medienbeispiels im Russischunterricht über ein Icon und eine Zusatzmaterialien-ID am Seitenrand angezeigt. Im eBook genügt ein Klick auf die ID, um auf die Arbeitsmaterialien zugreifen zu können. Leser:innen des gedruckten Buchs erhalten mit ihrem Gutscheincode auf der ersten Seite einen kostenfreien Zugriff auf das eBook und die Arbeitsmaterialien für den Unterricht. Außerdem werden weitere Icons am Seitenrand verwendet und kennzeichnen
die einzelnen Aufgabenstellungen
QR-Codes zum Aufruf von Links innerhalb der Aufgabenstellungen
Informationen zur Verfügbarkeit der einzelnen Medienbeispiele
Exkurse zu bestimmten Begriffen, Begriffsverwendungen oder landeskundlichen und kulturellen Informationen.
Abschließend möchten wir an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass russische Titel und Namen nach der internationalen wissenschaftlichen Transliteration wiedergegeben werden, um eine Rückführung auf die russische Originalschreibung zu ermöglichen.
2(Medien)Didaktische Überlegungen
Das vorliegende Buch unterscheidet sich von bisherigen Publikationen und Vorschlägen zum Einsatz audiovisueller Medien im Russischunterricht durch einen Perspektivenwechsel: Die audiovisuellen Medien werden nicht als Mittel zum Zweck präsentiert, um die sprachlichen Kompetenzen der Lernenden in der Zielsprache zu schulen, sondern die medialen Texte und Produkte selbst stehen im Mittelpunkt. Sie zu verstehen – im hermeneutischen wie auch sprachlichen Sinn – setzt die Kenntnis und Nutzung der Zielsprache voraus. Dieser Perspektivenwechsel bestimmt auch den inhaltlichen Aufbau des Buches, das sich in mehreren Stufen vom Allgemeinen zum Konkreten, von Überblicksdarstellungen zum spezifischen Beispiel, von historischen Hintergrundinformationen zur konkreten Filmszene bewegt. Das bedeutet, dass die einzelnen audiovisuellen Medien, Mediengattungen und Formate wie auch die gewählten Beispiele analytisch-beschreibend vorgestellt und themenzentriert besprochen werden. Auf diese Weise erhalten die Lehrenden nicht nur wichtige Kontext- und Detailinformationen, sondern auch Interpretationshilfen, die einen souveränen Umgang mit den verschiedenen Medien befördern sollen. Zentrale Aspekte dieser einleitenden Texte werden dann in den sprachlichen Übungen und kommunikativen Aufgaben wieder aufgegriffen, um so an die Lernenden weitervermittelt zu werden.
2.1Kritische Fremdsprachendidaktik
Bei unserer Herangehensweise an audiovisuelle Medien und deren Vermittlung im Russischunterricht orientieren wir uns an der Kritischen Fremdsprachendidaktik, deren wesentliches Ziel die Herausbildung und Schulung sogenannter transversaler Kompetenzen ist. Dazu gehören u.a. die kritische Diskursfähigkeit, das „Thematisieren und Erkennen von machttheoretischen Zusammenhängen, de[r] Abbau von Vorurteilen“ sowie Demokratieerziehung (Gerlach 2020: 8). Auch die Vermittlung von Medienkompetenz als Umgang mit und Einordnung von Quellen und Informationen, die Bild- und Symbolkompetenz, wie zum Beispiel das (Er)Kennen von Kollektivsymbolen, sowie Sprachbewusstheit sind gerade für den Russischunterricht heute wichtiger denn je zuvor.
Wie Bergmann (2023: 16) konstatiert, stehen die Russischlehrenden seit dem 24. Februar 2022 vor der schwierigen Frage, wie sie „in Zukunft mit Russland, mit der russischen Kultur und der russischen Sprache umgehen“ sollen. Der seit Russlands großangelegter Invasion der Ukraine in Europa geführte wissenschaftliche und mediale Diskurs über die russische Sprache und Kultur ist komplex und beinhaltet Forderungen, die von einem Ablegen der kolonialen russischen „Brille“, insbesondere im Hinblick auf den postsowjetischen Raum, bis hin zu einem Boykott der russischen Kultur reichen. Von russischer Seite wird die eigene Geschichte und Kultur instrumentalisiert und als Propagandawaffe eingesetzt – von der mittelalterlichen Kiewer Rus über die literarischen Klassiker des 19. Jahrhunderts, die den Ruf der „großen“ russischen Literatur (velikaja russkaja literatura) begründen, bis hin zur sowjetischen kulturellen und wissenschaftlichen Hinterlassenschaft, die oft fälschlicherweise mit Russisch und Russland gleichgesetzt wird. Lehrbücher und -materialien können sich, wenn sie von russischer Seite kommen, dieser ideologischen Vereinnahmung nur schwer entziehen, so unpolitisch sie auch erscheinen mögen. In Bezug auf in Deutschland verlegte Russischlehrwerke kann dagegen kritisch festgehalten werden, dass diese in Zusammenhang mit der (sprachlichen) Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht zunehmend inhaltsleer geworden sind (vgl. Bergmann 2023: 23). Während die Vermittlung von kulturellen, historischen oder sozioökonomischen Inhalten reduziert wurde, lässt sich eine Tendenz zur Bebilderung feststellen, die per se zur Stereotypisierung neigt: goldene Kirchenkuppeln, Matrjoschkas, Birkenwälder, die Basilius-Kathedrale in Moskau – Bilder, die an der Oberfläche bleiben und eher den Blick verstellen, als einen Zugang zum Verständnis von Land und Kultur(en) zu befördern. Um diesen vielfältigen Herausforderungen zu begegnen, ist es notwendig, sich von der Vorstellung zu verabschieden, es würde die eine russische Kultur und Sprache geben. Stattdessen gilt es, wie Bergmann es formuliert, einen „vielfältigeren und differenzierteren Blick auf russischsprachige Kultur zu etablieren“ (Bergmann 2023: 22).
Mit dem vorliegenden Buch versuchen wir, den skizzierten Herausforderungen mit Rückgriff auf die Kritische Fremdsprachendidaktik zu begegnen, indem wir uns mit medialen Inhalten auseinandersetzen und die Russischlehrenden dazu motivieren, diese Inhalte und Themen an die Russischlernenden weiterzuvermitteln. Dabei haben wir gezielt Inhalte ausgewählt, die in traditionellen Russischlehrwerken fehlen. Dazu gehören politische Propaganda, religiöser Fundamentalismus, die kritische Auseinandersetzung mit der (sowjetischen) Vergangenheit, interethnische Konflikte oder Genderstereotype. Da diese Inhalte komplex sind und „eines grundständigen und umfassenden Wissens“ von Seiten der Lehrenden bedürfen (Gerlach/Fasching-Varner 2020: 219), bieten wir einführende Texte zu den jeweiligen Medien und medialen Beispielen an und bereiten die Lehrkräfte auf diese Weise auf die präsentierten Diskussions- und Reflexionsaufgaben vor.
Die Auseinandersetzung mit komplexen Inhalten entspricht auch der Forderung von Byram (2021: 54), dass der (Fremd)Sprachenunterricht allgemeine Bildungsziele verfolgen soll. Byram verwendet dafür explizit den Begriff der politischen Bildung (political education), zu deren Zielen die Vermittlung von Wissen über und das Verständnis für andere Länder und Gesellschaften, die Reflexion über gesellschaftliche Normen sowie die Förderung der Bereitschaft zu Engagement und Interaktion gehören.
Michael Byram ist in der (Fremd)Sprachendidaktik vor allem für seine Monographie Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence bekannt, die erstmals 1997 erschienen ist und 2021 in überarbeiteter Form publiziert wurde. Die von Byram verwendete Begrifflichkeit „interkulturelle kommunikative Kompetenzen“ verweist auf die Verknüpfung von kommunikativen Kompetenzen, ergo linguistischen, soziolinguistischen und diskursiven Kompetenzen, mit interkulturellen Kompetenzen. Laut Byram (2021: 44) ist das Ziel der Entwicklung der interkulturellen kommunikativen Kompetenzen die Ausbildung folgender fünf Dimensionen: deklaratives Wissen (savoirs), die Fähigkeit, zu verstehen und zu interpretieren (savoir comprendre), die Fähigkeit, neues Wissen zu erwerben und anzuwenden (savoir apprendre/faire), die Fähigkeit, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln (savoir s’engager) sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, offen und interessiert für Neues zu sein (savoir être).
Eines der Ziele der Kritischen Fremdsprachendidaktik besteht darin, die Lerner:innen an gesellschaftliche Diskurse und kulturelle Praktiken heranzuführen und ihnen auf diese Weise Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen (vgl. Gerlach 2020: 9). Ein vergleichbares Ziel findet sich in Byrams Konzept der intercultural citizenship, welches Lernende dazu befähigen soll, an demokratischen Prozessen über die Landesgrenzen hinweg teilzunehmen (Byram 2021: 57).
Die im vorliegenden Buch präsentierten Medien und Aufgaben sind nicht zuletzt so gewählt, dass sie Lernende ermutigen, selbstständig Texte, Videos, Realien (weiter) zu recherchieren, zu rezipieren und beispielsweise auch in den Unterricht einzubringen (vgl. Gerlach 2020: 22). Ein konkretes Beispiel dafür findet sich u.a. in Kapitel 5.2.3 über den YouTuber Il’ja Varlamov, dem die Russischlernenden auf Instagram eine Zeitlang folgen sollen.
Ein weiteres Ziel der Kritischen Fremdsprachendidaktik stellt die Förderung derAnalysekompetenz und kritischen Bewusstseinsbildung dar (vgl. Gerlach 2020: 19). Um diesem Ziel insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung komplexer kultureller, historischer oder sozioökonomischer Inhalte gerecht zu werden, kann es im Fremdsprachenunterricht notwendig erscheinen, auf die Erstsprache (L1) bzw. Bildungssprache der Lerner:innen zurückzugreifen und so gewissermaßen eine sprachliche Barrierefreiheit zu schaffen (vgl. Gerlach 2020: 20). Obwohl das Ziel immer sein sollte, Diskussionen in der Zielsprache Russisch zu führen, bieten wir einige komplexe Diskussions- und Reflexionsaufgaben zusätzlich zu Russisch auch auf Deutsch (D) an, um bestimmte Medien und Medieninhalte besser vermitteln zu können und die kritische Diskursfähigkeit – unabhängig vom sprachlichen Niveau der Lernenden – zu fördern. Zudem spielt auch das Englische im Filmbereich, wo Untertitel zur Unterstützung des Hörverstehens hilfreich sind, eine immer wichtigere Rolle, da für russischsprachige Filme häufig nur englische Untertitel zur Verfügung stehen. Daher plädieren wir für eine gelebte Mehrsprachigkeit im Unterricht, was bedeutet, dass die (den Lernenden) zur Verfügung stehenden Sprachen als Repertoire an Ausdrucks- und Rezeptionsmöglichkeiten verstanden und genutzt werden.
Abschließend möchten wir festhalten, dass der kritisch-pädagogische Ansatz nicht als Ersatz für die bisherigen Grundprinzipien des (Fremd)Sprachenunterrichts gesehen werden soll (vgl. Gerlach 2020: 18). Vielmehr stellt er eine Ergänzung und Bereicherung des Unterrichts um Medien und Themen dar, die wir als essentiell erachten, um sowohl die Lernenden – sei es in der Schule, an der Hochschule oder Universität – als auch die Lehrenden zu Diskussion und Reflexion anzuregen: über Geschichte und Gesellschaft, über Medien und ihre Wirkung sowie über die russische Sprache in und außerhalb von Russland.
2.2Film- und Mediendidaktik
Die Aufgaben im vorliegenden Buch orientieren sich an den Arbeitsphasen, die in Zusammenhang mit dem lerner:innen- und handlungszentrierten Ansatz etabliert und vor allem für den Bereich der Englischdidaktik umfassend beschrieben worden sind (vgl. Thaler 2014; Viebrock 2016; Lütge 2018). Das Drei-Phasen-Modell sieht Aktivitäten vor, während und nach dem Filmsehen (pre-, while- und post-viewing-activities) vor und zielt darauf ab, die Lerner:innen in ihrem Prozess der Sinnbildung (constructing meaning) hinsichtlich Filminhalt, ästhetischer Gestaltung, filmischer Ausdrucksmittel sowie kultureller Implikationen zu unterstützen (vgl. Lütge 2018: 187).
In Bezug auf die Filmrezeption empfehlen wir den sogenannten Straight Through Approach nach Thaler (2014: 128–130), nach dem ein Film in einem durch bzw. in zwei bis drei Blöcken mit einer Dauer von jeweils 30–45 Minuten gesichtet bzw. gezeigt wird. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand, entspricht dies doch der üblichen Rezeption von Filmen. Alternativ zu einem Filmscreening im Unterricht, das je nach Medienbeispiel viel an wertvoller Unterrichtszeit in Anspruch nimmt, können und sollen die Lerner:innen dazu ermutigt werden, das jeweilige Medienbeispiel selbstständig (zu Hause) anzusehen. Die Voraussetzung für eine gelungene Filmvermittlung ist jedoch für beide Arten der Rezeption – gemeinsam im Unterricht oder selbstständig zu Hause –, eine Vor- und Nachbereitungsphase vorzusehen, da ansonsten das Potenzial des Mediums nicht ausgeschöpft und insbesondere Spielfilme lediglich passiv konsumiert werden.
Die einzelnen Phasen des Drei-Phasen-Modells verfolgen jeweils spezifische Ziele. Die Pre-Viewing-Phase soll das Vorwissen der Lernenden aktivieren und sie sowohl sprachlich als auch inhaltlich auf die Filmrezeption vorbereiten. In dieser Phase werden jene lexikalischen und grammatischen Besonderheiten erarbeitet, die die Lernenden beim Verständnis des jeweiligen audiovisuellen Medienbeispiels unterstützen. Neben diesem lexikalischen und grammatischen Scaffolding bieten wir auch ein inhaltliches Scaffolding an, wie eine Beschäftigung mit zentralen Begriffen mithilfe (geschichtlicher) Hintergrundrecherchen. Ein Beispiel dafür findet sich u.a. in den Aufgaben zur TV-Serie ZULEJCHA OTKRYVAET GLAZA (Kap. 4.5.2).
Während der Rezeption regen wir dazu an, nur ein Minimum an Aufgaben mit den Lerner:innen zu bearbeiten, um die Konzentration auf das jeweilige Medienbeispiel zu lenken. Die While-Viewing-Phase dient daher vorrangig der Strukturierung des Gesehenen und beinhaltet Aufgaben wie die Anordnung von Filmsequenzen in der richtigen chronologischen Reihenfolge, das Erkennen von Symbolen oder spezifische Beobachtungsaufgaben in Kleingruppen.
Einige Aktivitäten der While-Viewing-Phase können auch im Rahmen der Post-Viewing-Phase fortgesetzt bzw. besprochen werden. Bei Aufgaben, in denen die Lernenden Dialoge vervollständigen sollen, werden die jeweiligen Ausschnitte in dieser Phase noch einmal angesehen. Das eigentliche Hauptaugenmerk in der Phase nach der Rezeption legen wir jedoch auf Fragen zum Film- und Medienverständnis, indem wir das Medienbeispiel jeweils in einem breiteren historischen und/oder aktuellen Kontext verorten. Dadurch ermöglichen wir eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den darin behandelten Themen. Zudem bieten wir in dieser Phase Aufgaben zur Arbeit mit ausgewählten Szenen an, um das Detailverständnis zu schulen und die Lernenden dazu anzuregen, genauer hinzusehen und hinzuhören. Ein anschauliches Beispiel dafür bieten die Aktivitäten in der Post-Viewing-Phase zum Antikriegsfilm MANDARINIID (Kap. 3.9.3).
Ergänzend möchten wir hinzufügen, dass die hier vorgestellten Phasen keineswegs als präskriptiv verstanden werden sollen, sondern als eine Art des methodischen Scaffoldings. Selbstverständlich liegt es im Ermessen der Lehrkraft, welche der vorgeschlagenen Arbeitsphasen und -aufgaben ausgewählt werden. Aus diesem Grund wurden die Aufgaben in den einzelnen Arbeitsphasen so konzipiert, dass einige davon auch unabhängig voneinander im Unterricht eingesetzt werden können. Zudem wurden in dieses dreiteilige Modell auch sogenannte „produktions-“ bzw. „aktionsorientierte“ Aktivitäten (production-oriented bzw. action-oriented activities) eingebaut (vgl. Lütge 2018: 188), wie die Gestaltung eines Kurzfilms (VYVODY, Kap. 3.4.1), das Ersinnen eines alternativen Endes (BEZ SLOV, Kap. 3.4.2) oder die gemeinsame Gestaltung eines Plakats (varlamov, Kap. 5.2.3).
2.3Die Bandbreite audiovisueller Medien
Wie anhand der einzelnen Kapitel des vorliegenden Buches deutlich wird, ging es uns nicht zuletzt auch darum, eine möglichst große Bandbreite von zeitgenössischen audiovisuellen Medien zu berücksichtigen. Die vorgestellten Medienbeispiele unterscheiden sich im Hinblick auf die filmische Gattung (fiktional oder dokumentarisch), auf das sogenannte Dispositiv im Sinne von Arrangement oder Anordnung bei der Rezeption (der dunkle Kinosaal mit der großen Leinwand im Unterschied zum YouTube-Video, das am Mobiltelefon verfolgt wird), auf die Geschlossenheit oder Offenheit der Form (der Spielfilm gegenüber den seriellen Formaten), auf die Länge und Komplexität des Textes (Kurzfilm oder Autorenkino) oder auch auf die intendierte Wirkung (Meinungsmanipulation oder Information). Beim Einsatz von audiovisuellen Medien im (Fremd)Sprachenunterricht sollte es stets auch darum gehen, die Lernenden für diese Unterschiede zu sensibilisieren und diese bewusst zu machen.
Am Beginn der Auseinandersetzung mit Spielfilmen sollte stets das individuelle Filmerlebnis stehen, das sich über folgende Fragen erschließen lässt: Hat mich der Film emotional berührt, erheitert, gelangweilt, genervt? Welche Bilder oder Einstellungen haben mich fasziniert, was bleibt besonders in Erinnerung? Welche Figuren haben meine Sympathie auf sich gezogen und warum?
Der offene Austausch über das eigene Filmerleben kann je nach Film zuerst in Kleingruppen erfolgen oder die Lehrperson kann gemeinsam mit der gesamten Gruppe ein erstes Stimmungsbild zu den Eindrücken erheben. Dieses Stimmungsbild kann sich im Laufe der Auseinandersetzung, deren Ziel ein tieferes Verständnis des jeweiligen Films und seiner Bedeutungspotenziale ist, durchaus verändern. Diese Aspekte des Filmverstehens sind vor allem in Bezug auf künstlerisch und intellektuell anspruchsvolle Werke, wie beispielsweise VOZVRAŠČENIE (Kap. 3.5), von Bedeutung. Sie spielen jedoch auch bei emotional bewegenden Sujets, wie dies zweifelsohne beim Kurzfilm BEZ SLOV (Kap. 3.4.2) der Fall ist, eine wichtige Rolle. Bei den Reisereportagen von Varlamov dagegen steht vielmehr der Informationsgehalt im Vordergrund (Kap. 5.2.1), während es bei der Talkshow MODNYJ PRIGOVOR (Kap. 4.3.2) neben landeskundlichen und gesellschaftskritischen Aspekten nicht zuletzt auch darum geht, Einblicke in die russische Populär- und Fernsehkultur zu gewinnen.
Aufgrund der Heterogenität der Medien und der formalen und thematischen Spezifik des jeweiligen Beispiels kann es auch kein durchgehendes Schema geben, dem die sprachlichen Übungen und kommunikativen Aufgaben in den drei Phasen folgen. Während bestimmte Beispiele eine Auseinandersetzung mit dem gesamten Text nahelegen, liegt das Augenmerk bei anderen Beispielen, wie bei der propagandistischen Talkshow 60 MINUT, auf einem Ausschnitt eines kurzen thematischen Fragments einer einzigen Ausgabe (Kap. 4.3.1). Gleichzeitig bieten sich insbesondere Spielfilme dafür an, über den Film selbst hinausgehende Aspekte zu behandeln. So beleuchten wir etwa im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Spielfilm HYTTI NRO 6 (Kap. 3.11.3) die Besonderheiten der Umgangssprache (razgovornaja reč’) und legen auch in den Arbeitsaufgaben ein besonderes Augenmerk auf dieses Thema. Auf Basis ihrer thematischen Spezifik eignen sich bestimmte Spielfilme in der Schule auch für einen fächerübergreifenden Einsatz. Schließlich ermöglicht gerade die Heterogenität der Medien eine prinzipielle Flexibilität im Hinblick auf die verschiedenen sprachlichen Niveaustufen, beginnend mit der untersten Niveaustufe A1 (VYVODY, Kap. 3.4.1).
Eine gewisse Schwierigkeit in der Arbeit mit audiovisuellen Medien stellt ihre Verfügbarkeit sowie die Verfügbarmachung für größere Lerngruppen dar. Während YouTube wie auch russischer Fernsehcontent über das Internet frei zugänglich ist, sind vor allem Spielfilme urheberrechtlich geschützt. Insbesondere bei Kinofilmen, die im Falle eines Einsatzes im Unterricht zur Gänze rezipiert werden sollten, stellen Untertitel eine wesentliche Verständnishilfe dar. Hinweise zur Verfügbarkeit des jeweiligen medialen Beispiels wie auch zum Vorhandensein von Untertiteln finden sich entsprechend zu Beginn jedes Unterkapitels, jeweils nach den Produktions- und Stabsangaben.
3Kino und Spielfilme
Das Kino hat in Russland eine lange Tradition, denn bereits im Zarenreich wurden Filme – zunächst europäische Filme – vorgeführt und ab den 1910er Jahren auch produziert. Zu einem international viel beachteten Filmland wurde jedoch erst die Sowjetunion, wo das noch junge Medium in den 1920er Jahren wesentlich früher als anderswo als Kunstform anerkannt wurde. Das vom Sowjetstaat produzierte und kontrollierte Kino war über die gesamte Zeit seines Bestehens ein wesentlicher gesellschaftlicher, künstlerischer, ideologischer, politischer und wirtschaftlicher Faktor. Ob als Familienprogramm oder allein, zur kommunistischen Erbauung oder einfach nur zur Unterhaltung – ins Kino gingen in der Sowjetunion alle, wie der Schriftsteller Lev Rubinštejn in seinem ironisch-nostalgischen Rückblick so treffend schreibt (Rubinštejn 2004).
Mit dem Zerfall des Sowjetimperiums verschwand auch das sowjetische Kino als Institution, doch Filme wurden weiterhin produziert. Allerdings hat sich das Kino vom Beginn der 1990er Jahre bis heute grundlegend verändert – das gilt sowohl für Russland als auch für die anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie auch insgesamt für das Kino weltweit. Bereits gegen Ende der 1980er Jahre, in den letzten Jahren des Bestehens der Sowjetunion, verlagerte sich das individuelle Filmerlebnis zunehmend in die eigenen vier Wände, und Fernsehen und Video ersetzten im Laufe der 1990er Jahre den öffentlichen Kinosaal.
In den Jahrzehnten nach dem Ende der Sowjetunion entstanden neue Genres, Erzählweisen und Formate. Zudem wurden neue Vertriebskanäle geschaffen und auch die Produktions- und Rezeptionsbedingungen für Filme haben sich geändert. Doch ungeachtet der Transformationen, die das Filmwesen durchlaufen hat, stellt der Spielfilm mit seiner fiktionalen Handlung und einer Spieldauer von im Schnitt 90 Minuten bis heute ein wichtiges und vielrezipiertes Medium dar.
3.1Filmfestivals und Arthaus-Kino
Als das Kino im Russland der 1990er Jahre an einem Tiefpunkt angelangt war, wurden Filmfestivals ins Leben gerufen, um aktuellen Kinofilmen mehr öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Zum wichtigsten neu geschaffenen Filmfestival und Treffpunkt für Filmschaffende und Kritiker avancierte der sogenannte Kinotavr (vollständige russische Bezeichnung: Otkrytyj Rossijskij festival’ „Kinotavr“), der von 1991 bis 2021 alljährlich im Frühsommer in der Schwarzmeerstadt Sotschi abgehalten wurde. Der erfolgreiche Filmproduzent Aleksandr Rodnjanskij formulierte die Hauptfunktion des Kinotavr für die 1990er Jahre rückblickend in einem Interview wie folgt:
During the 1990s, Kinotavr was a festival whose main function was to promote rare Russian films made during that time, to make the audience aware of their existence before they were released on VHS. There was no theatrical industry and no other way of distribution. (Rodnyansky 2020: 263)
Abgesehen vom Kinotavr wurden zahlreiche kleinere und spezialisierte Filmfestivals ins Leben gerufen, die über das ganze Land verteilt sind. Auch in anderen postsowjetischen wie auch westeuropäischen Ländern sind es heute Filmfestivals von unterschiedlicher Größe und Reichweite, die den Blick der Öffentlichkeit auf Filme lenken, die kaum jemals regulär in die Kinos kommen. In Deutschland beispielsweise ist eine derartige Plattform für Filme aus Osteuropa das goEast Filmfestival in Wiesbaden, das seit 2001 jährlich stattfindet.
Aus den großen europäischen Festivals von Cannes, Venedig und Berlin sind russische bzw. russischsprachige Filme nie verschwunden, jedoch änderten sich auch hier die Kriterien der Auswahl. Zu den Regisseuren aus Russland, die in diesem international heiß umkämpften Feld seit der Jahrtausendwende reüssieren konnten, gehören allen voran Andrej Zvjagincev, dessen Debütfilm VOZVRAŠČENIE (Abb. 1) im Jahr 2003 mit dem Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet wurde, sowie Aleksandr Sokurov, dessen höchste Auszeichnung ebenfalls ein Goldener Löwe für die Goethe-Verfilmung FAUST (2011) darstellt.
VOZVRAŠČENIE. Die Brüder Ivan (sitzend) und Andrej (stehend)
Sowohl Andrej Zvjagincev als auch Aleksandr Sokurov sind sogenannte Autorenfilmer, d. h. Regisseure mit einer wiedererkennbaren „persönlichen Handschrift“, wie der Begriff des Autorenfilms (russ. avtorskoe kino) seit den 1950er Jahren zu verstehen gibt.
Der Begriff desAutorenfilms wird v. a. mit François Truffaut in Verbindung gebracht. Dieser sprach 1954 von einer politique des auteurs in seinem Aufsatz Une certaine tendance du cinéma français, der durch die Übersetzung ins Englische (vgl. Truffaut 1976) eine breite Rezeption außerhalb von Frankreich erfuhr. In diesem Aufsatz spricht Truffaut zwar explizit von einem cinéma des auteurs, er bietet jedoch keine Definition des Autorenfilms an.
Da die Grenzen zwischen Autorenfilm und kommerziellem Kino insbesondere seit den 1990er Jahren fließend geworden sind, tritt an die Stelle des Autorenfilms zunehmend der Begriff des Arthaus- bzw. Arthouse-Kinos – als Sammelbezeichnung für Nicht-Mainstream-Filme wie auch für die sogenannten Programm-Kinos. Wie im deutschsprachigen Raum ist auch im Russischen der Begriff artchaus weit verbreitet. Unter dem Stichwort artchaus finden sich auf russischsprachigen Webseiten Beschreibungen davon, welche Art von Filmen diesem Bereich zuzurechnen sind und umgekehrt – welche Art von Filmen nicht:
Артхаус — это кино, которое не рассчитано на широкую аудиторию. Его также называют авторским, независимым, фестивальным, некоммерческим, элитарным, интеллектуальным. Режиссеры артхауса, как правило, не стремятся к кассовому успеху своих картин. Они часто экспериментируют со смешением жанров и новаторскими методами съемки,наполняют фильмы символами[…]. (Kul’tura.RF, Hervorhebung durch die Autorinnen)
Arthaus bezeichnet eine Art von Kino, das sichnicht an ein breites Publikum richtet. Andere Bezeichnungen dafür sind Autorenkino, Independent-Filme, Festivalkino, nicht-kommerzielles Kino, elitärers oder intellektuelles Kino. Arthaus-Regisseure streben mit ihren Filmen in der Regel keinen Kassenerfolg an. Sie experimentieren oft mit Genremischungen und innovativen Filmtechniken, arbeiten mit Symbolen […].1
Für die Zeit seit der Jahrtausendwende können neben den international bekannten Namen Zvjagincev und Sokurov zahlreiche weitere russische bzw. russischsprachige Arthaus-Produktionen angeführt werden, die für sich einen künstlerischen und/oder gesellschaftskritischen Anspruch reklamieren und sich gerade aufgrund dieses Anspruchs auch für den Schulunterricht hervorragend eignen. Der Kinotavr bietet seit den 1990er Jahren einen guten Gradmesser für russische Arthaus-Filme. Zu seinen Preisträgern gehören auch einige der für dieses Buch ausgewählten Filme, nämlich RUSALKA (Preis für die beste weibliche Rolle 2007), GEOGRAF GLOBUS PROPIL (Hauptpreis und Preis für die beste männliche Rolle 2013), UČENIK (Preis für die beste Regie 2016) sowie der Kurzfilm des damals noch unbekannten Regisseurs Jurij Bykov NAČAL’NIK (Kategorie Kurzfilm 2009).
3.2Mainstreamkino und blokbastery
Zeitgleich mit der gestiegenen Präsenz russischer Filme auf internationalen Filmfestivals nach der Jahrtausendwende gelingt in Russland selbst der zumindest teilweise Wiederaufbau einer Infrastruktur im Kinobereich. Durch die Schaffung der sogenannten Multiplexe (russ. mul’tipleksy, umgangssprachlich auch mnogozal’niki) steigt Russland mit 6.000 Mio. US-Dollar Verleiheinnahmen im Jahr 2007 zum fünftgrößten Filmmarkt der Welt auf (vgl. Beumers 2009: 241). Als erstes modernes Multiplex, das mit seinem kommerziellen Konzept des Mehrsaalkinos mit Barbetrieb die alten, meist aus einem Saal bestehenden sowjetischen Kinos ablöst, gilt das in Moskau 2002 eröffnete Kino Karo Fil’m im Shoppingcenter Atrium beim Kursker Bahnhof. Zwei Jahre später kommt auch der erste russische Blockbuster (russ. blokbaster) heraus: NOČNOJ DOZOR (2004) in der Regie von Timur Bekmambetov.
Der auf der Fantasy-Reihe des Bestseller-Autors Sergej Luk’janenko1 basierende Streifen wurde in den russischen Kinos mit 300 Kopien gestartet und spielte bei Produktionskosten von 4,2 Mio. US-Dollar in Russland über 16 Mio. US-Dollar ein.2 Bekmambetovs als Fantasy-Thriller etikettierter Film ist ein apokalyptisches Action-Spektakel mit Vampiren, Hexen und Meistern der schwarzen Magie, die sich im Moskau der Gegenwart tummeln. Durch die Übernahme von Ästhetiken des US-amerikanischen Mainstreamkinos und nicht zuletzt auch durch gezielte Marketingstrategien setzte NOČNOJ DOZOR neue Maßstäbe für ein kommerziell ausgerichtetes russisches Genre-Kino, das mit Fortschreiten der Regierungszeit von Vladimir Putin zunehmend eine patriotische Richtung mit entsprechenden Sinnstiftungen einschlug. Zu den Genres, die in den 2000er und 2010er Jahren erfolgreich bedient wurden, gehören insbesondere Historienfilme (u.a. ADMIRAL von Andrej Kravčuk, 2008), Kriegsfilme (u.a. STALINGRAD von Fedor Bondarčuk, 2013), Komödien (u.a. das erfolgreiche Remake des sowjetischen Silvesterklassikers IRONIJA SUD’BY. PRODOLŽENIE von Timur Bekmambetov, 2008) oder Sportfilme. Um im Rahmen des Russischunterrichts auch das patriotische russische Mainstream-Kino zu beleuchten und kritisch zu reflektieren, haben wir aus den genannten Genres den Sportfilm herausgegriffen und werden den Film LEGENDA №17 (2017) in der Regie von Nikolaj Lebedev vorstellen.
3.3Kino jenseits nationalstaatlicher Grenzen
Anders als die Literatur, die auf der Sprache basiert und insbesondere im 19. Jahrhundert wesentlich zur Nationenbildung beigetragen hat, war der Film von Beginn an ein Medium, dem es – zunächst begünstigt durch seine Stummheit – leichter fiel, nationalstaatliche Grenzen zu überschreiten. Der Siegeszug des Tonfilms in den späten 1920er und beginnenden 1930er Jahren war zwar ein die Nationalsprachen begünstigender Faktor, doch das Kino insgesamt blieb, trotz der sich entwickelnden nationalen Kinematografien, ein internationaler Marktplatz und Ort der transnationalen Kommunikation. Darauf verweist nicht zuletzt die Gründung des ersten Filmfestivals der Welt – der Internationalen Filmfestspiele von Venedig – im Jahr 1932. Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Filmproduktion gewann besonders nach dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung, als internationale Co-Produktionen in beiden ideologischen Lagern des Kalten Krieges realisiert wurden. Seit dem Ende des Kalten Krieges und der damit einhergehenden Abschaffung des staatlichen Filmwesens in den Ländern Ost-, Ostmittel- und Südosteuropas bieten Co-Produktionen wichtige Möglichkeiten der Finanzierung von Filmprojekten. Abgesehen davon sind es gerade Co-Produktionen, die inter- und transkulturelle Themen erschließen und bearbeiten.
Die Perspektive auf ein Kino, das nationalstaatliche Grenzen transzendiert, lenkt den Blick nicht nur auf internationale Co-Produktionen, sondern auch auf russischsprachige Filme, die nicht in Russland produziert wurden. Ein thematisch besonders interessantes und filmästhetisch herausragendes Beispiel für diese Perspektive bildet die estnisch-georgische Co-Produktion MANDARIINID des georgischen Regisseurs Zaza Urushadze. Der Film thematisiert den georgisch-abchasischen Konflikt zu Beginn der 1990er Jahre und ist entsprechend mehrsprachig: Neben Russisch als Lingua franca des Sowjetimperiums sprechen die Figuren, motiviert durch ihre ethnische Zugehörigkeit, auch Estnisch und Tschetschenisch. Der zweite Film in der vorliegenden Auswahl, der eine transnationale Darstellungsperspektive einnimmt, zeigt eine Situation des Sprachenlernens: eine Finnin reist mit dem Zug von Moskau nach Murmansk und muss sich auf ihrer Reise nicht nur geografisch, sondern auch sprachlich zurechtfinden. HYTTI NRO 6 (Abb. 2) in der Regie von Juho Kuosmanen stellt eine finnisch-estnisch-deutsch-russische Co-Produktion dar. Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 2021 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet und stellt damit den aktuellsten Film in der Auswahl dar.
HYTTI NRO 6. Die Protagonistin Laura auf ihrer Zugreise von Moskau nach Murmansk
3.4Kurzfilme des Moskauer VGIK
Die Moskauer Filmhochschule VGIK (Vserossijskij gosudarstvennyj institut kinematografii imeni S.A. Gerasimova), die seit 1938 unter dieser Abkürzung bekannt ist, gilt als die älteste Institution der Welt, an der ein Filmstudium zu Regie, Drehbuch, Kamera, Schauspiel oder auch zu Filmkritik und Management absolviert werden kann. Seit mehr als 100 Jahren werden am VGIK Filmkünstler:innen ausgebildet, die in ihren studentischen Arbeiten ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen.
Mit der Gründung einer Staatlichen Schule für Kinematographie (Gosudarstvennaja škola kinematografii) am 1. September 1919 setzte das damals noch junge Sowjetrussland ein Zeichen dafür, wie wichtig die Filmkunst für den Aufbau einer neuen Gesellschaft und für ein zeitgemäßes Kunstverständnis war. An der bekannten Filmhochschule lehrten die prominentesten Regisseure des Landes, wie Sergej Eisenstein, Lev Kulešov oder der spätere Namensgeber Sergej Gerasimov.
Am Beginn der Karriere vieler Filmschaffender stehen in der Regel Kurzfilme, in denen die Jungregisseur:innen filmische Darstellungsweisen erproben und ihre Sicht auf die Welt darlegen. So gehören zu den bekanntesten und heute noch sehenswerten Abschlussarbeiten des VGIK die Kurzfilme von Andrej Tarkovskij (KATOK I SKRIPKA, 1960), Andrej Michalkov-Končalovskij (MAL’ČIK I GOLUB’, 1961) oder Nikita Michalkov (SPOKOJNYJ DEN’ V KONCE VOJNY, 1970). Eine Gemeinsamkeit dieser Kurzfilme ist, dass sie von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen handeln. So kommt in den beiden Kurzfilmen von Tarkovskij und Michalkov-Končalovskij die Aufbruchstimmung der Tauwetterzeit zum Ausdruck, als Kinder und Jugendliche meist auch eine symbolische Funktion hatten. Sie standen für Unschuld in Bezug auf die jüngste Vergangenheit und für einen Neubeginn nach der totalitären Herrschaft Stalins.
Junge Menschen standen jedoch nicht nur in der Tauwetterzeit im Mittelpunkt der studentischen Kurzfilme, sondern sie tun dies auch heute noch. Da studentische Kurzfilme in der Regel dem Weltempfinden junger Menschen nahestehen und deren Probleme und Fragen artikulieren, sind sie auch besonders für den (Fremd)Sprachenunterricht geeignet. Gleichzeitig lassen sich diese Filme gut in eine Unterrichtseinheit integrieren: Sie sind kurz und weisen in Bezug auf Handlung und Figuren weniger Komplexität auf als Spielfilme. Kurzfilme bedingen eine Reduktion auf meist einen Handlungsstrang und wenige Charaktere. Wenn sie gut gemacht sind, zeichnen sie sich dadurch aus, dass die Grundidee in pointierter Form herausgearbeitet ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die filmischen Erzählungen eindimensional oder flach wären. Im Unterschied zu Werbeclips oder Filmtrailern müssen diese Kurzfilme keine Botschaft vermitteln, sondern sollen vor allem demonstrieren, dass ihre Schöpfer:innen das filmische Handwerk beherrschen und einen neuartigen, ungewöhnlichen Blick auf einen – wenn auch noch so kleinen – Ausschnitt der Welt werfen können.
Aus diesem Grund werden wir in den nachfolgenden Abschnitten drei thematisch und ästhetisch sehr unterschiedliche Kurzfilme vorstellen und Möglichkeiten präsentieren, wie diese im Unterricht zur Auseinandersetzung mit der russischen Sprache, Kultur und Gesellschaft eingesetzt werden können. Für den Großteil der Lernenden bieten diese Kurzfilme zudem vermutlich eine neuartige Filmerfahrung, sind sie doch abseits des internationalen Mainstream-Kinos angesiedelt.
3.4.1VYVODY
Bei VYVODY (2014) handelt es sich um die 17-minütige Abschlussarbeit der Regie-Studentin Anastasija Možegova. Der auf YouTube verfügbare Film spielt in einem Taxi und hält in kurzen Episoden die Gespräche des Taxifahrers mit seinen Kund:innen fest. Aufgrund der eingängigen und lebensnahen Situation und der einfachen, gut verständlichen Dialoge ist dieser Film bereits für den Anfängerunterricht geeignet. Für das A1-Niveau empfehlen wir eine Beschränkung auf die erste Episode (Min. 00:00:00–00:04:15). Zusätzlich zu den Arbeitsanweisungen auf Russisch sollten diese auch auf Deutsch angegeben werden. Auf A2-Niveau sowie mit fortgeschritteneren Lernenden bietet es sich an, die ersten drei Episoden (Min. 00:00:00–00:09:43) sowie die letzte Episode (Min. 00:14:05–00:17:22) zu behandeln. Die vierte Episode (Min. 00:09:43–00:12:08), in der die russische Fluch- und Vulgärsprache Mat vorkommt, kann – ohne das Gesamtverständnis zu beeinträchtigen – beim Sehen bzw. bei der Besprechung problemlos ausgelassen werden.
VYVODY. (Schlussfolgerungen). Russland 2014. 17 Min. Regie, Drehbuch und Kamera: Anastasija Možegova; Musik: Evgenij Musin. Darsteller:innen: Kostja Lomkin (Ignat); Tolja Belikov (Chirurg); Šota Arabuli (Georgij), Lena Svanidze (Ol’ga), Lëša Šuravin (Drehorgelspieler); Goša Prokopenkov (junger Mann mit Pinguin); Sveta Karsaeva (junge Frau mit Pinguin); Olesja Nemirovskaja (Freundin von Ignat).
Der Kurzfilm ist unter folgendem Link auf YouTube abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=ikIrqpl5GUw (08.11.2023).
Pre-Viewing-Phase
Als Vorbereitung auf die erste Episode des Films (Min. 00:00:00–00:04:15) schlagen wir auf A1-Niveau eine Aufgabe vor, in der die Lernenden Berufsbezeichnungen zuordnen (1). Dabei sollten die Lernenden darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Russischen die Verwendung von Feminitiva seltener ist als im Deutschen, was u.a. damit zusammenhängt, dass viele der existierenden femininen Formen eine abwertende Bedeutung haben. In der Tabelle in Aufgabe (1) werden daher sowohl maskuline als auch feminine Berufsbezeichnungen angeführt, um auf die Möglichkeiten der Bildung von Feminitiva sowie auf die Besonderheiten ihrer Verwendung hinzuweisen. Dabei ist zu beachten, dass die in Klammern angegebenen Formen nicht standardsprachlich und teilweise pejorativ konnotiert sind.
Feminitiva im Russischen: In der russischen Standardsprache wird bis heute meist die maskuline Form für männliche und weibliche Berufsbezeichnungen verwendet, da die maskuline Form als generisch, d. h. als unmarkiertes Genus gilt. Das generische Maskulinum stand im vergangenen Jahrzehnt jedoch auch in Russland in der Kritik der poststrukturalistischen und feministischen Linguistik, die feminine Personenbezeichnungen bevorzugt, um Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Im Unterschied zum Deutschen besteht im Russischen jedoch ein grundlegendes Problem darin, dass bereits existierende feminine Berufsbezeichnungen häufig umgangssprachlich oder substandardsprachlich sind und pejorative Konnotationen aufweisen. So gelten die Suffixe -inja und -essa als scherzhaft, -icha dagegen als grob. Insbesondere das Suffix -š(a) wird als umgangssprachlich abwertend angesehen, da es die Bedeutung „zum Mann (und dessen Tätigkeit) gehörig“ hat und somit die Gattin des mit dem maskulinen Basiswort Bezeichneten meint. Erst in zweiter Bedeutung wird mit dem Suffix -š(a) eine weibliche Person bezeichnet, die den jeweiligen Beruf ausübt. Die abwertende Konnotation von -š(a) hat dazu geführt, dass häufig zwei oder mehr Formen (Dubletten) parallel existieren, wie z. B. blogerša und blogerka (Bloggerin). In feministischen Kreisen wurde in den letzten Jahren vor allem das Derivationssuffix -k(a) als Alternative zu -š(a) verwendet. Das Suffix -k(a) wird jedoch nicht von allen Sprecher:innen akzeptiert und seine Verwendung hat auch eine politische Komponente, da es in russischen oppositionellen Medien verbreitet ist, während die konservativ eingestellten politischen Eliten eine geschlechtergerechte Sprache generell ablehnen. Neben der Suffigierung maskuliner Substantive bieten auch die Zusammenrückung (z. B. ženščina-vrač [Frau-Doktor]) oder syntaktische Mittel Möglichkeiten, den Sexus zu markieren (z. B. Ona chorošijvrač. Naš direktor očen’ strogaja. [Sie ist ein guter Arzt. Unser Direktor ist sehr streng.]). Die Beispiele zeigen, dass die Frage der Verwendung femininer Formen für Berufsbezeichnungen in der russischen Gegenwartssprache äußerst komplex ist und dass es abzuwarten bleibt, ob und welche Formen sich durchsetzen werden.
Zusätzlich zur Zuordnung der Berufsbezeichnungen können die angeführten Berufe in Aufgabe (1) auch dazu verwendet werden, um den Instrumental Singular nach Verben (быть/работать кем) zu wiederholen. Schließlich können die Lernenden noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Jahr 2010 die Miliz (milicija) in Polizei (policija) umbenannt wurde. Im Kurzfilm werden noch beide Bezeichnungen verwendet und daher kommen beide Wörter auch in der Aufgabe vor.
(1) Найдите немецкие соответствия для следующих профессий. Первый пример (0.) сделан.
0.
парикмахер(-ша)
а.
Künstler:in
1.
продавец/-щица
б.
Friseur:in
2.
инженер(-ша)
в.
Kellner:in
3.
(женщина-)почтальон
г.
Lehrer:in
4.
таксист/-ка
д.
Polizist:in
5.
актёр/актриса
е.
Koch/Köchin
6.
повар(-иха)
ж.
Verkäufer:in
7.
официант/-ка
з.
Milizionär:in
8.
учитель/-ница
и.
Journalist:in
9.
журналист/-ка
к.
Ingenieur:in
10.
художник/-ница
л.
Briefträger:in
11.
(женщина-)милиционер
м.
Wachmann/-frau
12.
охранник/-ница
н.
Schauspieler:in
13.
(женщина-)полицейский
о.
Taxifahrer:in
Im Anschluss daran wird den Lernenden ein Screenshot (Min. 00:01:19) der ersten Szene des Kurzfilms gezeigt, mithilfe dessen sie eine kurze Personenbeschreibung erstellen und Vermutungen über den Beruf der zu sehenden Personen sowie das Ziel ihrer Fahrt anstellen sollen (2).
(2) Посмотрите на скриншот (мин. 00:01:19) из короткометражного фильма «Выводы». Поработайте в парах. Ответьте на следующие вопросы: Кто эти мужчины (имя, возраст…)? Кто они по профессии? Куда и к кому они едут?
Für Lernende ab A2-Niveau bietet sich als Aufgabe vor dem Filmsehen ebenso die Arbeit mit Screenshots an, wobei pro Episode jeweils ein Screenshot gezeigt wird und die Lernenden anschließend zu zweit oder in Kleingruppen Fragen (3) beantworten.
(3) Посмотрите на кадры из фильма «Выводы» (мин. 00:02:11 / 00:06:21 / 00:07:38). Опишите персонажей и ситуацию. Затем представьте ваших персонажей в классе/аудитории.
Кто они? (имя, возраст, профессия, семейное положение: женат/замужем…)
Как они выглядят? (одежда, внешний вид)
Куда или к кому они едут?
While-Viewing-Phase
Während des Filmsehens schlagen wir auf A1-Niveau eine Aufgabe zur Anregung der aktiven Mitarbeit der Lernenden vor. Anhand einer einfachen Einsetzübung sollen die Berufe, die im Dialog zwischen dem Fahrgast und dem Taxifahrer genannt werden, aus einem Schüttelkasten eingesetzt werden (4).
(4) Посмотрите фрагмент из фильма (мин. 00:00:00–00:04:15), в котором таксист говорит с клиентом, которого зовут Сергей. Заполните пропуски соответствующими словами из рамки. Два слова лишние. Пример (0.) сделан.
Таксист: Доброе утро! (Таксист сигналит.) Как вас зовут?
Сергей: Сергей.
Таксист: Вот это да! Я тоже Сергей. (Таксист опять сигналит.) А куда едете так рано?
Сергей: На работу.
Таксист: А кем вы работаете? Хотя нет. Давайте я сам угадаю. Вы, наверное, какой-нибудь … (0.) научный сотрудник …. Подождите, хотя, зачем научному сотруднику ехать на работу к пяти утра в воскресенье. Нет-нет, тут надо подумать … щас* … секунду … а-а-а вы можете быть … (1.) … и нужно вам сдать материал вот с утра. Да?
Сергей: Нет.
Таксист: А-а ну хорошо. Тогда вы можете быть … (2.) … .
Сергей: Я вообще всё, что угодно, могу.
Таксист: А-а то есть, я угадал, да?
Сергей: Нет.
Таксист:… (3.) … ?
Сергей: Нет.
Таксист:… (4.) … ?
Сергей: Нет, не … (5.) … .
Таксист:… (6.) … ?
Сергей: Нет, не … (7.) … .
Таксист:… (8.) … ?
Сергей: Нет.
Таксист: А … (9.) … ?
Сергей: Да нет же!
Таксист: Ага, … (10.) … ?
Сергей: Нет, не … (11.) … . На остановке остановите, пожалуйста.
Таксист: Ага, щас, секунду.
Сергей: Спасибо.
Таксист: И вам спасибо. … А кто вы? Кто вы?
Сергей:… (12.)… !
* щас — простореч. то же, что и сейчас
Fortgeschrittenere Lernende sollen während des Sehens die nachfolgenden Aussagen der jeweiligen Episode (I, II oder III) zuordnen, in der diese vorkommen (5).
(5) Посмотрите следующий фрагмент (мин. 00:00:00–00:09:43) из короткометражного фильма «Выводы» и определите, в каком эпизоде (I, II или III) персонажи говорят следующее. Первый пример сделан.
Post-Viewing-Phase
In der Post-Viewing-Phase soll auf A1-Niveau eine vertiefende Auseinandersetzung mit der im Dialog der ersten Episode (Min. 00:00:00–00:04:15) enthaltenen Lexik geschehen. Dazu ordnen die Lernenden die Aussagen der Protagonist:innen ihren deutschen Entsprechungen zu (6). Bei den Aussagen handelt es sich um lexikalische Einheiten (lexical chunks), die in der Alltagssprache häufig verwendet werden und daher – trotz erhöhter Schwierigkeit – bereits auf A1/A2-Niveau eingeführt werden sollten. Darüber hinaus sind sie als ein Differenzierungsangebot für leistungsstarke Lernende sowie Herkunftssprecher:innen geeignet.
(6) Найдите немецкие эквиваленты (А–Ж) данных слов и выражений (0–6). Пример (0) сделан.
A. Halten Sie bitte an der Haltestelle an.
0
Б. Nein, so was!/Mannomann!
В. Oder nein. Lassen Sie es mich selbst erraten.
Г. Heißt das, dass ich es erraten habe?
Д. Nicht doch!/Aber nein!
Е. Warten Sie!
Ж. Sie haben Glück!
Alternativ dazu bietet es sich auf höheren Sprachniveaus an, die deutschen Entsprechungen nicht vorzugeben, sondern diese von den Lernenden selbst erstellen zu lassen.
Die gezeigten Episoden aus dem Kurzfilm VYVODY können auch als Ausgangspunkt für anschließende kommunikative Aufgaben genutzt werden. So könnten die Lernenden auf A1-Niveau selbst Dialoge erstellen. Für diese abschließende Aufgabe teilt die Lehrperson Kärtchen mit russischen Berufsbezeichnungen (siehe Lösungsschlüssel) aus, die dann – analog zum Dialog in der ersten Episode des Kurzfilms – von den Lerner:innen gegenseitig erfragt bzw. erraten werden (7).
(7) Поработайте в парах. Один из вас играет таксиста/таксистку, а другой – клиента/клиентку. Тот, кто играет клиента/клиентку, берет одну из карточек. На этой карточке указана ваша профессия. Разыграйте диалог по аналогии персонажей фильма и угадайте профессии. Затем поменяйтесь ролями.
Таксист/ка: А кем вы работаете? Давайте я сам угадаю. Вы, наверное, какой-нибудь … .
Клиент/ка: Нет, не … .
Таксист/ка: Щас, секунду, вы, наверное, … .
Клиент/ка: Да нет же!
Таксист/ка: Тогда вы … .
Клиент/ка: Нет, не … .
Auf A2-Niveau sowie mit weiter fortgeschrittenen Lerner:innen ist eine Erweiterung des Dialogs vorstellbar, indem ein ähnlicher Dialog wie im Taxi erstellt wird.
(8) Вы в Ереване в отпуске и вам нужно ехать на такси. Вы говорите таксисту/таксистке, что вы знаете русский язык, и потом он/она начинает задавать вам много вопросов по-русски. Поработайте в парах и составьте диалог между таксистом/таксисткой и клиентом/клиенткой.
Als kreative Aufgabe bietet es sich weiterführend an, dass sich die Lernenden selbst einen möglichen Drehort überlegen, an dem ein ähnlicher Dialog stattfinden könnte, wie zum Beispiel am Bahnhof oder Flughafen, im Zug oder Flugzeug etc. In kleinen Teams drehen sie dann jeweils einen eigenen Kurzfilm.
3.4.2BEZ SLOV
Der Kurzfilm BEZ SLOV





























