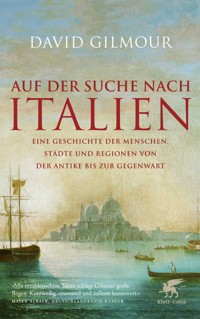
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Elegant und kenntnisreich führt David Gilmour seine Leser durch die Geschichte der Halbinsel. Er reichert seine Darstellung an mit prächtigen Anekdoten, sinnlichen Eindrücken und interessanten Gesprächen. Ein kluges und inspiriertes Buch. Gilmour zeigt, dass die Pracht Italiens immer in seinen Regionen mit ihrer je eigenen Kunst, städtischen Kultur, Identität und Küche gelegen hat. Die Regionen brachten die mittelalterlichen Städte und die Renaissance, die Republik Venedig und das Großherzogtum Toskana hervor, die beiden kultiviertesten Staaten der europäischen Geschichte. Dieses fesselnde Buch erklärt die italienische Geschichte so klug und stimmig, dass jeder Italienliebhaber seine Freude daran haben muss. Ein wahres Lesevergnügen, voll ausgewählter Geschichten und Beobachtungen aus persönlicher Erfahrung und bevölkert mit großen Gestalten der Vergangenheit: von Cicero und Vergil bis zu Dante und den Medici, von Cavour und Verdi bis zu den umstrittenen politischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Das Buch wirft einen klarsichtigen Blick auf das Risorgimento. Es entzaubert die Mythen, die sich darum ranken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DAVID GILMOUR
AUF DER SUCHE NACH
ITALIEN
EINE GESCHICHTEDER MENSCHEN, STÄDTE UND REGIONEN VON DER ANTIKE BIS ZUR GEGENWART
AUS DEM ENGLISCHEN VON SONJA SCHUHMACHER UND RITA SEUSS
IMPRESSUM
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Pursuit of Italy. A History of a Land, its Regions and their Peoples« im Verlag Allen Lane, London
© 2011 David Gilmour
Für die deutsche Ausgabe
© 2013, 2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung des Gemäldes »Venedig am Sommerabend« von I. K. Aiwasowski, © akg-images
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94929-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10496-7
Dieses E-Book entspricht der aktuellen Printausgabe
Für Ming und Elspeth Campbell
INHALT
Einleitung
1 VIELGESTALTIGES ITALIEN
Uneinheitliche Geographie
Italien und seine Menschen
Italien und seine Sprachen
2 IMPERIALES ITALIEN
Die Römerzeit
Das barbarische und das byzantinische Italien
Italia Germanica
3 DIE MACHT DER STÄDTE
Kommunale Träume
Kommunale Wirklichkeit
Republikanisches Italien
Das Italien der Fürsten
4 VENEDIG UND DER ADRIATISCHE RAUM
5 UMKÄMPFTES ITALIEN
Fremde Herrscher
Aufgeklärtes Italien
Das napoleonische Italien
Italien und die Restauration
6 REVOLUTIONÄRES ITALIEN
Romantisches Italien
Aufständisches Italien
Opernland Italien
7 ITALIEN AUF DEM WEG ZUR EINHEIT
Piemont in den 1850er Jahren
Die Lombardei und die Herzogtümer 1859
Sizilien und Neapel 1860
Venedig (1866) und Rom (1870)
8 LEGENDENUMWOBENES ITALIEN
Die Generation der Giganten
Der klügste Staatsmann
Der edelste Römer
Vater der Nation
Einige Generäle und ein Admiral
Risorgimento ohne Helden
9 DIE EINIGUNG DER ITALIENER
Piemont und Neapel
Mit Sizilien geht es bergab
Rom und das Parlament
Schöne Legenden
Das Streben nach Ruhm
Der Bär von Busseto
10 DAS NATIONALISTISCHE ITALIEN
Italietta
Kriegslüsternes Italien
Das zerrissene Italien
11 DAS FASCHISTISCHE ITALIEN
Italia romana
Italia imperiale
12 ITALIEN IM KALTEN KRIEG
Die Christdemokraten
Die Kommunisten
Wohlstand in Italien
13 DAS MODERNE ITALIEN
Zentrifugales Italien
Berlusconi
Unverwüstliches Italien
Tafelteil
Anmerkungen
Bibliographie
Karten
Abbildungsverzeichnis
Register
Italiam non sponte sequor.
»Eigener Trieb führt nicht nach Italien mich [sondern das Geheiß der Götter].«
Vergil, Aeneis, Buch IV
EINLEITUNG
In den siebziger Jahren war ich zu Gast in einer Villa, die Lorenzo der Prächtige aus der Dynastie der Medici im 15. Jahrhundert erbauen ließ. Nach Norden beschirmt von den bewaldeten Hängen der Pisaner Berge, blickte sie nach Süden über das Tal des Arno. In der Ferne, jenseits der Palmen im Park und der Olivenhaine, sah man den Schiefen Turm und dahinter das Meer. Die Innenausstattung war jüngeren Datums als die schlichte Renaissancefassade: Die nach Süden ausgerichtete Zimmerflucht atmete 19. Jahrhundert, von den Empire-Möbeln bis zum dekorativen Nippes des Fin de siècle. Bei späteren Besuchen konnte ich mir das Haus sehr gut mit Adligen des Risorgimento bevölkert vorstellen: Graf Cavour zum Beispiel, wie er mit Baron Ricasoli oder dem Marchese D’Azeglio am Esstisch sitzt und eine Rede hält.
Mein Gastgeber Giovanni Tadini, ein Aristokrat piemontesischer Herkunft, aber in Siena aufgewachsen, war belesen und von weltbürgerlichem Geschmack. Er war auch im republikanischen Italien Monarchist geblieben und hielt loyal zum savoyischen Herrscherhaus, der königlichen Familie im Exil. Manchmal sprach er gänzlich unprätentiös von italienischen Herrschern wie den Medici, so als ob sie persönliche Freunde und erst kürzlich gestorben seien. Wenn er mich durchs Haus führte, blieb er seufzend vor einem Porträt der Elisa Bonaparte stehen, die für kurze Zeit Großherzogin der Toskana war, oder lobte eine Radierung der Kirche Santa Maria Novella, eines der Hauptwerke Leon Battista Albertis in Florenz. Auf dem Flügel lag ein Band mit Karikaturen von Gästen des Caffè Michelangiolo, den schlug er auf. Oder er zeigte mir seine Erstausgabe von The Struwwelpeter Alphabet, einem ABC-Buch der wichtigsten Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im England der Jahrhundertwende. Während wir durch Räume schlenderten, die vom Duft der Parmaveilchen in Messingjardinieren erfüllt waren, verwob mein Gastgeber mit tiefer, sonorer Stimme und häufig unter schallendem Gelächter persönliche Erinnerungen mit historischen Anekdoten. Zeitweilig hatte er als inoffizieller Botschafter im eigenen Land fungiert. Eines Tages begleitete er die britische Queen Mum zu einigen großen Villen in Lucca und Florenz und um Mitternacht zum Dom von Pisa. »Wohin wir auch gingen, es war ihre Hauptsorge, den Tassen Tee aus dem Weg zu gehen, die ihr überall angeboten wurden, und stattdessen den Gin ausfindig zu machen.«
Giovanni hatte als Kind eine englische Hauslehrerin, Miss Ramage, und sprach Englisch mit besserem Satzbau und reicherem Wortschatz als die meisten Briten. Aber diese Hauslehrerin war schon seit 40 Jahren tot, und manche ihrer Aussprüche hatten sich in seiner Erinnerung ein wenig verändert. »Wie Sie sich vorstellen können«, bemerkte er zum Beispiel glucksend, »fühlte ich mich wie ein Nilpferd im Porzellanladen.« Oder er sagte nach einer schlüpfrigen Geschichte heftig kichernd: »So ließ ich sie in ihrer eigenen Soße kochen.« Und wenn er eine interessante Bemerkung hörte, »stellte er seine Ohren auf«. Wenn ich eine seiner Fragen sehr eingehend beantwortete, strahlte er mich an und sagte: »Hüte ab.«
Nach dem Abendessen betrachtete ich gerade eine Porzellanfigur mit den Zügen Cavours, als ein schlanker, silberhaariger Herr näher kam und sich mir vorstellte: Es war Paolo Rossi, nicht der Fußballer und auch nicht der Musiker, sondern ein angesehener Politiker und Richter, ein Sozialdemokrat und in jungen Jahren Gegner Mussolinis. »So so«, sagte er, als er sah, was ich betrachtete, »Sie interessieren sich für die Einigung, die unità d’Italia?« Damals war ich ein junger Journalist, der aus dem Libanon in den ersten Jahren des Bürgerkriegs berichtete, aber aus der Schulzeit wusste ich noch genug, um zu begreifen, wovon er sprach.
Mein Geschichtslehrer in den sechziger Jahren war ein überzeugter Liberaler der alten Schule gewesen, der nicht mit der revisionistischen Sicht des bedeutenden Historikers Denis Mack Smith vertraut war und glaubte, das italienische Risorgimento illustriere beispielhaft den Triumph der Freiheit über die Unterdrückung. Deshalb war ich mehr als verblüfft, als Signor Rossi, der 20 Jahre zuvor Bildungsminister in der italienischen Regierung gewesen war, verschwörerisch fortfuhr, als äußere er in großer Erregung etwas Ketzerisches: »Davide, ich sage Ihnen, Garibaldi hat Italien einen Bärendienst erwiesen. Wäre er nicht in Sizilien und Neapel einmarschiert, hätten wir heute im Norden den reichsten und zivilisiertesten Staat Europas.« Dann ließ er den Blick über die anderen Gäste im Raum schweifen und fügte mit noch leiserer Stimme hinzu: »Natürlich hätten wir dann im Süden einen Nachbarn wie Ägypten.«
Bald verschlug mich meine Tätigkeit nach Palästina, dann wieder in den Libanon und anschließend nach Spanien, das seine Franco-Ära gerade überwunden hatte; deshalb konnte ich erst einige Jahre später nach Italien zurückkehren. Ich ging nach Palermo und schrieb eine Biographie über Giuseppe Tomasi di Lampedusa, den Autor des Romans Der Leopard – oder in neuerer Übersetzung Der Gattopardo. Aber Rossis Worte gingen mir nicht mehr aus dem Sinn, und ich dachte darüber nach, ob die Einigung Italiens damals ein notwendiges oder auch nur erfolgreiches Unternehmen gewesen war. Rossi hatte das bourbonische Königreich Neapel mit Ägypten verglichen – das konnte ich natürlich nicht billigen, aber manchmal kam mir der Gedanke, ob es den Italienern heute nicht besser ginge, wenn ihr Land in drei, vier oder sogar noch mehr Staaten aufgeteilt wäre. Italiener schienen mir Internationalisten und – in einem guten Sinn – provinziell zu sein, aber nicht nationalistisch, es sei denn, ihre Politiker redeten es ihnen mit mehr oder weniger gewaltsamen Mitteln ein. Jedenfalls ist der Nationalstaat kein Naturgesetz, das weiß das Volk von Kurdistan sehr gut. Und manchmal ist er ein so künstliches Gebilde, dass er, wie etwa Jugoslawien, wieder zerfällt. Im heutigen Europa, in dem es so viele erfolgreiche kleine Nationen gibt, wäre sicher auch Platz für eine blühende Toskana, die im 18. Jahrhundert der vielleicht zivilisierteste Staat Europas war. Oder für ein prosperierendes Venedig, einst eine mächtige Republik mit einer tausendjährigen Geschichte.
Vor ein paar Jahren beschloss ich, in den 20 italienischen Regionen jeweils eine Weile zu leben, um sie mit all ihren Unterschieden zu den anderen Landesteilen kennen zu lernen. Herkömmliche Darstellungen der italienischen Geschichte waren aus einer zentralistischen Perspektive geschrieben, als wäre die Einigung Italiens unausweichlich gewesen. Mich dagegen interessierten die zentrifugalen Tendenzen der Halbinsel, und ich wollte herausbekommen, ob die verspätete Einigung und die Wirrnisse des Nationalstaats tatsächlich zufällige historische Entwicklungen oder nicht vielmehr eine Folge der Vergangenheit und der Geographie Italiens waren – jener Verhältnisse, die nationalistischen Bestrebungen zuwiderlaufen. Ist Italien nicht einfach zu vielgestaltig, um eine erfolgreiche Nation zu sein?
Zuerst wollte ich über das 19. und 20. Jahrhundert schreiben, die Epoche von Lampedusas Roman und seines eigenen Lebens. Aber dann ertappte ich mich dabei, dass ich immer weiter zurückgehen wollte, und dann noch weiter, um zu erkunden, was frühere Generationen über Italien dachten: die Aufklärer, Dante, Machiavelli, Kaiser Augustus, Karl der Große, Friedrich II. – stupor mundi (Das Staunen der Welt) – und Napoleon. Als ich meinem Verleger Stuart Proffitt erzählte, dass auch Cicero eine Vorstellung von Italien hatte, sagte er: »David, geh zurück zu Cicero.« Ich ging zurück zu Cicero und zu Vergil und betrachtete auch die nachfolgenden Epochen. Jede hatte ein ganz eigenes, oft sehr unterschiedliches Bild von Italien. In den ersten Kapiteln dieses Buches erhebe ich nicht den Anspruch, eine Geschichte von 2000 Jahren abzuhandeln, bis schließlich Napoleon Bonaparte 1796 über Italien herfiel und das Land ins Chaos stürzte. Eher biete ich eine chronologische Skizze, mit der ich versuche, die zahllosen Erscheinungsbilder Italiens und die zentrifugalen Tendenzen in seiner Geschichte aufzuspüren und darzulegen, in welcher Form sie auch die jüngere Vergangenheit der Halbinsel prägten.
Eine wissenschaftliche Untersuchung soll es nicht werden. Ich habe mir erlaubt, in der Wahl meiner Themen subjektiv und manchmal vielleicht auch eigenwillig zu sein und Einzelphänomenen unverhältnismäßig viel Raum zu geben, die bestimmte historische Momente oder Epochen in besonderer Weise beleuchten: den mittelalterlichen Fresken in Siena oder den Denkmälern in Turin, den frühen Opern Giuseppe Verdis oder einem Film des marxistischen Regisseurs Bernardo Bertolucci. Dies ist gleichermaßen das Buch eines einfachen Reisenden wie eines Historikers – und es ist auch das Buch eines Zuhörers. Denn über viele Jahre habe ich mit großem Vergnügen Italienern zugehört, die mir aus ihrem Leben erzählten und mir ihre Sicht der Geschichte darlegten. Der unvergleichliche Richard Cobb, bei dem ich vor bald 40 Jahren in Oxford studierte, pflegte zu sagen, vieles von der französischen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts könne erlaufen, gesehen, gerochen und vor allem gehört werden – in Cafés, in Bussen und auf den Parkbänken von Paris und Lyon, seinen Lieblingsstädten. Dasselbe gilt für Italien: für Neapel im 18. oder Turin im 19. Jahrhundert. Hier, in einem tristen Café am Bahnhof Porta Nuova der Hauptstadt des Piemont, erzählte mir die freundliche, aber bedrückte padrona ausführlich von den Verbrechen der Neapolitaner, um dann seufzend zu resümieren: »Wir verstehen zu arbeiten, aber die verstehen zu leben.« Noch heute sind die Unterschiede zwischen beiden Städten so krass, dass ich mich manchmal wundere, wie sie zum selben Staat gehören können. War es tatsächlich die Bestimmung Neapels, das vor 400 Jahren die zweitgrößte Stadt der Christenheit war, auf den Status einer Regionalhauptstadt wie Bari oder Potenza herabzusinken?
Viel Freundlichkeit begegnete mir in den 35 Jahren, die ich mit italienischen Reisen verbrachte, und ich erhielt eine Menge Anregungen. Meine früheste und vielleicht größte Dankesschuld besteht gegenüber einem älteren toskanischen contadino, der nordwestlich von Lucca ein paar Tagwerk Land mit Weinbergen und Olivenhainen bestellte, die meinen Eltern gehörten. Sein Lohn bestand in einigen Litern trübes Olivenöl und ein paar großen Korbflaschen Rot- und Weißwein, wovon mal der eine, mal der andere Jahrgang ungenießbar war. Zu seiner Verteidigung brachte er zu Recht vor, dass der Wein unbehandelt und frei von Chemie sei. Er arbeitete auch auf anderen Landgütern und beklagte sich über zu viel Arbeit (troppo lavoro). Dabei fand man ihn oft schon am frühen Nachmittag in der örtlichen Trattoria bei einem caffè corretto, das ist ein Espresso, der mit einem Schuss Grappa oder Vecchia Romagna »korrigiert« ist. Auch gab er zu, nur zweimal im Jahr Wasser zu trinken. Seine politische Einstellung war ziemlich kraus: Er wählte die Christdemokraten, gehörte einer kommunistischen Gewerkschaft an und meinte, Mussolini sei doch ein tüchtiger Kerl gewesen, molto bravo.
Angelo hatte viel Charme und verriet bodenständige Klugheit. Er nahm mich mit zu den Versammlungen des Gemeinderats von Pescaglia, machte mich mit anderen Landarbeitern bekannt (die meisten kamen aus Sardinien) und fuhr mich gelegentlich in das Dorf seiner Vorfahren in den Hügeln oberhalb von Camaiore, wo sein Nachbar, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, Lieder sang, die die Schlacht von Vittorio Veneto gegen die Österreicher 1918 feierten. Er hatte eine hübsche Hündin, einen Schäferhundmischling, und schenkte mir einen ihrer Welpen. Da er aber, was die Vaterschaft betraf, ziemlich achtlos gewesen war, präsentierte er mir ein bezauberndes, aber ziemlich sonderbar aussehendes Geschöpf. La Giulia, wie Angelos Frau allgemein genannt wurde, war eine große, eindrucksvolle Person, die in den Fiat Cinquecento nur hineinpasste, wenn der Beifahrersitz herausgenommen wurde. Sie war eine großartige Köchin vor allem ländlicher Gerichte aus einheimischen Zutaten und bereitete eine feine Polenta zu, die sie auf einem Leinentuch servierte und mit einem Baumwollfaden zerteilte. In den 30 Jahren seit ihrem Tod habe ich vergebens nach einer Polenta dieser Güte gesucht – das mag auch die eine oder andere abschätzige Bemerkung in diesem Buch über den besagten gelben Maisbrei erklären.
Ähnlich ausführlich würde ich gern über andere Freunde und Bekannte – Italiener und Engländer – schreiben, die mir geholfen haben, Italien zu verstehen. Aber ich muss mich auf die Aufzählung der Personen beschränken, denen ich besonders verbunden bin; einige sind leider schon tot: Harold Acton, Giancarlo Aragona, Vernon Bartlett, Tina Battistoni, Boris Biancheri, Gerardo di Bugnano, Giancarlo Carofiglio, Franco Cassano, Cristina Celestini, Rosso Dante, Leglio Deghe’ und seine Frau Susan, Deda Fezzi Price, Bona Frescobaldi, Dino Fruzza, Giuseppe Galasso, Michael Grant, Roberta Higgins, Carlo Knight, Denis Mack Smith, Donatella Manzottu, Roberto Martucci, Gabriele Pantucci, Emanuela Polo, Paolo Rossi, Cintia Rucellai, Steven Runciman, Giuseppe di Sarzana, Ignacio Segorbe und seine Frau Gola, Gaia Servadio, Xan Smiley, Giovanni Tadini, Riccardo Tomacelli, Nichi Vendola, Dennis Walters, Giles Watson und seine Frau Mariagrazia Gerardi, Edoardo und Francesco Winspeare.
Besonders dankbar bin ich den Freunden und Verwandten, die das Manuskript teilweise oder ganz gelesen und nützliche Hinweise zum Text gegeben haben: Christopher Duggan, mein Bruder Andrew Gilmour, meine Frau Sarah Gilmour, Ramachandra Guha, Richard Jenkyns, Robin Lane Fox, Gioacchino Lanza Tomasi, Nicoletta Polo, Maria Luisa Radighieri und Beppe Severgnini. Das Buch hatte auch das Glück, zwei hervorragende Verleger beiderseits des Atlantiks zu gewinnen, Stuart Proffitt in London und Elisabeth Sifton in New York. Beiden bin ich unendlich dankbar für ihre inspirierende, zuverlässige und gute Beratung. Gillon Aitken, mein Agent, war wie immer freigebig mit seiner wohltuenden Klugheit. Desgleichen stehe ich bei denen in der Schuld, die mit der Herstellung des Buches befasst waren, besonders Eugénie Aperghis van Nispen, Richard Duguid, Jenny Fry und David Watson. Ewige Dankbarkeit schulde ich meiner Frau Sarah, die stets beruhigend, unterstützend und außerordentlich geduldig war.
1VIELGESTALTIGES ITALIEN
UNEINHEITLICHE GEOGRAPHIE
Italien, so klagte Napoleon, sei zu lang. Es ist tatsächlich sehr lang – das längste Land Europas, neben der skandinavischen Halbinsel und der Ukraine. Es ist auch eines der schmalsten. Die Halbinsel ist etwa so breit wie Portugal und die Niederlande, nur Albanien und Luxemburg sind noch schmaler. Der republikanische Politiker Ugo La Malfa beschrieb sein Land im Bild eines Menschen, der mit den Füßen in Afrika steht und sich an die Alpen klammert, um sich zur Mitte Europas hochzuziehen.*1
Wir unterscheiden ziemlich ungenau zwischen Nord- und Süditalien, in Wirklichkeit aber durchläuft das Land mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von insgesamt 1200 Kilometern sehr unterschiedliche Klima- und Vegetationszonen: vom Aostatal im Nordwesten mit Französisch als zweiter Amtssprache bis zur Halbinsel Salento im südöstlichen Apulien, wo heute noch Griechisch gesprochen wird. Blickt man von den Zinnen der Burg von Otranto herab, hat man das Gefühl, man sei auf dem Balkan, und in gewisser Weise stimmt das sogar: Jenseits des Meeres sieht man die Berge Griechenlands und Albaniens, Istanbul und die Ukraine liegen näher als Aosta, und bis zum Schwarzen Meer ist es nicht so weit wie bis zur Westküste Sardiniens. Als Apulien 1861 ins Königreich Italien eingegliedert wurde, lag Turin, die Hauptstadt des neuen Staates, von Otranto weiter entfernt als die heutigen Hauptstädte von 17 anderen Ländern. Kein Wunder, dass sich die Apulier selbst bisweilen als Griechen oder Levantiner bezeichnen. Manchmal bestreiten sie sogar, dass sie Italiener sind.
Im Jahr 1847 tat der österreichische Staatsmann Metternich Italien als une expression géographique ab, was viele empörte, ganz besonders die Italiener und die Historiker. Italien war gewiss schon damals mehr als nur »ein geographischer Begriff«, aber es war immer noch in acht verschiedene Staaten aufgeteilt. Allerdings gab Metternich nur eine Ansicht wieder, die mehr als 2000 Jahre lang von vielen geteilt wurde: Italien mochte eine geographische Einheit mit natürlichen Grenzen sein wie die Iberische Halbinsel, doch seit römischer Zeit war es kein einheitliches Staatsgebilde mehr und schien weder jetzt noch in Zukunft der politischen Einigung zu bedürfen.
Italiens Ursprung ist eng mit den Sagen um den griechischen Helden Herakles verbunden. Er rettete ein entlaufenes Kalb, das durch ganz Süditalien gezogen war und die Straße von Messina durchschwommen hatte – ein Gebiet, das daraufhin Italia genannt wurde, nach ouitoulos, junges Rind. Dieses Wort fand über das Oskische und Lateinische (vitulus) als vitello (Kalb, Kalbfleisch) Eingang ins Italienische. Nach einer ähnlichen, von dem griechischen Historiker Timaios überlieferten Geschichte waren die alten Griechen von den Rindern Italiens so beeindruckt, dass sie dem Land diesen Namen gaben.
Diese Erklärung für den Ursprung des Namens Italia klingt nicht sonderlich überzeugend. Jahrhundertelang äußerten sich Besucher aus dem Norden abfällig über die mageren italienischen Rinder, besonders die kleinen weißen mit den großen Hörnern, die hauptsächlich Karren ziehen mussten und vor den Pflug gespannt wurden. Im trockenen Süden der Halbinsel sind grüne Weiden unbekannt und damit auch Gras und Heu, und das war ganz gewiss kein Paradies für Kuhhirten, nicht einmal in den Augen der Griechen. Die Hochebene der Murge in Apulien eignet sich nicht für die Rinderzucht, weil kein Gewässer sie durchzieht. Italien muss mehr als die Hälfte seiner Milch importieren, und wenn wir Süditalien heute mit Rindern in Verbindung bringen, dann mit den Wasserbüffeln, aus deren Milch der weiche weiße Büffelkäse, die mozzarella di bùfala, hergestellt wird. Aber die Büffel sind asiatischen Ursprungs; sie wurden im frühen Mittelalter eingeführt, um Pflüge zu ziehen. Später verwilderten sie und durchstreiften Kampanien und die Pontinischen Sümpfe, bis sie im 18. Jahrhundert erneut domestiziert wurden. Als Zugtiere, nicht für die Milch- und Fleischproduktion eingesetzt, wären diese Herden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben. Die Mozzarella, die aus ihrer Milch hergestellt wird, wurde erst in den 1980er Jahren bekannt und beliebt.
Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde nur die kalabrische Spitze des italienischen Stiefels, wo das Volk der Bruttier lebte, Italia genannt, später kamen Lukanien und Kampanien hinzu und noch später auch weiter nördlich gelegene Gebiete: die römischen Eroberungen auf der Halbinsel. Die griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Thukydides betrachteten das Land jenseits des Po nicht als Teil Italiens. Tatsächlich gehört die Poebene geographisch zur kontinentalen Landmasse, nicht zur italienischen Halbinsel. Als die Römer die keltischen Stämme in der Poebene unterwarfen und bis zum südlichen Alpenrand vordrangen, wurde auch dieses Gebiet Italia genannt. Der griechische Historiker Polybios meinte im 2. Jahrhundert v. Chr., fast das gesamte heutige Italien werde Italia genannt, auch wenn die römischen Dichter späterer Jahrhunderte andere Namen verwendeten: Hesperia, Ausonia, Saturnia terra und (passend für den heute weltweit größten Weinproduzenten) Oenotria, Land des Weins.
Der vorrückenden römischen Eroberung stand allerdings ein großes Hindernis entgegen. Im Jahr 91 v. Chr. erhoben sich einige römische socii (unterworfene Bundesgenossen) des Zentralapennin gegen Rom und gründeten einen eigenen Staat (Italia) mit der Hauptstadt Corfinium (später in Italica umbenannt), der von Prätoren, einem Senat und zwei Konsuln geleitet wurde. Die Aufständischen prägten sogar eigene Münzen mit dem italischen Stier, der die römische Wölfin auf seine Hörner nimmt. Doch im sogenannten Bundesgenossenkrieg wurden sie von den Römern mit einer Taktik aus Zuckerbrot und Peitsche besiegt, und in den nachfolgenden Jahrhunderten gab es keinen weiteren Versuch mehr, unter dem Namen Italia einen Staat zu gründen.
100 Jahre nach diesem Krieg teilte der erste römische Alleinherrscher Augustus dieses ältere Italia in elf große Verwaltungsbezirke (regiones) auf. Nur die Halbinsel Istrien, die dem Bezirk Venetien angegliedert wurde, gehört heute nicht mehr zum Staat Italien.1 Später erweiterte Kaiser Diokletian Italia um Sizilien, Sardinien, Korsika und Rätien (dies sind Teile der heutigen Schweiz, Bayerns und Tirols).
Das Italien unter Augustus, das Vergil und andere Dichter jener Zeit besangen, blieb das ganze Mittelalter hindurch ein Quell literarischer Inspiration. Petrarca spricht von dem »schönen Land, das der Apennin teilt und das Meer und die Alpen umringen«.*2 Doch bis Ende des 18. Jahrhunderts blieb es eine literarische Idee, eine abstrakte Vorstellung, eine imaginäre Heimat oder auch nur ein sentimentaler Wunschtraum. Wenn einige bisweilen diesen Traum beschworen, um der Verbitterung über eine Fremdherrschaft Ausdruck zu verleihen, so waren dennoch Unabhängigkeit und Einheit nicht die angestrebten politischen Ziele. Und für die große Mehrheit der Bevölkerung blieb der Name bedeutungslos. Noch 1861, zur Zeit der Einigung, glaubten manche Sizilianer, L’Italia – oder La Talia – sei ihre neue Königin. Und weitere 100 Jahre später begegnete der Sozialreformer Danilo Dolci Sizilianern, die noch nie von Italien gehört hatten und wissen wollten, was das sei.*3
Die Geographie Italiens, wie wir sie aus Schulbüchern und Atlanten kennen, lässt uns glauben, das Land sei durch seine Lage in ganz besonderer Weise begünstigt. Der Revolutionär und Patriot Giuseppe Mazzini meinte, Gott habe den Italienern »das am klarsten umrissene Vaterland Europas gegeben«.*4 Im Zentrum des Mittelmeers gelegen, sei es im Norden durch den Wall der Alpen und auf allen anderen Seiten durch das Meer geschützt.
In Wirklichkeit hat Italien eine ausgesprochen ungünstige Lage, und es gehörte immer zu den am leichtesten angreifbaren und am häufigsten überfallenen Gegenden der Welt. Die Alpen wirken zwar imposant, aber sie wurden seit der Bronzezeit immer wieder mühelos überwunden. Im 12. Jahrhundert v. Chr. brachten Kaufleute Bernstein von der Ostsee über die Alpen nach Etrurien und Sardinien. In römischer Zeit wurden 17 der 23 Alpenpässe genutzt. Nur wenige Gebirgswälle wurden im Lauf der Jahrhunderte so oft erfolgreich überwunden. Hannibal führte seine karthagische Armee über die Westalpen, Alarichs Goten und Attilas Hunnen kamen von Osten über die niedrigeren Julischen und Karnischen Alpen. Im Jahr 1796 durchquerte Bonaparte, damals noch General, die Voralpen zwischen Nizza und Genua und brüstete sich gegenüber seinen Soldaten: »Annibale a forcé lesAlpes – nous, nous les avons tournées«, Hannibal hat die Alpen bezwungen, wir haben sie umgangen. Doch vier Jahre später, nunmehr Erster Konsul, drang er über fünf weiter nördlich gelegene Pässe nach Italien vor. Später ließ er sich auf einem weißen Streitross malen, wie er den Großen Sankt-Bernhard-Pass im Schnee überquert. In Wirklichkeit wurde er auf einem kleinen grauen Maultier hinübergeführt.
Viele Angreifer sind dem Beispiel dieser Invasoren gefolgt. Nachdem sie die Alpenpässe überwunden hatten, lag die Poebene vor ihnen: flaches, einladendes Gelände, das schwer zu verteidigen war. Im Westen allerdings wurden sie von den Zuflüssen des Po behindert, die von den Seen im Norden herunterströmten. Mailand war mühelos einzunehmen, ebenso die anderen »Einfallstore« nach Italien: Turin und Verona. Auch deshalb hatte das Oströmische Reich (Byzanz) 1000 Jahre länger Bestand als der Westen des alten Imperiums: Es war sehr viel leichter zu verteidigen. Die Goten und Hunnen zogen zwar plündernd durch den Balkan, aber vor Konstantinopel geboten ihnen die gewaltigen Landmauern Einhalt, und der Weg durch den Bosporus und damit nach Kleinasien war ihnen durch eine Flotte verwehrt. Eine ähnliche Großtat vollbrachten die Byzantiner in umgekehrter Richtung, als sie im 7. Jahrhundert den Ansturm der Araber abwehrten und verhindern konnten, dass diese weiter nach Osteuropa und im Westen nach Italien vordrangen. Rom wurde nicht islamisiert. 100 Jahre vor Karl dem Großen wurde also das militärisch noch schwache Abendland durch Byzanz gerettet. Sein Aufstieg zur beherrschenden Macht wurde dadurch überhaupt erst möglich. Neben der französischen Riviera war nur die italienische Mittelmeerküste nie muslimisch (mit Bari als einziger Ausnahme).
Vom Meer her war Italien noch leichter anzugreifen als über die Berge. Mit insgesamt 7375 Kilometer Küstenlänge sind die Halbinsel und ihre Inseln kaum zu kontrollieren und können von drei Kontinenten her überfallen werden.
Schiffe sind das älteste Verkehrsmittel des Menschen, und um 500 v. Chr. waren diese Schiffe schon so stabil, dass man lange Seereisen unternehmen konnte. Herodot notierte im 5. Jahrhundert v. Chr., ein Schiff könne in 24 Stunden 120 Kilometer zurücklegen – diese Angaben belegen, dass Invasoren von der albanischen Küste die 70 Kilometer breite Straße von Otranto im Sommer bei Tageslicht überwinden konnten. Von der Adria her musste man also stets mit Überfällen rechnen. Die Ostküste mit ihren wichtigen Häfen musste ebenso überwacht werden wie die Insel Korfu am Eingang zur Straße von Otranto. Venedig hätte nie den Anspruch auf den Titel einer Königin (oder Braut) der Adria, eines »Löwen des Meeres« und schon gar nicht auf den Beinamen Serenissima (die Durchlauchtigste) erheben können, wenn es nicht immer wieder die dalmatinische Stadt Zara (heute Zadar) angegriffen hätte, wenn Triest zu einem ernsthaften Rivalen aufgestiegen oder Ragusa, das spätere Dubrovnik, als Seemacht genauso stark geworden wäre wie als Wirtschaftsmacht. In ihrer glanzvollsten Epoche musste sich die Republik Venedig einen sicheren Schutzraum an der Adria schaffen, weil auch die Bevölkerung an den Küsten größtenteils nichtitalienisch war. Kein Wunder, dass Kartographen die Adria oft kurzerhand mit dem Golf von Venedig gleichsetzten.
Die Inseln waren noch angreifbarer als die Küsten des Festlands. Elba wurde trotz seiner Nähe zur Toskana im 16. Jahrhundert von Eindringlingen aus Afrika, den Berber-Korsaren, so oft überfallen, dass die Bewohner ihre angestammten Siedlungen an der Küste verließen und sich in die Berge zurückzogen. Dieselbe Bedrohung führte zur Entvölkerung der Küsten Sardiniens: Festungen und Wachttürme konnten die Plünderer auf der Jagd nach Sklaven nicht abschrecken. Für Phönizier, Karthager, Römer, Vandalen, Byzantiner, Araber und Aragonesen, aber auch für Kolonisten, die in erster Linie am Handel interessiert waren, wie Pisaner und Genuesen, war die Insel leichte Beute. Sizilien hatte ein ähnliches Problem. Aufgrund seiner geographischen Lage waren die Bewohner der Insel seit 5000 Jahren nie Herr ihres Schicksals. Der Sieg der Syrakuser über die Athener im Peloponnesischen Krieg (5. Jahrhundert v. Chr.) war der letzte erfolgreiche Widerstand der Insel gegen einen gefährlichen Eindringling. Danach war Sizilien einerseits zu klein und zu schwach, um sich zur Wehr zu setzen, und andererseits zu groß, strategisch viel zu wichtig und bis ins späte Mittelalter hinein zu fruchtbar, um von Invasionen verschont zu bleiben. Für jede dominierende Macht im westlichen Mittelmeer war es daher eine verlockende Beute.
Das Schicksal Siziliens spiegelte sich, wenn auch in weniger konzentrierter und durchgängiger Weise, im Schicksal ganz Italiens. Bis zum Beginn der Großmachtdiplomatie Mitte des 19. Jahrhunderts war Italiens geographische Lage schuld daran, dass es im Lauf seiner Geschichte nur die Wahl hatte, entweder andere Völker selbst zu erobern oder von ihnen beherrscht zu werden. Es konnte entweder eine Weltmacht oder eine Kolonie sein, aber kein Nationalstaat. Aufschlussreich ist ein Vergleich mit England, das durch seine Meere und seine Seestreitmacht geschützt war. Die Normannen eroberten 1060 Sizilien und 1066 England. Hier wie dort gründeten sie blühende Königreiche, nur in Sizilien herrschte weitaus größerer Wohlstand. In den nachfolgenden 1000 Jahren setzten mehrere Thronprätendenten über den Ärmelkanal und griffen nach der englischen Krone, aber die Invasion Englands gelang nur einer einzigen fremden Macht: den Niederländern im Jahr 1688. Hier handelte es sich allerdings weder um eine vollständig fremde noch um eine typische Invasion, denn Wilhelm von Oranien war von mächtigen englischen Politikern aufgefordert worden, den unpopulären Jakob II. (seinen Onkel und Schwiegervater) zu stürzen. Innerhalb dieser 900 Jahre wurde Italien vom Haus Anjou und vom Haus Aragón, von den Deutschen (mehrmals), den Franzosen (oft), Spaniern, Türken (für kurze Zeit), Österreichern (häufig), Russen, Briten und Amerikanern eingenommen.2 Aber kein einziger Eroberer beherrschte die gesamte italienische Halbinsel.
Wirtschaftlich wie militärisch bietet die Nordsee für England klare Vorteile. Die Vorzüge des Mittelmeers für Italien sind weniger offenkundig, denn Land und Wasser stehen in einem komplizierten Verhältnis. Trotz seiner langen Küstenlinie hat Italien mit Genua, La Spezia und Neapel am Tyrrhenischen, Tarent am Ionischen sowie Ancona, Brindisi und Venedig am Adriatischen Meer relativ wenige gute Häfen. Amalfi, das im 9. Jahrhundert zur Seemacht aufstieg, verfügt nur über einen sehr kurzen Küstenstreifen und hat keinen ausgebauten Hafen. Als Republik überlebte es vor allem, weil es arabischen Angreifern half, andere Abschnitte der italienischen Küste zu überfallen.3 Doch es verfügte über den kampanischen Hanf und Flachs, die für Schiffstaue benötigt wurden, und über Wälder, die das Holz für den Schiffbau lieferten. Der Mangel an Holz in weiten Teilen der übrigen Halbinsel verhinderte jedoch den Aufbau großer Seeflotten. Vor allem in der Toskana und auf der Halbinsel Gargano gab es zwar ausgedehnte Wälder in Meeresnähe, aber wenn sie einmal abgeholzt waren und die dünne Humusschicht weggeschwemmt war, konnten sie sich im mediterranen Klima nicht mehr richtig regenerieren. Dies galt ganz besonders im Süden, wo zwischen den Setzlingen Ziegenherden nach Futter suchten. Ein Großteil der sardischen Küstengebiete überzog sich daher mit Macchia, aromatisch duftenden, niedrigen mediterranen Sträuchern, die den Sinnen und der Seele guttun, aber weder den Wohlstand fördern noch dem Ökosystem nützen.
Reichlich Holz gab es auf der italienischen Halbinsel nur in der Antike, als man erst anfing, die Wälder abzuholzen. Später reichten die Holzbestände nicht mehr aus, um mit den atlantischen Hochseeflotten Englands und der Niederlande zu konkurrieren, weil diese auf die Wälder im Ostseeraum zurückgreifen konnten, oder mit den Flotten der Weltmächte Spanien und Portugal. Knappes Eichenholz für Schiffsrümpfe war ein Dauerproblem. Die Venezianer holzten die Wälder Dalmatiens für ihre Schiffe ab, für die Millionen Pfähle, die sie für die Fundamente ihrer Häuser brauchten, und für die vielen tausend briccole, das sind wie bei einem Wigwam zusammengebundene Pfähle, die aus den Kanälen der Lagune herausragen und den Verlauf der schiffbaren Passagen markieren. Diese Holzbestände waren irgendwann erschöpft. Zur Zeit ihres triumphalen Siegs gegen die Türken in der Seeschlacht von Lepanto 1571 musste die Republik Venedig nicht nur Schiffsrümpfe, sondern ganze Schiffe in den Niederlanden kaufen.
Zum heutigen Straßenbild Neapels gehören die Restaurants am Meer und die Menschen, die frutti di mare genießen. Aber die Italiener waren nie große Fischesser, am wenigsten im Norden, wo man traditionell dem Süßwasserfisch gegenüber Meeresfisch den Vorzug gab. In der Antike gönnten sich römische Plutokraten den Luxus privater Fischteiche, während im Mittelalter die Bewohner Ferraras die nahe gelegene Adria ignorierten und lieber in Flüssen und Seen Hechte, Schleien und Karpfen angelten. Francesco di Marco Datini, der berühmte »Kaufmann von Prato«, importierte Aale aus der Lagune von Comacchio nördlich von Ravenna in den toskanischen Apennin.*5 Als nach dem Wirtschaftsaufschwung der 1960er Jahre die Armen sich mehr als nur Brot, Polenta, Nudeln und Suppe leisten konnten, kauften sie lieber Fleisch als Fisch. Zwischen 1960 und 1975 verdreifachte sich ihr Fleischkonsum, und dieser Trend verstärkte sich, als die katholische Kirche das Fleischverbot am Freitag lockerte. Ende des 20. Jahrhunderts konsumierten die Italiener mehr Fleisch als die Briten und weniger Fisch als der europäische Durchschnitt.
Der Fischfang vor der italienischen Küste war schon immer ein saisonal beschränktes und unberechenbares Unternehmen. Traditionell wurden vor der Küste Sardiniens und Siziliens alljährlich riesige Mengen Thunfisch gefangen, doch der Thunfischfang im eigentlichen Sinn (mit speziellen Netzen, die ein System von Kammern bilden) und die mattanza, das Abschlachten, konnte erst beginnen, wenn die Fischschwärme im Mai sardische Gewässer erreicht hatten, und nach wenigen Wochen war alles vorbei. Ein grundsätzlicheres Problem, das man jedoch kaum wahrnimmt, wenn man das quirlige Treiben auf den Fischmärkten selbst so kleiner Hafenstädte wie Trani erlebt, ist der Mangel an fangbarem Fisch. Die einzige reichlich vorkommende Fischart außer Thunfisch sind Sardinen und Sardellen. Mitte des 20. Jahrhunderts, vor der Einführung von Fangquoten, hatte Italien die größte Fischereiwirtschaft aller Länder, die ausschließlich vom Mittelmeer umgeben sind. Italien fischte das Zwanzigfache der Tonnage seines benachbarten Rivalen Griechenland, doch der italienische Fischfang insgesamt betrug nur ein Sechstel dessen, was die britische Fangflotte einholte.
Als der Historiker Fernand Braudel das Mittelmeer als »geologisch überaltert« und »biologisch erschöpft« beschrieb, wurde seine Terminologie als »evolutionistisch« kritisiert. Aber er verwies zu Recht auf die Fischarmut des Mittelmeers im Vergleich zum Atlantik, wenn er feststellte, dass sich »die Menge der vielgerühmten frutti di mare in Grenzen hält«.*6 Der schmale Festlandsockel des Mittelmeers und das Fehlen ausgeprägter Gezeiten beschränken das Wachstum von Nahrung für die Fische. Wenn dagegen die warmen Meeresströmungen aus dem Golf von Mexiko das Kontinentalschelf Westeuropas erreichen, bringen sie gewaltige Mengen Plankton mit, das den riesigen Fischschwärmen des Atlantiks rund um Großbritannien, Island und Neufundland Nahrung bietet. Eine Folge der Fischknappheit und der geringen Zahl von Fischern in Italien war, historisch gesehen, der Mangel an Seeleuten. Lange Zeit rekrutierte Venedig seine Mannschaften in Dalmatien, und Ende des 16. Jahrhunderts warben die Mittelmeerstaaten Seeleute aus Nordeuropa an. Philipp II. von Spanien soll nach dem Untergang seiner Armada im Jahr 1588 sogar versucht haben, Seeleute aus England anzuheuern.*7
Auch wenn die geographische Lage nicht verhindern konnte, dass Italien immer wieder überfallen wurde, schränkte die Beschaffenheit des Landesinnern die Bewegungsfreiheit von Eindringlingen wie Bewohnern gleichermaßen ein. Die Alpen haben mehrere Vorzüge gegenüber dem Apenninmassiv, Italiens gebirgigem Rückgrat, das die Halbinsel über eine Gesamtlänge von 1500 Kilometern in einem großen Bogen durchzieht und sich bis nach Sizilien und zu den Ägadischen Inseln fortsetzt. Die Alpen bieten Schafen und Rindern üppige Sommerweiden oberhalb der Baumgrenze; auch in noch sehr viel größerer Höhe gibt es Vegetation. Flüsse und Seen erleichtern den Waren- und Personenverkehr, und über die Pässe gelangten im Mittelalter das Bankwesen und der Kapitalismus aus Italien nach Nordeuropa. Zahlreiche Dörfer versorgten den Handel das ganze Jahr hindurch mit Geleit und Fuhrwerken, und selbst im Winter überwanden Menschen und Waren die Pässe mit Schlitten. Während Mailänder Kaufleute im 13. Jahrhundert über den Sankt-Gotthard-Pass eine befahrbare Straße bauten, die sie nach Deutschland und den Rhein entlang bis in die heutigen Niederlande führte, reisten die Venezianer über den Brenner, den niedrigsten Pass, nach Innsbruck und weiter nach Nürnberg und Frankfurt. Den Umfang des Handels über die Alpen – hauptsächlich mit Stoffen, Wein und Gewürzen – kann man anhand des Fondaco dei Tedeschi ermessen. Diese Handelsniederlassung direkt an der Rialtobrücke am Canal Grande, wo bis vor Kurzem das Hauptpostamt untergebracht war, diente den deutschen Kaufleuten während ihres Aufenthalts in Venedig als Herberge und Handelskontor.
Der Apennin dagegen bildet eine vielgliedrige Schranke aus Bergen, Sturzbächen und Schluchten, die schwer zu überwinden sind. Durch tiefe Schluchten getrennt, wussten die Dörfer im kalabrischen Sila-Gebirge wenig voneinander. Im Mittelalter gab es zahllose Saumpfade über den nördlichen Apennin, aber diese eigneten sich vor allem für Maultiere, mit denen man jedoch keine Wagenladungen Wein transportieren konnte wie über die Brennerrouten. Noch im Jahr 1750 waren auf dem gesamten Gebirgszug der Toskana und der Emilia Romagna nur zwei Teilstrecken für Karren passierbar. Der Apennin bildet somit eine Schranke zwischen dem Westen und dem Osten Italiens, die historisch gesehen fast genauso bedeutsam war wie die Trennung zwischen dem Norden und dem Süden. Bevor man Eisenbahnen und Tunnels baute, waren die Verkehrsverbindungen so schlecht, dass Reisende die Strecke zwischen Rom und Ancona einfacher und billiger per Schiff zurücklegten – über das Tyrrhenische, Ionische und Adriatische Meer –, statt auf dem kürzesten Weg durch das Landesinnere zu reisen.
Die Berge bieten den Bewohnern durchaus auch ein paar Vorteile. Da sie sehr hoch sind – der Gran Sasso in den Abruzzen ist 2912 Meter hoch – bleiben sie auch im Sommer mit Eis und Schnee bedeckt, eine Voraussetzung für die Herstellung lokaler Spezialitäten wie Speiseeis und Sorbet. Mitten im August des Jahres 1860, nach der Eroberung Siziliens, kletterten Garibaldis Soldaten auf den Aspromonte an der kalabrischen Stiefelspitze, um Schnee für die Kühlung von Speisen zu holen.
Das gebirgige Landesinnere bedeutete für den Vormarsch erobernder Armeen zudem ein so großes Hindernis, dass sogar noch die britischen und amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg trotz ihrer Luftüberlegenheit über die Deutschen 21 Monate brauchten, um sich von der einen Seite Italiens zur anderen vorzukämpfen. Die Berge halfen den Menschen, ihre Autonomie zu wahren, was jeder, der versuchte, das zerklüftete Landesinnere unter seine Kontrolle zu bringen, schnell erfahren musste. Damit förderten sie auch die Bewahrung – und sogar die Schaffung – kultureller Identität und sozialer Vielfalt innerhalb eines recht begrenzten Raums. Auch das kann man durchaus als Glücksfall bezeichnen. Der großartigen romanischen Kirchenarchitektur von Pisa und Lucca mit ihren düsteren Innenräumen stehen die lichtdurchfluteten romanischen Dome von Bari und Trani gegenüber. Doch eine Landschaft, die kulturelle Vielfalt begünstigt, fördert fast zwangsläufig auch die politische Zerrissenheit. Im Fall Italiens zeigte sich dies schon vor der Gründung Roms durch Romulus.
Wenig Segensreiches in kultureller und anderer Hinsicht brachten die beiden großen Vulkane des Landes, der Ätna in Sizilien, der größte aktive Vulkan Europas, und der Vesuv bei Neapel. So verheerend Vulkanausbrüche in der Vergangenheit oft waren, Erdbeben gibt es in Italien sehr viel häufiger, und sie sind sehr viel gefährlicher. Kaum eine Stadt im östlichen Sizilien oder im Südwesten des italienischen Stiefels wurde im Laufe ihrer Geschichte nicht mindestens einmal durch ein Erdbeben verwüstet. Seit 1976 starben rund 4000 Italiener bei Erdbeben im Friaul, in Kampanien und in der Basilicata, in Umbrien, den Marken, im Molise und in Apulien und zuletzt 2009 in den Abruzzen. In früheren Zeiten lag die Zahl der Opfer noch sehr viel höher. Drei der größten süditalienischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts verloren bei einem Erdbeben ihre nächsten Verwandten: Die Mutter des Romanautors Ignazio Silone kam 1915 bei einem Erdbeben in den Abruzzen ums Leben; die Eltern und die einzige Schwester des Philosophen Benedetto Croce starben 1883 auf Ischia; und der Historiker Gaetano Salvemini verlor seine Frau, seine Schwester und seine fünf Kinder 1908 in Messina, als ein Erdbeben und der nachfolgende Tsunami 70 000 Menschen den Tod brachte.
Flüsse mögen weniger Unheil anrichten, aber auf der Liste der Nachteile, die alle Italiener aufgrund der geographischen Lage ihres Landes in Kauf nehmen müssen, stehen sie ganz oben. Wie antike Autoren bestätigen, war die Schiffbarkeit der Flüsse in der Antike besser als heute, wenngleich nie besonders gut. Im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb der Geograph Strabon von der »harmonischen Anordnung« der Flüsse Frankreichs, die heute über eine Länge von insgesamt 6400 Kilometern schiffbar sind. Die Gesamtlänge der schiffbaren Flüsse Italiens dagegen beträgt nur ein paar hundert Kilometer. Kein einziger Fluss förderte den Handel, die Industrie und den Personenverkehr so, wie es die großen Flüsse Nordeuropas, etwa die Seine, die Rhône, der Rhein und die Elbe taten.
In Norditalien, wo es im Sommer regnet und wo viele Quellen und von den Schneemassen der Alpen gespeiste Gebirgsbäche ständig Wasser zuführen, sind die Vorzüge der Flüsse offenkundig. Der Po ist als einziger Fluss Italiens über größere Strecken schiffbar. Die Arme seines Deltas enthalten große Mengen Plankton, das einer Vielzahl von Fischarten Nahrung bietet. Zusammen mit seinen Nebenflüssen hat der Po eine große Schwemmebene geschaffen, Italiens größte und fruchtbarste Ackerbaufläche. Menschlicher Erfindergeist verstand es im 15. und 16. Jahrhundert auch, die Gewässer der Region wirtschaftlich nutzbar zu machen. Mit dem Bau eines Kanals vom Tessin und eines weiteren vom Fluss Adda nach Mailand wurde die reiche Hauptstadt der Lombardei mit dem Comer See und dem Lago Maggiore wie auch mit den Nebenflüssen des Po verbunden.
Trotzdem ist der Fluss nur bedingt von Nutzen. Norditalien profitiert nicht in derselben Weise vom Po wie Nordfrankreich von der Marne, der Seine und der Oise. Nur einer der 14 Mündungsarme in die Adria, der Po della Pila, kann von Schiffen befahren werden. Der Po selbst ist zwar über eine Länge von fast 500 Kilometern schiffbar, zumindest für kleinere Schiffe, doch die saisonalen Schwankungen der Pegelstände beschränken seine Fließgeschwindigkeit ebenso wie die gewaltigen Mengen Schlick, die er zum Meer transportiert. Einige seiner Nebenflüsse liefern Elektrizität und dienen der Bewässerung wie der Piave und die Etsch im Nordosten, aber kein einziger ist ganzjährig und mehr als ein paar Kilometer schiffbar. Der Unterlauf der Etsch ist aufgrund der Sandbänke in ihrem Mündungsgebiet für den Schiffsverkehr ungeeignet, und im Sommer und im Frühherbst wird er – wie der Unterlauf des Piave – zu einem dünnen Rinnsal zwischen Kiesbänken.
Der meistbesungene Strom ist Vergils »sanfter Tiber«, der drittlängste Fluss Italiens. Er ist so unauflöslich mit Rom verbunden wie die Seine mit Paris oder die Themse mit London. Die Gründer der Ewigen Stadt wählten die Lage ihrer Siedlung mit Bedacht: Roms Hügel sind gut zu verteidigen, in Ostia gab es Salzwiesen, und die Wasserversorgung war gesichert, bevor die Stadt so groß wurde, dass Aquädukte gebaut werden mussten. Doch vielleicht überschätzten die Stadtgründer den Nutzen ihres Flusses. Bis ins späte 19. Jahrhundert war der Tiber alles andere als ein sanfter Strom, und er trat so oft über die Ufer, dass in der Antike keine andere Stadt an seinen Ufern gebaut wurde. Giuseppe Garibaldi wollte im Jahr 1875, in der letzten Donquijoterie seines Lebens, den Fluss umleiten, um die Hauptstadt vor Überschwemmungen zu schützen.
Ein weiteres Problem war natürlich die Schiffbarkeit. In der Antike verkehrten zwischen dem Hafen von Ostia und Rom regelmäßig Schiffe, und stromaufwärts war der Tiber noch auf einer Strecke von gut 30 Kilometern befahrbar. Heute ist er nur in der Stadt selbst schiffbar. Auf der Themse dagegen gelangen Schiffe bis nach Lechlade, 20 Kilometer vor der Mündung, und die Seine, die fast 800 Kilometer lang gemächlich und majestätisch dahinfließt, eignet sich so gut für den Schiffsverkehr, dass 120 Kilometer vor ihrer Mündung ins Meer mit Rouen ein großer Hafen entstand.
Auch die anderen Flüsse des Apennin taugen nicht recht für Handel und Verkehr. Schon im Mittelalter war der Arno im Winter ein reißender Strom und im Sommer ein Rinnsal, und beim Transport des Carrara-Marmors von Pisa nach Florenz mussten sich die Schiffe mitunter an den Bäumen am Ufer voranziehen. Viele Flüsse stürzen im Winter wasserfallartig herab und sind im Sommer so trocken, dass sie kaum noch zur Bewässerung dienen. In Apulien erreichen einige nicht einmal das Meer. Reißende Ströme sind im Apennin die Hauptursache der Erosion. Sie stürzen die Bergflanken hinunter und reißen große Mengen Schlick und Steine mit. Wenn sie die Ebene erreichen, füllen sie nur die Sumpfgebiete an der Küste. Die Abholzung der Wälder hat die Situation noch verschlimmert. Bodenerosion, Überschwemmungen, Verlandung und malariaverseuchtes Sumpfland waren die Folge. Im Süden wurden die Wälder schon in der Antike abgeholzt, noch vor der Ankunft der Römer – ein Prozess, der sich durch die Beweidung mit Ziegen, den Bau von Schiffswerften und die Herstellung von Bahnschwellen und Telegraphenmasten weiter beschleunigte. In Sizilien, einst ein baumreiches Land mit Hartholz und Kiefern, waren am Ende des 20. Jahrhunderts weniger als 5 Prozent der Fläche bewaldet.
Mit seinem Plan, den Tiber umzuleiten, wollte Garibaldi nicht nur Überschwemmungen verhindern, sondern auch die Malaria bekämpfen. Flüsse aus den Lepinischen und den Albaner Bergen östlich von Rom brachten so viel Wasser in die Küstenebene, dass die Pontinischen Sümpfe entstanden, stehende Gewässer mit idealen Bedingungen für die Ausbreitung von Malaria. Die toskanische Maremma ein Stück weiter nördlich barg eine ähnliche Gefahr. Bevor die Sümpfe in den 1950er Jahren trockengelegt wurden, lebten hier nur wenige Menschen. Erst nach Garibaldis Tod wurden Moskitos als die Ursache für die Malaria erkannt, der Jahr für Jahr 15 000 Menschen zum Opfer fielen und eine vielfache Zahl körperlich schwächte. Erst 1962 wurde Italien offiziell für malariafrei erklärt.
Diese geophysischen Besonderheiten Italiens erklären auch, warum die Einigung des Landes ein so schwieriger Prozess war. Sie zeigen auch, dass die Apenninhalbinsel keineswegs so reich ist, wie Ausländer oft annehmen. Zu den fruchtbaren Gebieten Italiens zählen neben der Poebene mit ihren Mais- und Weizenfeldern der Unterlauf des Arno, das obere Veltlin, die kampanische Ebene (heute von der Camorra beherrscht), Palermos Zitronenhaine (in den sechziger Jahren von der Mafia zerstört) sowie die Weinund Olivengärten der Halbinsel Salento. Weinreben gedeihen überall in Italien, außer im nördlichen Venetien, im westlichen Piemont, im Inselinnern Siziliens und in der Poebene. Doch ein Großteil der Halbinsel ist von Bergen bedeckt, die von vielen Italienern als die Ursache für Armut und als Platzverschwendung betrachtet werden. Die Berge sind außerdem ein Hindernis für die Erschließung von Bauland, weshalb auf leichter zugänglichem Terrain rund um die Städte endlos wuchernde Vororte (die periferia) entstanden. Manchmal hat man den Eindruck, es gebe keine Ebene und kein Tal, das nicht als für die Bebauung geeignet betrachtet wird. Zwischen 1950 und 2005 wurden in Italien insgesamt 3,66 Millionen Hektar Land zubetoniert und asphaltiert – diese Fläche ist größer als die Toskana und Umbrien zusammen.*8
Viele Ausländer hatten wie ich das Glück, unter einer Pergola in der Toskana die Glühwürmchen zu beobachten, Chianti zu trinken und Olivenöl aus Lucca über ihren Rukolasalat zu träufeln in dem glückseligen Gefühl, materiell könne das Leben gar nichts Schöneres bieten. Italien scheint Gutes im Überfluss zu haben: funghi porcini und bistecca fiorentina, Feigen, Hülsenfrüchte und gegrilltes Gemüse sowie Schinkenkeulen, die in der cantina reifen. Die Toskana hat ein besseres Klima, fruchtbareren und mineralreicheren Boden als andere Teile Italiens. Den toskanischen Halbpächtern und den Tanzlieder singenden Bauern ging es im Verlauf der Geschichte besser als den Landarbeitern anderswo, und ihre traditionelle gehaltvolle Suppe, die ribollita, war sehr viel nahrhafter als die eher fade Polenta, das ungesunde Grundnahrungsmittel Norditaliens.
Doch auch hier, in einem der glücklichsten und kultiviertesten Landstriche der Welt, gibt der Boden nicht besonders viel her. Sogar in der Epoche, als Florenz weltweiter Mittelpunkt der Kunst und des Bankwesens war, konnte die Stadt nicht länger als fünf Monate im Jahr von dem leben, was ihr Umland produzierte. In den 400 Jahren nach 1375 erlitt Florenz alle vier Jahre eine Hungersnot, und im 16. Jahrhundert musste der Großherzog aus dem Geschlecht der Medici Getreide aus England, Polen und Flandern importieren. Als sich der englische Journalist Vernon Bartlett nach dem Zweiten Weltkrieg in der Toskana niederließ, sprachen einige seiner Nachbarn, die in britischer Kriegsgefangenschaft gewesen waren, »mit neidvoller Zuneigung von der Fruchtbarkeit des englischen Bodens«.*9 Parmesan und prosciutto, Capri und Chianti, Gondeln und Gorgonzola beschwören ein Bild Italiens, das uns lieb und teuer ist.
ITALIEN UND SEINE MENSCHEN
Beim Blättern im Telefonbuch der apulischen Stadt Bari staunt man über die Vielzahl von Familiennamen, die auf eine nichtitalienische Herkunft verweisen. Neben Greco finden sich Namen wie Spagnolo und Spagnuolo. Albano und Albanese deuten nicht auf eine Einwanderung aus Albanien in jüngerer Zeit hin, sondern auf die Flucht albanischer Vorfahren vor der türkischen Expansion in Richtung Adria im 14. und 15. Jahrhundert. Die Namen dokumentieren, was Italien seit dem Untergang des Römischen Reichs viele Jahrhunderte lang war: das Sehnsuchtsland für Siedler, Einwanderer und fremde Eroberer. Es ist leicht zugänglich, und sein Reichtum zieht nach wie vor Migranten an, auch wenn diese heute aus sehr viel weiter entfernten Ländern kommen. Im Jahr 2009 lebten in Italien über 600 000 Migranten aus Rumänien und eine Vielzahl von Marokkanern, Albanern, Chinesen, Südamerikanern und Schwarzafrikanern. Die toskanische Stadt Prato hat offiziell 10 000 chinesische Einwohner, inoffiziell sind es doppelt so viele.*10 Mit ihnen etablierte sich ein neuer Typus von Einwanderern: Prostituierte aus der Mandschurei, die ihren Konkurrentinnen in diesem Gewerbe, hauptsächlich Brasilianerinnen und Afrikanerinnen, den Rang ablaufen, weil sie billiger sind, zäher arbeiten und ihrer Tätigkeit auf Parkplätzen, in Gassen und öffentlichen Toiletten nachgehen. Viele Einwanderer kommen nicht deshalb illegal nach Italien, weil sie hier Kontakte oder gute Zukunftsaussichten hätten, sondern weil es einfacher zu erreichen ist als andere Länder.
Ehe wir dem französischen Historiker Lucien Febvre beipflichten, der die Frühgeschichte als Konzept ablehnt, sollten wir die Menschen des Mesolithikums betrachten, die um 10 000 v. Chr., nach dem Ende der letzten Eiszeit, auf der italienischen Halbinsel lebten. Das waren nomadische Jäger und Sammler, die Richtung Norden zogen, als sich das Klima erwärmte.
Um 7000 v. Chr., bevor Großbritannien eine Insel wurde, sickerten andere, neolithische Völker aus Südwestasien nach Europa ein. Aus dem Balkan kommend, erreichten sie Italien auf dem See- und Landweg und absorbierten auf ihrem Zug nach Westen die primitiveren Ureinwohner. Um 6000 v. Chr. erreichten sie Apulien, wenig später Kalabrien und Sizilien und schickten von dort Expeditionen nach Korsika und Sardinien. Sie scheinen einen unaufhaltsamen Drang nach Westen verspürt zu haben wie Tennysons Odysseus, dessen Ziel es war, »der Sonne Bad und aller Westgestirne zu übersegeln, und […] vielleicht […] auch sehn wir die glückseligen Inseln«.*11 Ihren Pioniergeist erklärt der Archäologe Barry Cunliffe mit »dem Wunsch zu sehen, was jenseits liegt, nach Westen geführt vielleicht von der Faszination der untergehenden Sonne«.*12
Die Völker der Jungsteinzeit, die sich um 4000 v. Chr. in Nordeuropa niederließen, unterschieden sich nur wenig voneinander. Sie rodeten das Land mit Steinäxten, bauten Weizen und Gerste an, züchteten Schafe, Rinder und Schweine und errichteten Häuser, statt in Höhlen zu leben. Die Unterschiede bildeten sich erst allmählich heraus – durch das Klima, die Vegetation und die natürlichen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen. Ohne Kupfer und Zinn zur Herstellung von Metalllegierungen hätte in Großbritannien und Irland die sogenannte Bronzezeit gar nicht erst ihren Anfang nehmen können. An den Küsten des Mittelmeers verwendeten die Menschen Olivenöl in der Küche und als Brennstoff für ihre Lampen. Weiter nördlich, wo Olivenbäume nicht gediehen, dienten tierische Fette als Nahrung und für die Herstellung von Talgkerzen.
Dieser Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden Europas reproduzierte sich auch in Italien – und er existiert bis heute: In der neapolitanischen Küche wird mit Olivenöl, in der piemontesischen mit Butter gekocht. Während Kastanien mit einem Nährwert etwa so hoch wie Weizen auf dem Speisezettel Süditaliens nicht vorkommen, waren sie im Nordwesten des Landes eine wichtige Nahrungsquelle. Dort brachten die Bäume reiche Ernte, und Brot aus Kastanienmehl war in den Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg ein Grundnahrungsmittel. Doch die Grenzen innerhalb Italiens verlaufen nicht nur zwischen Nord und Süd und zwischen Ost und West. Eine sehr präzise Trennungslinie bildet das zerklüftete Kalksteinmassiv des Apennin. Die jungsteinzeitlichen Siedler lebten von Anfang an in isolierten Territorien, was die Entstehung unterschiedlicher Sprachen und Kulturen und lokaler Sitten und Gebräuche begünstigte.
Um 700 v. Chr. wurden die verschiedenen Gruppen als eigenständige Einheiten erkannt und später von griechischen und römischen Autoren auch als solche benannt. Im Norden waren die Ligurer, Tauriner (die Urbevölkerung von Turin, dessen Symbol der Stier ist) und Veneter (die schon 1000 Jahre vor der Gründung Venedigs und der Erfindung von Gondeln als Krieger, Liebhaber rauschender Feste und Züchter von Zugpferden für Streitwagen bekannt waren). Der Zentralapennin wurde von Umbrern, Sabinern, Volskern und Samniten bewohnt, und in den Bergen weiter südlich lebten die Lukanier und die kalabrischen Bruttier. Die Adriaküste südlich der Territorien der Veneter war in die Siedlungsgebiete der Pikener, Daunier, Peuketier und Messapier aufgeteilt, und am Tyrrhenischen Meer lebten Etrusker, Latiner, Falisker und Kampanier. Als Letzte kamen griechische Kolonisten in den Süden. Hier herrschte eine ganz andere Situation als in Griechenland, dessen Bewohner alle dieselbe Sprache, wenn auch in verschiedenen Dialekten, sprachen und sich schon als »Griechen« betrachteten. In Italien dagegen wurden rund 40 Sprachen gesprochen, und die verschiedenen Gruppen sahen sich nicht als ein Volk, geschweige denn als Italiener.
Ein Volk, das sich besonders hervortat und neben den Griechen den höchsten Entwicklungsstand erreichte, waren die Etrusker. Sie lebten in Siedlungen auf Hügeln, zum Beispiel in Volterra, von wo aus sie sich Richtung Norden in die Poebene und Richtung Süden in die Bucht von Neapel ausbreiteten. In Lays of Ancient Rome beschreibt Thomas Babington Macaulay unter Berufung auf den antiken Historiker Livius den römischen Helden Horatius Cocles. Dieser verteidigte eine Brücke über den »Vater Tiber« gegen eine gewaltige etruskische Armee unter Führung von Lars Porsenna, König von Clusium, der »bei den neun Göttern« geschworen hatte, Rom zu erobern, um den Thron für den vertriebenen etruskischen König Tarquinius Superbus zurückzugewinnen. Er eroberte wohl tatsächlich die Stadt, unter deren Königen auch Etrusker waren. Zu diesem Zeitpunkt, um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr., besaß Rom keine eigene Identität, die es gegenüber seinen etruskischen und latinischen Nachbarn auszeichnete. Am Ende wurde Etrurien von den Römern besiegt und annektiert, aber seine Macht war schon zuvor von den Kelten, Griechen, Phöniziern und den Völkern im Landesinnern geschwächt worden.
Griechische Kolonien entstanden in Italien schon um die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. Die Euböer gründeten Cumae am westlichen Rand der Bucht von Neapel. Im Südosten Italiens (dem Landstrich, der nach dem entlaufenen Kalb Italia genannt wurde) siedelten die Achäer, die Ionier gingen in den Südwesten und ins nordöstliche Sizilien, die Dorer ins südliche Sizilien, und die Spartaner hatten eine Kolonie in Tarent, das den besten Hafen südlich von Neapel besaß. Sie alle gründeten Stadtstaaten (eine autonome polis mit einer Stadt und ihrem Hinterland), die wohlhabend und kultiviert waren und von sogenannten Tyrannen streng regiert wurden – eine unfaire Bezeichnung, weil das griechische tyrannos nichts anderes als Alleinherrscher bedeutete. Aus diesen Kolonien, den Vorläufern der Stadtstaaten des mittelalterlichen Italien, gingen Archimedes und Pythagoras hervor, aber nur wenige Demokraten und kein Herrscher, der fähig gewesen wäre, sich mit anderen gegen die Bedrohung von außen zusammenzuschließen.
Die Klassifizierung der übrigen Völker der Halbinsel hält wissenschaftlichen Kriterien nicht stand, nicht zuletzt weil ihre Sprachen innerhalb der italischen Sprachgruppe miteinander verwandt waren.4 Zu den Stämmen Apuliens zählten die Daunier, Peuketier und Messapier am Stiefelabsatz, doch diese Namen stammen von griechischen Autoren und wurden von ihren römischen Kollegen übernommen; die Völker selbst kannten diese Unterscheidungen wohl gar nicht. Auch können die Samniten, Stämme aus dem Molise, nicht streng von den verwandten Gruppen der Lukanier und Bruttier getrennt werden.
Die Bergvölker, so abgeschieden sie in ihren felsigen Enklaven verschanzt lebten, hatten freilich keine festen Siedlungen. Da kein Ort der Halbinsel weiter als 120 Kilometer vom Meer entfernt liegt, gab es seit jeher einen Austausch mit den Bewohnern der Küste – und den Neid auf deren Wohlstand. Seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. wanderten die Samniten in großen Gruppen vom Apennin nach Kampanien, wo sie der Herrschaft der Etrusker ein Ende setzten, und dann weiter in den Süden an die ionische und die tyrrhenische Küste – in das Gebiet von Magna Graecia, wo sie auf die griechischen Kolonien stießen. Eine ähnlich tiefgreifende Veränderung vollzog sich im Norden. Große Gruppen von Galliern (oder Kelten) kamen in immer neuen Wellen aus Südfrankreich über die Alpen, siedelten sich in der Poebene an und vertrieben die dort ansässigen Etrusker. Nach der Gründung von Mediolanum (Mailand) zogen sie durch Umbrien und Etrurien bis nach Rom, das sie im Jahr 390 v. Chr. plünderten. Die Vestalinnen – jungfräuliche Priesterinnen – mussten aus ihrem Tempel fliehen. Der Sage nach wurde der kapitolinische Hügel von den heiligen Gänsen gerettet, die bei der Ankunft der keltischen Eindringlinge anfingen zu schnattern und die Wachen weckten. Am Ende erhielten die Angreifer eine Art Schutzgeld und zogen ab. Erst 800 Jahre danach wurde Rom erneut geplündert.
Die sogenannte Romanisierung Italiens5 vollzog sich in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten im Eiltempo. Mit ihr erhielt die Halbinsel eine politische und kulturelle, aber keine ethnische Identität, die auch die Römer selbst gar nicht besaßen. Der Satirendichter Juvenal klagt sogar, die Hauptstadt mit ihren vielen griechischen und syrischen Bewohnern sei multiethnisch. In der Kaiserzeit zogen Millionen Menschen über die großen Straßen, um sich in Provinzen weit entfernt von ihrem Geburtsort niederzulassen oder dort angesiedelt zu werden. Doch in dem gesamten langen Zeitraum veränderte sich die ethnische Zusammensetzung Italiens nicht tiefgreifend, vom ständigen Zustrom ausländischer Sklaven einmal abgesehen. Die großen Umwälzungen vollzogen sich vor dem Aufstieg Roms und nach seinem Untergang.
Von großem Einfluss auf die ethnische Zusammensetzung Italiens waren die Barbareneinfälle, besonders die Invasion der Ostgoten, die Rom nach der Absetzung des letzten Kaisers im Jahr 476 n. Chr. beherrschten, und der gleichfalls germanischen Langobarden, die im nachfolgenden Jahrhundert über die Ostalpen kamen. 200 Jahre lang beherrschten die langobardi (»Langbärte«, die späteren Lombarden) weite Teile Italiens, bevor sie der fränkischen Armee unter Karl dem Großen, dem späteren Römischen Kaiser, unterlagen.
Im 9. Jahrhundert n. Chr. war Italien von unterschiedlichen Völkern besiedelt, deren Ursprünge im westlichen Asien, in Nordafrika sowie in Nord- und Osteuropa lagen. Ganz im Norden lebten hauptsächlich Langobarden und romanisierte Italiker, aber im Süden siedelten auch Araber, die in Bari ein kurzlebiges Emirat gründeten und Sizilien beherrschten, bevor sie von den Normannen verdrängt wurden. Hier lebten Griechen, die Nachkommen der Bewohner der Kolonien von Magna Graecia, und andere, die erst vor kurzem mit Verwaltungsaufgaben in den von Byzanz im 6. Jahrhundert eroberten Gebieten eingetroffen waren. Und schließlich gab es neben einer beträchtlichen jüdischen Bevölkerung kleinere Gruppen von Slawen, Armeniern und Berbern.
Alle späteren Eroberer italienischer Gebiete kamen in kleineren Gruppen, die sich hier ansiedelten, hauptsächlich Soldaten, Kaufleute und Beamte. Umfangreicher war die Zuwanderung von Albanern, die im späten Mittelalter entlang der Adriaküste und im kalabrischen Sila-Gebirge Dörfer gründeten, in denen Ende des 20. Jahrhunderts immer noch Arbëresh gesprochen wurde, ein unverfälschtes Albanisch.*13 Sie ließen sich auch in Sizilien nieder. Die Stadt Piana degli Albanesi südlich von Palermo feiert noch heute ein albanisches Dreikönigsfest mit farbenprächtigen Kostümen und griechisch-orthodoxen Riten. Berühmt für ihren Kampfgeist, dienten sie in den Armeen Neapels, Roms und schließlich Venedigs, einer wahrhaft»multikulturellen« und kosmopolitischen Stadt: Der Löwe von Sankt Markus beherrschte neben der albanischen Minderheit auch die Gemeinschaften der Griechen, Juden, Türken, Deutschen, Perser, Armenier und Slawen. Die Slawen, größtenteils aus Dalmatien stammend, gaben ihren Namen der Riva degli Schiavoni, dem längsten Kai Venedigs vor dem Dogenpalast, und der Scuola di San Giovanni degli Schiavoni mit Carpaccios berühmten Gemälden, die Episoden aus dem Leben der Heiligen Hieronymus, Georg und Augustinus zeigen.
Diese ethnische Vermischung, die sich über einen sehr langen Zeitraum vollzog und aus der die heutigen Italiener hervorgingen, bedeutet freilich nicht, dass sich alle ähneln. Niemand bestreitet, dass man Sarden sofort als solche identifizieren kann oder dass die Bewohner von Parma keine Ähnlichkeit mit denen Palermos haben. Aber wie groß die äußerlichen Unterschiede auch sein mögen, die ethnische Zugehörigkeit hat in der italienischen Geschichte nie eine große Rolle gespielt. Es gibt keine rein italienische Ethnie, und es hat nie eine gegeben. Die Argumente von Leuten, die das Gegenteil behaupten, in der Regel Faschisten oder Ultranationalisten, sind lächerlich, ebenso wie die Behauptung eines Lega-Nord-Funktionärs aus Venetien, die Lombarden seien Emporkömmlinge und stammten von den Kelten ab, während die Bevölkerung seiner Region ethnisch rein sei.*14 Der Wahrheit kam bereits im 19. Jahrhundert Cesare Balbo nahe, ein liberaler Denker des Risorgimento: Italien sei eine »multiethnische Gemeinschaft, bestehend aus aufeinanderfolgenden Einwandererwellen« mit »sehr gemischtem Blut« und »eine der eklektischsten Zivilisationen und Kulturen, die es jemals gab«.*15
mannen für stur und empfindsam, während die männliche Bevölkerung Perpignans vom Rest der Franzosen verlacht wird, weil sie den lieben langen Tag mit labbrigen Baskenmützen auf dem Kopf herumsitzt und Pastis trinkt oder unter Platanen Boule spielt und debattiert.*16 Auch die Italiener schreiben ihren Landsleuten gern stereotype Eigenschaften zu. So gilt ihnen das toskanische Temperament als eine Mischung aus Schläue, Skepsis, Individualismus, Unternehmergeist, Bedürfnislosigkeit, Aufrichtigkeit, gesundem Menschenverstand und Mäßigung in allen Dingen, besonders in Religion, Politik und Genüssen aller Art.*17
Aber auch Ausländer haben den Italienern immer wieder Etiketten aufgedrückt. Im Europa der Renaissance wurden im Ausland lebende italienische Kaufleute oft beneidet oder verachtet, besonders von den Polen, die sie als schwach und feminin einschätzten, als Laute spielende Romantiker, die Wein und Salat lieber mochten als Bier und Braten. Die Italiener stehen auch im Ruf, die schlechtesten Soldaten Europas zu sein. Als der Prätendent auf den englischen Thron, Charles Edward Stuart, genannt Bonnie Prince Charlie, in der Schlacht von Culloden die Flucht ergriff, beschwor Lord Elcho, der an seiner Seite gekämpft hatte, nicht die schottischen Vorfahren oder die polnische Mutter des Prinzen, sondern seine römische Kindheit und seine aus Modena stammende Großmutter, als er ihm nachrief: »Dann lauf doch weg, du verdammter feiger Italiener!« Den Italienern haftete das Image der Unmännlichkeit an, aber auch der Gewalttätigkeit, besonders im elisabethanischen Drama: stets bereit zum hinterhältigen Dolchstoß oder zum Giftmord. In John Websters Tragödien Der weiße Teufel und Die Herzogin von Malfi vergiften Italiener ihre Opfer auf vier verschiedene Arten.*18 200 Jahre später taucht bei Walter Scott eine Figur auf, die sich »wie ein feiger Italiener« verhält, als sie ihr »tödliches Stilett« zieht und ihrem Gegner ins Herz bohrt, statt sich »einem männlichen Gefecht zu stellen«.*19





























