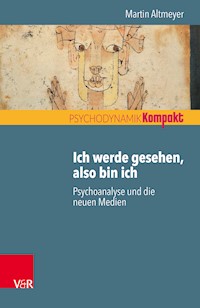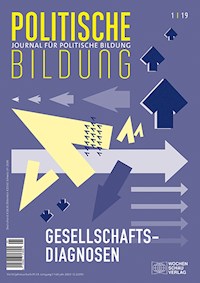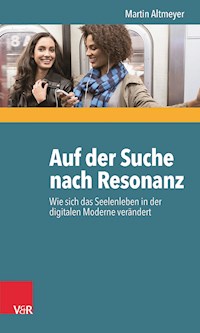
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Alltagsleben und die Mentalität wurden von der digitalen Moderne radikal umgekrempelt. Martin Altmeyer untersucht, wie in unseren modernen Kommunikationsgesellschaften psychosoziale Veränderungen erkennbar werden. Im Zeitalter des Internet scheint das Seelenleben vom Wunsch nach zwischenmenschlicher Kommunikation bestimmt, von einer Sehnsucht nach Spiegelung, nach einem Echo aus der Lebenswelt, vom Verlangen danach, von anderen Menschen gesehen und gehört zu werden. Unaufhörlich sind wir am twittern, chatten, mailen, bloggen, hashtaggen, googeln und downloaden. Wir posten und posen, was das Zeug hält. Wir stellen unsere Selfies ins Netz oder verschicken sie über soziale Medien. Eifrig füllen wir unsere Facebook-Seiten oder bedienen uns der Bildtechniken von Instagram. Begeistert schauen sich Jugendliche und Heranwachsende auf ihren Laptops TV-Casting- und Realityshows an oder nehmen selbst daran teil. Ständig schauen sie auf ihr Smartphone, um ja nicht die neueste SMS zu verpassen oder eine WhatsApp-Nachricht, die umgehend beantwortet wird. Warum tun wir das alles? Aus narzisstischen Motiven? Weil Aufmerksamkeitssucht und Kommunikationsgier uns dazu treiben? Weil wir manipuliert und medienabhängig gemacht werden, wie Zeitgeistkritiker gerne behaupten? Wir tun das aus einem elementaren Motiv: weil wir auf der Suche nach Umweltresonanz sind und weil die Befriedigung von Resonanzbedürfnissen identitätsstiftend wirkt – von Geburt an, ein Leben lang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Altmeyer
Auf der Suche nach Resonanz
Wie sich das Seelenleben in der digitalen Moderne verändert
2., unveränderte Auflage
Vandenhoeck & Ruprecht
In Erinnerung an Helmut Thomä
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99773-5
Umschlagabbildung: Women talking on subway© Dreampictures/Image Source RF/vario images
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Das Ende der Unsichtbarkeit
I – Identitätsspiele mit Kamera: Das moderne Selbst in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit
Kapitel 1 – Ein zeitgenössisches Gesellschaftsspiel: Der Massenwettbewerb um soziale Identität
Warum wir digitale Selbstporträts verschicken – die Blitzkarriere des Selfie · Wobei Menschen überall zuschauen sollen – kleines Panoptikum der Zeigelust · Wie auch die Kulturprominenz das mediale Identitätsspiel genießt – Sphären der gehobenen Aufmerksamkeitsökonomie
Kapitel 2 – Ein Blick hinter die Kulissen: Authentizität als Edelware der Medienwelt
Neugier – auf der Suche nach dem Menschen hinter der Medienfigur · Rätsel – die Botschaft des Mediums im submedialen Raum · Geheimnis – Exkurs über Realität in der Gegenwartskunst · Hoffnung – wer die Büchse der Pandora öffnet
Kapitel 3 – Der kategorische Imperativ der Mediengesellschaft: Ich werde gesehen, also bin ich!
Mentaler Kapitalismus – Bewirtschafte deine Persönlichkeit! · Demokratisierung des medialen Narzissmus – Die Kamera liebt dich! · Einladung auf die Schaubühnen der Lebenswelt – Zeig uns, wer du bist!
II – Big Brother als Big Mother: Die Lust an öffentlicher Selbstdarstellung
Kapitel 4 – Sichtbarkeit für alle: Das interaktive Fernsehen bittet auf die Schaubühnen der Lebenswelt
Ein Dreieck des Begehrens – das Medium zwischen Darsteller und Publikum · Der Untergang des Abendlandes – Kulturkritik im Modus des Ressentiments · Die Verteidigung eines Medienprivilegs – im Verachtungsdiskurs der Eliten
Kapitel 5 – Das Zwischenmenschliche wird interessant: Die soziale Dramaturgie von »Big Brother«
Beachtung oder Überwachung – ein Dilemma der neuen Medienwelt · Unverfälschtes Gruppenleben – eine Wohngemeinschaft unter Beobachtung · Die Geburt von Kultfiguren der Spaßgesellschaft – das Medium in Hebammenfunktion
Kapitel 6 – Ein echtes Abenteuer unter freiem Himmel: Der exotische Reiz des »Dschungelcamps«
Mediale Auffrischungskur unter Stress – Ich war mal ein Star, holt mich hier raus · Ausweitung der Zielgruppe – mit Alt-Achtundsechzigern das gebildete Publikum ködern · Bilanzen im Urwaldkampf – eine narzisstische Gewinn- und Verlustrechnung
III – Hoffen auf Umweltresonanz: Die unbewusste Kehrseite des Narzissmus
Kapitel 7 – Zwischen Innen und Außen: Die Scharnierfunktion des Unbewussten
Vom Trieb zur Beziehung – die relationale Wende der modernen Psychoanalyse · Das Unbewusste ist kein Rebell – sondern ein sozialer Konformist · Die vernetzte Seele – der entwicklungspsychologische Abschied von der Monadentheorie
Kapitel 8 – Im Spiegel des Anderen: Ein Beziehungsmodell des Narzissmus
Ich werde gesehen, also bin ich – eine moderne Identitätsformel · Zwischen Selbst und Welt vermitteln – die schöpferische Funktion des Narzissmus · Den Anderen betrachten, wie er mich betrachtet – die narzisstische Urszene
IV – Angreifen vor Publikum: Gewalt als demonstrative Machtinszenierung
Kapitel 9 – Morden im Rampenlicht: Ein grandioses Selbst läuft Amok
Das Phantasma von Unbesiegbarkeit und Unsterblichkeit – der Columbine-Effekt · Der Täter ist keine Marionette, an der andere ziehen – das Schulmassaker von Erfurt · Allmacht, Vorphantasie, Nachruhm – die performative Selbsterschaffung im Gewaltakt · Anpassungsverweigerung, Freiheitspathos, Mordlust – eine Blaupause sozialrebellischer Gewalt
Kapitel 10 – Weder von innen noch von außen: Vernichtungswut entsteht zwischen den Menschen
Eine fatale Beziehungsstörung – soziale Metamorphosen des Todestriebs · Ein großartiges Gefühl – von der Ursachenforschung zur Phänomenologie der Gewalt · Täter, Opfer, Publikum – zur Dreiecksstruktur zeitgenössischer Gewalt
Kapitel 11 – Die Krieger des Guten: Über das Töten im Namen höherer Moral
Gruppengewalt – wie unauffällige Menschen zu Massenmördern werden · Kunstwerke des Bösen – zur medialen Inszenierung des religiösen Terrors · Die Welt als Ganzheit – mentale Verwandtschaftsbeziehungen zwischen totalitären Massenbewegungen · Eine Kultur der Niederlage und die Figur des radikalen Verlierers
V – Verbindungen zur Welt knüpfen: Die zeitgenössische Psyche als soziale Netzwerkerin
Kapitel 12 – Die menschliche Seele: Ein kompliziertes Beziehungsorgan
Damit das Ich nicht aus der Welt fällt – die Integrationsaufgabe der Psyche · Soziale Resonanz – ein seelisches Bindemittel der ersten Stunde · Sichtbarkeit gegen Unsichtbarkeit – eine Paradoxie des Seelenlebens
Kapitel 13 – Strukturwandel der Öffentlichkeit: Die Flucht aus der sozialen Anonymität
Kolonialisierung oder Befreiung – die Modernisierung der Lebenswelt · Niedergang oder Fortschritt – wie das Neue verkannt wird · Zwang oder Lust – das Bedürfnis nach Selbstdarstellung · Entdeckung oder Erfindung – die Avantgarde der Internetpioniere
Kapitel 14 – Ein zeitgemäßer Persönlichkeitstyp: Das exzentrische Selbst als moderner Sozialcharakter
Eine Wende in der Generationendynamik – die Umkehrung des Ödipuskomplexes · Ein Ende des seelischen Heldentums – auf dem Weg zur postheroischen Persönlichkeit · Exzentrik im Profisport – Exkurs zur Modernisierung des Fußballs · Aus sich herausgehen – um der Welt zu zeigen, was in einem steckt
Literatur
Nachwort
Danksagung
Personenregister
Sachregister
Vorwort
Mit diesem Buch lege ich eine Zeitdiagnose der digitalen Moderne vor. Es enthält den ebenso anspruchsvollen wie riskanten Versuch, besser zu verstehen, worin eigentlich die enorme Anziehungskraft der interaktiven Medien besteht, darüber aufzuklären, wie das zeitgenössische Selbst die mediale Lebenswelt zu eigenen Zwecken nutzt, und schließlich zu untersuchen, was uns die besondere Art dieser Nutzung über die soziale Natur des Seelenlebens im Allgemeinen verrät.
Den unter kritischen Intellektuellen weit verbreiteten Manipulations- oder Pathologieverdacht gegenüber der medialisierten Gesellschaft teile ich nicht. Deshalb sammle ich dafür auch keine Beweise. Meine eigene Sicht ist vielmehr wohlwollend und meine Untersuchungsmethode eher der Ethnologie abgeschaut, die sich ihrem Gegenstand nicht aus einer urteilenden Position, sondern aus der einer teilnehmenden Beobachtung nähert. Dazu bedarf es freilich einer unvoreingenommenen, am Neuartigen, Ungewohnten und Befremdlichen interessierten Grundeinstellung, die im modernekritischen Ressentiment leicht verloren geht.
Dass die heutige Mediengesellschaft tatsächlich attraktiv ist, lässt sich schon an bloßen Zahlen ablesen. Drei Viertel der europäischen Privathaushalte verfügt bereits über einen Online-Anschluss, Tendenz steigend. Die mobile Verwendung des Internets über Smartphones und Tablet-Computer nimmt rapide zu, vor allem unter der Jugend, bei der auch das interaktive Fernsehen die höchsten Einschaltquoten erzielt. Die sozialen Netzwerke, die es überhaupt erst seit 2004 gibt, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Stellen wir uns nur einmal die Facebook-Gemeinde als eigene Gesellschaft vor: Mit zum Jahresende 2015 über 1,5 Milliarden Einwohnern wäre sie die größte Nation der Erde und mit einem weltweiten Durchschnittsalter von unter dreißig Jahren auch die jüngste.
Manche Modernekritiker sehen sich durch solche Zahlen geradezu bestätigt, belegen sie doch aus ihrer Sicht einen psychosozialen Verfall im Weltmaßstab. Darauf stützen sie ihre Zeitdiagnosen eines informationskapitalistischen Totalitarismus, ganz gleich ob sie das mit den begrifflichen Mitteln der Psychoanalyse, der Gesellschaftstheorie oder des Romans tun. Sie wollen eine totalitäre Entwicklung erkannt haben, der sich die narzisstisch bedürftigen Individuen auch noch widerstandslos auslieferten. Im Grunde suggerieren sie, dass die digitale eine mentale Revolution ist, die längst die Seelen erfasst hat. Ich glaube das übrigens auch. Nur halte ich das nicht für einen Prozess der Zersetzung, sondern der Öffnung: Die Mediengesellschaft verändert das Verhältnis von Innen- und Außenwelt, indem sie soziale und psychische Sperren beseitigt. Inwiefern und auf welche Weise erreicht sie das?
Die digitale Moderne macht es ihren Bewohnern einfacher, miteinander Verbindungen aufzunehmen und zu kommunizieren, sich füreinander zu öffnen, sich untereinander auszutauschen und voneinander Antworten zu bekommen. Damit trägt sie zur Befriedigung eines zwischenmenschlichen Grundbedürfnisses bei. Im zeittypischen Drang zur medialen Sichtbarkeit wird nämlich ein elementares Resonanzverlangen erkennbar, das zum sozialen Fundament der Conditio humana gehört und schon den Säugling mit seiner Umwelt verbindet. Selbstverständlich machen die neuen Medien die Menschen, die sich ihrer bedienen, nicht besser und die Gesellschaften, in denen sie leben, nicht humaner. Aber sie bilden ein historisch einzigartiges, allen zugängliches Resonanzsystem, unter dessen Spiegel-, Echo- und Verstärkerwirkungen sich die Menschen stärker aufeinander beziehen – im Guten wie im Bösen. Das ist der Kern der hier vorgelegten Zeitdiagnose.
Meine zeitdiagnostischen Kernbefunde werden in den fünf Teilen des Buchs Schritt für Schritt entfaltet, wobei der Fokus immer wieder anders eingestellt wird. Jeder einzelne Teil beginnt mit einer knappen Übersicht und besteht wiederum aus jeweils drei Kapiteln (Ausnahme Teil III: zwei Kapitel). Die Kapitel sind durchlaufend nummeriert.
Der erste Teil – »Identitätsspiele mit Kamera: Das moderne Selbst in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit« (S. 33 ff.) – enthält eine weit gefächerte Materialsammlung zur Suche nach Resonanzerfahrungen in der gegenwärtigen Lebenswelt. Zunächst wird der Massenwettbewerb um sozialen Identitätsgewinn als zeitgenössisches Gesellschaftsspiel behandelt, dessen jüngste, schlichteste, am weitesten verbreitete und am meisten beeindruckende Variante das Spiel mit dem Selfie ist. Anschließend werfe ich einen Blick hinter die medialen Kulissen, wo zunehmend Emotion, Verhalten und Persönlichkeit vermarktet werden und Authentizität als Edelware gilt. Am Ende wird der kategorische Imperativ der Mediengesellschaft benannt, der eine identitätsstiftende Urerfahrung des werdenden Selbst in sich aufnimmt: Ich werde gesehen, also bin ich! In dieser Eröffnung deute ich das Verlangen nach gesellschaftlicher Sichtbarkeit und Umweltresonanz als psychosoziales Bindemittel der digitalen Moderne.
Im zweiten Teil – »Big Brother als Big Mother: Die Lust an öffentlicher Selbstdarstellung« (S. 77 ff.) – werden zeittypische Sichtbarkeits- und Resonanzwünsche anhand des interaktiven Fernsehens analysiert, das sich im Übergang zum dritten Jahrtausend als weltweit erfolgreichste Sendeform etabliert hat (einmal abgesehen von Fußballübertragungen und selbst diese werden allmählich zu interaktiven Shows). Sämtliche Formate des Reality-TV lassen sich im Prinzip als Schaubühnen verstehen, auf denen sich jeder und jede einem Publikum präsentieren kann. Im Detail untersucht werden die quotenträchtigen, insbesondere bei der Jugend äußerst beliebten Realityshows »Big Brother« und »Dschungelcamp«, die beide das authentische Zusammenleben in der Gruppe zum Thema machen. Die soziale Dramaturgie solcher seriellen Shows setzt auf das Interesse von Teilnehmern, sich der Welt zu zeigen und von dort Rückmeldungen auf die eigene Darstellung zu bekommen, ein interaktives Interesse, mit dem sich die Zuschauer offensichtlich identifizieren.
Dieses Interaktionsmuster, das den neuen Medien eingeschrieben ist, wird im dritten Teil – »Hoffen auf Umweltresonanz: Die unbewusste Kehrseite des Narzissmus« (S. 101 ff.) – mit den Mitteln einer modernen Psychoanalyse untersucht, die dabei ist, vom klassischen Triebmodell zu einem Beziehungsmodell der Psyche überzugehen: Das individuelle Selbst ist stets auf die soziale Realität bezogen und auf Umweltresonanz angewiesen. Aus dieser relationalen, durch die Interaktionsbefunde der Säuglingsforschung gestützten Betrachtungsweise lässt sich zunächst das Unbewusste neu definieren, nämlich als angeborene Bestrebung des Selbst, Verbindungen mit der Umwelt herzustellen. Im Rahmen dieser Neudefinition erhält auch der Narzissmus eine ganz andere Bedeutung als in der klassischen Psychoanalyse: Er wird nicht länger als reine Selbstliebe verstanden, die den Anderen nicht braucht, sondern im Gegenteil als eine Beziehung zum eigenen Selbst, die unbewusst überhaupt erst im Spiegel des Anderen entsteht.
Im vierten Teil – »Angreifen vor Publikum: Gewalt als demonstrative Machtinszenierung« (S. 135 ff.) – zeige ich, dass ein intersubjektiv verstandener Narzissmusbegriff nicht nur zum generellen Verständnis der medialen Welt taugt, sondern insbesondere auch den Inszenierungscharakter barbarischer Gewaltakte, die vor Zuschauern stattfinden, aufklären hilft. Exemplarisch lässt sich aus Verlauf und Phänomenologie des Schulamoklaufs die grandiose Botschaft des mörderischen Gewaltakts herauslesen, der insgeheim auf einen entsetzten Dritten spekuliert, der bei der Demonstration der eigenen Allmacht zuschauen soll. Skizziert wird eine Interaktionstheorie menschlicher Destruktivität, die weder von innen noch von außen und auch nicht aus Fremdheit entsteht, sondern aus zu großer Nähe zwischen Menschen, die sich real oder imaginär aufeinander beziehen. Das erklärt auch die makabre Tötungslust bei den »Kriegern des Guten«, die ihre religiös oder weltanschaulich motivierten Massenmorde stets vor einem medialen Weltpublikum und im Namen einer höheren Moral begehen; die Vernichtung und Entwürdigung des Gegners dient zugleich der Erhöhung des eigenen Selbstbilds.
Im fünften und letzten Teil – »Verbindungen zur Welt knüpfen: Die zeitgenössische Psyche als soziale Netzwerkerin« (S. 185 ff.) – verdichte ich meine Befunde zu einer Zeitdiagnose, die von sozialanthropologischen Erkenntnissen der Humanwissenschaften ausgeht. Heute wissen wir, dass der Mensch kein Einzeller ist, der sich in einer abgegrenzten psychischen Realität bewegt, sondern von Geburt an ein soziales Wesen, das sich auf die äußere Realität und seine Mitmenschen bezieht; die Seele wird als ein komplexes Beziehungsorgan verstanden, das Selbst und Welt, Innen und Außen, Trieb und Kultur miteinander verbindet. Die digitale Moderne knüpft an den sozialen Netzwerkcharakter der Seele an. Die neuen Medien erzeugen einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, der auch Menschen, die nicht dem exklusiven Kreis der Reichen, der Schönen und der Bedeutenden angehören, die Flucht aus der Anonymität in die Sphäre sozialer Sichtbarkeit erlaubt. Die Chance auf mediale Spiegelung, auf ein Echo aus der Umwelt wird ausgiebig genutzt: Mit dem exzentrischen Selbst entwickelt sich ein moderner Persönlichkeitstyp, der auf der Suche nach sozialer Resonanz aus sich herausgeht, um sich und der Welt zu zeigen, was in ihm steckt – ganz gleich, was das ist.
Naturgemäß hatte die Kunst- und Literaturszene immer schon exzentrische Figuren angelockt. Einer der ersten literarischen Exzentriker war Heinrich von Kleist. Zu seiner Zeit ein Außenseiter der Literaturszene, gilt er heute als literarischer Erfinder des verunsicherten, zerrissenen, weltverlorenen Menschen in der beginnenden Moderne. Den seelisch gebrochenen Figuren seiner Theaterstücke und Novellen hat er ein verzweifeltes Bedürfnis nach sozialem Echo, nach Aufmerksamkeit und Anerkennung eingeschrieben. Das Käthchen von Heilbronn, die Marquise von O. oder Michael Kohlhaas – sie alle lassen sich von ihrem Schicksal keineswegs unterkriegen, sondern unternehmen etwas. Statt sich enttäuscht in sich selbst zurückzuziehen, gehen sie handelnd aus sich heraus und verlangen nach Resonanz.
Das gleiche Verlangen nach gesellschaftlicher Resonanz mag den zeitlebens verkannten Kleist im Alter von 34 Jahren getrieben haben, zusammen mit seiner Geliebten in Aufsehen erregender Weise Selbstmord zu begehen: Nach einem lukullischen Picknick am kleinen Berliner Wannsee erschießt er erst Henriette Vogel und dann sich selbst mit einer Pistole. In einem »Triumphgefühl«, wie es in seinen Abschiedsbriefen heißt, hinterlässt er der Nachwelt ein letztes Theaterstück, das bis heute in Erinnerung geblieben ist.
So herrscht im Werk, im Leben und im Tod von Heinrich von Kleist eine auffällige Exzentrik, die der Berliner Schauspieler Ulrich Matthes in einem Zeitungsinterview mit Uwe Ebbinghaus (2011) anlässlich des 200. Todestags des Dichters zu beschreiben versucht hat: »Immer wieder gibt es den Versuch bei ihm, sich in irgendeiner Weise mit dem, was innerlich in ihm brodelt, der Welt zu präsentieren, zu sagen: Schaut her, das bin ich, nehmt es wahr, reagiert darauf, ich biete es euch an«.
Was der für seine intensive Darstellungskunst zu Recht gerühmte und anerkannte Schauspieler im Dichter (wie in sich selbst) erkennt, ist ein dringendes Bedürfnis, das Innerste nach außen zu wenden, in der Hoffnung, von der sozialen Welt ein Höchstmaß an Resonanz und Spiegelung zu erhalten. Diese psychische Exzentrik scheint mir den Kern eines Persönlichkeitstyps zu bilden, den Kleist, seiner Zeit weit voraus, schon im frühen 19. Jahrhundert verkörpert hat. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert hat das Exzentrische den Durchbruch geschafft und ist zum Erkennungsmerkmal des modernen Sozialcharakters geworden.
Das ist die zeitdiagnostische Bilanz dieses Buchs: In der digitalen Moderne neigt das zeitgenössische Selbst stärker dazu, sich anderen Menschen zu zeigen, um besser wahrgenommen zu werden und mehr Beachtung zu finden, letzten Endes aber, um jene Resonanz zu erhalten, die es gerade in einer krisenhaft zusammenwachsenden, allseits vernetzten und nicht zuletzt deshalb beunruhigenden Welt für die eigene Selbstvergewisserung braucht.
Dieses Buch ist nicht erst beim Niederschreiben entstanden, sondern Ergebnis eines langjährigen Lern- und Forschungsprozesses mit dem Ziel, die zwischenmenschliche Natur des Seelenlebens zu begreifen. Seit der Millenniumswende habe ich in verschiedenen Vorträgen, Zeitungsbeiträgen, Fachaufsätzen und Buchveröffentlichungen untersucht, wie sich in der Mediengesellschaft mit der Modernisierung der Lebenswelt auch die Psyche modernisiert. All diese Untersuchungen sind in diesen Text eingeflossen und zu einer Gegenwartsdiagnose verbunden worden. Wer sich für die Quellen im Einzelnen interessiert, findet sie im Nachwort am Ende des Buchs.
Gewidmet habe ich das Buch der Erinnerung an Helmut Thomä, meinen langjährigen Gesprächspartner, Mitautor und Mitstreiter in Sachen Modernisierung der Psychoanalyse, der mir zu einem späten Freund geworden ist. 2013 ist er in hohem Alter gestorben; ich vermisse seine frühmorgendliche Anrufe. An Helmut habe ich immer die Chuzpe bewundert, mit der er die Aufklärungsfunktion einer wissenschaftlich fundierten Psychoanalyse gegen ihre fundamentalistische Versuchungen verteidigt hat. Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, dass die Intersubjektivität des Seelenlebens allmählich auch in Deutschland als Paradigma einer modernen psychoanalytischen Theorie und Praxis anerkannt wird. Die aus diesem Paradigmenwechsel erwachsene Erkenntnis, dass das Selbst unbewusst auf den Anderen bezogen, dass die Psyche mit der Lebenswelt aufs Engste vernetzt und dass das Internet als ein soziales Resonanzsystem zu verstehen ist, hat dieses Buch erst ermöglicht.
Martin Altmeyer
Einleitung:Das Ende der Unsichtbarkeit
What is the Self, anyway? It is the identifiable subject of a selfie.1
Jason Feifer, »The Essence of a Selfie« (2015)
Unaufhörlich sind die Menschen am twittern, chatten, mailen, bloggen, hashtaggen, googeln und downloaden. Sie posten und posen und stellen ihre Selfies ins Netz oder verschicken sie über soziale Medien. Eifrig füllen sie ihre Facebook-Seiten. Begeistert schauen sie sich auf ihren Laptops TV-Casting- und Realityshows an oder nehmen selbst daran teil. Ständig blicken sie auf ihr Smartphone, um ja nicht die neueste SMS zu verpassen oder eine WhatsApp-Nachricht, die umgehend beantwortet wird. Warum tun sie das alles, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, aber zunehmend auch ältere Menschen? Aus narzisstischen Motiven? Weil Aufmerksamkeitssucht, Kommunikationsgier und Medienabhängigkeit sie dazu treiben? Sie tun das, vermute ich, weil sie auf der Suche nach sozialer Resonanz sind. Das Seelenleben im digitalen Zeitalter scheint von einem Grundbedürfnis nach sozialem Kontakt durchdrungen, vom Wunsch nach zwischenmenschlicher Kommunikation, vom Verlangen danach, gesehen und gehört zu werden, von einer Sehnsucht nach Spiegelung, nach einem Echo aus der Lebenswelt.
Beginnen wir mit zwei Beobachtungen, die mich in dieser Vermutung bestätigen. Die erste ist eine Selbstbeobachtung und stammt von David Brooks, einem US-amerikanischen Journalisten. Er hat ein lesenswertes Buch darüber geschrieben, wie Beziehungen und Emotionen unser Leben bestimmen – »Das soziale Tier« (Brooks, 2012) – und ist Kulturkolumnist bei der liberalen »New York Times«. In einer seiner Zeitgeistkolumnen beschreibt er ein eigentümliches Lebensgefühl, das sich im gewohnheitsmäßigen Griff nach dem Handy äußert:
»Selbst während der kleinsten Pause im wirklichen Leben greifst du zu deinem Phone, um Nachrichten zu checken. Du spürst jene Phantomvibrationen selbst dann, wenn niemand dir textet. […] Online zu sein ist so, als ob man Teil der großartigsten Cocktailparty wäre, die jemals stattfände und nie zu Ende ginge. Wenn du eine E-Mail schreibst oder eine SMS, auf Facebook bist oder Instagram oder bloß den Links im Internet folgst, hast du Zugang zu einem ständig wechselnden Universum sozialer Kontaktoptionen. Es ist, als ob du in einem unendlichen Menschenpulk unterwegs bist, mit unmittelbarem Zugang zu Leuten, denen du in Wirklichkeit fast niemals begegnest. Online zu leben ist so herrlich, weil es Geselligkeit nahezu ohne Spannungen schafft. Du kannst Bonmots, Fotografien, Videos oder Zufallsmomente von Einsicht, Ermutigung, Solidarität oder gutem Willen mit anderen teilen. Du lebst in einem Zustand immerwährender Vorwegnahme, weil die nächste soziale Begegnung in der nächsten Sekunde ansteht. […] Diese Art der Interaktion fördert mentale Beweglichkeit. […] Diese schnelle, reibungslose Welt begünstigt die rasche Auffassungsgabe, die unmittelbare Einschätzung und den gekonnten Auftritt« (Brooks, 2015; eigene Übersetzung).
Das ist gut beobachtet. Die zweite Beobachtung ist erkenntnistheoretischer Natur und stammt von dem Philosophen Peter Bieri, der unter dem Pseudonym Pascal Mercier eine Reihe von interessanten Romanen veröffentlicht hat (unter anderem »Nachtzug nach Lissabon«; Mercier, 2004). Er befasst sich mit dem Problem der Selbsterkenntnis und fragt danach, wie wir erkennen, wer wir sind:
»Wohin können wir blicken? Nach innen, möchte man meinen. Doch es nützt nichts, die Augen zu schließen und sich zu konzentrieren. Es gibt kein inneres, geistiges Auge, das mit seinem unsinnlichen Blick die Konturen der Innenwelt erkunden könnte. Denn die Welt unserer Gedanken, Gefühle und Wünsche ist kein abgekapselter, selbstgenügsamer Bereich, der sich ohne Blick nach außen verstehen ließe. Wenn wir wissen wollen, was wir über eine Sache denken […], so müssen wir nicht nach innen blicken, sondern nach außen auf diese Sache. Wenn wir wissen möchten, was genau das Gefühl ist, das wir einer Person oder einem Ereignis entgegenbringen, so geht es darum, die Empfindung aus der Situation und ihrer Geschichte heraus zu verstehen. Nur so finden wir heraus, ob es sich um Wut oder Verachtung, um Liebe oder Bewunderung handelt. Und wenn wir wissen wollen, was unsere bestimmenden Wünsche sind, ist es manchmal nötig, uns selbst wie einem Fremden gegenüberzutreten und uns in unserem Tun wie von außen zu betrachten. Erst dann wird uns vielleicht klar, dass wir am liebsten allein leben möchten, im Verborgenen und nicht, wie wir dachten, im Rampenlicht« (Bieri, 2007).
Das Empfinden imaginärer Vergemeinschaftung, das Brooks an sich selbst beobachtet, und der Blick nach außen, den Bieri im Prozess der Identitätsfindung am Werk sieht, beides wird in diesem Buch zusammengebracht. Meine Hypothese lautet, dass die neue Medienwelt ein einzigartiges Kommunikationssystem darstellt, das soziale Sichtbarkeit anbietet und zur persönlichen Resonanzsuche geradezu einlädt. Von ihren Bewohnern wird diese suggestive Einladung bereitwillig angenommen. Nicht etwa deshalb, weil sie dazu genötigt, verführt oder manipuliert würden, sondern aus zutiefst menschlichen Gründen: weil Erfahrungen von Umweltresonanz zum Kern der Conditio humana gehören, weil Resonanzerfahrungen dieser Art der Stärkung eines Gefühls von Identität und Bedeutung dienen.
Mein Interesse gilt dem Zusammenspiel von Seelenleben und Lebenswelt in Zeiten des Informationskapitalismus: Wie eignen sich die Kinder der digitalen Moderne die Technokultur, in die sie hineinwachsen, seelisch an? Und was verrät uns die Art dieser Aneignung über die Verfassung der zeitgenössischen Psyche? Was den Leser und die Leserin erwartet, ist der Versuch einer psychoanalytischen Zeitdiagnose der digitalen Moderne. Um auf die Lektüre vorzubereiten, beantworte ich einleitend einige Fragen.
Sind die seelischen Wirkungen der digitalen Moderne bloß oberflächlicher Natur?
Die Moderne ist ständig in Bewegung. Rastlos dreht sie das Rad der Geschichte immer weiter. Unaufhaltsam treibt sie den Fortschritt voran. Andauernd verlangt sie nach Erneuerung. Seit dem 15. Jahrhundert, als sie sich allmählich aus dem Spätmittelalter zu entwickeln begann, besteht sie aus einer einzigen Folge von Entdeckungen, Erfindungen und Eroberungen und zugleich von entsprechenden Umbrüchen in den Selbst- und Weltbildern der menschlichen Gattung. Der technische, soziale und mentale Wandel ist geradezu das Markenzeichen der Moderne. Nachdem die Menschheit die frühe Moderne, die Hochmoderne, die Gegenmoderne, die Spät- oder Postmoderne und die zweite oder reflexive Moderne hinter sich gelassen hat, markiert der Millenniumswechsel erneut eine Zeitenwende. Heute reden wir vom Zeitalter der digitalen Moderne, das durch die rasante Entwicklung der neuen Medien im Übergang vom zweiten zum dritten Jahrtausend durchdrungen ist.
Gewöhnlich bezeichnen wir als digitale Moderne einen durch revolutionäre Entwicklungen in der Elektronik- und Computerindustrie hochgerüsteten Informationskapitalismus mitsamt seinem technologischen Arsenal. Letzten Endes sind es grandiose Ingenieursleistungen, denen wir all jene Produkte einer elektronischen Kommunikationsindustrie verdanken, die aus dem gewöhnlichen Alltagsleben nicht mehr wegzudenken sind: Personal Computer, Notebook, Laptop, Tablet, Smartphone – allesamt keine 25 Jahre alt. Die Herzkammer all dieser digitalen Technologien bildet das Internet, das weltweit in der Lage ist, alles mit allem, jeden mit jedem zu verbinden, und in seiner Qualität, Reichweite und Geschwindigkeit ständig optimiert wird. Um dieses Kraftzentrum herum haben sich Korrespondenzdienste für Text- wie Bildaustausch und Sozialmedien angesiedelt, die sich permanent ausdehnen und vermehren.
Die pragmatische Verwendung der neuen Medientechnologien ist den meisten Zeitgenossen längst in Fleisch und Blut übergegangen. Bereitwillig lernen sie die Wundergeräte mit den glatten Fassungen und durchgestylten Oberflächen zu bedienen, zumal diese mit jeder Innovation nicht nur schöner, sondern auch benutzerfreundlicher zu werden versprechen. Doch die mentale Anpassung an die neuen Medien geht über die Begeisterung an deren Ästhetik und die Freude am multimedialen Kompetenzerwerb weit hinaus. Die digitale Revolution reduziert sich keineswegs auf Fortschritte in den angewandten Informationswissenschaften, sondern reicht bis in die Tiefenstrukturen der Psyche.
Was für die industrielle Revolution galt, die im Fabrikzeitalter nicht nur die äußere, sondern auch die innere Welt veränderte, gilt für die digitale Revolution in noch stärkerem Maße. Die Veränderungen, die sie hervorgebracht hat, lassen sich nicht auf die rasanten Fortschritte in den angewandten Informationswissenschaften reduzieren. Sie erschöpfen sich keineswegs in einer revolutionären Medientechnologie und deren alltagspraktische Verwendung. Denn weit über den Zwang zum medialen Kompetenzerwerb hinaus haben wir uns auf die schöne neue Computerwelt mental eingestellt. Wir müssen nicht nur notgedrungen damit leben, sondern wir tun das gerne. Mit ihrem Angebot an universellen Wissensbeständen, schnellen Verbindungen und sozialen Vernetzungen verlockt und verführt sie uns geradezu. Aber worin genau besteht diese Faszination?
Gewiss werden Smartphones und Laptops auch benutzt, um Fakten und Wissen abzurufen, Termine zu vereinbaren, Einkäufe zu machen, Bestellungen aufzugeben, Bankgeschäfte zu erledigen, Wohnungen zu suchen, Autos zu mieten, Kinobesuche zu planen oder Reisen zu organisieren und einiges mehr. Die unbestreitbaren Vorteile, die mit der stetigen Ausdehnung der digitalen Kommunikationstechnologien verbunden sind und analogen Aufwand ersparen, werden von immer mehr Menschen genutzt. Solche medialen Angebote sind schon deshalb attraktiv, weil sie den persönlichen und beruflichen Alltag erleichtern, bei der Organisation des Soziallebens helfen, der Erweiterung des eigenen Horizonts dienen und für die Lebensgestaltung noch weitere nützliche Funktionen erfüllen, die wenig kosten. Aber das ist eben nicht alles.
Ausgiebig und intensiv nutzen die Menschen die zahlreichen Kommunikationskanäle, um sich darzustellen und sichtbar zu machen, mit anderen in Verbindung zu kommen und zu interagieren, Rückmeldungen zu erhalten und zu geben. Die psychische Anpassungsleistung, die die Bewohner der digitalen Moderne zu erbringen haben, ist anscheinend kein Akt der passiven und widerstrebenden Unterwerfung, sondern einer der aktiven und freiwilligen Aneignung: Endlich können sie sich zu Wort melden, ins Bild setzen und zeigen, wer sie sind. Wie sie das im Einzelnen bewerkstelligen und welche seelischen Rückwirkungen das hat, wird in diesem Buch untersucht.
Bildet sich in der modernen Kommunikationsgesellschaft ein neuer Persönlichkeitstyp?
Im Zentrum meiner Untersuchung steht die Frage, ob sich in der medienvermittelten Technokultur des 21. Jahrhunderts (Lemma, 2015) ein zeitgemäßer Sozialcharakter herausbildet, der die typischen Charakterformationen des 20. Jahrhunderts alt aussehen lässt. Dabei verzichte ich auf jene Pathologisierungen, wie sie in der Tradition gesellschaftskritischer Zeitdiagnosen üblich waren. Denn vom Vorherrschen psychopathologischer Störungsmuster ausgehend, dienten die klassischen Analysen des Sozialcharakters jeweils der Untermauerung einer bestimmten Sozialkritik – ganz gleich, ob sie nun dem Fin de Siècle die »Neurasthenie« (Radkau, 1998), der autoritären Gesellschaft den faschismusanfälligen »autoritären Charakter« (Horkheimer, 1936/2005; Adorno et al., 1973), einer Kultur der Selbstbezogenheit die »narzisstische Persönlichkeit« (Ziehe, 1978) oder einer von anonymen Machtdiskursen beherrschten Welt das »subjektlose Subjekt« (Foucault, 1982/2007) zuordneten.
Im Gegensatz zu solchen Diagnosen einer Individual- und Sozialpathologie erkläre ich weder die moderne Kommunikationsgesellschaft für krank und behandlungsbedürftig noch die Individuen, die in ihr leben. Auch die These einer »Kolonialisierung der Lebenswelt« (Habermas, 1981) durch moderne Systemimperative wird hier nicht fortgeschrieben. Die digitale Moderne kolonisiert die Menschen nicht, sie verbindet sie miteinander. Meine eigene Haltung zur Medialisierung des Alltagslebens ist wohlwollend-interessiert, jener von Freud empfohlenen Grundeinstellung einer gleich schwebenden Aufmerksamkeit vergleichbar, die von Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen ihren Patienten gegenüber wie selbstverständlich eingenommen wird, gegenüber den kulturellen Phänomenen der Medienwelt aber häufig schwer fällt.
So hat beispielsweise Christopher Bollas (2015) – in einem der Hauptvorträge beim Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, der 2015 unter dem Motto »Psychoanalysis in a Changing World« stattfand – die digitale Moderne als »age of bewilderment« tituliert, was man als Zeitalter der Verwirrung, des Durcheinanders oder der Verwilderung übersetzen kann. Der Welt der neuen Medien hat er ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Durch den »Horizontalismus« der Netzwerkgesellschaft gehe Denk- und Gefühlstiefe verloren: Alles sei nur noch bezogen, ohne Essenz. Mit ihrer Tendenz zur »Homogenisierung« entwerte sie die Bedeutung von Differenz: Alle seien gleich, alles sei gleich wichtig. Die ihr unterworfenen Individuen flüchteten sich in »Pseudo-Dummheit«: Symptomatisch dafür sei die verkürzte Twitter-Sprache. Die Menschen seien infiziert durch eine oberflächliche »Sightophilia«: Eine unbändige Lust am Sehen und Gesehenwerden hätte die Fähigkeit zur inneren Einsicht zersetzt. Unter Verweis auf entsprechende Erfahrungen mit jüngeren Patienten, deren niedriges Bildungsniveau, eingeschränkte Reflexionsfähigkeit und restringierte Sprachcodes er bemängelt, prognostiziert Bollas allen Ernstes den drohenden »Subjektizid« (subjecticide): Wenn eine angewandte Psychoanalyse mit psychotherapeutischen und kulturkritischen Mitteln diesen digitalen »Mord am Subjekt« schon nicht verhindern könne, müsse sie wenigstens Widerstand leisten.
Solche Unheilsprognosen, in denen sich eine apokalyptische Weltsicht mit der grandiosen Selbstsicht einer helfenden Profession mischen, liegen mir fern. Die hier vorgelegte Zeitdiagnose, die methodisch aus der psychoanalytisch-kulturanthropologischen Perspektive teilnehmender Beobachtung entstanden ist, wird dagegen eher beschreibend als kritisch, eher wohlwollend als skeptisch, eher verständnisvoll als anklagend ausfallen. Wer nach empirischen und epidemiologischen Daten verlangt, wird sie in den umfangreichen Studien finden, die der Entwicklungspsychologe Martin Dornes in seinen beiden Büchern zur mentalen Verfassung moderner Kommunikationsgesellschaften – »Modernisierung der Seele« (2012) und »Macht der Kapitalismus depressiv?« (2016) – zusammengetragen hat.
In seiner Metaanalyse kommt Dornes zu einer insgesamt positiven Bewertung des psychischen Strukturwandels im informationskapitalistischen Zeitalter. Der »postheroischen Persönlichkeit« (Dornes, 2012), so nennt Dornes den zeitgenössischen Sozialcharakter, bescheinigt er freilich eine ambivalente Struktur: Die typische Persönlichkeitsstruktur der Gegenwart sei im Vergleich zu früheren Epochen offener, durchlässiger, flexibler, lebendiger und reichhaltiger geworden, weniger starr, weniger zwanghaft und weniger eingeschränkt, aber auch, womöglich aus denselben Gründen, sensibler, labiler und störungsanfälliger.
Diese innere Ambivalenz – übrigens generell ein Kennzeichen der Moderne, wie Zygmunt Bauman in »Moderne und Ambivalenz« (2005; vgl. auch Bauman, 2003) gezeigt hat – gehört vielleicht zum seelischen Preis einer sexuellen, moralischen und kulturellen Liberalisierung, der freilich mit den psychischen Kosten zu verrechnen ist, die durch die Liberalisierung eingespart werden. Denn gerade jene Charakterpanzerung, die in vorliberalen Gesellschaften durch Verdrängung, Verleugnung und Unterdrückung von Bedürfnissen entstanden war, musste teuer bezahlt werden.
Die zeitdiagnostische Bewertung von psychosozialen Veränderungen ist stets eine Frage der eigenen Perspektive und Einstellung. Ich selbst stehe der digitalen Moderne offen, jedoch nicht indifferent gegenüber. Was für die Technologie generell gilt, hat auch für die Medientechnologie Geltung. Sie ist an sich weder gut noch böse, aber auch nicht neutral (vgl. Kranzberg, 1986). Insofern bin ich weder Digitalutopist noch Digitalpessimist, sondern interessiert und neugierig auf das Neue, das sich in den medienvermittelten Formen von Individuierung und Vergesellschaftung andeutet.
Das Verlangen nach sozialer Resonanz ist beileibe kein Kunstprodukt der Medienwelt, was manche ihrer Kritiker behaupten. Es handelt sich vielmehr um ein menschliches Grundbedürfnis, das am Beginn jeder seelischen Entwicklung steht, wie uns die Säuglingsforschung lehrt. Von Geburt an verlangt der Säugling nach Umweltantworten. Er tut das mit all seinen Sinnen. Er schaut, er hört, er tastet, er greift und er riecht buchstäblich in seine Umwelt hinein. In der Erwartung, Reaktionen zu bekommen, versucht er ständig, Kommunikationen zu initiieren, Affekte und Kognitionen auszutauschen, Menschen in seinem Blickfeld zu animieren – bis er müde wird und sich in den Schlaf, den Traum oder die eigene Phantasiewelt zurückzieht. Aber selbst dann ist der Säugling nicht einsam, sondern in einem Zustand des »Alleineseins in Gegenwart eines Anderen« (Winnicott, 1974), einer Seelenverfassung, die sich von der Einsamkeit dadurch unterscheidet, dass er sich nicht von der umgebenden Welt verlassen, sondern aufgehoben und in sie eingebettet fühlt.
Menschen brauchen Umweltresonanz nicht zuletzt deshalb, um ihr Selbst- und Sicherheitsgefühl zu regulieren, um zu erfahren, wer sie sind. Weit über Kindheit, Pubertät und Adoleszenz hinaus bleibt der Niederschlag frühkindlicher Resonanzerfahrungen im Seelenleben des Einzelnen virulent, bis ins hohe Alter hinein. Genau das macht die Attraktivität der digitalen Moderne aus: dass sie an solchen, im impliziten Gedächtnis aufbewahrten Spiegel- und Echoerfahrungen andocken kann. Für diese These wird das Buch Evidenzen und Begründungen liefern.
Oder verursacht der technologische Totalitarismus der digitalen Moderne einen psychosozialen Verfallsprozess?
Mit der Annahme, dass die digitale Moderne ein soziales Resonanzsystem zur Befriedigung zwischenmenschlicher Echo- und Spiegelungsbedürfnisse bietet, setze ich mich einerseits von futuristischen Cyborgvisionen ab, andererseits aber auch von einer radikalen Modernekritik, die Endzeitstimmung verbreitet, und einen »digitalen Totalitarismus« heraufziehen sieht. »Big Data« heißt das Codewort für die angebliche Herrschaft einer dubiosen Koalition aus privaten Internetkonzernen und staatlichen Geheimdiensten, welche die Menschheit bedroht.
Einer der internationalen Wortführer des modernekritischen Kulturpessimismus ist Evgeny Morozov, der mit zahlreichen Blogs, Zeitungsaufsätzen und Vorträgen einen intellektuellen Feldzug gegen den Informationskapitalismus führt. Insbesondere attackiert er mit der Idee des Teilens ein Schlüsselkonzept der digitalen Ökonomie. Jede praktische Anwendung des »Sharing«-Gedankens – und sei sie noch so einleuchtend wie das Teilen der eigenen Wohnung oder des eigenen Autos – entlarvt er als infamen Trick der Computerindustrie zum Zwecke weiterer Ausspähung, sozialer Kontrolle und kapitalistischer Profitmacherei. Morozovs Buch »Smarte neue Welt« (2013) erinnert schon im Titel an die »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley (1932/1953), der in seinem berühmten Roman aus dem Jahr 1932 – dem Vorjahr der faschistischen Machtübernahme in Deutschland – das Schreckensbild einer totalitären Gesellschaft entworfen hatte.
Auf Morozovs »antitotalitäre« Abrechnung mit der digitalen Moderne beruft sich auch Jonathan Franzen in seinem Gegenwartsroman »Unschuld« (2015), nur dass er das Internetzeitalter nicht mit dem Nationalsozialismus, sondern mit dem DDR-Sozialismus vergleicht. Andreas Wolf, eine seiner als Sprachrohr des Autors benutzten Romanfiguren und fiktiver Neffe von Markus Wolf, dem Leiter des DDR-Auslandsspionage, lässt er entsprechende Parallelen ziehen: »Ersetzte man Sozialismus durch Netzwerke, hatte man das Internet« (Franzen, 2015, S. 662). Um ihn wenig später nachtragen zu lassen: »Wie die alten Politbüros stellte sich auch das Neue als Feind der Elite und Freund der Massen dar, darauf aus, den Konsumenten zu geben, was sie haben wollen« (Franzen, 2015, S. 664). Die »Echokammer des Internet«, meint der Autor – im Interview mit der Überschrift »Das ist alles sehr deutsch« – sei aber nicht nur totalitär, sondern gleichzeitig »so ziemlich das größte Instrument zur Förderung von Narzissmus, das je gebaut wurde« (zit. n. von Lovenberg, 2015).
Im Diskurs des kulturellen und seelischen Niedergangs mischt die deutsche Intellektuellenszene kräftig mit. In einem einschlägigen Sammelband spricht Frank Schirrmacher (2015) vom »technologischen Totalitarismus«. Botho Strauß (2013a) beschwört die »Bakterienschwärme neuer Medien«. Hans Magnus Enzensberger beklagt die »Fallgruben der Digitalisierung« (2014). Harald Welzer warnt vor der »Totalisierungsfalle des Informationszeitalters«, in der die digitale Medienwelt eine Jugend gefangen halte, die zur Verteidigung ihrer »Autonomie« nicht mehr bereit oder in der Lage sei (Pauen u. Welzer, 2015). Byung-Chul Han erkennt im zeitdiagnostischen Zweijahresrhythmus nacheinander eine erschöpfte »Müdigkeitsgesellschaft« (Han, 2010), eine manipulative »Transparenzgesellschaft« (Han, 2012) und schließlich eine Gesellschaft neoliberaler »Psychopolitik« (Han, 2014), in der die klassisch-kapitalistische Fremdausbeutung durch informationskapitalistische Selbstausbeutung ersetzt, der Einzelne gar »zum Geschlechtsteil des Kapitals« gemacht werde.
In seinem Ressentiment gegen die gleichmacherische Moderne verfolgt auch Peter Sloterdijk jene »schrecklichen Kinder der Neuzeit« (2014), die seit der französischen Revolution »das Glück der Privilegierten« hassten und durch die Wechselfälle der Geschichte hindurch in den Computerkids ihre zeitgemäßen Avatare gefunden hätten. Aber ist die Generation der »Millennials« – der um die Jahrtausendwende geborenen »digital natives« – wirklich so schrecklich oder zeugt Sloterdijks Attacke nur vom Schrecken eines geistesaristokratischen Autors, der seine publizistischen Privilegien gefährdet sieht, wo jetzt auch Herr Hinz und Frau Kunz sich zu allem Möglichen zu Wort melden dürfen?
Als ob die Zeit anzuhalten wäre, predigen Intellektuelle von links bis rechts digitale Enthaltsamkeit: Werft eure Handys weg! Kappt eure Internetzugänge! Meidet die sozialen Netzwerke! Solche Parolen verraten freilich mehr über die inneren Dämonen der Modernekritiker als über die Medienwelt, die sie dämonisieren. Frei von jeder Ironie fordern sie die Jugend zum strategischen Rückzug aus der digitalisierten Gegenwartskultur auf, in einer Kombination von Selbstgerechtigkeit und moralischer Emphase, die wir bisher nur von den Weltreligionen kannten in ihrem fundamentalistischen Widerstand gegen die kulturelle Moderne – die Gleichstellung der Frau, die sexuelle Freizügigkeit, die Zulassung der Homosexuellen-Ehe, die intellektuelle Flachheit sowie weitere Schritte ins sittliche Verderben.
In ihrem entsetzten Blick auf die Gegenwart ähneln die Fortschrittskritiker dem »Angelus Novus« von Paul Klee, jenen Unheil verkündenden Engel, der sein Gesicht bekanntlich der Vergangenheit zuwendet. In seinem marxistisch inspirierten Messianismus hat Walter Benjamin diesen »Engel der Geschichte« schon 1940 als Seher der kommenden Katastrophe gedeutet:
»Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm« (Benjamin, 1940/1974, S. 697 f.).
Was bewegt die neuen Modernekritiker und wie kann man ihnen antworten?
Im digitalen Zeitalter hat der Wettbewerb um katastrophische Deutungshoheit unterschiedliche Pathologiediagnosen hervorgebracht, von denen drei gegenwärtig um die zeitdiagnostische Diskursführerschaft streiten:
1.Die erste und älteste war die Zeitdiagnose einer Kultur des wachsenden Narzissmus im morbiden Spätkapitalismus (ausgehend von Lasch, 1979/1995): Ein sozialisierter Narzissmus mit der ihm eigenen Selbstbezogenheit, Beziehungsunfähigkeit und Verantwortungslosigkeit sorge letztlich dafür, dass die Individuen im Strudel ihrer endemischen Egomanie zunehmend vereinsamen – um am Ende in den sozialen Medien vergeblich nach Ersatzbefriedigungen und Surrogatbeziehungen zu fahnden.
2.Es folgte die Zeitdiagnose eines allgemeinen Erschöpfungszustands, der eigentlich nur ein gesellschaftliches Unbehagen zum Ausdruck bringe (zuerst vorgelegt von Ehrenberg, 2008, 2011): Mit ihrem psychisch nicht zu verkraftenden Überschuss an Inszenierungsangeboten, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungszwängen treibe die Multioptionsgesellschaft die Menschen in die Depression, der typischen Zeiterkrankung; das Selbst erlebe sich chronisch als überfordert und unzulänglich – um sein Versagen schließlich in manischen Versuchen der Selbstoptimierung abzuwehren, in depressiven Selbstvorwürfen zu bewältigen oder in Alkohol, Drogen und anderen Süchten wie Arbeits-, Vergnügungs- und Mediensucht zu ertränken.
3.Breite Zustimmung gewann zuletzt die Zeitdiagnose einer rasenden Beschleunigung im Turbokapitalismus (vor allem vertreten von Rosa, 2005, 2011, 2013; dagegen Reiche, 2011): Das Bewegungstempo der neoliberalen Konkurrenzgesellschaft mit ihren rasenden Taktfolgen, unendlichen Bilderfluten und wachsenden Flexibilitätsanforderungen erzeuge eine kulturelle Akzeleration, welche bereits die psychische Strukturbildung bei Kindern und Jugendlichen unterminiere – und diese zur heillosen Flucht in die Oberflächen einer virtuellen Medienwelt treibe, während die Erwachsenen sich zunehmend in Burnout-Erkrankungen flüchteten.
Im Unterschied zum Pessimismus dieser Art von Zeit- und Gesellschaftskritik komme ich zu einer sozialdiagnostisch wie individualpsychologisch optimistischen Einschätzung der digitalen Moderne. Potenziell haben die neuen Medien eine demokratiefördernde Wirkung, weil sie der Mehrheit der Menschen ungehinderten Zugang zur Öffentlichkeit gewähren, der ihnen früher verwehrt geblieben war; sie bieten Foren, auf denen Ansichten über Gott und die Welt vorgetragen und diskutiert werden können. Sie haben eine kulturell stimulierende Wirkung, weil sie den Nutzern nicht nur einen nahezu ungehinderten Zugang zu Werken der Kunst, der Literatur, der Architektur, der Fotografie, der Archäologie, der Musik, des Theaters und des Films gestatten, sondern auch kreative Selbsttätigkeit erlauben. Sie haben eine sozial integrative Wirkung, weil sie den zwischenmenschlichen Austausch erleichtern, weil sie Kommunikationswege einfacher, schneller und unaufwändiger machen, weil sie zum Teilen von Informationen, Produkten und Ansichten ermuntern. Und nicht zuletzt haben sie eine psychisch befreiende Wirkung, weil sie jenem menschlichen Grundbedürfnis nach einem sozialen Widerhall entgegenkommt, das die apokalyptischen Reiter der Modernekritik übersehen, ein universelles, in jedem Einzelnen angelegtes Verlangen nach Umweltresonanz, das Gegenstand der folgenden Untersuchung ist.
Nicht zufällig hat die computerisierte Welt ihre historischen und kulturellen Wurzeln in der kalifornischen Hippie- und Alternativszene des Silicon Valley. Dort jedenfalls, wo sie sich frei entfalten konnte, hat sie zur Entwicklung außerordentlich vitaler und offener Kommunikationsgesellschaften beigetragen, die ihren Mitgliedern weniger überflüssige Zwänge emotionaler, sozialer und moralischer Natur auferlegt, dafür aber mehr Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Ausdrucksbereitschaft abverlangt, auch wenn diese Entwicklung ihre dunklen Kehrseiten hat.
Denn zweifellos gibt die digitale Moderne, wie alles, was neu in die Welt kommt und deshalb ungewohnt, unvertraut oder unverstanden ist, auch Anlass zur Beunruhigung. Selbstverständlich kann eine unvernünftige Nutzung der neuen Medien schaden, wenn man sich etwa pausenlos im Internet bewegt oder in den sozialen Netzwerken unterwegs ist oder suchtartig am Smartphone hängt. Auch sind User, die gewohnheitsmäßig Gewalt- oder Pornografieseiten anklicken, in Videospielen die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit aus dem Blick verlieren oder sich offen, meist aber im Schutz der Anonymität an Hasstiraden im Netz beteiligen, keine angenehmen Zeitgenossen. Ebenfalls auf der Schattenseite der digitalen Medienwelt liegen etwa Pop-up-Werbung, Fake-Identitäten oder Online-Betrug, ganz zu schweigen vom regen Gebrauch, den rechts- und linksradikale Gruppierungen, religiöse Terrororganisationen, Sektenprediger, Organhändler, Menschenschmuggler, homophobe Eiferer, Verschwörungstheoretiker, Judenhasser und Holocaust-Leugner, Besucher kinderpornografischer Tauschbörsen oder Mitglieder von Verbrecherringen von der neuen Kommunikationstechnologie machen.
Das alles sind höchst problematische Folge- und Begleiterscheinungen einer digitalen Moderne, die die Menschen nicht besser macht oder schlechter, sondern nur neue Lebens- und Entwicklungsbedingungen schafft. Man muss sehr ernst nehmen, was sich im Schatten des Internets an Bösartigem, Verabscheungswürdigem und Verachtenswertem entwickelt. Aber es sind Randphänomene, die eine mitunter überscharfe Modernekritik gern ins Zentrum rückt. Ihr scheint das Vertrauen in die technische Intelligenz, das soziale Gespür, die moralische Integrität und die praktische Lernfähigkeit einer Jugend zu fehlen, die in die Mediengesellschaft hinein gewachsen, mit ihr groß geworden und auch in der Lage ist, sie zu gestalten. Wie jede neue Generation eignen sich auch die Kinder der digitalen Moderne ihre Welt auf eigene Weise an, mit all den Chancen und Optionen, den Risiken und Gefahren, den Überraschungen und Abenteuern, die diese zu bieten hat.
Wie lassen sich Veränderungen im zeitgenössischen Seelenleben erkennen?
In die Psyche kann niemand hineinschauen. Manche Neurobiologen glauben das zwar, doch in ihrem Naturalismus verwechseln sie die Seele mit dem Gehirn. Sogar manche Psychoanalytiker glauben das, auch wenn sie das Gehirnscanning durch Introspektion ersetzen wollen; aber das ist ebenfalls ein Irrtum. Wenn dem zeitgenössischen Seelenleben also weder auf dem objektiven Weg neurowissenschaftlichen Wissens noch auf dem subjektiven Weg spekulativer Innenschau auf die Spur zu kommen ist, wie sonst?
Die innere Beschaffenheit der Psyche können wir nur aus ihren Äußerungen erschließen. Was Menschen denken, fühlen, wünschen, glauben, hoffen oder fürchten, wie sie andere Menschen und sich selbst sehen, lässt sich bloß im genauen Blick auf die Beziehung erkennen, die sie zwischen sich und ihrer Lebenswelt herstellen. Dazu aber müssen wir die soziale Oberfläche des Seelenlebens ergründen, die psychoanalytisch allzu lange missachtet worden ist. Die Psychoanalyse »hat das Graben in der Tiefe übertrieben«, meint Sudhir Kakar, ein indischer Psychoanalytiker und Kulturvermittler, doch »im Fluss des Lebens fließt alles mehr oder weniger weit oben. Die allertiefste Tiefe ist eine Illusion« (zit. n. von Thadden, 2005).
In diesem Buch folge ich erkenntnistheoretisch einer »flachen Ontologie« (vgl. Krämer, 2001). Im Gegensatz zur Tiefenontologie der klassischen Psychoanalyse verzichtet diese auf die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung, Tiefe und Oberfläche. Sie nimmt die Dinge, wie sie sind, ohne »dahinter« oder »darunter« etwas anderes zu vermuten. Letzten Endes sind wir das, was wir tun und lassen. Wir sind, was und wie wir reden. Wir sind was und wie wir wahrnehmen, denken und empfinden. Daraus folgt jedoch keineswegs, Tiefe oder Essenz überhaupt zu bestreiten. Eine flache Ontologie bedeutet lediglich, das Wesen der Dinge in den Erscheinungen zu erfassen, die Tiefe an der Oberfläche selbst zu suchen, genau hinzuschauen und aufmerksam zu registrieren, was dort passiert. Erst wenn wir eine horizontale Perspektive einnehmen, und das heißt: die Beziehungsoberflächen und Oberflächenphänomene würdigen, versetzen wir uns in die Lage, die soziale Struktur unserer Sprache, die intersubjektive Struktur unserer Lebenswelt, die Beziehungsstruktur der menschlichen Psyche zu entdecken.
Im mäandernden Fluss des digitalen Lebens enthüllt die zeitgenössische Psyche, was sie in früheren Zeiten gern und erfolgreich verhüllt hat (oder mangels entsprechender Bühnen weniger zeigen konnte): dass Menschen keine Monaden, sondern aufeinander bezogen sind; dass Individuen nicht autonom, sondern voneinander abhängig sind; dass persönliche Identität nicht von innen entsteht, sondern auf Umweltresonanz angewiesen ist. Das mag für den Einzelnen kränkend sein, erklärt jedoch zugleich die Attraktivität der Medienwelt als eines einzigartigen Resonanzsystems, das der sozialen Vergewisserung der eigenen Existenz dient. Offenbar ist es der digitalen Moderne gelungen, eine entwicklungspsychologische Identitätsformel mit einer medialen Identitätsformel zu kombinieren: »Ich werde gesehen, also bin ich!«.
________________
1»Was ist das Selbst überhaupt? Es ist das erkennbare Subjekt eines Selfie« (eigene Übersetzung).
IIdentitätsspiele mit Kamera: Das moderne Selbst in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit
Niemand kann alleine spielen, sagte ich. Selbst wenn niemand anderes im Zimmer ist, muss ein imaginärer
Anderer da sein (S. 324).
Die Griechen wussten, dass die Maske im Theater keine Verkleidung ist, sondern ein Mittel der Enthüllung (S. 85).
Ist es nicht das, was ich will? Schaut meine Arbeit an.
Schaut und seht. Wie soll man leben? In der Welt oder in einer Welt im Kopf? Außen gesehen und anerkannt werden oder sich innen verstecken und denken?
Als Schauspielerin oder Einsiedlerin (S. 293)?
Aus den Notizbüchern von Harriet Burden, der Hauptfigur im Roman von Siri Hustvedt »Die gleißende Welt« (2015).Weil die fiktive Künstlerin als Frau in der Kunstwelt zu wenig Beachtung fand, ließ sie in ihrem feministischen Enthüllungsprojekt »Maskierungen« die eigene Kunst von verschiedenen Männern unter deren Maske und Namen ausstellen – zunächst mit Erfolg.
Vieles spricht dafür, dass sich in den liberalisierten Gesellschaften des Westens neben dem sozialen und kulturellen Wandel auch ein psychischer Wandel vollzieht. Identität ist das seelische Hauptproblem unserer Zeit, nicht mehr Sexualität. Sämtliche Zeitdiagnosen, ganz gleich ob epidemiologischer, entwicklungspsychologischer, sexualmedizinischer, sozialwissenschaftlicher oder familiensoziologischer Provenienz, teilen miteinander diesen Kernbefund. Es scheint so, als ob das Leiden am Selbst jenes Leiden am Trieb ersetzt hätte, mit dem das Ich in der sexualfeindlichen Kultur zu Freuds Zeit noch beschäftigt war. Heute quält sich der Einzelne mit anderen Fragen herum: Wer bin ich? Wohin soll ich mich entwickeln? Was ist mein Platz in der Welt? Wer sind meine Freunde? Wo finde ich Beachtung? Woher bekomme ich Anerkennung? Wie erhalte ich Resonanz? Weil die innerseelischen Konflikte weniger um die Befriedigung sexueller Wünsche als um die Beziehung des eigenen Selbst zur sozialen Umwelt kreisen, beginnt Freuds Triebmodell der Identitätsbildung zu veralten. Nicht mehr Triebschicksale, sondern Beziehungsschicksale begleiten die Entwicklung der modernen Persönlichkeit. Alter Gewissheiten beraubt sendet der Einzelne Botschaften aus, die der eigenen Selbstvergewisserung dienen, adressiert an einen Anderen, der statt als Objekt des sexuellen Begehrens eher als Spiegel des eigenen Selbst Bedeutung erhält. Es sind stumme Resonanzerwartungen, unausgesprochene Forderungen eines Selbst, das nach Antworten aus der Umwelt verlangt. Im Unbewussten jedenfalls wird der Andere als jemand gebraucht, der irgendwie reagieren soll. Erst seine Reaktionen verschaffen dem Selbst nämlich jene identitätsstiftende Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung, die es um seiner persönlichen wie sozialen Existenz willen dringend benötigt. Diese Art von Identitätssuche steht im Zentrum eines medialen Gesellschaftsspiels, das in der globalisierten Kommunikationsgesellschaft an Bedeutung gewinnt (Kapitel 1, S. 37 ff.). Ein Blick hinter die Kulissen der Medienwelt zeigt, dass bei diesem Spiel das Authentische gesucht wird, das so schwer zu finden und deshalb so kostbar ist (Kapitel 2, S. 52 ff.). Wer dabei mitmacht, darf sich zeigen und dem kategorischen Imperativ der digitalen Moderne folgen: Ich werde gesehen, also bin ich! (Kapitel 3, S. 67 ff.).
Kapitel 1Ein zeitgenössisches Gesellschaftsspiel: Der Massenwettbewerb um soziale Identität
Warum wir digitale Selbstporträts verschicken – die Blitzkarriere des Selfie
Auf Selfies sehen wir Menschen, wie sie sich selbst sehen oder gern sehen möchten. So scheint es zumindest. Aber die digitalen Selbstporträts sind nicht fürs eigene Fotoalbum bestimmt, sondern für Freunde, Bekannte und den Rest der Welt. Sie folgen einer Logik der Selbstinszenierung, die stets auf ein Echo aus der Umwelt hofft. In Wahrheit zeigen Selfies – gern auch Doppel- oder Gruppenselfie mit Prominenz –, wie ihre Produzenten von anderen Menschen gesehen werden möchten. Sie werden ins Internet gestellt oder per SMS, Facebook oder Instagram verschickt, um potenzielle Betrachter zu interessieren. Insgeheim zielt das per Smartphone in Sekundenschnelle aufgenommene, mit zwei, drei Clicks in die digitale Welt übertragene Selbstbild auf soziale Resonanz. Mit dem Selfie ruft der Einzelne der Welt zu: Schaut her! Hier bin ich! So bin ich! Was haltet ihr davon? Wie findet ihr mich? Antwortet mir!
Mit solchen Botschaften steht das Selfie indes nicht allein. Zum gleichen Genre gehören auch andere Produkte jener neuen »Ökonomie der Aufmerksamkeit« (Franck, 1998), die sich bereits im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts herausgebildet, aber erst im 21. Jahrhundert richtig Fahrt aufgenommen hat und auf deren Märkten bekanntlich Selbstdarstellung gegen Beachtung getauscht wird. Dazu zählen unter anderem
•der weltweit boomende Körperkult, vom Workout oder Bodybuilding über die Tattoo- und Piercingmode bis zur schönheitschirurgischen Körpermodifikation; indem es seinen Körper gestaltet und ausstellt, spekuliert das an seiner Optimierung arbeitende Selbst insgeheim auf den virtuellen Blick des Anderen.
•das ebenso globalisierte Mitmachfernsehen mit seinen zahllosen Talk-, Quiz-, Game-, Koch-, Casting-, Doku- und Realityshows oder wie sie alle heißen; wie schon der Name sagt, sind derartige Shows ein einziges Angebot an das bedürftige Selbst, sich zu zeigen (to show: zeigen), um in der Welt Beachtung zu finden.
•die sozialen Netzwerke,