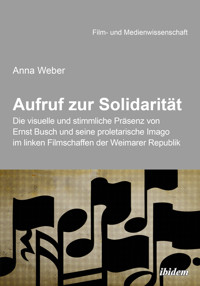
Aufruf zur Solidarität: Die visuelle und stimmliche Präsenz von Ernst Busch und seine proletarische Imago im linken Filmschaffen der Weimarer Republik E-Book
Anna Weber
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Film- und Medienwissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ernst Busch war bereits zu Lebzeiten ein Idol der deutschen Linken. Er galt als Ikone, Choleriker und Querulant. Er war Werftarbeiter, Sänger und Schauspieler. Während sich in der bereits zum Scheitern verurteilten Weimarer Republik politisch linke und rechte Kräfte zu einem bedrohlichen Kräftemessen aufwiegelten, stellte er sich lautstark und unüberhörbar auf die Seite der Linken. Verschiedene, vorwiegend linke Filmschaffende holten den Schauspieler und Sänger an ihr Set, um seine Popularität und Authentizität für die Aussagekraft ihrer Filme zu nutzen, unter ihnen Victor Trivas für Niemandsland (1931) und Bertolt Brecht für Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt (1931/1932). Anna Weber leistet einen wertvollen Beitrag zum Diskurs über den frühen Tonfilm, indem sie den Fokus von den berühmten sogenannten Tonfilmoperetten der 1930er-Jahre auf das engagierte, politisch linke Filmschaffen lenkt, das die betonte Selbstreflexivität und Selbstreferenzialität dieses Genres zugunsten sozialer und emanzipatorischer Themen sowie politischer Einflussnahme zu überwinden suchte. Sie zeichnet die mediale Konstellation zu Beginn der Tonfilmperiode nach und arbeitet heraus, wie Victor Trivas und Bertolt Brecht die proletarische Imago sowie die stimmliche und visuelle Präsenz Ernst Buschs in ihren Regiekonzepten aufgriffen und als Anknüpfungspunkt zur Alltagsrealität des Publikums nutzten. Die Analyse der Filme setzt Weber in eine Verbindung zur zeitgenössischen Debatte zwischen Bertolt Brecht und Georg Lukács, indem sie Niemandsland in die Nähe der ästhetischen Ideen von Lukács rückt, während Kuhle Wampe als Modellfall für das filmästhetische Konzept Brechts steht. Weber nimmt eine neuartige und erhellende Perspektive ein auf eine bislang zu wenig beachtete, aber äußerst bemerkenswerte Strömung innerhalb des Weimarer Kinos zu einer politisch hochbrisanten Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Teil 1: Die Grundlagen
2.1 Der selbstreflexive Beginn des Tonfilms
3. Die Imago Ernst Buschs
Teil 2: Zwei Fallstudien
5. Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt?
6. Es geht um den Realismus: Niemandsland, Kuhle Wampe und die Brecht-Lukács-Debatte
7. Schlusswort
Epilog
8. Literaturverzeichnis
9. Filmverzeichnis
10. Anhang
Zensurunterlagen der Film-Oberprüfstelle
Film- und Medienwissenschaft
Impressum
1. Einleitung
Ernst Busch war zu dieser Zeit das Idol der Linken. [...]
Das Publikum war verrückt nach ihm. Er stand da, hochelegant,
mit einer Hand in der Tasche, und sang mit lauter Stimme
ganz ohne Mikrofon. Das hatte Stil.
(Gad Granach, zit. in Voit 2010, 31)
Ernst Busch (1900–1980) war bereits zu Lebzeiten eine politische Leitfigur. Er galt als Ikone, Choleriker und Querulant. Er war Werftarbeiter, Sänger und Schauspieler. Während sich in der bereits zum Scheitern verurteilten Weimarer Republik politisch linke und rechte Kräfte zu einem bedrohlichen Kräftemessen aufwiegelten, stellte er sich lautstark und unüberhörbar auf die Seite der Linken. Busch war in jenen Jahren in Berlin als Theater- und Filmschauspieler sowie als Sänger im Kabarett und auf politischen Veranstaltungen berühmt. Er und der Musiker und Komponist Hanns Eisler ergänzten sich zu einem publikumswirksamen und gemeinschaftsformenden Gespann. Verschiedene, vorwiegend linke Filmschaffende holten den Schauspieler und Sänger an ihr Set, um seine Popularität und Authentizität für die Aussagekraft ihrer Filme zu nutzen. In dieser Studie soll dem Phänomen Ernst Busch und seiner Bedeutung für das linke Filmschaffen der Weimarer Republik nachgespürt und damit ein Beitrag zur Diskussion um den frühen Tonfilm geleistet werden.
Die Zeit der Weimarer Republik lässt sich auf den Tag genau eingrenzen. Sie begann am 9. November 1918 mit der Ausrufung der Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann und endete am 30. Januar 1933 mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Spricht man vom Tonfilm der Weimarer Republik, ist dieser folglich auf wenig mehr als drei Jahre zwischen der Einführung des Tonfilms (als technische Realität in den Kinos) ab Ende 1929 und dem Ende der Republik Anfang 1933 begrenzt. Für das linke Filmschaffen sind vor allem die Jahre 1931 und 1932 von Bedeutung. Zum einen war die Umstellung auf den Tonfilm in Deutschland erst 1931 soweit abgeschlossen, dass alle täglich spielenden Filmtheater entsprechend umgerüstet waren, es gab also eine relativ lange Umstellungszeit vom Stumm- zum Tonfilm (vgl. Korte 1998, 91). Zum anderen verhinderte die verschärfte politische Situation und Zensurpraxis während der Zeit der Notverordnungen bereits im Verlauf des Jahres 1932 die Herstellung und Auswertung politisch linksgerichteter Filme (vgl. Korte 1998, 265).
Busch wirkte in der Weimarer Republik an einem Dutzend Tonfilmen mit. Die Durchsicht des Filmmaterials zeigt eine Gemeinsamkeit seiner Mitarbeit auf: Die visuelle und die stimmliche Präsenz Ernst Buschs verleiht den Filmen einen appellativen Charakter. Ob er in KUHLE WAMPE das „Solidaritätslied“ singt oder in NIEMANDSLAND mit Blick in die Kamera fordert „Komm, Kamerad. Jetzt machen wir Schluss“ – als Symbolfigur und Signalstimme der Arbeiterbewegung schafft er eine direkte Verbindung zum Publikum. Diese Wirkung kommt einerseits durch den Einbezug der zu dieser Zeit populären Arbeiterlieder zustande, andererseits ist Ernst Buschs proletarische Imago, das heißt, das Vorstellungsbild, das das Publikum mit seiner Erscheinung verbindet, von Bedeutung. Um dieses Phänomen zu erklären, wird in dieser Studie dargelegt, aus welchen Komponenten sich dieses Bild zusammensetzt. Es gilt zu bedenken, dass sich Buschs Imago schon vor seinen Filmrollen in Theater, Kabarett und durch Gesangsauftritte geformt hatte. Das linke Weimarer Kino suchte insbesondere deshalb eine Zusammenarbeit mit Ernst Busch, um die politische Aussagekraft der Filme und die Wirkung auf das Publikum zu verstärken.
Es ist interessant, dass die Filme eine unterschiedliche Ästhetik aufweisen. Diese Differenziertheit wird vor allem am – hier detailliert anzustellenden – Vergleich von NIEMANDSLAND (DE 1931, Victor Trivas) und KUHLE WAMPE ODER WEM GEHÖRT DIE WELT? (DE 1932, Slatan Dudow, Bertolt Brecht u.a.) deutlich. Bertolt Brecht prägte trotz der Arbeit im Kollektiv KUHLE WAMPE wesentlich, NIEMANDSLAND hingegen lässt sich sowohl der Brechtschen als auch der Lukácsschen Ästhetik zuordnen.
Zwischen Bertolt Brecht und Georg Lukács entstand in den 1930er Jahren eine Debatte um den Realismusbegriff in der marxistischen Ästhetik. Sie drehte sich um die Frage, wie der politischen Aufgabe der Kunst, der Vermittlung der „objektiven Wahrheit“ durch die künstlerische Bearbeitung des Abbilds, nachzukommen sei. Während Brecht in der Literatur, auf der Bühne und im Film mit modernen Stilmitteln experimentierte, orientierte sich Lukács an der Tradition der aristotelischen Dramentheorie und am kritischen Realismus des 19. Jahrhunderts. In den linken Filmen jener Zeit manifestieren sich ähnliche Differenzen: KUHLE WAMPE weist Elemente des epischen Theaters auf, NIEMANDSLAND dagegen erinnert an die Realismustheorie von Lukács. Beide wirkungsästhetischen Ansätze verlangen unterschiedliche Herangehensweisen an die formale Gestaltung: Während sich Brecht in KUHLE WAMPE durch distanzierende Verfahren an ein aktiv partizipierendes Publikum wendet, legt Trivas in der Unterstandssequenz von NIEMANDSLAND den Fokus auf die Entwicklung der Figuren und das Mitgefühl des Publikums. Diese Prämissen bestimmen sowohl die Art und Weise, wie die Arbeiterlieder in den Film einbezogen werden, als auch die Darstellung der Figuren. Dennoch arbeiteten sowohl der Regisseur Victor Trivas als auch das Produktionskollektiv um Slatan Dudow, Bertolt Brecht und Hanns Eisler mit Ernst Busch zusammen. Es stellt sich also die Frage: Inwiefern ist die Präsenz Buschs beiden Filmen trotz ihrer gegensätzlichen ästhetischen Ansprüche dienlich?
Am Beispiel von NIEMANDSLAND wird aufgezeigt, dass die Arbeiterlieder, die Hanns Eisler in die Filmmusik integriert hat und die von Ernst Busch gesungen werden, den an der Oberfläche allgemein pazifistisch gehaltenen Film durch das Wecken von Assoziationen an die politisch brisante Alltagsrealität des Publikums anbinden. Die Darstellung des deutschen Soldaten Emil Köhler durch Busch lässt die Entwicklung der Figur vom Kleinbürger zum Revolutionär aufgrund der kämpferischen Imago des Schauspielers besonders glaubwürdig erscheinen. Das gemeinsame Aufbrechen der ehemals feindlichen Soldaten aus dem Unterstand und das Niederreißen eines Stacheldrahtverhaus versinnbildlichen den Solidaritätsgedanken, der im Film entwickelt und vermittelt wird.
In KUHLE WAMPE hingegen verkörpert Ernst Busch mit dem Automechaniker Fritz eine Figur, die den politischen Bestrebungen der revolutionären Linken eher teilnahmslos gegenübersteht. Bertolt Brecht besetzt diese Figur gegen die Erwartungen des Publikums. Der Widerspruch zwischen der politisch indifferenten Rolle und der starken, proletarischen Imago Ernst Buschs lässt sich als Bestandteil der Brechtschen Verfremdungsverfahren interpretieren. In diesem Film wird das „Solidaritätslied“ in vielfältiger Form wiedergegeben, unter anderem in der Interpretation von Ernst Busch. Dadurch kommt diesem Song eine Sonderstellung zu: Er verbindet die Massenwirkung des Tonfilms als neues Medium mit derjenigen des Massengesangs zu einem eindringlichen politischen Appell.
Die Forderung nach Solidarität und einem internationalen sowie parteiübergreifenden Zusammenschluss der Linken erlangte zum Ende der Weimarer Republik angesichts des aggressiven Faschismus äußerste Dringlichkeit. Dieser Diskurs fand hier Eingang ins Weimarer Kino. Die Rolle, die Ernst Busch dabei spielte, ist Gegenstand dieser Studie.
Teil 1: Die Grundlagen
Da es bisher kein vergleichbares Forschungsprojekt gibt, sollen im ersten Teil dieser Studie die Grundlagen dargelegt werden, auf denen die beiden Filmanalysen aufbauen. Zunächst wird ein Einblick in den aktuellen Diskurs zum Medienumbruch vom Stummfilm zum Tonfilm gegeben. Zentral ist hier die Frage nach dem Verhältnis des Tonfilms zur außerfilmischen Realität sowie die Bedeutung, die Musik und Gesang in diesem Kontext besitzen. Dann wird die proletarische Imago Ernst Buschs rekonstruiert, die für eine Einschätzung der Bedeutung seiner visuellen und stimmlichen Präsenz in den zu analysierenden Filmen elementar ist.
2. Der frühe Tonfilm der Weimarer Republik
Die ganze Welt spricht von dem schweigenden Gegenstand,
der sprechen gelernt hat.
(Eisenstein et al. 2014 [1928], 54)
Das Kino des Übergangs vom Stummfilm zum Tonfilm blieb in der deutschen Filmgeschichtsschreibung lange nahezu unerforscht, obwohl es das Medium Film fundamental umgestaltete und damals so breit wie kontrovers diskutiert wurde. Der Grund dafür sind sowohl inhaltliche als auch ästhetische Vorbehalte gegenüber dem frühen Tonfilm, der in den Krisenjahren der Weimarer Republik an der Schwelle zum so genannten Dritten Reich seinen Durchbruch hatte.
Eine Ursache für dieses Schattendasein sieht die Filmhistorikerin Corinna Müller in der einflussreichen Studie Von Caligari bis Hitler von Siegfried Kracauer, die nachhaltig den Film der späten Weimarer Republik als Ausdruck präfaschistischer Strukturen und Wegbereiter des Nationalsozialismus demontierte (vgl. Müller 2003b, 9). Der deutsche Filmsoziologe verließ Berlin 1933 und veröffentlichte in den USA die Studie, in der er Merkmale der Mentalität der deutschen Gesellschaft darzulegen suchte, die den Nährboden für die faschistische Ideologie bereitet und dem Faschismus schließlich zum Durchbruch verholfen hätten. Diese „psychischen Dispositionen“ manifestierten sich – so Kracauers These – im Weimarer Kino:
Da die Deutschen auf politischer Ebene gegen Hitler waren, muss ihre seltsame Bereitwilligkeit, den Naziglauben anzunehmen, ihren Ursprung in psychischen Dispositionen haben, die stärker als alle ideologischen Skrupel waren. Die Filme der vorhitlerischen Zeit sind für sie psychologische Situation durchaus erhellend (Kracauer 2012 [1979], 246).
Ein gutes Beispiel für Kracauers Argumentation bietet seine Lesart von Robert Wienes DAS CABINET DES DR. CALIGARI (DE 1920). Die changierende Erzählkonstruktion des Filmes mit einer Rahmen- und einer Binnenhandlung lässt verschiedene Deutungen zu. Während in der Binnenhandlung die Figur des Caligari als der „Wahnsinnige“ gilt, werden die Vorzeichen in der Rahmenhandlung umgedreht: Im Setting einer psychiatrischen Anstalt erscheint Caligari als Arzt und damit als die „Autorität“. In dieser Umkehrung sieht Kracauer einen Ausdruck der gesellschaftlichen Stimmung: „Denn während die ursprüngliche Geschichte ja gerade den aller Autorität innewohnenden Wahnsinn blosslegen wollte, verherrlichte Wienes Fassung diese Autorität und überführte ihren Gegenspieler des Wahnsinns.“ (Kracauer 1958, 43) Diese Interpretation der Erzählkonstruktion legt Kracauers Argumentation offen: Die als autoritätskritisch gelesene Binnenhandlung werde bewusst durch die Rahmenhandlung in das Gegenteil verkehrt und damit zum Ausdruck einer Art kollektiven „Autoritätssehnsucht“ zur Zeit der Weimarer Republik. Auf diese Art und Weise erkennt Kracauer in zahlreichen Produktionen des Weimarer Kinos die präfaschistischen Anlagen, die sich seiner Meinung nach in der deutschen Mentalität jener Zeit finden ließen und im populären Film zum Ausdruck gekommen seien.
In der neueren Filmgeschichtsschreibung wird eine solche einseitig ideologiekritische Interpretation des Weimarer Kinos problematisiert. Der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser beispielsweise diskutiert in seinem Buch Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig Kracauers Studie und weist auf die selektive Auswahl der Filmbeispiele hin (vgl. Elsaesser 1999, 35f.). So vernachlässigt Kracauer eine angemessene Betrachtung des durchaus engagierten linken Filmschaffens und stellt stattdessen eine Überzahl an Filmen vor, in denen er die Empfänglichkeit der deutschen Gesellschaft für faschistisches Gedankengut nachzuweisen glaubt.
Der beschriebene Einfluss von Kracauers Analysen auf den filmwissenschaftlichen Diskurs wurde dadurch verschärft, dass erst im Jahr 1979 im Suhrkamp Verlag unter dem Titel Von Caligari zu Hitler eine vollständige deutsche Übersetzung des Buches herausgegeben wurde. Die stark gekürzte Fassung, die 1958 im Rowohlt Verlag erschienen ist, verstärkte das Ungleichgewicht zwischen präfaschistisch und antifaschistisch interpretierten Filmen zusätzlich, da bedeutende Teile der Argumentation fehlten. Diese Problematik zeigt Kracauers Besprechung von KUHLE WAMPE beispielhaft auf. Zu diesem Film, der die solidarische Organisation der jungen Arbeiterbewegung zeigt, steht in beiden Ausgaben: „Obwohl die radikale Haltung zweifellos echt war, fehlte es ihr auf politischer Ebene an Erfahrung und Fingerspitzengefühl.“ (Kracauer 1958, 161, vgl. auch Kracauer 2012 [1979], 296) Die Erläuterungen zu diesem Einwand unterschlägt die Rowohlt-Ausgabe. Der Filmsoziologe führte sein Argument jedoch weiter aus:
Der schwerste Fehler, der in KUHLE WAMPE begangen wird, ist sein massiver Angriff auf die kleinbürgerliche Mentalität der alten Arbeiter [...]. Zu einer Zeit, als die Naziherrschaft in ganz Deutschland spürbar drohte, wäre es eine bessere Strategie gewesen, die Solidarität der Arbeitermassen zu betonen, anstatt große Teile von ihnen zu kritisieren (Kracauer 2012 [1979], 296).
Trotz der deutlichen Kritik belegt dieser Kommentar eine differenzierte Beschäftigung mit den politisch linken Tendenzen des Weimarer Kinos. Dennoch schädigte die in viele Sprachen übersetzte Studie nachhaltig die Reputation, die das deutsche Kino zur Zeit der Weimarer Republik in Europa, Russland und den USA „als Modell einer ästhetisch und oft auch politisch progressiven Filmpraxis genossen hatte“ (Elsaesser 1999, 27).
Ein weiterer Grund für die Geringschätzung des frühen deutschen Tonfilms liegt in filmästhetischen Bedenken. Lange Zeit galt der Übergang zum Tonfilm als ästhetischer Rückschritt, da die synchrone Tonaufnahme den Schnittexperimenten und die schwere Verkleidung der lärmenden Kameras den Freiheiten der „entfesselten“ Kamera technische Grenzen gesetzt habe. Die neuere Filmgeschichtsschreibung steht den ästhetischen Entwicklungen aufgeschlossener gegenüber. Corinna Müller zeigt in ihren Beispielanalysen auf, mit welcher „Schnelligkeit und Findigkeit deutsche Tonfilme die ihnen angeblich von der schwerfälligen Tonfilmtechnik aufgezwungene ästhetische Lähmung überwanden“ (Müller 2003b, 20). Anhand der Filme ZWEI HERZEN IM ¾ TAKT (DE 1930, Géza von Bolváry), DIE DREI VON DER TANKSTELLE (DE 1930, Wilhelm Thiele) und DER SOHN DER WEISSEN BERGE (DE 1930, Luis Trenker, Mario Bonnard) entkräftet sie die „noch immer virulenten Gerüchte über die technisch bedingten Begrenzungen des frühen Tonfilms“ (Müller 2003b, 21).
In den letzten zwanzig Jahren wurden nicht nur die ästhetischen Ausformungen, sondern auch die inhaltlichen Schwerpunkte des frühen deutschen Tonfilms einer neuen, vorurteilsfreien Betrachtung unterzogen. Besondere Beachtung gilt den so genannten „Tonfilmoperetten“ und musikalischen Tonfilmkomödien, die während der frühen 1930er Jahre quantitativ die deutsche Filmproduktion dominierten. Mehrere Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker haben einen breiten autothematischen und selbstreflexiven Diskurs innerhalb dieser Genres herausgearbeitet. Beispiele sind die Artikel „Wie im Kino!“ von Jörg Schweinitz und „Tonfilm: Neuer Realismus?“ von Corinna Müller, die 2003 im Sammelband Diesseits der „Dämonischen Leinwand“ – neue Perspektiven auf das späte Weimarer Kino herausgegeben wurden, sowie Müllers Monographie Vom Stummfilm zum Tonfilm, die im selben Jahr erschienen ist. Thomas Elsaessers Buch Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig (1999) nähert sich dem frühen Tonfilm ebenfalls mit neuen Thesen und Argumenten. Diese Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit einem Kino, das sich so spielerisch wie einfallsreich mit den Möglichkeiten des neuen Mediums und dem Verhältnis des Tonfilms zur Alltagsrealität auseinandersetzt. Sie bilden den aktuellen Forschungsstand zum Weimarer Kino am Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm und damit die Grundlage dieser Studie.
Ein genauer Blick auf den Diskurs um die Relation zwischen Film und Wirklichkeit lohnt sich für die anstehende Analyse: Die These besagt, dass der Schritt von der Filmhandlung in die Alltagsrealität in NIEMANDSLAND und in KUHLE WAMPE durch den Einbezug von Ernst Busch als Darsteller und als Sänger begünstigt wurde. Die folgenden Kapitel werden aufzeigen, dass der Realitätsbezug keineswegs im Wesen des Tonfilms liegt. Um beim Publikum eine Assoziation zwischen Filmhandlung und Alltagsrealität hervorzurufen, mussten Strategien entwickelt werden. Der Diskurs, der mit den Begriffen der Autothematik, Selbstreflexivität und Selbstreferenzialität geführt wird, zeigt Möglichkeiten auf, den Tonfilm über das Kinoerlebnis hinaus in den Alltag des Publikums wirken zu lassen.
2.1 Der selbstreflexive Beginn des Tonfilms
Die neuartigen und populären Genres der Tonfilmoperetten und der musikalischen Filmkomödien bezeichnete Kracauer als „Tonfilmopiate“, die dazu dienten, „den Arbeitslosen ihr Unbehagen zu nehmen“ (Kracauer, zit. in Schweinitz 2003, 373). Der Vorwurf des Eskapismus blieb haften und führte dazu, dass die filmwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen lange Zeit ausblieb. Darüber gerieten „filmästhetische und kinematographische Besonderheiten aus dem Blick [...]. Dabei ist das Kino der letzten Jahre vor Hitler durch außerordentliche Modernität und Lebendigkeit gekennzeichnet“, schreibt Jörg Schweinitz (2003, 373f.). In diesem Kontext verweist der Filmwissenschaftler auf die auffällige „Affinität zu autothematischen und selbstreflexiven Konstruktionen“ (Schweinitz 2003, 374) innerhalb des frühen Tonfilms der späten Weimarer Republik. Auf der einen Seite dienen autothematische Inhalte, die sich mit Themen wie der Filmproduktion im Atelier oder der Filmrezeption im Kino beschäftigen, einer realistischen Motivierung von Musik, Tanz und Gesang. Ein Beispiel dafür ist der Film ICH BEI TAG UND DU BEI NACHT (DE 1932) von Ludwig Berger, der durch eine Film-im-Film-Konstruktion die interne Tonfilmoperette ironisch und geistreich dem alltäglichen Leben der Hauptfiguren gegenüberstellt. Auf der anderen Seite erfüllt die Autothematik eine gegensätzliche Funktion, nämlich die der „graduellen Derealisierung der Storywelt“ (vgl. Schweinitz 2003, 386f.). Hier stellen Musik, Tanz und Gesang die Künstlichkeit des Films heraus, ohne Notwendigkeit einer realistischen Einbettung der Showeinlagen. DIE DREI VON DER TANKSTELLE etwa singen und tanzen durch ein Geschehen, das zum Schluss mit dem Fallen des Vorhangs und einem nachgeholten Finale in die Tradition der Bühnenoperetten gesetzt wird. Die selbstreflexiven Strukturen legen den Status des Film-als-Film-Konzepts offen, die anti-illusionistischen Verfahren lassen rein formal an den Brechtschen Verfremdungseffekt denken (vgl. Elsaesser 1999, 265). Die Konjunktur des Autothematischen und Selbstreflexiven begründet Schweinitz sowohl mit dem Interesse am Kino als „Medium der Moderne“ (Schweinitz 2003, 377) als auch mit der „Faszination durch die neue Massenkultur“ (Schweinitz 2003, 379). Mit der Einführung des Tons und dem Einbezug von Schlagern schloss sich das Kino mit den modernen Massenmedien Radio und Schallplatte zu einem lukrativen und einflussreichen Medienverbund zusammen.
Die Filmhistorikerin Corinna Müller sieht in dieser Stilisierung eine überdeutliche Markierung des Bestrebens, die Besorgnis des Publikums, dass der Übergang zum Tonfilm mit einem Einbruch der Alltagsrealität in den Film einhergehe, zu zerstreuen. In Vom Stummfilm zum Tonfilm formuliert sie ihre These der „Kultur des Fiktionalen“, mit der sie den Trend zu Musik, Tanz und Gesang im frühen Tonfilm erklärt.
Der Ausgangspunkt von Müllers Argumentation ist die Feststellung, dass die ersten Tonfilme THE JAZZ SINGER (USA 1927, Alan Crosland) und THE SINGING FOOL (USA 1928, Lloyd Bacon) auf eine Technik zurückgreifen, die schon um die Jahrhundertwende verwendet wurde, die im Jahr 1912 aber wieder verschwand. Die frühen Tonbilder und die so genannten Nadeltonfilme der späten 1920er Jahre beruhten technisch auf derselben Lösung: Der Ton wurde synchron zum Film von einer Schallplatte aufgenommen und zeitgleich abgespielt. Der einzige technische Unterschied lag in der Verstärkung, da die elektrischen Lautsprecher die früheren Hornlautsprecher ersetzt hatten (vgl. Müller 2003b, 13). In Deutschland produzierte vor allem der Berliner Filmpionier Oskar Messter zwischen 1903 und 1911 Tonbilder. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Lichtton, bei dem der Ton auf dem Filmstreifen gespeichert wird, gegen den Nadelton auf Schallplatte durchgesetzt hat, wird die technische Überlegenheit des Lichttons angenommen. Müller betont aber, dass der Nadelton gegenüber dem Lichtton lange Zeit die führende Technologie war, und schreibt: „Auch die Technikgeschichte des Mediums Film bietet ein Beispiel dafür, dass sich in der Technik nicht unbedingt immer die qualitativ besten Systeme durchsetzen“ (Müller 2003b, 14).
Die Zeit, in der die technisch vorhandenen Möglichkeiten des Tonfilms nicht genutzt wurden, bezeichnete Müller als „Tonfilmzäsur“ (Müller 2003b, 13). Den Grund dafür vermutete sie in einem bewussten Verzicht: „Der Stummfilm strebte nicht nach der technischen Reproduktion der akustischen Wirklichkeit, er zog vielmehr Gewinn aus deren Fehlen: der Stummfilm war ein vorsätzlich stummer Film“ (Müller 2003b, 13, Herv. i. O.). Um dieses Phänomen in einen größeren Kontext zu setzen, führte sie den Begriff der „Kultur des Fiktionalen“ ein: „In aller Kürze gesagt, handelt es sich bei diesem Phänomen um ein System von Kommunikationskonventionen, die der Abgrenzung von medial vermittelten fiktionalen Äußerungen und Darstellungen gegenüber Tatsachenmitteilungen dienen“ (Müller 2003b, 14). Die Konventionen, die sich, ausgehend von Schrift und Theater, zur Unterscheidung zwischen Fiktion und Tatsachenmitteilungen etabliert haben, sind Kulturtechniken, deren wir uns unbewusst und selbstverständlich bedienen. Müller greift auf den durch den Medienwissenschaftler Hans Jürgen Wulff eingeführten Begriff des „Fiktions-Kontrakts“ zurück, in dem die stillschweigend gültige Vereinbarung eingeschlossen ist, „dass Fiktionen von ihren Produzenten stets auf irgend eine Weise deutlich erkennbar als solche ausgewiesen und von Tatsachenmitteilungen abgegrenzt werden müssen“ (Müller 2003b, 122, Herv. i. O.). Im Medium Film hätten sich – so Müller – in den 1910er Jahren noch keine Konventionen ausgeprägt, die der Unterscheidung von Fiktion und Tatsache dienten. Der frühe Film nutzte beide Optionen gleichermaßen: Als Tatsachenmedium und als Illusionskunst.1
Im Fehlen solcher Konventionen sieht Müller die Herausforderung, die der Film meistern musste, als er sich in den 1910er Jahren in die „kommerziell ertragreiche Kultur des Fiktionalen, in Kunst und Unterhaltung“ (Müller 2003b, 15) eingliedern wollte. Um eine deutlich erkennbare Differenz zwischen Fiktion und Realität in einem Medium herzustellen, dessen Besonderheit im Abbilden des Sichtbaren liegt, wurden starke Eingriffe notwendig. Die Stummheit und auch die stilisierte Farbgebung des frühen Films erfüllen in der Argumentation Müllers diese Anforderung (vgl. Müller 2003b, 129). Der vorsätzlich stumme Film lenkte die Entwicklung des Mediums demnach in eine bestimmte Richtung und gliederte das Kino somit in die Kultur des Fiktionalen ein. Tatsächlich entwickelte sich das so genannte Kino der Attraktionen mit seinen Kurzfilmprogrammen ab 1910 hin zu komplexeren narrativen Formen und abendfüllenden Spielfilmen.
Der Übergang zum Tonfilm erforderte neue Strategien: Die Leerstellen des Stummfilms, die das Publikum mit Phantasie und Mitgefühl auszufüllen gewohnt war, wurden zunächst von scheppernden Lautsprechern, undeutlichen Dialogen und langen, ungeschnittenen Szenen gefüllt. „Dem Publikum nicht die Möglichkeit zu nehmen, zu träumen und seinen Illusionen nachzuhängen, und dennoch zum Tonfilm überzugehen“, so formuliert Müller (2003b, 175), sei die Aufgabe der Filmproduktion Ende der 1920er Jahre gewesen. Die Lösung war so einfach wie bestechend: Der materialtechnisch realitätsnähere Tonfilm wurde mit umso phantastischeren, märchenhafteren Inhalten gestaltet, die Tonfilmoperetten und musikalischen Tonfilmkomödien kamen in die Kinos:
Mit Musik und Gesang suchte der frühe Tonfilm den Anschluss an die Wirklichkeitsferne des Stummfilms und vermittelte gewissermaßen das Versprechen, dass auch der Tonfilm nicht ‚realistisch‘ werden und auch in ihm die Differenz des Films zur Realität deutlich erkennbar bleiben sollte (Müller 2003b, 176).
Der Musik und dem Gesang komme Ende der 1920 Jahre also die Funktion zu, die deutlich wahrnehmbare Differenz zur Realitätin einem Medium zu gewährleisten, das sich im Übergang zum Tonfilm der natürlichen Sinneswahrnehmung annähert. Der Ton wird als Möglichkeit zur Stilisierung genutzt, die die Filmhandlung und das Kinoerlebnis von der Alltagsrealität abhebt und damit die Befürchtung einer zunehmenden Realitätsnähe zerstreuen sollte. Die gesanglichen und tänzerischen Einlagen wurden zum einen durch die Handlung realistisch motiviert, wie zum Beispiel in ICH BEI TAG UND DU BEI NACHT: Die Film-im-Film-Konstruktion ermöglicht die Einbettung der realitätsfernen Gesangsnummern und thematisiert den Tonfilm sowie seine Wirkung auf das Publikum. Zum anderen wird durch den Rückgriff auf Konventionen des Fiktionalen gar nicht erst versucht, den Anschein einer realistischen Handlung herzustellen, wie etwa im Film DIEDREI VON DER TANKSTELLE. Beide Verfahren haben den Tonfilm selbst zum Thema, die autothematischen und selbstreflexiven Inhalte erlauben ein spielerisches Ausprobieren, Diskutieren und Präsentieren der technischen Neuerung.
Müllers These der Kultur des Fiktionalen bildet damit den Gegenpol zur These, die in dieser Studie verfolgt wird: Während die Filmhistorikerin sich mit Musik und Gesang im frühen Tonfilm als Mittel der Unterscheidung von der Realität beschäftigt, soll hier dargelegt werden, wie mit denselben Mitteln eine für den politischen Einfluss notwendige Verbindung zwischen dem Filmschaffen und der Alltagsrealität hergestellt wird.
Im frühen Tonfilm lassen sich demnach zwei unterschiedliche Tendenzen ausmachen. Die neuen Möglichkeiten des Kinos wurden sowohl zur Differenzierung von als auch zur Anbindung an die Realität genutzt. Daraus ergibt sich die Frage, wie der Schritt von der Selbstbezüglichkeit zu einem Bezugspunkt außerhalb des Mediums bewältigt wurde. Corinna Müller gibt in einem weiteren Text einen Anhaltspunkt, indem sie die weitreichende Wirkung der Musik betont (vgl. Müller 2003a, 393–408). Thomas Elsaesser arbeitete zudem am Beispiel des als propagandistisch verstandenen Films DAS FLÖTENKONZERT VON SANSSOUCI (DE 1930, Gustav Ucicky) heraus, dass ein Bezugspunkt außerhalb des Films die Selbstreferenzialität, die dem Tonfilm eigen ist, zerstöre respektive überwinde (vgl. Elsaesser 1999, 252–278). Beide Texte sind aufschlussreich für die Frage, wie das Kino an den politischen Diskurs der Weimarer Republik anknüpft.
2.2 Die Überwindung der Selbstreferenzialität
Das Überschreiten der Grenze zwischen der filmischen Diegese und der Alltagswirklichkeit muss bewusst hergestellt werden, denn die Rückbezüglichkeit ist – so Thomas Elsaesser – der Praxis des frühen Tonfilms inhärent. Der Filmwissenschaftler konstatiert im Kapitel über DAS LIED IST AUS





























