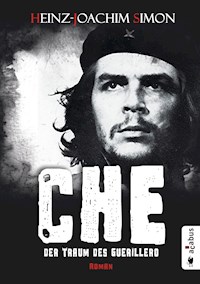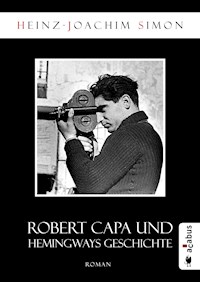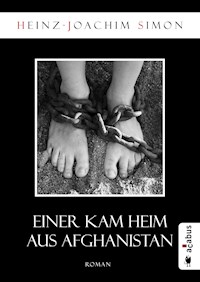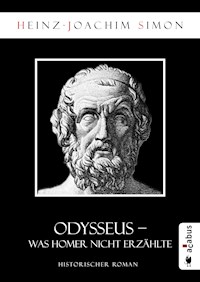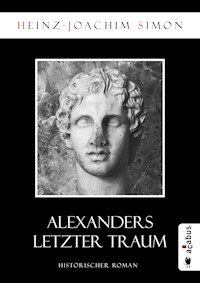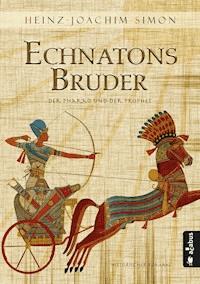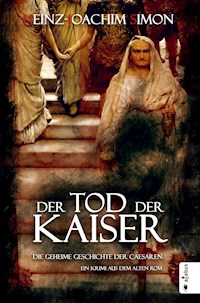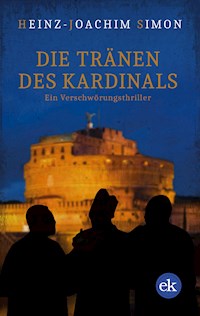Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufstand in Berlin Was läuft falsch im Zeitalter der Globalisierung? Eine fantastische Geschichte über Anstand und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft – und doch möchte man, dass sie passiert, dass sie bald passiert. Was würde sich ändern, wenn sich Stadtstreicher, Studenten und Arbeitslose solidarisieren? Ist es nicht legitim zu fordern, dass jeder Arbeit hat und davon leben kann? Darf man nicht davon träumen, dass die "Gutmenschen" den Aufstand wagen und gegen die Gleichgültigkeit und Kälte unserer Gesellschaft ankämpfen … und hoffen, dass die Politiker wieder die Nöte und Probleme der Menschen entdecken? Jede Jugend zieht voller Enthusiasmus der Morgenröte einer besseren Zukunft entgegen. Altersarmut, Hartz IV und prekäre Arbeitsverhältnisse zeigen, dass eine neue Generation alles Recht hat, ein Umdenken einzufordern. In der Umwelt, in der Verteilung der Lasten. Jeder hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Dies darf nicht nur eine Hoffnung sein. Es gilt etwas zu tun. Lesen Sie vom Suppenkrieg in Berlin – wie eine kleine Gruppe von Zukurzgekommenen den Aufstand gegen "die da oben" wagt. Die Bürger nennen sie "Penner", einige von ihnen nennen sich selbst "Berber". Sie glauben noch, dass man siegen kann. Spannend, romantisch und vergnüglich erzählt. Ein Roman ist nur dann gut, wenn der Leser glaubt dabei zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz-Joachim Simon
Aufstand in Berlin
Roman
Simon, Heinz-Joachim : Aufstand in Berlin. Roman. Hamburg, acabus Verlag 2018
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-667-4
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-666-7
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Eine Legende –
gewidmet denen, die die Träume der Jugend träumen.
Schon die Bezeichnung Legende im Untertitel weist aus, dass in diesem Buch keine realen Personen beschrieben werden, sondern sie allesamt meiner Phantasie entsprungen sind. Dies gilt insbesondere für die fiktive Persönlichkeit des Regierenden Bürgermeisters. Da ich das Berliner Lokalkolorit, so hoffe ich, sehr genau beschrieben habe, lege ich Wert auf die Feststellung, dass sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig wären.
„Dann gingen wir weg
1
Der Vogel kreiste über dem Tal. Es war ein großer schwarzer Vogel. Ruhig, beinahe ohne Flügelschlag zog er seine Kreise. Den Menschen unten war er vertraut; sie hatten ihn in ihr Herz geschlossen und oft sprachen sie voller Bewunderung von seiner Kraft und seiner Größe. Er war der letzte Milan in dieser Gegend. Er war schon alt und um seine Kraft war es längst nicht mehr so gut bestellt, wie die Leute glaubten. Doch was ihm durch das Alter an Kraft und Geschicklichkeit abging, machte seine Erfahrung mehr als wett. Eines Tages kamen sie mit Planierraupen, Baggern und Lastwagen in sein Tal. Immer öfter wurde der Vogel gestört und immer höher musste er fliegen, um dem Gestank und dem Lärm zu entfliehen.
Monate später erkletterten Kinder einen großen Baum am Rande der Straße. Dort, in einer Astgabel, fanden sie einen großen verwesten Vogel. Nur das prächtige Federkleid erinnerte an den Milan, der einst über dem Tal gekreist war. Die Kinder warfen den toten Vogel in hohem Bogen vom Baum herunter und noch einmal breiteten sich die Schwingen des Vogels aus, ehe sie das herbstliche Gras berührten. Noch immer konnte er fliegen.
Damals wohnte er noch in einem Haus, das auf einem Hügel allein am Rande des Grunewalds stand. Das große weiße Haus mit dem gepflegten Rasen kannte jeder in der Gegend und sonntags blieben die Spaziergänger vor der Villa stehen und sahen bewundernd auf die schier endlose Grünfläche und die Terrasse mit dem Swimmingpool und die Säulen der Veranda. Mit Hochachtung und mit ein wenig Neid sahen die Menschen auf das Haus des Eugen Singer.
Er hatte es geerbt. Dies und anderes, was ihn als reichen Mann auswies und doch nur ein Bruchteil dessen war, was die Singers einst besessen hatten. Es war das Erbe seiner Mutter, die in einer Anstalt dahin dämmerte, bis sie starb. Er hatte sie nie kennen gelernt. Er wusste nur, dass sie ihren Bruder umgebracht hatte und die Geschichte ein dunkles Geheimnis der Singers war. Aber von seiner Mutter hatte er nichts dazu erfahren. Selbst von seinem Onkel nicht, dem alten Michael Singer, der ihm die Eltern ersetzt hatte. Alle wähnten Eugen Singer glücklich und reich und mächtig. Und als Vorstand der Singerwerke mit den Stahlwerken, Gruben, Kaufhäusern, Gütern und anderen Unternehmungen, war diese Annahme mehr als verständlich. Doch er besaß nur ein kleines Aktienpaket. Der Name war es, der ihm den Vorstandsposten eingebracht hatte und – trotz der fast sprichwörtlichen Zurückhaltung – der Einfluss des alten Michael Singer, der auf seinem Gut Ritschen bei Neuruppin auf den Tod wartete.
In letzter Zeit liefen die Geschäfte nicht ganz so gut und der Aufsichtsrat war mit ihm unzufrieden und die Aktionäre verlangten nach einer aggressiveren Geschäftspolitik. Die alten Werte des Michael Singer galten nicht mehr und er war nun zu alt, um Eugen zu unterstützen und wohl auch zu gleichgültig, sich jetzt noch um das Erbe der Singers zu kümmern.
Seit einiger Zeit hatte sich bei Eugen Singer der Eindruck verstärkt, dass sich gegen ihn etwas zusammenbraute. Über sich selbst erstaunt, stellte er fest, dass es ihm gleichgültig war. Er war nun in den Fünfzigern, was man ihm nicht ansah, da er sich eine leutselige Art bewahrt hatte, und die Frauen nannten ihn charmant, was mit seiner Eloquenz, seinem
Optimismus, der distinguierten Erscheinung und dem leichten Grau seiner Schläfen zu tun hatte. Singer war, obwohl er sich dessen nicht bewusst war, ein Frauentyp, jedenfalls für die Frauen, die einen Mann nicht nach einem Waschbrettbauch und den Erwähnungen in den einschlägigen Glamourmagazinen beurteilen.
Es geschah in jenem Jahr, als ein durchaus fähiger und tatkräftiger Regierungschef von der Presse aus dem Amt geschrieben wurde und nun eine Frau die Regierung übernahm. Diese machte ihr Geschäft nicht so schlecht, wie alle erwartet hatten. Die Presse lobte sie anfangs sehr. Was bei dem alten Regierungschef Proteste ausgelöst hätte, wurde nun als sachlicher Regierungsstil gepriesen und man war mit der Kritik sehr zurückhaltend. Die Fußballweltmeisterschaft fand in dem Land statt und die Bürger feierten sich selbst und die paar verunglückten Reformen fanden wenig Beachtung. Noch immer gab es über vier Millionen Arbeitslose. Die Presseverlautbarungen der Konzerne verkündeten in wohlbegründeten Worten, dass Entlassungen unumgänglich wären, damit Deutschland weiter wettbewerbsfähig blieb. Die Aktienkurse stiegen daraufhin kräftig und niemand schien etwas dabei zu finden, dass die Wertsteigerungen mit Leid, Angst und Verzweiflung in Verbindung standen.
An einem sonnigen Herbsttag wurde Eugen Singer bewusst, dass hinter seiner Gleichgültigkeit mehr steckte: eine tiefgehende Unzufriedenheit über das, was er geworden war und was von ihm verlangt wurde. Am Anfang war es nur eine Ahnung, dass dies mit dem zu tun haben könnte, was ihm in seiner Jugend einmal als wichtig erschienen war. In seinen jungen Jahren war alles einfach gewesen und er hatte gewusst, worum es wirklich ging und was getan werden musste und dass man zwar Angst haben durfte, aber diese zu überwinden dazu gehörte. Damals war es für ihn selbstverständlich gewesen, dass sich das Dasein damit erklärte, zu Träumen unterwegs zu sein. Er war ein Achtundsechziger. Vor dem Schöneberger Rathaus hatte er einen Wasserstrahl auf das Ohr bekommen, was ihn auf der linken Seite das Gehör gekostet hatte, so dass er sich noch jetzt bei Konferenzen so setzen musste, dass er alle Teilnehmer zur Rechten hatte. Damals, als die Rolling Stones „Street Fighting Man“ sangen, war der Verlust des Trommelfells eine Auszeichnung gewesen, der Tribut dafür, dass man für das eintrat, was man für richtig hielt. Es war eine Menge Schwärmerei und Unsinn dabei gewesen und manche Torheit – aber einige Träume hatten sich verwirklichen lassen. Wenigstens den Mief aus der Nazizeit hatten sie vertreiben können. Wie der ehemalige Außenminister des alten Regierungschefs konnte er von sich sagen, dass er ein „Rock’n Roller“ war. Doch dies bedeutete nichts mehr, war nur von Erinnerungen begleitet an das „Big Apple“ in der Spichernstraße, an die „Badewanne“ und das gute alte „Riverboat“ am Fehrbelliner Platz, die damals die Tempel einer neuen Zeit waren. Heute war das nur noch Nostalgie. Die Presse, nun von jüngeren Redakteuren besetzt, nannte die Achtundsechziger Schwärmer und sie gab ihnen die Schuld am Zustand der Republik, woran manches stimmte, aber die positiven Auswirkungen außer Acht ließ.
Gefühle der Unzufriedenheit über den Sinn seiner Arbeit hatte er in letzter Zeit öfter gehabt und dies darauf zurückgeführt, dass das Geschäft härter geworden war und die Zeiten vorbei zu sein schienen, in denen ein Absatzrekord den anderen ablöste. Bisher hatte er die trüben Gedanken immer beiseitegeschoben und weiter gemacht. Er glaubte bis dahin, dass es keine Alternative zum Weitermachen gab. Bis zu diesem Herbsttag hatte er dies geglaubt.
Später dachte er oft an jenen Augenblick, als er aus dem Grunewald zur Stadtmitte fuhr. Es war ein schöner Herbsttag, und die Blätter der Bäume hatten sich bereits verfärbt und waren der Abgesang auf einen heißen Sommer, den man einen Jahrhundertsommer nannte. Aber die Meteorologen sprachen bereits davon, dass wegen der Erderwärmung viele solcher Sommer folgen würden. Zum ersten Mal hatte er keine Freude daran, wie gut sein Wagen beschleunigte. Es war ein gutes Auto mit allem Komfort und einem Motor, der in Fachkreisen als Meisterstück deutscher Ingenieurkunst gepriesen wurde und mehr Pferdestärken hatte und schneller beschleunigte, als notwendig war. Das dunkelblaue Coupé mit den hellen Ledersitzen und dem Stern vor der Motorhaube entsprach seiner Bedeutung als Vorsitzender des Singerkonzerns. Aber Singer wusste, dass dies nur ein trügerisches Abzeichen geliehener Macht war.
Während er an der Siegessäule vorbei auf das Brandenburger Tor zufuhr, grübelte er darüber, was an diesem Tag anders war. Er kam zu keinem Ergebnis. Automatisch beschleunigte Singer, überholte einige Busse und reihte sich wieder in die allmorgendliche Autoschlange ein. Singer brauchte nicht sehr Acht zu geben. Er kannte jede Kurve, jede Kreuzung, jede Unebenheit der Straßen in der Stadtmitte. Oben am Himmel zog ein Flugzeug Warteschleifen über der Stadt. Es war alles so wie an den vorangegangenen Tagen. Auch nachher, in seinem exklusiven Penthausbüro am Gendarmenmarkt erwartete ihn nichts, was von einem normalen Arbeitstag abweichen würde.
Seine Sekretärin würde ihn freundlich lächelnd empfangen und den Kaffee und die Akten bringen. Vielleicht würde sie ein paar Worte über das gestrige Fernsehprogramm verlieren, um danach mit ihm die Post durchzugehen. Oh ja, er hatte alle Tribute eines wichtigen Mannes. Das Büro hatte ein bekannter Innenarchitekt eingerichtet und an den Wänden hingen Bilder von Kandinsky und Kokoschka. Die Möbel waren vom Bauhausstil beeinflusst und nüchtern genug, um eine kühle sachliche Atmosphäre zu vermitteln. Er wusste, dass er viele Neider hatte. Aber noch schützte ihn sein Name und mehr noch … der Einfluss des Konsuls, seines Schwiegervaters.
Auch seine Frau gehörte einer mächtigen Industriedynastie an und das Haus im Grunewald war mit ihrem Geld renoviert worden. Von dem Reichtum, den man Eugen Singer zuschrieb, gehörte ihm persönlich nur das kleine Aktienpaket des Singerkonzerns, das trotz des schlechten Kurses immer noch einige Millionen wert war. Helen dagegen konnte sich mit ihren Aktien, die ein Vermögensverwalter betreute, als eine der reichsten Frauen der Republik bezeichnen. Zum Glück war dies aber nur Eingeweihten bekannt. Den wirklich Reichen des Landes, die sich hinter hohen Mauern verbargen und genug Macht hatten, dass selbst die Presse sich zurückhielt, da deren Eigentümer auch zu dem illustren Kreis der Reichen zählten und man gute Freunde und Bekannte natürlich vor zu großer Publizität schützte.
Eine bleierne Schwere der Glückseligkeit lag über dem Land. Die Menschen wollten den Zustand ihres Landes nicht wahr haben und verdrängten die Furcht und die Erkenntnis, dass sie auf Kosten ihrer Kinder lebten. In der Hauptstadt löste ein Event das andere ab.
Eugen Singer wusste, dass ihn unangenehme Nachrichten erwarteten, aber dies war nicht der eigentliche Grund seiner Unzufriedenheit, es war grundsätzlicher. Er würde zwar wieder einmal dem Aufsichtsrat melden müssen, dass sich die gesteckten Ziele nicht erreichen ließen. Zum Teufel damit, dachte er. Sie wissen doch, dass die Inder bei gleicher Qualität billiger Stahl produzieren können. Aber nicht dies Eingeständnis beschäftigte ihn. An diesem Morgen entdeckte er, dass ihm dieser Ärger gleichgültig war. Das war es, was ihn beunruhigte.
Vor ihm leuchteten Bremslichter auf. Eugen Singer nahm das Gas zurück und trat leicht auf die Bremse. An anderen Tagen hätte er sich gefreut, wie mühelos sich der Wagen fahren ließ. Helen hatte ihm das Auto zu seinem Fünfzigsten geschenkt. Singer fiel nun die Verabredung ein, die er heute mit dem Einkaufschef eines Automobilkonzerns hatte. Sie wollten sich im Adlon zu einem Arbeitsessen zusammensetzen. Er war ein wichtiger Kunde, und wenn Singer ihn überzeugen konnte und dieser ihn im Preis nicht zu sehr drückte, konnte er das vorgegebene Umsatzziel des Quartals doch noch erreichen. Doch den Zuschlag würde er nicht wegen eines guten Abendessens erhalten, sondern er würde den Einkaufschef mit einigen hunderttausend Euro auf ein Konto auf den Bahamas schmieren müssen und vielleicht noch mit einer Reise auf der „Seemöwe“, einem Luxussegelschiff, das der Singerkonzern in der Karibik für die Pflege von Geschäftsbeziehungen bereithielt.
Eugen Singer seufzte. Ohne „Bakschisch“ lief nichts mehr in diesem Land. Nicht nur Baukonzerne pflegten Aufträge über Zuwendungen an Entscheidungsträger hereinzuholen. Jeder tat es. Jedenfalls fast jeder. Das Land war korrupt geworden. Wir haben alle Speck angesetzt und dies hat uns verdorben, dachte er und tastete nach seinem Bauch, mit dem er eigentlich ganz zufrieden war. Sonst war er vor solchen Gesprächen immer etwas aufgeregt. Nicht so sehr, dass man es ihm angemerkt hätte. Der Druck in der Magengegend und das Kribbeln, das dann durch seinen Körper lief, hatten ihn immer erst so richtig in Schwung gebracht. Er spürte auch keine Freude darüber, wieder einmal im Adlon essen zu können. Dabei war er gern in dem Restaurant mit seiner mediterranen Atmosphäre und dem Ausblick auf den Pariser Platz, wenn sie dort nicht, wie zur Fußballweltmeisterschaft einen riesigen Fußball platziert hatten. Nicht nur das Essen war gut – insbesondere die Adlonente – sondern auch die Art, wie man als Gast behandelt wurde. Eugen Singer dachte an Henkel, den Servicechef. Henkel erinnerte ihn an einen alten kriegserfahrenen Offizier. Jemand, der genau wusste was zu tun war, der auf jedes überraschende Ereignis mit den richtigen Maßnahmen antworten und eine Panne in der Küche, was selten genug vorkam, in einen erneuten Beweis exzellenter Dienstbereitschaft und Wertschätzung des Gastes verwandeln konnte.
Eugen Singer sah den drahtigen Mann mit dem kurzen Bürstenhaarschnitt und den scharfen energischen Gesichtszügen vor sich. Henkel konnte seinen Gästen das Gefühl vermitteln, dass es wichtig war, alle Sorgfalt auf Auswahl und Zusammenstellung der Gerichte zu legen, auf die Wahl des passenden Weines und dass das Wissen darum ein Zeichen von Kultur war.
Eugen Singer fuhr nun am Brandenburger Tor und der Baustelle der amerikanischen Botschaft vorbei und bog in die Behrenstraße ein. Man meldete Verkehrstaus in Charlottenburg. Eigentlich war alles so wie immer. Nur dieses bohrende Gefühl und die Gleichgültigkeit hinsichtlich der Dinge, die ihm als Vorstandsvorsitzender nicht unwichtig sein durften, waren beunruhigend und neu und verwirrend. Aber seltsamerweise wünschte er sich nicht, dass es anders wäre.
Er fuhr an der Komischen Oper vorbei und der Verkehr wurde immer dichter. Im Radio spielten sie „Strangers in the night“, einen uralten Hit von Frank Sinatra. Er dachte an die Zeit, als dieses Lied populär gewesen war. Alle trugen sie enge, auf den Leib geschneiderte Hosen, die an den Schenkeln spannten und unten ausgestellt waren und einen Schlag hatten, wie sie es nannten. Singer trug dazu stets einen roten Pullover und abends im „Big Apple“ hörten sie die Platten der Rolling Stones und Beatles und Kinks und wie diese trugen sie ihr Haar lang. „Satisfaction“, „Midnight Ramble“ und „The Last Time“, das waren die Songs, die sie wieder und wieder hörten. Er erinnerte sich noch, dass er die Wand in seinem Schlafzimmer mit Bildern aus „ …..denn sie wissen nicht, was sie tun“ tapeziert hatte. Damals hatte er sich immer Cowboystiefel gewünscht, wie sie James Dean in „Giganten“ trug. Singer lachte vor sich hin.
Nun bog er in den Gendarmenmarkt ein und erfreute sich wieder an den Proportionen des Platzes und grüßte zu dem Schalmeispieler auf dem Löwen hinüber. Er liebte den Platz und verteidigte ihn oft gegen Helens Ansichten, dass die Piazza Navona in Rom oder der Place Vendôme in Paris viel schöner seien. Für ihn war der Gendarmenmarkt sein Wohnzimmer und er ließ nichts auf seine Schönheit kommen.
Als er vor dem Haus Nummer 12 schräg gegenüber dem Schauspielhaus hielt, kam der Portier herausgelaufen. Singer stieg aus und nickte ihm zu. Der Portier, ein Angestellter seines Konzerns, würde den Wagen in die Garage fahren. Ohne die Touristen zu beachten, die neugierig der Wagenübergabe zugesehen hatten, ging er mit schnellen Schritten in die marmorverkleidete Halle des Hauses, das nach der Wende vom Singerkonzern gebaut worden war und dessen drei oberste Etagen die Verwaltung des Konzerns in Beschlag genommen hatte. Das Parterre war an Anwaltskanzleien vermietet worden. Das Singer–Domizil am Gendarmenmarkt beherbergte nur die Vorstandsetage mit den Büros der drei anderen Vorstände und eine gehörige Anzahl von Referenten und Sekretärinnen, die ihnen zuarbeiteten. Das Hauptbüro dagegen war in einem schäbig aussehenden Hochhaus aus der DDR–Zeit am Alexanderplatz.
Der zweite Portier begrüßte ihn mit einem fröhlichen „Guten Morgen“ und wünschte ihm einen guten Tag. Singer nickte ihm freundlich zu und ging zu dem Fahrstuhl, wo er beinahe mit Schmude zusammengeprallt wäre, der für die Auslandsmärkte in Südamerika zuständig war. Dieser stammelte einige Entschuldigungen und entkrampfte sich auch nicht, als Singer freundlich zurück grüßte und mit einem launigen Scherzwort die Schuld auf sich nahm. Verblüfft stellte Singer fest, dass der Mann Angst hatte. Bis dahin hatte er immer geglaubt, dass ihn seine Leute wegen seines bewusst verbindlichen und leutseligen Führungsstils schätzten. Er hatte immer die Ansicht vertreten, dass man auch ohne übertriebenen Druck die Mannschaft zu Höchstleistungen motivieren könne. Seinen kameradschaftlichen Ton hielt man im Konzern für amerikanischen Stil, und er war diesem Eindruck nie entgegen getreten. Aber in Wirklichkeit hatte sein Führungsstil überhaupt nichts mit der burschikosen und knochenharten Art amerikanischer Geschäftsleute zu tun, sondern entsprang seinem Sicherheitsgefühl. Die neue Sitte, dass sich alle in der Führungsmannschaft duzen, hatte er nicht eingeführt. Singer hatte es nie nötig gehabt, die Ellenbogen zu gebrauchen. Sein Name, das Geld und die Stellung des Schwiegervaters hatten ihn unangreifbar gemacht, und lange Zeit gingen die Geschäfte zur Zufriedenheit der Aktionäre und es hieß, dass er vom gleichen Schlag sei wie sein Großvater, den er genau so wenig kennengelernt hatte wie seinen Vater. Auch dies gehörte zu den düsteren Geheimnissen der Singerfamilie.
Als er die Tür zu seiner Büroflucht öffnete, sah seine Sekretärin hoch und lächelte ihn an. Jeden Morgen, wenn er das Büro betrat – meistens hatte sie dann schon eine Stunde gearbeitet und alles für die Besprechung mit ihm vorbereitet – wandte sie sich vom Computer ab, stand auf und nahm ihm, immer noch lächelnd, den blauen Sommermantel ab. Sie war eine gute Kraft. Mehr als das, sie war so etwas wie seine Stellvertreterin, obwohl es diesen Titel natürlich nicht gab. Die Abteilungsleiter hatten sie die „Graue Eminenz“ getauft, was treffend, aber nicht besonders originell war. Die Einkaufsleiter der Kunden schwärmten über den Charme und die Tüchtigkeit seiner Sekretärin. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte sie es sicher in den Vorstand geschafft. Aber in seiner Branche hielt man noch nicht viel von Emanzipation. In anderen Branchen kam eine neue Generation von Frauen sogar in die Führungsetagen.
Sie sah gut aus, fast zu gut, und er gestand sich ein, dass er die Art mochte, wie sie sich kleidete. Meistens trug sie elegante blaue oder dunkle Kostüme, die ihre schlanke Figur vorteilhaft zur Geltung brachten. Ihr Make–up war stets perfekt und nie hatte er sie die Haltung verlieren sehen. Einmal, bei einem Betriebsfest, war zwischen ihnen so etwas wie ein Flirt gewesen. Auf dem Parkplatz hatten sie sich geküßt. Doch mehr war nicht passiert, und am nächsten Tag hatten sie sich wie immer begrüßt und sie war Frau Kugler und er Herr Singer oder ganz einfach Chef. Weder sie noch er hatten je auf diesen Zwischenfall angespielt. Sie wussten beide, dass sie sich ihren Partner eigentlich anders vorstellten. Sie war ihm zu kühl, zu kontrolliert und er ihr zu weich und eloquent, zu sehr Sohn aus reichem Haus, dem man eine „gemähte Wiese“ anvertraut hatte und der nie für etwas hatte kämpfen müssen.
„Der Große Manitu hat angerufen. Er trifft in einer halben Stunde ein.“
„Er kommt hierher?“
„Ja. Ich habe alle Daten zusammengestellt und sie Ihnen auf den Schreibtisch gelegt. Sie sollten sich ein paar gute Argumente zurechtlegen. Wenn er die neuesten Zahlen hört, wird er nicht gerade in Begeisterung ausbrechen.“
„Warum kommt er selbst? Wir haben in vierzehn Tagen ohnehin Quartalskonferenz.“
Der Große Manitu war niemand geringerer als der Aufsichtsratsvorsitzende und damit sein Chef. Es war ungewöhnlich, dass er sich zu ihm bemühte. Das konnte nur Ärger bedeuten. Eugen Singer fühlte, dass nun das Kribbeln eintrat, das er am Morgen vermisst hatte.
„Nicht nur bei uns gehen die Zahlen zurück. Der gesamten Branche geht es schlecht! Wir haben zwar tonnenmäßig nachgelassen, aber unsere Konkurrenten haben noch mehr verloren, und so gesehen haben wir sogar Marktanteile in Europa gewonnen.“
„Sie haben einen guten Job gemacht. Keine Frage. Unsere Mitarbeiter haben sich tüchtig ins Zeug gelegt. Der Singersche Geist lebt noch“, pflichtete sie ihm bei.
Er wollte sich für ihre Loyalität bedanken, doch nach ihren nächsten Worten ließ er es lieber.
„Aber ich glaube nicht, dass Ihnen das beim Manitu viel helfen wird. Er kann es sich nicht leisten, auf die Marktsituation Rücksicht zu nehmen. Nicht mehr. Die Aktionäre üben Druck auf ihn aus. Stimmt es eigentlich, dass die Philadelphia Steel verstärkt Aktien der Singerwerke aufkauft?“
Sie hatte also auch davon erfahren. Natürlich, denn durch ihre Hände gingen schließlich die Zahlen der Kursentwicklungen. Auch dies gehörte zu den Sorgen, die sie sich im Vorstand machten. Bei ihrem schlechten Aktienkurs bestand die Gefahr einer feindlichen Übernahme. Sollte Philadelphia Steel tatsächlich die Aktienmehrheit bekommen, wovon sie glücklicherweise noch ein Stück entfernt waren, würden sie ihn gewiss vor die Tür setzen, zwar mit einer anständigen Abfindung, aber seinen Job wäre er los.
„So lange mein Onkel Michael Singer noch dreißig Prozent der Aktien hält und sein Stiefsohn Thomas fünfundzwanzig Prozent mache ich mir deswegen keine Sorgen. Doch was will unser Chef von uns?“
„Was Gutes sicher nicht. Aber Sie können ja ganz gut mit ihm, und vielleicht wird es auch nicht so schlimm. Er bekommt doch auch regelmäßig die Zahlen und weiß, wie es im Markt läuft.“
Es stimmte. Manitu mochte ihn beziehungsweise die Verbindungen, die Singer durch seinen Schwiegervater hatte. Manitu war der Vorstand einer der größten deutschen Banken und damit ein bedeutender Mann. Aber er gehörte nicht dem Kreis der wirklich Reichen an und diese sahen auf „neues Geld“ immer mit ein wenig Geringschätzung herab.
Singer ging nicht auf ihre optimistische Einschätzung ein, öffnete die Tür zu seinem Zimmer, setzte sich an den Schreibtisch und schaltete den Computer ein. Er wartete geduldig, bis die Daten erschienen, die ihm die neuesten Verkaufszahlen zeigten. Sie trat hinter ihn und beugte sich über seinen Rücken. Er roch ihr Parfum. Er kannte es. Es war Egoiste von Chanel, eigentlich ein Herrenduft. Sie wies mit ihrem Montblanc auf die Zahlenreihen.
„Das würde ich ihm zeigen und das hier. Sieht doch diesen Monat gar nicht so schlecht aus, und vielleicht klappt ja heute Mittag die Sache mit Kretschmann.“
„Dann schaffen wir das Plansoll für dieses Quartal. Kumuliert liegen wir aber immer noch fünfzehn Prozent unter Plan, wenn wir das Jahressoll erreichen sollen. Wir werden wohl doch noch Kurzarbeit anmelden müssen.“
Sie nickte kühl. „Ich habe Ihnen damals gesagt, dass ich die Einschätzung des Vorstands für sehr optimistisch halte.“
Ihr Vorwurf war berechtigt. Singer hatte am Anfang des Jahres die Marktentwicklung falsch eingeschätzt und Sollzahlen vorgegeben, die nun nicht zu erreichen waren, auf denen aber das gesamte Kostengefüge aufgebaut war. Er musste zugeben, dass er es trotz gewisser Anzeichen nicht hatte wahrhaben wollen, dass sie Schwierigkeiten bekommen würden. Es hätte bedeutet, dass tiefe Einschnitte ins Unternehmen erforderlich geworden wären. Es war bisher immer stolz darauf gewesen, nie Mitarbeiter entlassen zu müssen. Jedenfalls nicht wegen mangelnder Aufträge. Die Fehleinschätzung der Marktentwicklung konnte man ihm jetzt ankreiden.
Es würde ein hartes Gespräch werden und Singer überlegte, ob er dies geahnt hatte und deswegen so unzufrieden war. Aber eigentlich war er selbst jetzt, gemessen an dem, was ihn vielleicht vom Manitu erwartete, fast gelassen. Er sah die Unterlagen durch, die sie ihm bereit gelegt hatte. Aber er vermochte sich nicht darauf zu konzentrieren.
„Komisch, als wäre ich heute nicht ich selbst!“, sagte er halblaut vor sich hin. Seine Sekretärin, die gerade wieder zur Tür hereinkam, um ihm Kaffee nachzuschenken, sah ihn fragend und ein wenig besorgt an.
„Nichts. Es ist nichts!“, sagte er abwehrend zu ihr.
Sie lächelte verbindlich, und doch hatte er den Eindruck, als wolle sie ihm damit Mut machen.
Was sie wohl heute von mir denkt, fragte er sich, nachdem sie hinausgegangen war und stand auf und ging zum Schrank und öffnete ihn und sah sich in dem Spiegel an, der an der Innenseite der Tür angebracht war und rieb sich das Gesicht.
2
Der Mann war wie ein Fels. Ein hochgewachsener schwerer Mann. Übergewichtig, optimistisch und selbstbewusst. Meistens wirkte er unerschütterlich. Eine Eigenschaft, die für einen Aufsichtsratsvorsitzenden sehr wichtig war. Obwohl sein Kinn angriffslustig hervorstach, wusste Singer nur zu gut, dass es ein Glaskinn war. Er hatte ihn schon öfter zögerlich und schwach erlebt. Schweißperlen glitzerten dann auf seiner Stirn, sein Atem ging schwer, er lief rot an und seine Stimme lag einige Tonlagen höher. Aber auf den ersten Blick wirkte Manitu wie ein Mann, der jedes Schiff sicher in den Hafen bringen konnte. Er strahlte Kraft aus und die Aktionäre fühlten sich sicherer, seit er dabei war. Die gefurchte hohe Stirn suggerierte Gedankentiefe. Ein italienisches Gesicht, fand Singer. Helen hatte es mit Mussolini verglichen.
„Schön, dass wir uns mal außer der Reihe sehen können“, fing er an, nachdem die Sekretärin den Kaffee vor ihn auf den Tisch gestellt und das Zimmer verlassen hatte. Breitbeinig in dem Sessel sitzend, mit gefalteten Händen vor dem Bauch, schweifte sein Blick durch das Büro.
„Schön haben Sie es hier. Ich wollte, unsere Zentrale säße nicht in Frankfurt, sondern auch an so einem schönen Platz wie dem Gendarmenmarkt.“
„Ja. Den Singers gehörten hier schon vor dem Krieg etliche Grundstücke. Nach der Wende haben wir natürlich sofort unsere Ansprüche geltend gemacht.“
„Es ist ein riesiger Schatz, wenn man auf eine alte Tradition zurückgreifen kann. Der Name Singer ist so wertvoll wie die Namen Krupp, Siemens, Bosch und Mercedes. Ikonen deutschen Unternehmertums. Umso bedauerlicher die Entwicklung der letzten Zeit.“
„Wir hatten schon öfter mal Schwächephasen und sind dann noch stärker daraus hervorgegangen.“
„Wie geht es der Frau Gemahlin?“, fragte der Aufsichtsratsvorsitzende, ohne auf Eugen Singers Einwand einzugehen. Er lächelte dabei, was Anteilnahme ausdrücken konnte. Die Augen jedoch blieben kalt.
Auf dem deutschen Presseball hatte Manitu mehrmals mit Helen getanzt. Keine andere Frau war so oft von ihm aufgefordert worden. Singer fand damals, dass sie ein wenig zu eng miteinander tanzten. Helen hatte auf seine Bemerkung hin geantwortet, dass sie auch nichts dafür könne, dass der gute Breitschmidt so ein „Ranschmeißer“ wäre. Aber er war nicht eifersüchtig gewesen. Nicht wirklich. Schließlich war es nicht schlecht, wenn der Große Manitu ein wenig scharf auf seine Frau war.
„Sie können sich denken, wieso ich zu Ihnen gekommen bin!“, kam Manitu auf den eigentlichen Grund seines Besuches zu sprechen. Das Lächeln war verschwunden, und die Stimme wurde hart und kalt. Singer nickte gelassen und lächelte freundlich, und der Aufsichtsrat lief rot an.
„So geht das wirklich nicht mehr weiter, Singer!“ polterte er nun los. Die Hände vor dem Bauch hatten sich gelöst und die Rechte fiel schwer auf den Tisch.
„Am Ende des Jahres droht ein Desaster. Dauernd melden sich die Aktionäre bei der Bank und fragen, ob sie die Aktien noch halten sollen und Philadelphia Steel nutzt dies kräftig aus. Wenn die so weitermachen, schlucken die eines Tages die Singerwerke und das zu einem Spottpreis.“
Er starrte Singer anklagend an.
„Wir kommen da wieder raus. In diesem Quartal könnte es schon wieder besser aussehen“, erwiderte Singer ruhig. Es klang nicht einmal nach einer Entschuldigung.
„Sie machen sich etwas vor, Singer! Es ist kein Konjunkturproblem. Das habe ich Ihnen schon letztes Jahr nach der Bilanzpressekonferenz gesagt.“
Breitschmidt stand auf, ging ans Fenster und sah hinunter auf den Gendarmenmarkt. Aber Singer wusste, dass Manitu nicht dessen Schönheit bewunderte. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Eine dramatische Pause, um ihm Angst einzujagen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende drehte sich langsam um und musterte Singer finster.
„Sie haben Fehler gemacht. Sie haben versäumt, Restrukturierungsmaßnahmen einzuleiten.“
„Sie meinen, ich sollte Entlassungen vornehmen“, übersetzte Singer dessen Worte.
„Jawohl. Alle tun es. Alle specken ab und verlegen die Produktionsstandorte nach Übersee. Wenn wir Deutschland wieder voranbringen wollen, dann sind solche Maßnahmen unumgänglich. Natürlich ist es betrüblich für die Menschen. Keine Frage. Aber sagen wir es deutlich: Deutschland ist nur noch als Ingenieurs– und Konstruktionsbüro wettbewerbsfähig. Die Globalisierung verlangt von uns, dass wir uns weltweit etablieren und da produzieren, wo wir dies zu wettbewerbsfähigen Preisen können.“
Da war es wieder. Globalisierung. Die Lieblingsentschuldigung ratloser Industrieführer. Und als einzige Medizin fiel ihnen ein mitzuspielen und die Produktionsstandorte nach Thailand, Indien oder China zu verlegen, Arbeitsplätze also dorthin zu verschieben, wo man den Profit maximieren konnte.
„Es wird ernst, sehr ernst, Singer. Forsten Sie den Laden durch, schmeißen Sie die raus, die nicht spuren und die zu alt sind. Machen Sie die Singerwerke jung und schlank und kümmern Sie sich um strategische Partnerschaften im Ausland oder, noch besser, um Produktionsstandorte in Lohnniedrig–preisländern. Wir sind uns im Aufsichtsrat einig, dass nun gehandelt werden muss!“
Soweit waren sie also schon, dachte Singer. Es geht um meinen Kopf. Bei früheren, viel geringfügigeren Vorwürfen war er nervös geworden. Heute war er so gelassen, als erzählte ihm Breitschmidt seine Krankheitsgeschichte.
„Michael Singer, unser Hauptaktionär, stimmt mit mir überein, dass wir den Produktionsstandort Deutschland erhalten wollen. Wir sind ein deutsches Unternehmen mit Schwerpunkt in diesem Land. Und wir sind stolz darauf, dass wir nie entlassen haben, selbst wenn es einmal kriselte.“
„Ach, Singer, kapieren Sie es doch endlich! Es geht ums Eingemachte. Wenn die Aktie nicht steigt, übernimmt uns Philadelphia Steel für ’n Appel und ‘n Ei.“
„Noch haben die Singers die Aktienmehrheit. Wir werden nicht verkaufen.“
„Da seien Sie sich mal nicht so sicher. Thomas Singer war bei mir und wollte meinen Rat. Er überlegt schon nicht mehr, ob er verkauft, sondern nur noch wann er verkauft. Ich habe ihn beruhigt, dass er dies erst einmal zurückstellen soll.“
„Bis die Aktie gestiegen ist?“
„Natürlich. Man gibt ein Juwel wie die Singerwerke nicht für einen Bettel weg.“
Breitschmidt ging es nicht um den Erhalt der Singerwerke, sondern nur darum, dass vor allem seine Bank, die ein gehöriges Aktienpaket hielt, ein besseres Geschäft machte. So einfach war das.
„Wir haben unser Personal bereits durch natürlichen Abgang reduziert. Wir kommen auch in Deutschland durch. Ich bin nicht dazu bereit, das Lebenswerk von Generationen wegzuwerfen, nur weil die Aktionäre die Nerven verlieren.“
„Mann, Singer, alle tun es.“
„Ich bin nicht bereit das zu tun, was meine verantwortungslosen Kollegen in anderen Unternehmen tun. Es ist natürlich der einfachste Weg, nur noch in Billiglohnländern zu produzieren. Wir Singers denken nicht an einen kurzfristigen Vorteil. Es gibt genug Beispiele, dass es auch anders geht. Was soll aus diesem Land werden, wenn wir es so herunterwirtschaften, dass keine Arbeitsplätze mehr da sind. Unsere Menschen können nicht alle Konstrukteure, Ingenieure oder Wissenschaftler werden. Wir brauchen die Basis. Mit dieser Wirtschaftspolitik nehmen wir, für einen kurzfristigen Vorteil, unseren Kindern die Zukunft.“
„Hat man so etwas schon gehört? Mann, Singer, so einen Scheiß hört man nur von linken Sozis!“
Erregt ging Breitschmidt vor seinem Schreibtisch auf und ab. Er schüttelte dabei den Kopf und schnaufte, als bekäme er keine Luft.
„Ich sollte Sie auf der Stelle abberufen. Weiß Ihr Schwiegervater eigentlich, wie Sie denken? Was glauben Sie, was der sagen würde, wenn er Sie eben gehört hätte.“
„Wahrscheinlich hätte er das Gleiche gesagt wie Sie.“
„Na also! Alle entlassen, schneiden das überflüssige Fett ab. Wir haben nicht mehr die Wirtschaftswunderjahre, nicht einmal die Neunziger. Nur wenn wir …“
„Wenn wir uns dem ungehemmten Kapitalismus hingeben, werden wir die Gewinne maximieren können. Dabei waren die Gewinne der Industrieunternehmen nie höher.“
Breitschmidt blieb mit offenem Mund stehen.
„Aber nicht bei uns. Da gab es schon bessere Zeiten. Sagen Sie mal, ist mit Ihnen etwas passiert? Vielleicht sollten Sie mal eine Kur nehmen. Ungehemmter Kapitalismus, so etwas habe ich bisher nur von den Schmierfinken im Spiegel gelesen. Haben Sie den Unfug daher?“
„Es gibt noch ein paar Blätter, die sich trauen ihre Meinung zu sagen. Zugegeben, es werden immer weniger. Wer schwimmt schon gern gegen den Strom?“
„Mit Ihnen ist nicht zu reden. Also, Klartext: Sie legen mir bis Ende November einen Restrukturierungsplan vor oder ich werde Ihren Rücktritt erzwingen. Und hören Sie auf, so unqualifiziert daher zu reden. Ich werde über unser Gespräch Stillschweigen bewahren. Denn wenn der Inhalt publik würde, Ihre Tirade über ungebremsten Kapitalismus und Zukunft der Kinder, verlieren Sie Ihre letzte Reputation und die Aktienkurse stürzen ins Bodenlose.“
„Sie werden mich nicht so ohne weiteres los! Ich werde kämpfen!“, trotzte Singer, obwohl er nicht einmal sicher war, ob er dies wirklich noch wollte.
„Sie glauben, dass Michael Singer Sie weiterhin unterstützen wird? Dass Sie sich da mal nicht täuschen. Wenn ich Ihre Entlassung zur Bedingung mache, weil sonst der gesamte Aufsichtsrat zurücktritt, möchte ich mal sehen, ob er nicht weich wird. Aber, Sie können es sich ja noch überlegen. Noch haben Sie Zeit, das Steuer herumzureißen.“
Er trat an den Schreibtisch und setzte sich wieder und breitete die Arme aus und fuhr in versöhnlichem Ton fort: „Mann, Singer, verpfuschen Sie sich nicht Ihre Karriere. Schließlich waren Sie vor fünf Jahren einmal Wirtschaftsführer des Jahres. Ich mag Sie. Ich habe mich immer für Sie stark gemacht. Was soll dieser sozialistische Quatsch? Noch nie habe ich in einer Vorstandsetage derartiges gehört. Nehmen Sie doch Vernunft an. Die besten Namen in Deutschland handeln so.“
„Aber nicht alle. BMW zum Beispiel, um nur einen Namen herauszugreifen, entlässt keine Leute.“
„Aber produziert auch schon in den USA. Auch die werden hier noch abspecken. Das ist nur eine Frage der Zeit. Niemand tut das gern. Aber es muss sein, und Sie werden es auch tun, wenn Sie vernünftig sind. Es ehrt Sie, dass Sie
Skrupel haben, aber als Unternehmensführer wird man dafür bezahlt, und gut bezahlt, wie ich weiß, dass man Gewinne macht. Das allein zählt.“
„Das allein zählt nicht. Wir müssen auch an die Zukunft denken, an die Erhaltung des betrieblichen Friedens, an das Wohl der Mitarbeiter, an die Zukunft der Kinder. Auch sie sollen Arbeitsplätze hier in Deutschland vorfinden. Wo arbeiten eigentlich Ihre Söhne?“
„Was tut das zur Sache?“
„Wo arbeiten sie?“
„In London“, gab Breitschmidt unwillig zu und lief wieder rot an. „Genug mit dem Gerede! Sie legen mir bis November vor, wie viele Sie entlassen können und welche Pläne die Singerwerke in Übersee haben …..“ Er schwieg, schnaufte und starrte ihn wütend an.
Er glaubt wirklich, dass ich nachgeben werde, dachte Singer. Nun, Mühe hat er sich gegeben, mich unter Druck zu setzen. Es ist gar nicht so lange her, da hätte ich jetzt kapituliert. Ihm wurde in diesem Augenblick, in der Konfrontation mit Breitschmidt, bewusst, was aus ihm geworden war. Obwohl zur Unzeit, erinnerte er sich wieder an die Demonstration vor dem Schöneberger Rathaus, als ihn der Wasserwerfer traf. Damals glaubten sie wirklich, die Guten zu sein und selbst später, als ihm klar wurde, wie sehr sie manipuliert worden waren, blieb die Überzeugung, dass die Achtundsechziger Deutschland zum Positiven verändert hatten. Ihn schauderte, wenn er an die muffige Atmosphäre Ende der Fünfziger dachte, an das immer noch wirkende Gift der braunen Epoche in den Köpfen der Menschen. Aber den Kompass hatte er nach dem Studium aus den Augen verloren und Karriere gemacht, was mit seinem Namen und Hintergrund nicht schwer gewesen war. Verdammt leicht hast du es gehabt und nun bist du zum ersten Mal mit der Wirklichkeit konfrontiert und musst dich entscheiden, dachte er und stellte fest, dass er ihr nicht ausweichen konnte.
„Sie haben mich also verstanden? Fünfzigtausend sollten es wenigstens sein, die Sie freistellen. Und Sie werden sehen, wie die Aktie in die Höhe schießt!“, hörte er Manitu schwer atmend sagen.
Singer fürchtete, Entscheidendes verpasst zu haben und ärgerte sich über sich selbst. Auch diese Unkonzentriertheit wäre ihm früher nie passiert.
„Übrigens, kann Ihnen Ihr Schwiegervater nicht bei der Suche nach den richtigen Produktionsstandorten helfen?“
Manitu beugte sich über Singers Schreibtisch und seine Stimme wurde nun beschwörend und kollegial.
„Der Konsul. Er hat doch Beziehungen in der ganzen Welt. Damals, bei dem Riesenauftrag der amerikanischen Automobilindustrie, hat er Ihnen doch auch geholfen. Ich mag Sie, Singer. Sie und Ihre liebe Frau. Ich erinnere mich noch gern an unser letztes Beisammensein. Es war ein zauberhafter Abend. Sollten wir mal bei mir wiederholen. Ich würde es menschlich sehr bedauern, wenn wir zueinander in Konfrontation stünden.“
Nun versucht er es auf die sanfte Tour, dachte Singer. Was ist er doch für ein Scheißkerl und du bist auf dem besten Weg so zu werden wie er.
„Ich glaube nicht, dass er mir helfen wird.“
Manitus Gesicht zeigte Betroffenheit. „Warum nicht?“
Singer hatte nicht vor ihm zu erzählen, wie demütigend es war, auf die Unterstützung von Helens Vater angewiesen zu sein, und dass dies ein Streitpunkt zwischen ihm und Helen war. Deshalb erzählte er Breitschmidt, dass er in letzter Zeit nicht sehr gut mit seinem Schwiegervater zurechtkäme, und das war ja auch nicht so falsch.
„Singer, mit einem Mann wie dem Konsul verdirbt man es sich doch nicht!“ rief Breitschmidt erschrocken. „Ihr Schwiegervater ist wichtig für Sie, für die Singerwerke, für uns alle!“
Die Art und Weise, wie er reagierte, ließ erkennen, dass er fest damit gerechnet hatte, dass sein Schwiegervater ihn letztendlich überzeugen würde. Er muss selbst ganz schön unter Druck stehen, wenn er jede Unterstützung einkalkuliert, überlegte Singer. Ich habe Manitu im Nacken und Manitu seinen Bankenaufsichtsrat, der sich mit besseren Kursen der Singerwerke ein gutes Geschäft erhofft. So funktionierte das System.
„Nun, es ist Ihr Problem, wenn Sie Ihre Beziehungen nicht nutzen!“, sagte Breitschmidt kalt. „Aber Sie werden mir den Restrukturierungsplan präsentieren. Wenigstens Fünfzig–tausend, daran werde ich Sie messen.“
„Nein!“, entgegnete Singer und richtete sich auf.
Manitu war einen Augenblick lang verblüfft. Die Faust auf dem Schreibtisch öffnete sich und schloss sich wie unter Krämpfen. „Was soll das heißen? Was sagen Sie da?“
„Nein. So lange ich Vorsitzender bin, wird sich die Mitarbeiterzahl der Singerwerke nur durch natürliche Abgänge verringern.“
Einen Augenblick war es still. Im Nebenzimmer waren die Schritte seiner Sekretärin zu hören. Durch das offene Fenster kamen die Geräusche der vorbeifahrenden Lastwagen und Busse. Es war die Zeit, wo die Wirte die Schirme aufspannten und die Stühle vor ihre Lokale stellten.
Manitu keuchte asthmatisch. „Ich habe mich wohl verhört? Es geht um Ihren Kopf, Singer!“
„Ich werde nicht durch hektische Entlassungen wertvolles Wissen, Erfahrung und Können wegwerfen, nur damit die Kurse wieder in die Höhe gehen.“
„Sie sind undankbar!“, änderte Manitu seine Taktik. „Ich habe Sie vor den Angriffen im Aufsichtsrat immer in Schutz genommen. Ich habe denen immer wieder gesagt, dass ein Singer mit dem Konsul im Hintergrund über Kontakte verfügt wie kaum ein anderer Vorstandsvorsitzender. Deswegen haben Sie noch einmal eine Chance bekommen und Ihnen wird nicht gleich der Stuhl vor die Tür gestellt. Sie verhalten sich unkooperativ.“
„Sie werden mich nicht los, so lange die Aktienmehrheit mich schützt“, unterbrach ihn Singer lächelnd.
Das Gespräch war gekippt. Beide wussten dies. Singer war nun im Vorteil, weil er sich durch Manitus schärfste Waffe, nämlich ihn zu feuern, nicht hatte einschüchtern lassen.
„Singer, Singer!“, brummte Manitu bitter. „Sie machen es mir wirklich schwer. Es scheint Sie geradezu kalt zu lassen, dass Sie Ihren Sessel verlieren.“
„Noch sind wir nicht soweit. Aber es stimmt. Es geht mir nicht darum, ihn um jeden Preis zu halten. Ich mache mir nicht die Hände schmutzig.“
Singer war selbst verwundert, zu welchem Ergebnis das Gespräch geführt hatte und Breitschmidts Reaktion ließ erkennen, dass auch er darüber unglücklich war.
„Es tut mir leid um Sie, um Ihre Frau!“ sagte der Aufsichtsratsvorsitzende zögernd, als überlege er, wie er Singer doch noch beikommen könne und was er falsch gemacht hatte, dass Singer so gänzlich die Spielregeln missachtete. Fast klagend fuhr er fort: „Alle tun es. Nennen Sie mir einen großen Konzern, der heute nicht abspecken muss. So etwas wie Sie habe ich noch nicht erlebt!“
Nach diesem Ausruf stutzte Breitschmidt und in seine Augen trat ein ungläubiger fast ängstlicher Ausdruck.
„Sie wollen wohl, dass wir auf Sie verzichten? Natürlich, Sie haben ein anderes Angebot, nicht wahr? Das ist nicht ehrlich, Singer. Das habe ich nicht verdient. Wo wir uns so gut kennen. Auch von Haus zu Haus. Hat Ihr Schwiegervater vor, Sie in seinem Konzern an die Spitze zu stellen? Es wird ja schon seit geraumer Zeit gemunkelt, dass er sein Haus bestellen will.“
Natürlich musste der Aufsichtsratsvorsitzende so denken. Nur bei einem besseren Angebot war Singers Verhalten für ihn verständlich.
„Nein!“, widersprach Singer ruhig.
„Nein? Was heißt das?“
„Ein Singer verlässt den Singerkonzern nicht ohne weiteres. Sie müssen mich schon aus dem Sessel kippen.“
Singer fand selbst, dass dies ein wenig zu theatralisch klang, zumal er festgestellt hatte, dass die Drohungen ihn nicht ängstigten, dass der Verlust des Chefsessels der Singerwerke keine Panik bei ihm auslöste. Was ist nur los mit mir, fragte er sich. Erlebst du gerade das, was die Medien ein „Burn–out–Syndrom“ nennen. Ist diese Gleichgültigkeit in dir, weil du ausgebrannt bist?
Breitschmidt stand wieder schnaufend auf. Erregt fuhr er mit der Hand durch die Luft.
„Ach was, Sie sollten mal vierzehn Tage ausspannen. Auf jeden Fall bleibt es dabei. Ende November werden wir im Aufsichtsrat Ihre Vorschläge diskutieren. Überlegen Sie sich alles noch einmal in Ruhe. Sprechen Sie mit Ihrem Schwiegervater. Wenn Sie doch noch zur Vernunft kommen, werde ich das heutige Gespräch vergessen. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Und ich tue es nur, weil ich Ihre Frau, Ihren Schwiegervater sehr schätze. Verpfuschen Sie nicht Ihr Leben. Sie benehmen sich ja wie ein Narr!“
Singer war ebenfalls aufgestanden. Breitschmidt nickte ihm noch einmal zu und stürmte aus dem Büro.
Die Kugler kam herein und ihre braunen Augen musterten ihn neugierig. „Was war denn los? Manitu war auf Hundertachtzig, als er rauslief.“
Mit einer automatischen Geste strich sie sich dabei das Haar zurück. Singer drückte ihr einige Akten in die Hand und ließ sich in den Ledersessel zurückfallen.
„Sie könnten vielleicht bald einen neuen Chef bekommen.“
„So schlimm?“, fragte sie ruhig. Sehr erstaunt schien sie nicht zu sein.
„Wir sollen abspecken!“, sagte er und schilderte ihr das Gespräch.
„Und Sie wollen sich dem wirklich verweigern?“
Ihre Augen verengten sich ungläubig. Sie griff in ihre Kostümjacke und holte ein Päckchen Zigaretten heraus. Singer gab ihr Feuer.
„Ja. Wir kommen auch ohne solche Radikalmaßnahmen durch. Natürlich werden die Aktienkurse eine Zeitlang im Keller bleiben.“
„Manitu wird dies nicht zulassen“, sagte sie und stieß den Rauch aus, wobei sie aufmerksam ihre Fingernägel betrachtete. „Ich weiß nicht, ob es so klug ist, den Michael Kohlhaas zu spielen.“
„Nein. Klug vielleicht nicht. Aber ich kann dann wenigstens noch gut schlafen.“
„Ich wusste immer, dass Sie kein Mann für harte Maßnahmen sind“, sagte sie offen und sah an ihm vorbei.
Das geht ja schnell, dachte Singer. Orientiert sie sich jetzt schon neu?
„Sie sind einfach ein zu netter Mann“, setzte sie schnell hinzu.
„Kein tolles Kompliment für einen Vorstand.“
„Nein“, gab sie zu. „Es ist auch kein Kompliment.“
„Na, dann wünsche ich Ihnen mit dem Mann für harte Maßnahmen viel Vergnügen, sollte er denn kommen.“
„Es wird kein Vergnügen sein. In meiner Position erwartet man das auch nicht. Ich werde auch mit einem Mann der Fakten zurechtkommen. Es wird schon gehen.“
„Sie werden prima zurechtkommen“, sagte er höhnisch, verletzt durch ihre offenen Worte.
„Oh ja. Vielleicht nicht prima, aber ich werde zurechtkommen.“
Auf ihren Wangen zeichneten sich rote Flecken ab.
„Passen Sie gut auf sich auf!“, warnte Singer.
„Ich habe sehr gern mit Ihnen zusammengearbeitet. Es gab einmal eine Zeit, da war ich sogar …“ Sie brach ab und sah ihn mit einem Blick an, wie er ihn von ihr nicht kannte, als erinnerte sie sich an etwas, was für sie eine Hoffnung gewesen war. „Ja. Sie haben es nicht einmal bemerkt. Es gab eine Zeit, da war ich sehr verliebt in Sie.“
Sie drückte die Zigarette in dem Aschenbecher aus, strich sich den Rock glatt und wollte hinauslaufen.
„Ich mag Sie doch auch. Habe ich das nicht immer erkennen lassen?“
„Ja. Sie mögen mich. Aber das ist auch alles“, sagte sie bitter und war wieder im Vorzimmer.
Singer brauchte einige Zeit, um dieses Geständnis zu verarbeiten. Er hatte nicht gewusst, wie ernst es ihr war, damals auf dem Betriebsfest. Er hatte geglaubt, dass er in beiderseitigem Interesse handelte, wenn er mit Schweigen darüber hinweg ging. Es ist immer ein Fehler, wenn man sich mit dem Personal einlässt. Das wusstest du, machte er sich Vorwürfe. Er war froh, dass er nicht mit ihr ins Bett gegangen war. Das wenigstens nicht. Aber andererseits schmerzte ihn ihre Enttäuschung. Aber nun konnte er sich nicht damit aufhalten. Er musste handeln.
„Können Sie mich mit meinem Onkel verbinden?“, sagte er in die Sprechanlage.
„Sofort!“, antwortete sie. Ihre Stimme klang kühl und professionell wie immer.
„Na, mein Junge, wo drückt der Schuh?“, hörte er die Stimme des alten Mannes. Für ihn würde er wohl immer ein Junge bleiben. Für einen fast Hundertjährigen waren alle unter siebzig junge Spunde.
„Weißt du es schon?“
„Was soll ich wissen? Ich weiß nur, wenn du am Montagmorgen noch vor dem Mittagessen anrufst, dann muss es bei dir brennen.“
Singer erzählte ihm von dem Gespräch und auch von Breitschmidts Andeutungen, dass Michael Singers Stiefsohn eventuell seine Aktien abstoßen wolle. Er hörte den alten Mann seufzen.
„Ja, mein Thomas. Was für eine Enttäuschung! Er hat mir gegenüber einmal so etwas angedeutet. Bei einer Übernahme durch Philadelphia Steel hofft er durch einen Aktientausch einen dicken Fisch zu fangen. Ich hatte geglaubt, dass ich ihm das ausgeredet habe. Die Kinder entwickeln sich nicht immer so wie man hofft. Ich werde aber noch einmal mit ihm reden. Die Singerwerke dürfen nicht verschwinden, und darauf läuft es hinaus, wenn wir von den Amerikanern übernommen werden.“
„Habe ich richtig gehandelt, als ich abschlug, Entlassungen vorzunehmen? Fünfzigtausend, das ist eine Kleinstadt, die ich freisetzen soll.“
„Natürlich hast du nicht richtig gehandelt …, aber in meinem Sinne. Als ich die Geschäfte von meinem Bruder übernahm, der, wie du weißt, mit den Nazis gekungelt hat, nahm ich mir vor, einiges gut zu machen. Unsere Politik war nach dem Krieg davon geprägt, unseren Mitarbeitern einen guten und sicheren Arbeitsplatz zu geben und wir haben ihre Schufterei an den Hochöfen gut bezahlt. Nein, du hast in meinem Sinn gehandelt. Aber ich weiß nicht, ob wir gewinnen werden. Thomas ist ein unsicherer Kandidat.“
„Ich werde nicht nachgeben.“
„Das ist gut. Sorge dich nicht. Mein Testament weist dich als meinen Haupterben aus.“
„Ich sorge mich nicht deswegen. Ich sorge mich, ob ich es schaffe, unsere Mitarbeiter vor den Hyänen zu schützen.“
„Du musst kämpfen“, hörte er den alten Mann sagen. Aber wie er es sagte, schien er von seinen kämpferischen Eigenschaften nicht viel zu halten.
„Ich werde mir Mühe geben“, versicherte Singer.
„Du wirst dir sehr viel Mühe geben müssen. Du hast es hier mit Menschen zu tun, die verdorben sind und denen nicht einmal bewusst ist, was sie tun.“
„Ich werde kämpfen!“, versicherte er noch einmal.
3
Am gleichen Tag sah Singer Jonas zum zweiten Mal. Er kam gerade aus dem Adlon und verabschiedete sich von Kretschmann. Zufrieden schüttelten sie sich vor dem Hotel die Hände. Beide glaubten ein gutes Geschäft gemacht zu haben und dies ließ sie noch einen Augenblick vor dem Adlon entspannt zusammen stehen und zufrieden auf den Pariser Platz blicken, wo man dabei war, den hässlichen Fußball der Fußballweltmeisterschaft abzubauen. Kretschmann bedankte sich überschwänglich für das gute Essen und Singer fand, dass er allen Grund dazu hatte. Sie hatten ‚Dorade in Salzkruste‘ gegessen und Henkel hatte ihnen dazu einen trockenen kühlen Pouilly Fumé serviert. Genau der richtige Wein zu einem Fischgericht.
Aber der Dank galt nicht allein dem vorzüglichen Essen, mehr noch den Zuwendungen zur Pflege der Geschäftsbeziehungen, die sich auf einige hunderttausend Euro belief zuzüglich dem Urlaub auf der Seemöwe, der selbst die verwöhntesten Gäste zufriedenstellen konnte.
„Sie werden mit Ihrer Gattin traumhafte Tage in der Karibik verbringen,“ sagte Singer und sah dabei über den Pariser Platz zu dem Brandenburger Tor hin, dessen klare Linien ihn immer wieder aufs Neue begeisterte und das er genauso liebte wie den Gendarmenmarkt.
„Wie viele Gäste werden auf dem Schiff sein?“
„Meistens so um die zwanzig. Alles Leute aus der Wirtschaft. Sie werden sich wohlfühlen.“
„Meine Frau wird leider nicht teilnehmen können. Sie hasst die See.“
„Ach ja? Nun, an weiblicher Gesellschaft wird es nicht fehlen. Sie brauchen nur ein Wort zu dem Skipper sagen. Die Seemöwe schippert schließlich durch die Karibik. Sie wissen doch, Rum, Reggae und kaffeebraune Mädchen …“
„Nicht, dass ich ….“
„Nein. Was kann jemand gegen einen kleinen Spaß haben? Sie haben es das ganze Jahr schwer genug.“
Kretschmann war nun sehr erleichtert und verabschiedete sich schnell.
„Sie erhalten die Vertragspapiere noch in dieser Woche.“
„Fein. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben.“
Sie winkten sich gegenseitig zu und Kretschmann verschwand in dem Gedränge auf dem Boulevard.
Es war später Nachmittag und Singer hätte noch einmal ins Büro gehen können, und normalerweise hätte er es auch getan. Aber dies hätte ihn wieder mit Manitus Forderung konfrontiert, und nach der Einigung mit Kretschmann, die nicht einfach gewesen war und ein gutes Stück Geld gekostet hatte und ihm erst gelang, als er die Seemöwe mit ihren weißen Segeln unter karibischer Sonne in die Schlacht geworfen hatte, war er nun erschöpft und müde. Er ging den Boulevard hinunter und wechselte an der Ecke Friedrichstraße die Straßenseite und lief am Schweizer Haus vorbei zu Dussmann. Ihm fiel ein, dass er sich mit Helen am Abend auf einer Vernissage verabredet hatte.
„Aber nicht, dass du mich wieder versetzt, wie schon so oft!“, hatte sie gesagt.
Er seufzte bei dem Gedanken an die Menschen, die er dort vorfinden würde und die ihm so gleichgültig waren, wie Helen sie für geistreich, interessant und aufregend hielt. Sie hatte andere Ansprüche. Es war erst vier Uhr. Er hatte noch Zeit.
Eugen Singer liebte Bücher und infolgedessen auch Buchhandlungen, wenn er auch jedes Mal bedauerte, dass es fast nur noch Buchhandlungsketten gab, die mit amerikanischen Thrillern vollgestopft waren und wohlfeilen
Seelenmassagen. Als er jung und voller Illusionen gewesen war, hatte er davon geträumt, Schriftsteller zu werden. Er hatte sogar einige Kurzgeschichten geschrieben und sie an die Zeitungen geschickt, aber niemand hatte sie angenommen. Von diesen jugendlichen Träumen war die Leidenschaft für gute Bücher geblieben. Diese Buchhandlungssupermärkte hatten den Vorteil, dass man ungestört stöbern konnte. Er fand eine neue Fitzgerald–Ausgabe vom Diogenes Verlag und kaufte sie erfreut. Neben Faulkner war Fitzgerald sein Lieblingsautor. Niemand konnte die Atmosphäre eines Abends oder die Stimmung einer Gesellschaft so romantisch schildern wie der Autor des Jazz Age. Den Schluss vom „Großen Gatsby“ hielt er für den Höhepunkt der amerikanischen Literatur. Er wünschte sich, dass man auch Faulkner wieder einmal neu auflegen würde, denn seine Bücher aus den achtziger Jahren waren bereits reichlich zerfleddert.
Als er mit seinem Päckchen Bücher aus dem Laden trat, sah er den Alten neben einem Akkordeonspieler stehen und er erinnerte sich sofort, dass er ihm schon einmal begegnet war. Es war vierzehn Tage her. An einem Samstag. Er war mit Helen am Kurfürstendamm einkaufen gewesen. Der Samstagvormittag gehörte ihr. An jedem Samstagvormittag fuhren sie früh in die Stadt, um im KaDeWe einzukaufen. Er konnte sich erinnern, wieviel Spaß ihm das früher gemacht hatte. Doch in den letzten Jahren war daraus mehr und mehr eine Gewohnheit geworden, eine Verpflichtung. So war er jedesmal froh, wenn sie im Regent, im Restaurant „Fischer’s Fritz“ den Vormittag ausklingen lassen konnten. Meistens aßen sie dort einen leichten Fisch, Hechtröllchen in Weißweinsoße oder Loup de mer und tranken dazu ein Glas Taittinger. Er war gern im Regent, mochte die Atmosphäre, die Holztäfelung des Restaurants und den Ausblick auf den Gendarmenmarkt. Das Essen war stets hervorragend, genau so wie der Champagner. Vor dem Hotel hatte er sich gerade von Wilfried verabschiedet, dem hochgewachsenen Portier, der ihn wegen seiner gestelzten würdevollen Haltung an eine Figur aus einem Dickensroman erinnerte. Sie kannten sich seit Jahren, da er oft auch an Arbeitstagen im Regent aß und dort auch gern seine Geschäftspartner unterbrachte. Es war nicht so groß wie das Adlon und ganz in der Nähe seines Büros, und seine Gäste hatten sich immer wohlwollend über den Service geäußert.
Singer wartete auf Helen, die ihren Porsche aus der Garage in der Friedrichstraße holen wollte, als ein Mann auf ihn zukam, der in einem Historienfilm gut einen Propheten abgegeben hätte.
„Man kann nicht gerade sagen, dass du glücklich aussiehst, obwohl du doch eigentlich glücklich sein müsstest, wenn du in solch einem Haus schläfst.“
Mit diesen Worten hatte der Alte ihn angesprochen. Singer erinnerte sich noch, wie betroffen er darüber gewesen war. Es stimmte, was der Alte gesagt hatte. Der eigenartige Mensch war nicht so alt wie er schien. Bei genauer Betrachtung mochte er nicht viel älter als Singer sein. Nur der weiße Bart und das silbern schimmernde Haar, das ihm in Locken auf die Schulter fiel, vermittelten diesen Eindruck.
Es waren die Augen, die das Gesicht sympathisch machten. Braune, intensive Augen, die verständnisvoll, fast liebevoll blickten. Ein breiter Mund mit kräftigen weißen Zähnen, umrahmt von Lachfalten, verstärkte den freundlichen Eindruck. Die kühn gebogene Nase und der dunkle Hautteint gaben dem Alten etwas Fremdländisches. Er erinnerte ihn ein wenig an Georges Moustaki. Der Alte trug einen dunklen Mantel mit einer Kapuze, einen Dufflecoat, wie er in England bei den Studenten üblich und auch in Deutschland in den sechziger Jahren einmal Mode gewesen war. Vielleicht lag es an der Kapuze, dass Singer bei dieser Begegnung den Eindruck hatte, dass der Alte in diesem Aufzug einem Mönch glich.
„Warum sollte ich unglücklich sein?“, hatte Singer unwillig gefragt.
„Ja. Warum? Du bist gut gekleidet und dieses Hotel ist sicher nicht billig. Du hast bestimmt eine schöne Frau, ein Haus und die Sonne scheint. Warum solltest du unglücklich sein? Aber du siehst so aus.“
„Glück ist immer relativ!“, hatte Singer hilflos geantwortet.
„Richtig!“, hatte der Alte ihm beigepflichtet. „Aber wenn du nicht glücklich bist, wer sollte es dann sein? Es liegt an dir. Ändere dein Leben, ändere alles, denn es ist zu kurz, um unglücklich zu leben.“
„Bist du denn glücklich?“, hatte Singer gefragt.
Erst später wurde ihm bewusst, wie absurd die Situation gewesen war. Er im dunklen Anzug und mit Helens Einkaufstüten vor dem Luxushotel und ihm gegenüber der seltsame Alte, der wie ein Mönch aussah. Wilfried hatte ihm einen fragenden Blick zugeworfen, ob er den Alten verscheuchen sollte und Singer hatte den Kopf geschüttelt.
„Oh ja!“, war die Antwort des Alten gewesen. „Ich habe in der Suppenküche in Friedrichshain einen guten Eintopf bekommen. Es ist ein wunderschöner Tag, und die Frauen sehen heute aus wie Melodien in einem Violinkonzert oder wie Gemälden von Chagall entsprungen. Oben am Kronprinzenpalais spielen zwei Russen Vivaldi und Mozart. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Frauen wie Melodien durch die Straßen schweben sehe. Warte mal, vielleicht gefällt dir das Lied.“
Der Alte spitzte den Mund und fing an zu pfeifen. Eine Melodie aus „Vier Jahreszeiten“. Singer war kein großer Musikkenner, aber diese Melodie kannte er.
„Was kann einem Schöneres passieren als an einem Samstag dieses Lied zu hören und die Sonne scheint und die Frauen lachen glücklich“, fuhr der Alte fröhlich fort.
„Deswegen bist du glücklich“, stellte Singer spöttisch fest.
„Ja. Das Wichtigste sind natürlich die Frauen, die wie Melodien durch die Straßen schweben“, ergänzte der Alte schmunzelnd.
„Frauen, die wie Melodien durch die Stadt schweben. Auf so etwas muss man erst einmal kommen“, erwiderte Singer amüsiert. Der Weißbärtige lächelte zurück.
„Wenn man aufpasst, sieht man jeden Tag etwas, was einen glücklich machen kann. Man muss nur den Willen haben, es zu sehen, zu hören und zu riechen. Ja, riech doch einmal!“
Der alte Mann schloss die Augen und zog hörbar die Luft ein.
„Ah, wie gut das tut. Es riecht nach französischem Parfum, nach Menschen, die alles haben, die eigentlich glücklich sein müssten. Dieses Hotel ist wohl sehr teuer.“
„Es ist ein Fünfsternehaus“, erwiderte Singer. Er fand, dass es hier in der Charlottenstraße, dicht am Gendarmenmarkt, allenfalls nach Benzin roch, und war ein wenig traurig darüber, dass er nicht die gleichen Sinneseindrücke hatte wie der Alte.
„Eine Insel der Reichen, ein Camelot, nicht wahr?“
„Du hast wirklich eine lebhafte Phantasie!“, staunte Singer und war beeindruckt, welches Wissen und welchen Wortschatz der Alte hatte.
„Natürlich, Phantasie gehört zum Leben. Was würden wir ohne sie tun? Die Menschen hätten keine Häuser, keine Kleider und nicht einmal Gebete. Sie würden noch in Höhlen leben. Schade, dass du dein Glück nicht erkennen kannst. Aber es ist verständlich. Ein unglücklicher Mensch ist allein und lebt in einer dunklen Kammer. Ich hoffe, dass du sie eines Tages verlässt und glücklich wirst.“
Helen war mit dem Wagen erschienen und Singer hatte die Einkaufstüten aufgenommen.
„Ein schönes Auto“, sagte der Weißbärtige noch. „Du bist noch ärmer dran als ich dachte. So reich zu sein und dann nicht glücklich. Was muss denn noch geschehen, damit deine Augen wieder leben?“
Singer hatte die Frage nicht beantworten können, da Helen hupte, und er hatte dem Alten noch kurz zugenickt und war in den Wagen gestiegen. Aber diese Frage hatte ihn die ganze Zeit während der Fahrt nach Hause beschäftigt. Auch die Tatsache, dass er keine Antwort gewusst hätte. Helen hatte ihn gefragt, ob der Alte ihn angebettelt habe. Singer hatte dies verneint und nur ganz allgemein von einer interessanten Begegnung gesprochen. Seine Frau hatte ihn daraufhin erstaunt angesehen. Noch einige Tage war die Frage des Alten durch seine Gedanken gegeistert. ‚Was muss denn noch geschehen, damit deine Augen wieder leben?‘ Diese Frage tauchte immer wieder zwischen anderen Gedanken auf. Doch schließlich hatte er den Alten vergessen.