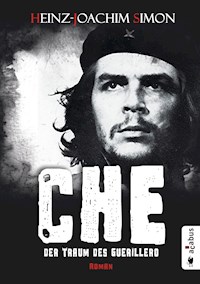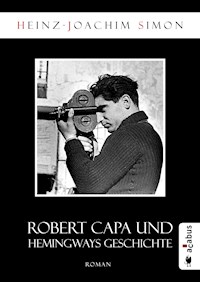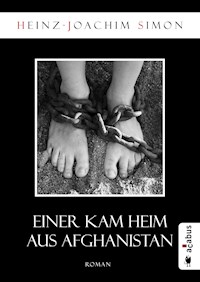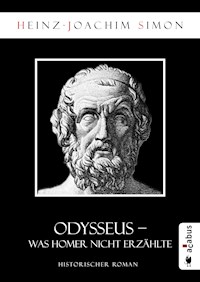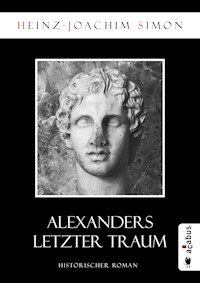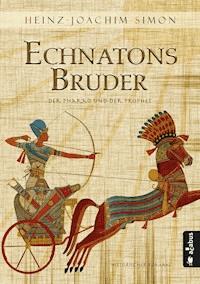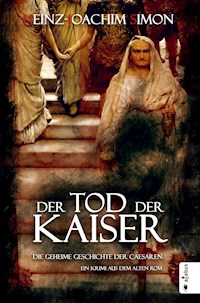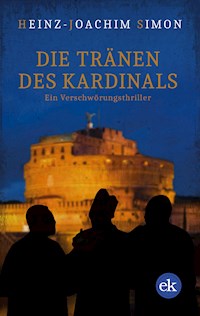Der Palast der unsterblichen Dichter. Das größte Abenteuer seit Dumas' Monte Christo E-Book
Heinz-Joachim Simon
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das größte Abenteuer seit Dumas' Graf von Monte Christo! In einem Pariser Palais treffen sich die Großen der Weltliteratur und erzählen gemeinsam ein letztes großes Abenteuer: Alexandre Dumas, Victor Hugo, Emile Zola, George Sand und Gustave Flaubert. Während Dumas und Balzac sich über die Größe ihres Genies streiten, verhöhnt George Sand die Eitelkeit ihrer männlichen Kollegen - Gustave Flaubert versucht zu schlichten. Dabei entsteht ein großartiges literarisches Gemälde des 19. Jahrhunderts. Wir durchleben den Aufstand der Pariser Kommune, den Barrikadenkampf in den Straßen. Der Held Julien Morgon wird ins Bagno nach Französisch-Guayana verbracht und kann von dort fliehen. Er wird ein Gaucho im Grasland Argentiniens und reitet für die indigenen Völker. Im Wind der Pampa liegt die Freiheit. - Er kehrt als Fürst von Almeria nach Paris zurück und rächt sich an denen, die ihn ins Gefängnis brachten … Spannend, romantisch, verzaubernd - große Erzählkunst!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 983
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz-Joachim Simon
Der Palast der unsterblichen Dichter
Das größte Abenteuer seit Dumas’ Monte Christo
Historischer Roman
Simon, Heinz-Joachim: Der Palast der unsterblichen Dichter. Hamburg, acabus Verlag 2019
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-643-8
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-642-1
Print: ISBN 978-3-86282-641-4
Lektorat: Larissa Jäger, SE, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © pixabay.com / #seville-187928_1920
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2019
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
VON WORT UND SCHRIFT.
IHR WERDET BLIND SEIN UND
BALD TAUB.
Ihr erkennt nichts mehr,
versteht nicht mehr die Schrift …
Fremd ist euch geworden, was Homer einst sang.
Ihr wisst nichts von den Taten des Gilgamesch …
Von Hamurabi habt ihr nie gehört …
IHR WERDET BLIND SEIN UND
BALD TAUB!
Wertlos ist euch das,
was am Anfang stand
und zu Ur und Theben in Stein gehauen wurde.
IHR WERDET BLIND SEIN UND
BALD TAUB!
Ihr merkt nicht, wie nackt ihr seid,
weil ihr die Schrift missachtet und das Buch …
IHR WERDET BLIND SEIN UND
BALD TAUB!
Doch noch ist der Ton da,
graben wir noch einmal Homers Worte hinein:
Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
welcher so weit geirrt, nach des heiligen Troja Zerstörung …
Noch sind die Worte nicht verschwunden, noch die Schrift …
NOCH NICHT – DOCH BALD?
H.-J. S.
Prolog
1 – Die Einladung
Fantasie an die Macht. So stand es im Mai 1968 an den Hauswänden des Boulevard St. Michel zu Paris. In den Straßen brannten die Autos. Das Pflaster der Boulevards war aufgebrochen. Graue Steine fielen blutbefleckt zu Boden. Eine Eliteeinheit der Polizei bekämpfte die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Knüppeln. Barrikaden standen am Boulevard St. Germain. Alles schien möglich. Eine Gesellschaft ohne Repressionen. Im Laufschritt ging es durch die Straßen. Die alte Losung bekam wieder Bedeutung: Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit. 1848 war gestern und 1789 nicht vergessen. Kommune war kein Schimpfwort mehr. Pausenlos tagte man in der Sorbonne.
Oh ja, es floss schon Blut. So war es also, Revolution zu machen. Mädchen schwenkten auf den Schultern ihrer Freunde rote Fahnen. Jede eine Jeanne d’Arc. Eine Zeitenwende. Der Funke sprang über, wie schon 1789, 1835 und 1848. In Berlin tagte der SDS. Untergehakt stürmte man über den Kurfürstendamm: »Ho-ho-ho Chi Minh« und »Venceremos, Genossen!«.
Verwegene Träume. Gefährliche Fantasien, schrieben die Zeitungen. Der Staatsapparat schlug zurück. Das Bürgertum ließ sich nicht anstecken. Was wollen die Chaoten? Wir leben doch in den besten aller Zeiten! In Berlin rief man »Zwei, drei, viele Vietnam!« und schwenkte das Bild von Che.
Gewiss, vieles war schief, vieles Karneval, vieles einfach Blödsinn. In der Bonner Republik ein Aufbegehren gegen den dumpfen braunen Mief. Hast du gemordet, Vater? Die Flamme wurde erstickt. Die garstigen Lieder verstummten. Ruhe kehrte ein. Man ging wieder studieren.
Von all dem war im 16. Arrondissement nichts zu spüren. Gastons Eltern waren erst kürzlich von Aix-en-Provence nach Paris gezogen. Er vermisste die lange Platanenallee vom Cours Mirabeau. Sein Vater hatte jetzt hier in der Avenue Bugeaud sein Anwaltsbüro aufgemacht. Er hoffte, in diesem Viertel der Reichen ein besseres Auskommen zu haben und es ließ sich gut an. Er, Gaston, vermochte Aix nicht zu vergessen. Es war für ihn nicht die Stadt Mirabeaus, sondern die seines Lieblingsmalers Cézanne, und wenn er an Aix dachte, sah er immer den Springbrunnen mit der großen Fontäne am Ende des Boulevards. Er spürte dann die Sonne auf seinem Gesicht.
Er war fünfzehn Jahre alt und noch gefangen in kindlichen Träumen, die von Alexandre Dumas und Victor Hugo genährt wurden. In seiner Fantasie ritt er mit D’Artagnan, litt mit Edmond Dantes im Chateau d’If, war Balsamo am Hof des Königs und bereitete die große Revolution vor. Sein Vater sorgte sich wegen seiner Träumereien.
»Er hat die Eierschalen immer noch nicht abgeworfen!«
»Lass ihm seine Jugend!«, verteidigte ihn die Mutter.
Seine Zukunft verbarg sich hinter einem Nebel. Homer hätte gemurmelt, dass die Götter sich noch uneins waren, was sie aus ihm machen wollten. Er besuchte eine Vorbereitungsschule zur Grande Ecole. Er fiel dort nicht durch Leistungen auf, sondern durch sein romantisches Aussehen: ein schmales Gesicht mit schulterlangen blonden Haaren und warmen braunen Augen.
»Hoffentlich will er nicht Maler werden oder gar Schriftsteller«, sorgte sich der Vater, wenn der Sohn dicke Wälzer aus der Bibliothek anschleppte. Bücher von Autoren, die er nicht kannte, wie Jack London, Mark Twain, Melville oder Edgar Allan Poe. Die Franzosen wie Flaubert und Zola ließ er noch gelten.
»Ich weiß, er hat Großes in sich«, setzte die Mutter seinen Bedenken entgegen.
Eine zarte, schmale Frau, so flüchtig wie eine Eisblume, sagten die Nachbarn, die Sartre und Camus las und ihren Mann mit zärtlicher Nachsicht wie ein großes Kind behandelte. Sie besuchte literarische Clubs und diskutierte dort bis in die Nacht über Verlaine, Rimbaud und Pound, dieses arme verrückte Genie.
Gaston wurde zwischen den unterschiedlichen Neigungen und Anforderungen seiner Eltern hin- und hergerissen, wobei er eindeutig der Mutter zuneigte, die ihn ein Wunderkind nannte, nur weil er infolge seines fabelhaften Gedächtnisses seitenweise Homer zitieren konnte. Auch Alexander der Große vermochte dies, pflegte sie bedeutungsvoll zu sagen. Der Vater schätzte diese Fähigkeit gering und hoffte, dass sie sich auswachsen würde.
Es geschah an einem der letzten Maitage. In der Avenue Bugeaud, dem Haus der Eltern gegenüber, lag ein schlossähnliches Anwesen aus der Belle Epoque mit einem vorgelagerten Park, in dessen Mitte ein Springbrunnen die Fontänen tanzen ließ. Von seinem Zimmer im dritten Stock hatte er einen guten Blick hinüber zum Palais. Links und rechts hatte es kleine turmartige Anbauten, die jedoch keinen sehr wehrhaften Eindruck machten, sondern nur beide Seiten des Gebäudes abschlossen. Dort, am Fenster des linken Turms, gewahrte er sie. Die Sonne verlieh ihr eine goldene Aureole. Er holte sein Fernglas von der Anrichte, stellte sorgsam das Okular ein und atmete tief aus. Er sah sie nun ganz deutlich.
Nie, so glaubte er, hatte er ein schöneres Gesicht gesehen. Etwas Helles, Reines ging von dem Mädchen aus. Sie erinnerte ihn an eine Fee, an die Geschichten, die ihm einst seine Großmutter erzählt hatte, eine Provenzalin. Tarascon war ihm ein Zauberwort. Er musste lächeln. Wenn er später an das Mädchen dachte, dann fiel ihm immer ihr Anblick am Fenster ein, wo eine goldene Aureole sie wie ein Traumbild aussehen ließ.
Das Mädchen hatte ihn bald entdeckt, verschwand und kam mit einem Fernglas wieder. Erschrocken zog er den Kopf zurück. Doch seine Neugier ließ ihn wieder hinübersehen. Sie winkte. Was mochte sie von ihm denken? Es war ihm peinlich. Durch die Ferngläser waren sie sich nun ganz nah. Minutenlang sahen sie sich an. Schließlich senkte sie das Fernglas, winkte noch einmal und verschwand. Er wartete. Aber sie kam nicht wieder. Er seufzte. Er spürte einen Verlust, denn er ahnte, dass etwas Außerordentliches passiert war, aber er hätte es nicht benennen können. Nun blieben ihm nur noch die Mathematikaufgaben. Über die verflixten Zahlen gebeugt, versuchte er, das Gesicht zu vergessen. Aber es gelang ihm nur sehr unvollkommen. Gibt es vielleicht doch Feen?, fragte er sich.
Zwei Tage später begegneten sie sich wieder. Er kam von der Ecole, als er sie erblickte. Er blieb vor dem schmiedeeisernen Tor am Eingang zum Park stehen. Sie saß in einem Rollstuhl vor dem Haus und lächelte ihm zu. Vorsichtig sah er um sich, stieß das Tor auf, betrat den Park und ging zu ihr. Sie erhob sich aus dem Rollstuhl. Er sah, dass ihr rechtes Bein in einer Schiene steckte. Er streckte ihr die Hand entgegen.
»Ich heiße Gaston Cartouche«, stellte er sich vor, ernsthaft, ganz gefangen von diesem zarten Gesicht mit den blauen Adern an der Schläfe.
»Cartouche, der Bandit?«, fragte sie lächelnd.
Wie weich ihre Hand ist, dachte er. Und wieder dieses Lächeln, das ihm die Kehle zuschnürte.
»Nein. Kein Bandit. Ich komme aus Aix«, sagte er unbeholfen. »Ich besuche eine Vorbereitungsschule zur Grande Ecole.«
»Eine gute Voraussetzung, um es im Leben voranzubringen.« Es klang etwas altklug, ihr Lächeln milderte dies jedoch.
»Sagt mein Vater auch. Aber ich langweile mich auf der Schule.«
»Was würdest du gern werden?«
Gaston zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß nicht. Meine Mutter meint, dass irgendetwas mit Kunst für mich das Gegebene wäre. Mein Vater will, dass ich Anwalt werde wie er.«
Sie machte vorsichtig ein paar Schritte zurück und setzte sich wieder in den Rollstuhl.
»Entschuldige. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Michelle James. Wir sind aus England. Meine Mutter ist jedoch Französin. Sie hat großen Wert darauf gelegt, dass ich so gut Französisch spreche wie Englisch. Wir sind eigentlich aus Torquay in Devon, haben aber in letzter Zeit in London gelebt, gegenüber dem Palast der Königinmutter.«
Im Schoß hatte Michelle ein Buch. Gefesselt von ihrem Gesicht hatte er es bisher nicht bemerkt. Interessiert beugte er sich vor.
»Eine Geschichte aus zwei Städten«, las er laut vor. »Von Dickens. Ich kenne von ihm Oliver Twist und David Copperfield.«
»Du kennst Dickens?«, rief sie erfreut. »Dieses Buch spielt während der Französischen Revolution. Hör mal zu!«
Eifrig schlug sie das Buch auf: »Schon der Anfang ist großartig.«
Sie befeuchtete ihre Lippen und hob die Hand, so andeutend, dass sie etwas Wichtiges vortrug: »Es war die beste, es war die schlechteste aller Zeiten. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das der Torheit, es war die Epoche des Glaubens, es war die des Unglaubens, es waren die Tage des Lichts, es waren die der Finsternis. Es war der Lenz der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung.« Sie ließ das Buch sinken. »Ist das nicht großartig?«
»Er ist auf gleicher Höhe mit Balzac«, sagte Gaston beeindruckt.
»Du kennst dich mit Büchern aus?«
»Meine Mutter sagt immer, dass man mit Büchern ein zweites Leben lebt. Ich liebe Balzac, Hugo, Zola und all die anderen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.«
»Warum ausgerechnet Balzac und Zola?«
»Weil sie sich eine eigene Welt erschufen, mit hunderten von Figuren, die so wirklich sind wie das Leben.«
»Du liest also viel«, stellte sie befriedigt fest.
»Ja. Mein Vater nennt es Zeitverschwendung. Aber ich gehe nie ohne ein Buch aus dem Haus.«
Er zerrte an seiner Aktentasche, öffnete sie und hielt ihr ein Buch entgegen.
»Die Menschliche Komödie. Gobseck, Vater Goriot, Oberst Chabert. Und alle in einem Band. Wunderbar. Die gehören auch zu meinen Lieblingsbüchern«, sagte sie aufgeregt. »Ich lese auch gern Zola. Die Rougon-Marquart-Bücher, die das Leben der Pariser Gesellschaft im Zweiten Kaiserreich schildern.«
»Und welches Buch von ihm hat dir am besten gefallen?«
»Germinal, Nana – Das Werk. Und Der Bauch von Paris. Also fast alles von ihm«, erwiderte sie glücklich lachend.
»Ja. Er war ein ganz Großer«, gestand er mit rotem Kopf.
»So wie Balzac. Die großen Schriftsteller sind alle besessen«, erwiderte sie bestimmt.
»Du liest also auch gern«, stellte er unnötigerweise fest, nur um diese Gemeinsamkeit herauszustreichen. Sie nickte eifrig.
»Aber nicht nur die Klassiker, sondern auch Sartre, Camus, Malraux. Camus vor allem. Hast du Mensch in der Revolte gelesen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ein ganz wichtiges Buch. Du solltest es lesen. Es könnte dein Leben beeinflussen. Wenn es die Studenten vom Boul’ Mich sorgsam lesen würden, hätten sie eine Chance zu begreifen, dass ihre Absolutheit auf sie selbst zurückfällt.«
»Ich werde es mir kaufen.«
»Nein. Ich werde es dir leihen. Schiebst du mich an den Eingang?«
Er stellte sich hinter den Rollstuhl und schob sie vorsichtig an die Treppe heran. Michelle erhob sich und humpelte, sich am Geländer festhaltend, die Treppe hoch.
»Warte. Ich bin gleich wieder da.«
Die Tür wurde geöffnet. Ein schwarz befrackter Diener nahm den Rollstuhl in Empfang. Gaston wartete. Er war ganz benommen und stand unter dem Eindruck, dass der Tag heller geworden war, die Vögel im Gebüsch aufgeregter lärmten und eine Lerche sich jubelnd in den azurblauen Himmel schraubte. Das Mädchen kam wieder und reichte ihm das Buch.
»Camus«, sagte sie knapp. »Du kannst es behalten. Wir haben es doppelt.«
»Sehen wir uns wieder?«, fragte er schüchtern, dabei wieder rot werdend.
»Aber ja doch. Du wohnst doch gegenüber. Wenn du mich sehen willst, stellst du ein Buch auf deine Fensterbank. Wir treffen uns dann am nächsten Tag um die gleiche Zeit wie heute im Park.«
Der schwarz gewandete Diener, mit einem weißen Haarkranz um die spiegelnde Glatze, erschien erneut.
»Gnädiges Fräulein, Ihr Vater erwartet Sie.«
Michelle nickte hoheitsvoll.
»Ist gut, Vater Goriot. Abgemacht?«, wandte sie sich Julien zu. »Er heißt natürlich anders. Aber ich nenne ihn so – nach der Romangestalt von Honoré de Balzac. Es ist also abgemacht?«
»Abgemacht!«, bestätigte er und fragte sich, was das war, was ihn warm durchströmte. Er wusste noch nicht, dass so die Liebe anfängt.
Von dem Tag an trafen sie sich wieder und wieder und erzählten einander von den Büchern, die sie gerade lasen und die der andere unbedingt lesen sollte.
Es war ein später Freitagnachmittag, der gerade in einen goldenen Abend überging, als sie unter dem Zedernbaum saßen und sie sagte: »Ich glaube, jetzt sind wir soweit. Du wirst zu den Eingeweihten gehören.«
»Zu wem?«, fragte er erstaunt.
»Du bist würdig, den Palast der unsterblichen Dichter kennenzulernen. Ich werde dich einführen. Komm heute Nacht kurz vor zwölf an unsere Tür. Ich werde dich erwarten und dir eine Welt zeigen, die dich für immer glücklich machen wird.«
Wieder spürte er dieses warme Gefühl in sich hochsteigen. Er staunte über sich selbst, als er sich sagen hörte: »Seit ich dich kenne, bin ich glücklich, Michelle.«
Sie beugte sich zu ihm, legte ihre Arme um seinen Hals und ihre Lippen berührten ihn so sanft wie die Berührung durch einen Schmetterlingsflügel.
»Werde ein Dichter, Gaston. In allen anderen Berufen wirst du unglücklich werden.«
»Dazu muss man Talent haben.«
»Das hast du. Fantasie und Träume. Was du heute Nacht erleben wirst, wird dich davon überzeugen, dass du zu den Eingeweihten gehörst und in deinem Kopf bereits all das ist, was du hörst. Es muss nur noch in dir befreit werden.«
Der Greis in seinem altertümlichen Frack erschien und verbeugte sich. »Mademoiselle, Ihr Vater möchte, dass Sie ins Haus kommen. Es wird kühler und Sie dürfen sich nicht erkälten.«
»Gut, Vater Goriot. Bringen Sie mich ins Haus.«
Sie zwinkerte Gaston zu und dieser zwinkerte zurück. Der Alte hieß zwar nicht Goriot, aber er sah aus als wäre er aus dem Roman von Balzac entstiegen.
Er ging aus dem Park und wandte sich am Tor noch einmal um. Der alte Diener trug Michelle gerade die Treppe hoch.
»Du kommst doch wie abgemacht?«, rief sie ihm zu.
Er nickte heftig und ging über die Straße zu dem Haus seiner Eltern, das neben dem Eingang ein kupfernes Schild aufwies: Albert Cartouche, Rechtsanwalt und Notar stand dort in Versalbuchstaben.
Nach dem Essen bat ihn der Vater zu einem ernsthaften Gespräch in sein Büro. Wenn er ihn in sein Heiligtum bat, ging es immer um etwas sehr Unerfreuliches.
»Ich habe heute einen sehr beängstigenden Anruf von Maître Lagrange von der Ecole erhalten. Er sagte mir, dass es mit deinen Leistungen weiter bergab geht. Wenn nicht bald eine Besserung eintritt, wird man dich von der Schule werfen. Du bist dabei, dein Leben zu vergeuden!«
»Dann wird er eben etwas anderes werden als eine Bürokraft«, verteidigte ihn die Mutter, die herbeigeeilt war, um ihrem Sohn beizustehen.
»Setz ihm noch mehr solche Flausen in den Kopf und er wird ein Clochard unter den Brücken«, schnaubte der Vater. »Ich gebe ihm die Möglichkeit, an einer Grande Ecole zu studieren und als Dank verhunzt ihr beide seine Zukunft!«
»Ich weiß, dass aus ihm etwas Besonderes wird«, erwiderte die Mutter im Brustton der Überzeugung und warf ihrem Sohn einen verschwörerischen Blick zu.
Gaston saß unglücklich zwischen den beiden. Er liebte seinen Vater trotz dessen Vorhaltungen, diesen stets korrekt gekleideten Mann mit der bleichen Haut, den traurigen Augen, dem leidenden Zug um den Mund, der stets nach Lavendelwasser roch. Mit den grauen Schläfen und dem sorgfältig gestutzten Oberlippenbart sah er aus wie eine Figur aus den Erzählungen von Maupassant. Der Vater seufzte und sah niedergeschlagen zu den in rotes Leder gebundenen Gesetzesbüchern hinüber.
»Hör nicht auf die Einflüsterungen deiner Mutter. Sie ist eine Träumerin. Das ist als Frau sehr charmant, aber von uns Männern verlangt das Leben, dass wir zupacken und uns das Können, in welchem Beruf auch immer, hart erarbeiten.«
Gaston nickte, war aber bereits mit den Gedanken bei dem, was ihm Michelle in dieser Nacht eröffnen wollte. Er sah auf die Uhr.
»Hast du heute noch etwas vor?«, fragte der Vater missbilligend.
»Ich habe noch eine Verabredung«, gestand Gaston freimütig.
»Was? Zu dieser Zeit? Mit wem?«
»Du kennst sie nicht.«
»Also mit einem Mädchen? Verstehe. Ist das der Grund, warum du immer schlechter in der Schule wirst? Kommt gar nicht infrage. Mädchen und Rendezvous sind viel zu früh für dich.«
»Er ist fünfzehn. Du solltest bedenken, dass die Jugend heute früher erwachsen wird«, trat die Mutter für ihn ein.
»So lange er die Beine unter meinen Tisch stellt, richtet er sich nach meinen Anweisungen. Du bist schuld, wenn er zu einem Filou wird!«, fauchte der Vater.
Sie haben sich doch einmal geliebt, dachte Gaston. Was war mit den beiden passiert, dass sie sich so gleichgültig waren und manchmal sogar hassten?
»Wer ist das Mädchen?«, bohrte der Vater. »Eines der Flittchen aus den Jazzkellern des Quartier Latin?«
»Du bist hoffnungslos altmodisch, Albert. Bei den jungen Leuten ist Beat angesagt. Oder hast du noch nichts von den Beatles gehört?«
»Diese Pilzköpfe aus England? O tempora, o mores. Wohin steuert die Welt? Also, was ist das für ein Mädchen?«
»Es ist Michelle James, aus dem Palais gegenüber«, gestand er mürrisch. Er hatte dabei das Gefühl, Michelle zu verraten.
»Diese Engländer?«, staunte der Vater. »Na immerhin, es scheinen mir ordentliche Leute zu sein.«
»Na klar, weil sie ein Palais haben«, kommentierte die Mutter ironisch.
»Es lässt jedenfalls darauf schließen, dass es eine honorige Familie ist. Also meinetwegen. Aber pass auf. Für etwas Ernstes bist du noch viel zu jung. Nicht, dass du eine ernste Verbindung eingehen musst.«
»Albert, du wirst geschmacklos«, mahnte die Mutter.
»Er würde sich seine ganze Zukunft verbauen«, fuhr Albert Cartouche unbeirrt fort. »Habt ihr schon …? Du weißt, was ich meine.«
»Nein. Haben wir nicht«, antwortete Gaston verlegen.
Er hatte noch nie mit einer Frau geschlafen. Bisher begnügte er sich mit dem Playboy als Vorlage für gewisse körperliche Vergnügungen.
»So ganz hast du deinen Verstand also noch nicht verloren. Was interessiert dich denn an dem Mädchen? Oder besser, was interessiert ein Mädchen, das in einem Palast wohnt, an Gaston Cartouche?«
»Wir reden viel über Bücher. Sie ist ungeheuer belesen.«
»Ein Blaustrumpf!«, höhnte der Vater. »Aber andererseits vielleicht doch ganz gut, dass ihr keine anderen Interessen habt.«
»Bravo, mein Sohn«, freute sich die Mutter.
Er war froh, dass er sich mit der Bemerkung, noch lernen zu müssen, nach oben auf sein Zimmer verdrücken konnte. Statt sein Pensum zu studieren, vertiefte er sich in Stendhals ›Kartause von Parma‹. Der Roman spielte in einer Zeit, in der noch Kronen in der Gosse lagen, wie Napoleon es einst formuliert hatte.
Um halb elf wurde es unten ruhig, die Eltern gingen früh zu Bett. Als es kurz nach halb zwölf war und er sich sicher sein konnte, dass seine Eltern schliefen, schlich er die Treppe hinunter und öffnete behutsam die Haustür. Er zuckte zusammen, als sie laut quietschte. Er stand wie gebannt und horchte. Nein, die Eltern waren nicht wach geworden. Er trat hinaus und sah die Straße hinunter. Niemand war zu sehen. Er lief zum schmiedeeisernen Tor des Palais. Es war nicht verschlossen. Gaston ging über den Kiesweg auf das Palais zu. Unter seinen Füßen knirschten die Steine. Die Tür vor ihm öffnete sich, kaum dass er die Treppe erreicht hatte. Michelle stand im Eingang. Sie machte einen Knicks und wies hinter sich.
»Willkommen im Palast der unsterblichen Dichter.«
Er griff nach ihrer Hand und ihre Finger verschränkten sich mit seinen. Hand in Hand gingen sie in die große Empfangshalle, die meterhohe rotbraune Bücherregale aufwies. Er ging betont langsam, nahm Rücksicht auf ihre Behinderung. Sie schüttelte den Kopf. Lächelte. »Es geht schon.«
Sie stiegen eine Treppe hoch und betraten eine weitere holzgetäfelte Halle, in der ein Kamin brannte. Michelle legte den Finger auf den Mund und wies auf den großen Tisch, an dem sechs Männer und eine Frau saßen. Gaston kannte sie alle. In der Mitte des Tisches lag ein Totenkopf. Vor den Männern standen gläserne Pokale, in denen es golden schimmerte. Über ihnen brannte ein wagenradgroßer Lüster.
»Das kann doch nicht möglich sein«, entfuhr es ihm.
Die Herrschaften um den Tisch beachteten sie nicht, schienen sie nicht einmal zu sehen. »Du siehst nur das, was in deinem Kopf ist«, flüsterte Michelle. »Es sind Balzac, Zola, Hugo und Dumas. Der mit dem mächtigen Bart ist Flaubert. Die schöne Frau ist George Sand. Der Dürre mit den karierten Hosen ist Dickens aus England.«
»Ja. Ich erkenne sie alle«, bestätigte er flüsternd. »Manche hat Daumier gezeichnet.«
»Du kannst ruhig lauter sprechen. Wir gehören nicht zu ihrer Welt.«
»Sie sind … Geister?«
»Und doch sind sie unsterblich und bleiben für uns lebendig. Sie sind deinem Kopf entstiegen. Aber nun wollen wir ihnen zuhören. Es wird eine aufregende Nacht. Setzen wir uns etwas abseits neben den Kamin.«
»Wie fangen wir es an?« George Sand sah fordernd in die Runde. »Wo habt ihr nur den scheußlichen Totenkopf her?«, setzte sie hinzu und kräuselte indigniert die Nase.
»Das ist der Schädel des großen François Villon, der treffliche Sänger und Vagant, der uns manch schönen derben Vers geschenkt hat«, erklärte Balzac mit dem ihm eigenen Pathos.
»Das beantwortet nicht meine Frage.«
»Ich habe ihn bei dem Trödler Archantes entdeckt. Er versichert mir mit Expertise, dass es der Originalschädel des großen Villon ist.«
»Hauptsache, du glaubst daran«, gab George Sand schnippisch zurück. »Schlepp aber nicht mehr von dem Zeug an.«
»Er wird eines Tages noch mit dem Jochbein des großen Homer auftauchen«, lästerte Dumas grinsend.
»Hört auf! Fangen wir endlich an. Ich denke, die Geschichte sollte mit meinem Tod enden«, schlug Zola vor.
Bis auf Flaubert nickten alle traurig.
»Nein. Wir sollten das nicht gleich am Anfang festlegen. Lassen wir die Geschichte sich entwickeln.«
»Wir sollten gleich stürmisch in die Geschichte einsteigen«, schlug Balzac vor. »Ich hätte zur Anfeuerung meiner Fantasie gern noch einen Mokka.«
Daraufhin tauchte ein Diener auf und stellte den Mokka vor ihn hin.
»Das ist doch Vater Goriot aus meinem gleichnamigen Roman!«, staunte Balzac.
»Wir sind im Palast der Unsterblichkeit, mein Guter«, erwiderte George Sand mit maliziösem Lächeln.
»Wir sollten endlich anfangen«, drängte Flaubert.
»Du meinst, wir sollten mit den Tagen der Kommune beginnen?«, fragte Hugo.
»Ja, mein Lieber. Um zu erklären, warum man Zola umbrachte, müssen wir zu den Tagen der Schande und Ehre zurückgehen«, pflichtete George Sand bei.
»Zu den Tagen, als die Elenden gegen ihr Unglück aufbegehrten? Da bin ich dabei«, stimmte auch Zola zu.
Balzac zupfte sich die Kutte zurecht und nahm einen Schluck Mokka.
»Ganz vorzüglich! Die richtige Stärke«, stellte er fest.
»Wie machen wir es?«, drängte die Sand.
»Ich denke mir das so«, sagte Dumas nachdenklich. »Jeder erzählt ein Kapitel. Der nächste muss dann die Geschichte fortführen. Ich denke, Dickens sollte anfangen. Er hat über Kinder ein paar hervorragende Sachen geschrieben. Ich bewundere dich für deinen Oliver Twist und den … Dings Copperfield. Gute Literatur!«
»David Copperfield«, korrigierte Dickens indigniert.
»Schon gut, alter Freund. Ich lege danach mit dem nächsten Kapitel los und dann greift Zola den Faden auf und so weiter. Bei den Eiern des François Villon, wir, die Unsterblichen, basteln eine Geschichte unserer Geschichten zusammen. Das wird ein Spaß!« Balzacs Gesicht glühte vor Begeisterung.
»Wir werden die Gestalten aus unseren Büchern mitspielen lassen. Wir werden die Schwierigkeit haben, die unterschiedlichen Stile zu einer Einheit zu verschmelzen.«
»Ach was, George Sand kann alles mitschreiben. Sie wird schon darauf achten, dass wir die Kapitel nicht zu unterschiedlich erzählen«, schlug Dumas vor.
»Du hast wohl mit Porthos zu viel Wein gebechert? Ich bin eine genauso gute Erzählerin wie ihr. Nein, ich bin nicht eure Schreibmadame.«
»Wir werden Vater Goriot bitten, alles aufzuschreiben. Er liebt auch gute Geschichten«, schlug Flaubert beschwichtigend vor.
»Warum eine Gestalt von Balzac?«, protestierte Dumas. »Immer steht Balzac im Mittelpunkt.«
»Bleibt friedlich!«, mahnte Flaubert. »Habt ihr alle verstanden, wie die Regeln sind?«
»Klar doch«, winkte Hugo ab. »Jeder muss mit seiner Erzählung an die vorherige anschließen und dann den Stab weitergeben.«
»Richtig. Aber es muss glaubwürdig abschließen. Nur so wird ein Buch draus, das ein guter Verlag veröffentlichen wird.«
»Wir müssen in die Figuren hineinkriechen, damit der Erzählstil nicht zu unterschiedlich wird.«
»Ich finde, wir haben genug geredet, wir sollten beginnen«, drängte Dumas. »Unser Epos endet mit dem Verbrechen an Zola und mit der Aufdeckung, wer das Verbrechen begangen hat. Genau so dramatisch würde ich gleich einsteigen.«
»Du hast die Trommel laut genug geschlagen. Dickens, fang endlich an!«, sagte die Sand und stieß Rauchkringel aus, die sich langsam auf Dumas zubewegten. »Sonst wird er uns gleich wieder daran erinnern, dass seine Bücher weltweit die größte Verbreitung gefunden haben.«
»Stimmt das etwa nicht?«, fauchte Dumas. »Vor mir liegt auflagenmäßig nur die Bibel.«
»Gib nicht so an«, grollte Balzac. »Du hast eine Menge Schinken für kleine Dienstmädchen und gelangweilte Bürgersfrauen verzapft. Große Literatur ist was anderes.«
»Große Literatur? Was ist das?«, brauste Dumas auf. »Meine Bücher liest man in Amerika und in Argentinien. Selbst im fernen Australien kennt man den Namen Alexandre Dumas. Der große Garibaldi war ein Verehrer von mir. Es gibt wohl kein Buch, das häufiger verlegt wurde als ›Die drei Musketiere‹. Da kommt ihr alle nicht mit. Selbst wenn ihr eure Auflagen zusammenlegt.«
»Angeber! Du bist mal wieder unerträglich«, fauchte Balzac.
»Hört auf zu streiten!«, fuhr die Sand dazwischen. »Ihr benehmt euch wie kleine Jungs. Also, wir sind uns einig, dass Dickens beginnt. Er ist der Gast und ihm gebührt die Ehre anzufangen. ›Oliver Twist‹ ist wirklich ein feines Buch. Und mit Revolutionen kennt er sich aus, was sein Roman ›Die zwei Städte‹ beweist.«
»Also los! Genug geredet. Fangen wir an«, sagte Hugo ungeduldig.
»Wieso genug geredet? Es geht doch ums Reden«, sagte Dumas mit selbstgefälligem Blinzeln.
»Ja, Englishman, lass deine Pickwickier aufmarschieren.«
»He, unsere Geschichte spielt in Paris«, meldete sich Zola.
»Wir haben Azincourt vergeben und vergessen. Erzähl es so authentisch wie möglich«, forderte Dumas.
»Hör auf!«, blaffte Balzac. »Schon seit der Eroberung von Orléans durch die Heilige Jungfrau Jeanne d’Arc ist diese Schmach getilgt.«
»Die die Engländer verbrannt haben«, keilte Dumas zurück.
»Es waren Franzosen, die sie verurteilten«, erinnerte Zola.
»Ja. Bei uns gibt es immer wieder mal ein paar vortreffliche Kanaillen«, gab Flaubert zu.
»Ich stelle es mir so vor: Julien Morgon steht auf den Champs Elysées und sieht zu, wie die Armee vorbeidefiliert. Und das Volk schreit begeistert: ›Krieg!‹. Nie hatten die Regimenter des Kaiserreiches prächtiger ausgesehen …«
1. Buch
Das alte schöne Lied von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
2 – Der Kaiser mit der falschen Frau
(Charles Dickens erzählt)
Julien Morgon stand im hellen Sommerlicht auf den Champs Elysées und sah den stolz vorbeimarschierenden Regimentern zu. Nie hatte eine Armee prächtiger ausgesehen. Die Sonne schien heiß auf die Truppen und viele wähnten, dass es die Sonne von Austerlitz war. Julien Morgon stand inmitten des jubelnden Publikums und schrie mit den tausenden von Zuschauern: »Hoch lebe der Kaiser!«
Gewiss, die Soldaten sahen prächtig aus. Die Säbel blitzten, die Brustharnische der Kürassiere glänzten, die roten Federn an den Helmen hüpften im Takt der Marschmusik. Man war überzeugt, dass man bald durch das Brandenburger Tor marschieren würde.
»Verhaut die Preußen! Verhaut die Preußen!«, stieg es aus tausendfachen Kehlen in den Himmel.
Julien Morgon war an einer Laterne hochgeklettert, so dass er einen guten Blick auf die marschierenden Truppen hatte. Die Adlerstandarten glänzten golden, die Kaiserfahne blähte sich im Wind. Dumpf dröhnten die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster des Boulevards.
»Hat man je so prächtige Truppen gesehen?«, rief unter ihm ein wohlbeleibter Kleinbürger in einem speckigen Rock und mit einem Zylinder auf dem Kopf, der auch nicht viel besser aussah. Beifall heischend sah er um sich. Ein Hagestolz neben ihm, mit ausgezehrtem Gesicht und einer Hakennase und langen Koteletten, nickte bestätigend.
»Jawohl, General MacMahon hat versichert, dass in unseren Truppen der gleiche Siegeswille herrscht wie bei der glorreichen Armee, die bei Arcole, Jena und Borodino siegte. Die Preußen werden ein Desaster erleben.«
Der Wohlbeleibte neben ihm riss den Zylinder vom Kopf und schrie: »Hurra! Keine Gnade für die Preußen. Hoch lebe die Armee!«
»Hoch lebe der Kaiser!«, setzte der Hagere hinzu.
Es gab keinen Zweifel, Paris vertraute den Soldaten und dem Genie des Kaisers. Sie wussten nicht, dass Eugenie, die Frau des Kaisers, Napoleon III. zu diesem Abenteuer getrieben hatte.
Julien Morgon stutzte. Er sah eine Gruppe Jungen in seinem Alter herankommen. Keiner war älter als siebzehn Jahre. Er kannte sie. Sie waren aus seiner Klasse. Nun bemerkte er, dass sie ein überirdisches Wesen begleitete, das der Kaiserin gleichkam. Im Gegensatz zu dieser war sie blond. Ihre Haare fielen ihr reich auf den Rücken. Er hasste die jungen Männer um sie herum. Nicht, weil sie die Schönheit begleiteten, sondern weil sie ihn verachteten, auf ihn herabsahen, ihn nicht für würdig erachteten, eines Tages eine Grande Ecole absolvieren zu dürfen. Was hatte der Sohn eines Druckers und Papierhändlers neben den Söhnen der Väter zu suchen, die sich zur Elite des Kaiserreiches zählten.
Ihr Anführer war Auguste Mercier, sein Vater war Minister im Kabinett des Kaisers. Ein schwarzhaariger Junge mit einem scharfen Gesicht, mit dem Spitznamen ›der Husar‹, weil er unbedenklich jeden Streich anführte. Sein Vater sorgte schon dafür, dass sie keine ernsten Konsequenzen hatten. Neben ihm ging Hubert Henry, dessen Vater – ursprünglich ein Großbauer – sich durch glückliche Spekulationen einen Namen gemacht und dem Sohn die Gabe mitgegeben hatte, mit Zahlen jonglieren zu können. Er stimmte Auguste servil in allem zu, achtete aber darauf, dass er sich nicht zu sehr exponierte. Der dritte in der Gruppe war der schöne Charles-Ferdinand Esterhazy, der wie ein griechischer Gott aussah und der Schwarm aller Mädchen war und sich darauf eine Menge einbildete. Sein Vater war im Generalstab, sein Großvater General bei den Österreichern gewesen. Aufgrund mysteriöser Verdienste war er nach dem Wiener Kongress von den Franzosen ausgezeichnet und schließlich französischer Baron geworden. Der vierte war Jean Sandherr. Sein Vater war Textilfabrikant. Er hatte die Uniformen geliefert, in denen die Truppen paradierten. Insgeheim verachteten ihn die anderen, da er ein notorischer Schummler war und ständig von den anderen abschrieb. Dazu stieß manchmal Armand du Paty de Clam, dessen Arroganz selbst Auguste auf die Nerven ging. Aber man akzeptierte den stets elegant gekleideten Jüngling, da er einem der vornehmsten Adelsgeschlechter angehörte. Sie nannten sich die glorreichen Fünf. Sie wussten, dass auch sie eines Tages zur Elite gehören würden und ausersehen waren, eine herausragende Stellung im Kaiserreich einzunehmen.
Julien dagegen konnte nur durch das Stipendium des Baron Edmond de Savigny die Vorbereitungsschule zur Grande Ecole besuchen. Der gute Baron, wie man ihn in der Familie nannte, wohnte auch in der Avenue Bugeaud. Julien war ihm durch seinen Eifer und sein fröhliches Wesen aufgefallen, als er ihm voller Enthusiasmus im Papiergeschäft die verschiedenen Papiersorten für seine Geschäftsausstattung vorgestellt und die unterschiedliche Qualität erklärt hatte. Julien wusste über Edmond Savigny, dass er ein überzeugter Bonapartist war und sich den Spruch des großen Bonaparte zu eigen gemacht hatte, dass jeder einen Marschallstab im Tornister habe. Man munkelte, dass der Kaiser auf ihn höre und er mehr Macht habe als ein Minister. Sein Einfluss, so hieß es, sei in letzter Zeit zurückgegangen, da er sich nicht mit der Kaiserin verstünde. Trotzdem sah man ihn in den Tuilerien ein- und ausgehen.
Juliens Vater war stolz darauf, den guten Baron nicht nur als Kunden, sondern auch als Förderer seines Sohnes bezeichnen zu können. Der gute Baron schien Julien ins Herz geschlossen zu haben und in ihm jemand zu sehen, der es auch ohne entsprechenden Familienhintergrund zu etwas bringen könne.
Nun hatten auch die glorreichen Fünf Julien entdeckt.
»Seht mal, da ist doch der Papierhändler!«, schrie Auguste und wies auf Julien, der sich oben an der Laterne festhielt.
»Wie frech er dort oben auf uns herabblickt. Dieser Niemand nimmt sich heraus, unseren tapferen Soldaten zuzujubeln. Kommt, bringen wir dem Kerl Demut bei.«
Er nahm Pferdeäpfel auf, die seit dem Vorbeiritt der Kürassiere reichlich auf der Straße lagen und schleuderte sie zur Laterne hoch. Schon taten es ihm die anderen nach und Julien wurde mit Pferdeäpfeln eingedeckt. Doch diese trafen nicht nur ihn, sondern auch die am Straßenrand jubelnden Zuschauer.
»Nichtsnutzige Bengel!«, empörten sie sich.
»Ihr seid unfair«, rief das überirdische Wesen. Ihr Blick traf Julien tief ins Herz. Für diese Parteinahme hätte er noch ganz andere Beschwernisse in Kauf genommen.
»Hört auf! Ihr seid so feige«, erregte sich das Mädchen in dem weißen Kleid und schlug mit ihrem zierlichen Sonnenschirm Armand auf die Hand, sodass diesem das Wurfgeschoss entfiel.
»Was ist denn mit dir los, Mercedes?«, empörte sich Armand. »Das ist doch nur der Papierfatzke.«
»Er hat euch doch nichts getan. Also hört auf damit. Die guten Leute hier sind zurecht empört. Ihr stört ihre Freude am Anblick unserer tapferen Armee.«
»Auch ich bin ein Gefolgsmann des Kaisers«, rief Julien – obwohl ihm dieser bisher herzlich gleichgültig gewesen war – nur um dem Mädchen zu gefallen. Er rutschte von der Laterne hinunter, drängte sich durch die Zuschauer, lief auf den Boulevard und marschierte im Takt der Trommeln im Gleichschritt neben dem Fahnenträger mit.
»Es lebe die glorreiche Armee des Kaisers!«, rief Julien.
Die Menge am Straßenrand klatschte Beifall. Der Fahnenträger zog die Rose, die man ihm aus der Menge zugeworfen hatte, vom Revers und gab sie Julien.
»Bewahre sie gut auf. Sie wird dich an den Tag erinnern, an dem die große Armee auszog, um die Preußen zu besiegen.«
Julien schwenkte die Rose und ließ die Armee hochleben und die Menge am Straßenrand nahm seinen Ruf auf. Einen winzigen Augenblick lang war Julien ein Held auf den Champs Elysées. Jauchzend lief er zum Straßenrand und drängte sich durch die Menge. So mancher gab ihm einen gutmütigen Klaps auf den Kopf. An der Laterne angelangt, traf er nur noch das Mädchen an.
»Wo sind Auguste und die anderen?«, fragte er erstaunt.
»Ach, den guten Leuten hier wurde ihr Treiben zu bunt und sie haben sie vertrieben.«
»Darf ich dir die Rose der Grande Armée übergeben?«, sagte Julien mit einer Verbeugung, die auch Napoleons Hofmarschall nicht besser hinbekommen hätte.
»Für mich?«, fragte das Mädchen überflüssigerweise, knickste und nahm die Blume.
»Eine Rose für eine Rose«, gab Julien zurück und staunte über sich selbst. Nie hätte er angenommen, sich in solch einer Situation so weltgewandt ausdrücken zu können.
»Sieh mal an, dabei erzählte mir Armand, dass du nur ein kleiner Ladenschwengel bist.«
»Du weißt, wer ich bin«, sagte er unzufrieden.
Es stimmte. Sie kannten sich. Auch sie wohnte in der Rue Bugeaud. Doch bisher hatte sie ihn nicht beachtet oder so getan, als wäre er Luft. Denn sie wohnte im Gegensatz zu ihm in einem Palais auf der anderen Straßenseite.
»Deine Freunde mögen mich nicht. Sie sind der Meinung, dass ich nichts auf einer Grande Ecole zu suchen habe. Mein Vater, wie du weißt, hat nur die kleine Druckerei und den Papierhandel in der Rue Bugeaud.«
»Ach, tatsächlich. Du bist der Junge aus dem Papiergeschäft«, sagte sie, legte die zierliche behandschuhte Hand auf das Kinn und sah ihn nachdenklich an.
»Du hast mich doch schon gesehen«, erinnerte er sie unwillig an ihre kurzen Begegnungen.
»Ach, ich achte nicht so darauf, wer mich ansieht«, erwiderte sie hochmütig.
Sie ist ganz schön schwierig, dachte er ernüchtert. Sie bemerkte seine Enttäuschung und legte ihm die Hand leicht auf den Arm.
»Aber mir ist egal, von wem jemand abstammt. Mein Vater war einst auch nur ein einfacher Weinbergbesitzer bei Amboise, ehe ihn der Kaiser zum Baron ernannte. Ich heiße Mercedes Montaigne, du kannst mich aber Mercedes nennen.«
»Aus der Gegend, wo man Krammetsvögel isst und die Könige ihre schönsten Schlösser gebaut haben«, sagte er beeindruckt.
»Bist du ein Royalist?«, fragte sie stirnrunzelnd. »Meine Familie ist streng bonapartistisch.«
»Meine Familie ist fürs Volk. Mein Vater hält es mit der Republik.«
»Das will ich gelten lassen. Aus der Republik wurde schließlich das Kaiserreich. Der Kaiser vollendet den Willen des Volkes«, fügte sie altklug hinzu.
»Darf ich dich nach Hause begleiten?«
»Wir haben ja denselben Weg«, willigte sie ein. »Mein Vater kauft auch sein Briefpapier bei euch. Auch ich war schon öfter in dem hübschen kleinen Laden, in dem es so angenehm nach Papier riecht. Aber an dich erinnere ich mich nicht.«
»Ich bin auch nicht jeden Tag im Geschäft, sondern helfe nur hin und wieder aus. Lange wohnst du noch nicht in unserer Straße, nicht wahr?«
»Richtig. Wir sind erst seit zwei Monaten hier. Vater sagte, dass man in Paris präsent sein muss, wenn man mit der Heeresverwaltung Geschäfte machen will. Der Wein, den die Offiziere des Heeres trinken, stammt von unseren Weinbergen.«
»Dann muss es ein guter Wein sein.«
»Man lobt ihn allgemein«, sagte sie leichthin. Sie kam ins Stolpern, fiel gegen ihn und er stützte sie ab, hielt sie länger, als dies nötig war und sie ließ es zu. Eine feine Röte überzog ihr Gesicht.
»Wie hast du die glorreichen Fünf kennengelernt?«, fragte er und gab sich Mühe, seiner Stimme nicht anmerken zu lassen, dass ihm diese Bekanntschaft Sorgen machte.
»Ach, Augustes Vater hat meinem Vater beim Heeresamt geholfen. Als Minister hat er natürlich erheblichen Einfluss. Wir waren heute in dessen Haus in der Rue Rivoli zu Gast und Auguste fragte mich, ob ich mitkommen will. Natürlich wollte ich die Parade der Armee nicht versäumen. Seine fürchterlichen Kameraden stießen erst später dazu. Feine Kavaliere sind das! Sie haben sich von einem alten Hagestolz vertreiben lassen, als dieser mit dem Spazierstock auf sie einprügelte.«
Mittlerweile waren sie am Eingang zur Rue Bugeaud angelangt. Viel zu kurz war ihm die Wegstrecke vorgekommen.
»Darf ich dich wiedersehen?«
»Warum nicht?«, fragte sie lachend. »Ich werde morgen mit meiner Freundin Diane du Plessis den Jardin du Luxembourg besuchen. Vielleicht treffen wir uns dort rein zufällig?«
Sie lachte kokett, drehte den Sonnenschirm in ihrer Hand und zwinkerte ihm zu. Er hätte sie lieber allein getroffen, wagte aber keinen Einwand und antwortete, dass er sich freuen würde, sie wiederzusehen. Sie verabredeten sich zur Zeit des Mittagskonzerts. Er versuchte es beim Abschied mit einem Handkuss, aber sie entzog sich diesem.
»Aber nein. Du musst nicht galant sein. Bleib so, wie du bist.«
»Danke noch einmal, dass du mir beigesprungen bist.«
»Das war doch selbstverständlich. Fünf gegen einen ist einfach nicht anständig. Auguste ist manchmal ein Flegel.«
Sie nickte ihm zu und ging in den Hof des Palais. Er sah ihr nach, bis sie das Haus betreten hatte. Frohgemut ging er zum Papiergeschäft seines Vaters, der wie oft an Feiertagen vor der Tür stand und sich die Abendsonne ins Gesicht scheinen ließ.
»Was sehe ich? Mein Sohn in Begleitung der vornehmen Demoiselle de Montaigne«, empfing er ihn schmunzelnd.
»Ich habe sie bei der Parade auf den Champs Elysées getroffen. Und da wir den gleichen Weg haben …«
»Lässt sich eine Montaigne von einem einfach Morgon nach Haus begleiten. Sie sind wohl eine republikanische Familie?«
»Nein. Sie sind Bonapartisten.«
»Na, wenigstens keine Bourbonenanhänger.«
Sein Vater war ein sich gebückt haltender Mann in den Fünfzigern mit langen grauen Koteletten. Stets trug er eine blaue Schürze. Er sah älter aus, als er tatsächlich war. Arbeit und Sorgen hatten tiefe Falten in sein Gesicht gegraben. Die kräftige Nase, die allen Morgons zu eigen war, erinnerte daran, dass er aus der Gascogne stammte. Schon der Großvater war während der großen Revolution nach Paris gezogen und hatte den Jakobinern angehangen und sich stets gerühmt, mit Robespierre im Procope gegessen zu haben. Unter dem Konsul Bonaparte hatte er dem mosaischen Glauben abgeschworen. Von diesem Familiengeheimnis zeugte nur noch ein siebenarmiger Leuchter. Julien hatte den Verdacht, dass sein Vater nur einen Gott hatte: das Volk von Paris.
»Hast du dich für die neuen Prüfungen ordentlich vorbereitet?«, fragte der Vater, der stolz darauf war, dass sein Sohn eine Grande Ecole besuchen würde.
»Aber ja doch. Keine Schwierigkeiten.«
Das war keine Beschwichtigung. Julien fiel das Lernen leicht, weil er ein Gedächtnis hatte, das die Lehrer die Köpfe zusammenstecken ließ. Er brauchte nur etwas zu überfliegen und schon hatte er es im Kopf gespeichert und konnte es mühelos, selbst nach Wochen oder Monaten, abrufen.
»Setz dich ruhig noch einmal hin und lies alles durch. Unsereiner muss doppelt so gut sein wie die Abkömmlinge aus den großen Familien. Wir können dem guten Baron wirklich dankbar sein, dass er sich für dich beim Direktorium eingesetzt hat. Du darfst Monsieur Savigny keine Schande machen, hörst du? Und noch etwas: Lass nie verlauten, dass du eine jüdische Großmutter hattest. Der Baron, dies habe ich aus einigen Bemerkungen entnommen, ist kein Freund der Juden. Wo Licht ist, ist auch Schatten.« Er seufzte.
»Aber ja doch, Vater«, murmelte Julien gelangweilt. »Ich weiß doch, dass es genug Franzosen gibt, die einen seltsamen Hass auf die Juden haben. Warum eigentlich? Die Juden, die ich kenne, sind wie du und ich.«
»Woher kennst du Juden?«, fragte der Vater erstaunt.
»Ach, die Weißenburgs sind auch Juden. Lambert, der Sohn des Antiquitätenhändlers, ist mein Freund.«
»Du solltest dir lieber Freunde unter deinen Schulkameraden suchen.«
»Ach, Vater, für die bin ich doch nur der Ladenschwengel, der eigentlich nicht auf eine Grande Ecole gehört. Sie schneiden mich wie einen Aussätzigen.«
»Das tut mir leid. Vielleicht haben wir eines Tages wieder eine Republik und alle sind gleich.«
»Das wird so schnell nicht passieren. Schon gar nicht, wenn der Kaiser siegreich aus dem Krieg zurückkommt. Ich habe die Soldaten gesehen. Es sind die besten der Welt.«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Mit den Deutschen muss man immer rechnen. Doch nun geh hinein. Mutter wartet schon auf dich.«
»Junge, wo bist du so lange gewesen?«, empfing ihn die kleine rundliche Frau mit dem rosigen Gesicht einer Bäuerin.
Eine Schönheit war sie selbst in ihrer Jugend nicht gewesen. Aber dies machte sie mit einer gütigen Art wieder wett, so dass sie in der ganzen Nachbarschaft beliebt war. Ihre elsässische Herkunft war nicht nur an ihrer Aussprache zu erkennen, sondern auch an der deftigen Küche, zu der sie gern einlud. Julien war ihr einziges Kind und sie begluckte ihn gern und hingebungsvoll.
»Ich habe dir ein paar schöne Fleischklößchen gemacht. Iss, damit du gut lernst. Wer dem Körper nicht gibt, was er braucht, wird durch schlechtes Lernen bestraft.«
Nach dem Essen ging er auf sein Zimmer unter dem Dach. Der Vater hatte die Mansarde daneben, um zusätzliche Einkünfte zu erschließen, an einen Abbé vermietet, einen kräftigen Mann in mittleren Jahren, der in der naheliegenden Kirche als Aushilfspfarrer sein Brot verdiente. Nicht nur, weil er durch seine Größe und seinen mächtigen Körperbau so gar nicht einem Geistlichen glich, auch weil er – wie Julien bald erfuhr – eine ganz eigene Auslegung des christlichen Glaubens predigte, wurde er im Arrondissement mit scheelen Blicken bedacht. Seine wahre Leidenschaft konnte man mit dem Glauben an die Phrygische Mütze umschreiben. Er war also in vielem sehr jakobinisch und immer schnell dabei, das Paradies im Diesseits zu fordern.
Die Wohnung des Abbé Leon Flamboyant war vollgestopft mit Büchern, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit forderten. Voltaire, Diderot, Rousseau waren die Autoren, doch auch Feuerbach, Bakunin und … Marx. Alles was er erzählte, lief darauf hinaus, die Gesellschaft umzustürzen, um nach einem Weltenbrand zu einer Gesellschaft zu kommen, wo der Löwe friedlich neben dem Lamm lagert. Julien war gern mit ihm zusammen, nicht weil er dessen Gedanken teilte, sondern weil Flamboyant ihm beibrachte, nach dem Grund aller Dinge zu fragen. Was bewegt die Welt? Was bedeutet Freiheit? Warum sind auch bei Gleichheit nicht alle gleich? Ist auch der Kaiser unser Bruder? Er mochte den Abbé und der Abbé mochte ihn. Julien war durchaus bewusst, dass dessen Zuneigung daraus resultierte, in ihm einen Samen zu pflanzen. Dagegen hatte Julien nichts einzuwenden, denn die Ausführungen des guten Abbés blieben doch sehr im Theoretischen.
Als er die Tür zu seinem Zimmer öffnete, kam der Abbé aus seiner Wohnung, als hätte er die ganze Zeit auf ihn gewartet. Julien kannte dies längst und akzeptierte es.
»Du warst also bei der Parade«, stellte der Abbé fest.
Wie immer trug er die fleckige Soutane, die ihm an den Ärmeln viel zu kurz war. Wenn er durch die Straßen ging, sah man ihm hinterher, weil er die Menschen meist um mehr als eine Kopflänge überragte. Ein länglicher Kopf mit Pferdezähnen, die ihm ein wildes Aussehen gaben – zumal er sie bei Zorn oder Wut fletschte –, machten ihn zu einem Gesprächsthema im Viertel. Da er oft zornig war, auf die Bonapartisten, auf die Bourbonen, floss dies mit gewagten Gleichnissen in seine Predigten ein, über die man sich oft beschwerte, so dass man ihm schließlich nur noch die Frühmessen zuteilte. Allein die Republikaner ließ er gelten, zumal wenn sie aus dem Faubourg St. Antoine kamen und an die glorreichen Tage von 1789 erinnerten.
»Was für ein grandioser Anblick! Auf den Champs Elysées marschierte die stolzeste Armee der Welt.«
»Alles Todgeweihte. Dieser sogenannte Kaiser schickt sie ins Verderben. Wie kann man nur so dumm sein, auf die Provokationen der Preußen hereinzufallen. Nun, auch gut. Er wird seine Herrschaft ruinieren und dann schlägt die Stunde der Wahrheit und aus den Vorstädten werden die Erniedrigten hervorbrechen und die Tuilerien besetzen. Dem Volk wird die Macht gehören. Die Reichtümer Frankreichs werden gleichmäßig verteilt werden.«
Julien wusste, dass Flamboyant, wenn er erst einmal in Fahrt gekommen war, seine Tiraden stundenlang ausweiten konnte und so versuchte er, das Gespräch mit dem Hinweis abzukürzen, dass er noch zu lernen habe.
»Was musst du pauken?«, fragte der Abbé eifrig.
»Latein. Den gallischen Krieg. Ich muss Cäsars Eigenlob wenigstens mal überflogen haben.«
»Eigenlob? Einverstanden. Aber er war wenigstens kein Blender. Veni, vidi, vici ist unserem Kaiserdarsteller nicht gegeben. Ich werde dich abhören.«
»Na gut«, gab sich Julien geschlagen. Es war nicht so einfach, den Abbé abzuschütteln.
Sie gingen zusammen in die Mansarde, von deren Decke ein Segelschiff hing. Er hatte sich mit dem Sohn eines Seineschiffers angefreundet, der die beiden Jungen gern mitnahm, wenn er auf der Seine fischte. Von ihm hatte er nicht nur das Segelschiff bekommen, sondern auch Segeln gelernt und manch anderes über das Meer, denn der Fischer hatte einst, wie er nicht müde wurde zu betonen, die Weltmeere befahren und den Äquator überquert, was sich bei ihm nach einer bedeutenden Sache anhörte.
An der Wand über dem Bett hing ein Säbel, den ihm sein Freund Lambert Weißenburg geschenkt hatte, der ihn unter dem unverkäuflichen Gerümpel seines Vaters fand. Angeblich hatte er einst Danton gehört. Doch die Jakobiner waren in kaiserlichen Zeiten nicht sehr en vogue. Der Säbel Napoleons dagegen hätte ein Vermögen gebracht.
Sie setzten sich an den kleinen Tisch, der Abbé nahm das Lateinlexikon und begann, nachdem Julien eine Weile das BellumGallicum überflogen hatte, ihn abzufragen. Zu des Abbés Verdrusses vermochte Julien jede Frage zu beantworten. Nachdem sie eine Weile gearbeitet hatten, hielt der Abbé die Lehrerrolle nicht mehr durch.
»Wusstest du, dass Marc Anton dem verflixten Octavian das Leben gerettet hat?«
Julien sah hoch. Was sollte das denn wieder?
»Octavian, der spätere Augustus, hat doch Marc Anton bei Actium besiegt.«
»Die Lebensrettung passierte vorher, als sie sich noch als Triumvirat verstanden und gegen die Republikaner einig waren. Der dumme Bengel Marc Anton bewahrte Octavian vor dem Zorn des Volkes, das ihn wegen der schlechten Lebensmittellage in den Tiber werfen wollte. Marc Anton war ein naiver Schlagetot, Octavian dagegen eine Schlange. Seine Gemeinheit verbarg er hinter seinem Jünglingsgesicht.«
»Aber er wurde doch später der vielgeliebte Augustus.«
»Ja. Ein Heuchler durch und durch. Wusstest du, dass er in Perugia dreißigtausend Menschen umbringen ließ?«
»Auf was willst du hinaus?«, fragte Julien ratlos.
»Merke dir: Die Welt ist nie so, wie sie scheint. Was siehst du in mir? Einen kleinen Abbé, der sich mühsam durchschlagen muss, von den Kirchenoberen verächtlich behandelt, von den Kirchgängern belächelt. Doch ich sage dir, ich bin ein Teil der Macht, die darauf drängt, die Menschheit vom Kopf auf die Füße zu stellen. Man wird noch von mir hören.«
Julien hatte Mühe, ein Lächeln zu unterdrücken. Immer wieder kam der Abbé mit so seltsamen Bemerkungen, dass er, der so armselig, fast abgerissen wirkte, in Wirklichkeit jemand von Bedeutung sei. Irgendwie bekam er immer die Kurve, darauf hinzuweisen.
»Also, Augustus war ein Schleimer, Heuchler und Intrigant«, stöhnte Julien. »Und was nun?«
»Und ein Mörder«, ergänzte der Abbé. »Aber der Kerl mit dem Unschuldsgesicht wusste, was er wollte und er tat alles für seine Machterhaltung. Alles, Julien. Er war genauso, wie sich Macchiavelli einen Fürsten wünscht. Wenn man ein Omelett haben will, muss man die Eier zerschlagen.«
»Und?«, fragte Julien ratlos.
»Du musst so werden wie er«, sagte der Abbé mit Aplomb.
»Ha? Ich habe keine Lust, ein Schleimer, Heuchler und Mörder zu werden«, protestierte Julien.
»Junge, du hast viele großartige Anlagen. Du kennst nur das Leben noch nicht. Aber wir Phrygier von der Loge des höchsten Wesens wissen, warum Danton die Verantwortung für die Septembermorde auf sich nahm.«
»Er hat dafür mit der Guillotine bezahlt.«
»Nicht dafür. Er war schwach geworden und kungelte mit der Bourgeoisie. Der große Robespierre und Saint Just taten recht ihn zu verurteilen.«
»Leon, für einen Geistlichen bist du ganz schön blutrünstig.«
»Ich sagte doch schon: Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine.«
»Und wer bist du? Ich habe außer von dir nie von den Phrygiern oder von der Loge des höchsten Wesens gehört.«
»Wir sind wie die Freimaurer, Templer, Rosenkreuzer und Illuminaten, nur auf der anderen Seite der Barrikade.«
»Als Abbé bist du eine Fehlbesetzung«, erwiderte Julien lachend, der dessen Gerede schon lange nicht mehr ernst nahm.
»Warte ab, Julien, warte nur ab. Wenn die Soldaten des Kaisers geschlagen aus dem Krieg zurückkommen, wenn sie begreifen, wie sehr man sie benutzt hat, wie verlogen das Gerede vom Vaterland ist, schlägt unsere Stunde. Wir Phrygier werden aus dem Dunkel ins Licht treten und es wird sein wie beim Jüngsten Gericht. Wir werden die herrschende Klasse das Fürchten lehren. Die Aristokraten, die Geschäftemacher, die Bankiers und ihre Spekulanten werden der gerechten Strafe zugeführt. Monsieur Guillotine wird wieder zu Ehren kommen.«
»Du willst ein Blutbad?«, entsetzte sich Julien.
»Das Alte, das Verrottete, das Verfaulte muss weg! Wir werden einen neuen Menschen schaffen. Alle werden gleich und frei und Brüder sein, wie es Robespierre und Saint Just einst forderten. Der Menschheitstraum wird wahr werden!«
»Brüderlich kommt mir das Ganze nicht gerade vor.«
»Es ist ein steiniger Weg zum Reich der Freiheit. Von allein stellt sich die klassenlose Gesellschaft nicht ein. Je reicher jemand ist, je mehr Güter er besitzt, umso erbitterter wird sein Widerstand sein. Er wähnt sich im Recht, glaubt, dass sein Reichtum von Gott kommt und er auserwählt ist. Sie werden uns bis aufs Messer bekämpfen. Aber wir werden siegen und sie umerziehen.«
»Heiliger Franziskus. Du bist aber heute mal wieder scharf drauf, da kann einem ja angst und bange werden. Ich glaube, ich muss noch einmal an die frische Luft.«
Julien sprang auf, denn er wusste, dass der Abbé sonst noch stundenlang bei seinem Lieblingsthema verweilen würde.
»Na gut, geh nur. Aber wisse, ich werde meine Hand über dich halten, wenn die großen Tage kommen, und dafür einstehen, dass man dich bei den Phrygiern aufnimmt und erst zufrieden sein, wenn du der Loge des höchsten Wesens angehörst. Tod der Bourgeoisie! Tod allen Aristokraten, Bonapartisten und Royalisten!«
»Ja doch, Abbé Leon. Tod allen Gegnern der Freiheit!«, erwiderte Julien genervt und schob den Abbé aus dem Zimmer. Er sammelte die Bücher ein und steckte sie für den nächsten Tag in den Tornister. Pfeifend verließ er das Zimmer.
Mittlerweile war es draußen dunkel geworden. Eine schöne helle Mondnacht. Er ging die Avenue Bugeaud hinunter. Es war nicht die Luft, nach der er Verlangen hatte, sondern die blauen Augen, das blonde Haar, das so reich auf die Schultern fiel. Er ging bis zum Ende der Straße und sah sehnsuchtsvoll zu den hell erleuchteten Fenstern des Palais hinüber. In welchem Zimmer mochte sich Mercedes aufhalten? Dachte sie an ihn? Er wünschte es sich sehr. Er sah nur einen Schemen. Sein Herz schlug schneller. Grüßend hob er die Hand. Dann war der Schatten fort. Vielleicht hatte er nur das gesehen, was er hatte sehen wollen.
»Hat sich der Ladenschwengel etwa in Mercedes Montaigne verknallt?«, riss ihn eine höhnische Stimme brutal aus seinen Wunschträumen.
Auguste stand breitbeinig nur wenige Schritte von ihm entfernt. Hinter ihm grinsten Hubert, Armand, Charles und Jean.
»Was macht ihr denn hier?«
»Wir haben uns nur erkundigt, ob die schöne Mercedes gut nach Hause gekommen ist. Und was hören wir? Der Ladenschwengel maßte sich an, sie zu begleiten. Und als wir uns gerade nach Hause verdrücken wollen, was sehen wir da? Der Streber schmachtet vor ihrer Tür.«
»Ich habe nur das getan, was sich gehört, nachdem ihr euch verdrückt habt.«
»Verdrückt?«, empörte sich Auguste. »Wir wollten nur keinen Skandal verursachen, während unsere stolze Armee vorbeimarschierte. Deswegen haben wir uns zurückgezogen, nachdem du die Zuschauer gegen uns aufgehetzt hattest.«
»Unsinn. Die Menge war nur wütend, weil eure Pferdeäpfel nicht nur mich, sondern mehr noch die vielen Zuschauer getroffen hatten. Ihr habt Angst bekommen und Mercedes im Stich gelassen.«
»Du vergisst, wer du bist«, wütete Auguste. »Mercedes ist eine Montaigne und du bist ein Niemand. Was maßt du dir an, einer Dame das Geleit zu geben?«
Julien hatte vom Vater genug gascognisches Blut mitbekommen, um vor einer Übermacht nicht zu kapitulieren. Aber er war auch klug genug, die glorreichen Fünf nicht weiter zu provozieren.
»Was wollt ihr von mir? Ich will keinen Streit mit euch. Ich wohne hier und habe alles Recht, in dieser Straße spazieren zu gehen.«
»Er versucht eine Poussiererei mit Mercedes«, hetzte Hubert.
»Auguste, lass dir das nicht gefallen.«
»Der Sohn eines Papierhändlers, der sich nur durch Protektion auf die Grande Ecole vorbereiten kann, will sich mit unsereinem vergleichen«, stimmte der schöne Charles ein.
»Mercedes scheint aber etwas für ihn übrig zu haben. Immerhin versuchte sie, uns davon abzuhalten, ihn mit Pferdeäpfeln zu bewerfen«, fügte Jean hinzu, blickte gespannt auf Auguste und wartete darauf, welche Reaktion diese Bemerkung auslösen würde.
»Stimmt. Sie war auf seiner und nicht auf unserer Seite«, stimmte Armand mit verschwörerischem Blick zu.
»Ich werde ihm austreiben, sich an Mercedes ranzuschmeißen!«, brüllte Auguste. »Auf ihn, Kameraden! Es lebe das Kaiserreich!«
Was seine Eifersucht mit dem Kaiserreich zu tun hatte, erschloss sich niemandem, aber alle fünf stürzten sich nun auf Julien. Auguste vermochte er noch zurückzustoßen, aber dann warfen ihn die anderen zu Boden und prügelten auf ihn ein. Er versuchte den Kopf abzudecken, aber es half ihm nicht viel. Sie traktierten ihn obendrein mit Füßen. Julien brüllte seine Wut und seine Scham heraus. Seine Widersacher lachten höhnisch.
»Dir wird die Lust vergehen, den Blick auf eine Demoiselle von Stand zu werfen«, kreischte Auguste.
»Was geht hier vor?«, meldete sich eine Stimme aus der Dunkelheit.
Leon Flamboyant fuchtelte mit seinem Spazierstock und widerstrebend ließen die Jungen von Julien ab.
»Macht, dass ihr fortkommt, ihr Pack, sonst …!«, rief der Abbé.
»Wer ist denn der Kerl? Ein Bettlerabbé?«, höhnte Auguste. »Wisse, dass mein Vater Minister im Kabinett des Kaisers ist.«
»Ach so! Auch einer dieser Lumpen, die Frankreich ins Verderben führen. So einer gehört auf die Guillotine«, erwiderte Flamboyant mit bösem Lächeln.
Auguste erstarrte. Fassungslos drehte er sich zu seinen Freunden um, hatte er doch noch gehört, wie sein Vater geschmäht wird.
»Lump nennt er meinen Vater? Habt ihr gehört, dieser seltsame Abbé spricht von der Guillotine? Das dürfen wir nicht zulassen, dass man die Obrigkeit schmäht. Diesem Kerl müssen wir es geben, was, Freunde?«
Aber die Freunde hatten nicht viel Lust, sich mit einem ausgewachsenen Mann, der zudem sehr energisch aussah und einen Stock hatte, auseinanderzusetzen.
»Lass es gut sein, Auguste. Julien hat sein Fett abbekommen«, sagte Jean.
»Feiglinge!«, keuchte Auguste. »Wenn ihr kneift, dann werde ich dem Abbé eben allein eine Tracht Prügel verabreichen.«
Er bückte sich schnell, hob einen Stein auf und wollte das wiederholen, was er auf den Champs Elysées mit den Pferdeäpfeln vorgeführt hatte. Doch der Abbé zog einen Degen aus dem Stock.
»Komm, Bürschchen, komm nur, Herrenjüngelchen!«, sagte Leon Flamboyant und hielt Auguste den blitzenden Stahl entgegen. Auch im Funzellicht der Gaslaterne blinkte dieser gefährlich und unheilverkündend. Auguste machte ein paar Schritte zurück.
»Auguste, nichts wie weg!«, kreischte der schöne Charles.
Dieser sah ein, dass seine Aussichten, unverletzt davonzukommen, nun nicht mehr sehr erfolgversprechend waren und nickte. Die Jungen gaben Fersengeld, liefen aus der Straße hinaus und verschwanden im Dunkel.
Julien rappelte sich hoch.
»Wie geht’s, mein Junge?«, fragte der Abbé und zog Julien hoch.
»Mir tun alle Rippen weh.«
»Ist doch gut, dass ich plötzlich Lust verspürte, noch ein wenig frische Luft zu schnappen. Was war denn das für eine Aristokratenbande? Es waren doch Aristokraten, nicht wahr?«
Julien zuckte mit den Achseln.
»Sie gehen mit mir auf die Ecole. Ihre Eltern sind wichtige Leute.«
»Da siehst du, wie recht ich habe, dass wir eine Veränderung herbeiführen müssen.«
»Ach, Abbé, sie sind unermesslich reich und mächtig. Dagegen vermag niemand etwas.«
»Du irrst. Der Wunsch nach Freiheit und Gleichheit vermag alles.«
Gemeinsam gingen sie zu ihrem Haus zurück.
An diesem Abend war Julien Morgon dem Abbé dankbar und hoffte mit ihm, dass sich bald alles ändern würde, wenn er auch nicht ganz so blutrünstig dachte wie Leon Flamboyant. Hoffentlich habe ich kein blaues Auge, wenn ich morgen Mercedes treffe, dachte er besorgt. Dies beschäftigte ihn viel mehr als der Tag, der das Oberste zuunterst kehren würde.
3 – Die schönen Tage im Jardin du Luxembourg
(Honoré de Balzac erzählt)
Sie trafen sich regelmäßig im Jardin du Luxembourg, spazierten artig um das große Bassin, sahen zu, wie Kinder ihre Segelboote zu Wasser ließen und mit jeder Begegnung wurden ihre Blicke zärtlicher. Julien störte nur, dass ständig ihre Freundin du Plessis dabei war, die Tochter des kaiserlichen Hofmarschalls, die Mercedes an Schönheit in nichts nachstand. Trotzdem hatte Julien nur Augen für Mercedes und der Blick aus ihren blauen seelenvollen Augen ließ ihm Schauer über den Rücken laufen. Diane hätte durchaus seine Aufmerksamkeit verdient gehabt, aber ihre Schönheit berührte ihn nicht. Beide Frauen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Mercedes war lebendiger und befand sich ständig in einem Erregungszustand, zeigte ihre blitzenden weißen Zähne und lachte ein helles glückliches Lachen. Sie heischte nach Aufmerksamkeit und Bewunderung und genoss die Blicke der Männer. Diane dagegen war ernster, das himmelhoch Jauchzende ging ihr ab. Sie musterte Julien mit kritischem Blick, obwohl er ihr nicht unsympathisch war. Sie verurteilte jedoch sein unverhülltes Drängen auf Erfüllung seiner leidenschaftlichen Gefühle, die sie für nicht standesgemäß hielt. Insgeheim hoffte sie auf eine Abkühlung, entweder von Julien, mehr noch von Mercedes, die in ihrem Gefühlsleben, wie sie aus Erfahrung wusste, unstet sein konnte. Sie war guter Hoffnung, dass Mercedes’ Gefühle noch umschlagen und sich bald auf andere Schwärmereien konzentrieren würden.
Doch erst einmal trat keine Veränderung ein. Wenn Diane darauf hinwies, welche Vorzüge Auguste auszeichneten, der zudem von Stand war, wehrte sie dies ab und nannte den Sohn des Ministers einen dummdreisten Jungen, während Julien von der Freundschaft zwischen Heloise und Abelard zu erzählen wusste oder von Cagliostro am Hofe Ludwigs XVI, von den Memoiren des Giacomo Casanovas ganz zu schweigen.
»Auguste dagegen kennt sich nur mit Pferden, Geld und Soldaten aus, was auf die Dauer sehr ernüchternd ist.«
Und wenn Julien von den beiden Schwestern erzählte, die Casanova verführte, gingen die beiden gebückt etwas schneller, pressten ihre Taschen gegen die Körpermitte und atmeten heftig. Ihre Gesichter zeigten eine rote Farbe.
Oh ja, Julien kannte seltsame Geschichten, die er teilweise von Abbé Flamboyant gehört hatte, von den Geheimnissen der Carbonari, vom Siegeswillen des Garibaldi und von jenem Rastignac, der nach Paris kam, um sein Glück zu machen und es, obwohl aus einfachen Verhältnissen, bis ganz nach oben schaffte. Er verschwieg ihnen auch nicht die geheimnisvollen Phrygier und die Loge des höchsten Wesens, die die Welt auf den Kopf stellen wollten, indem sie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit anstrebten, sowie ein Ende der Armut auf Erden.