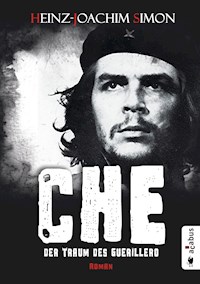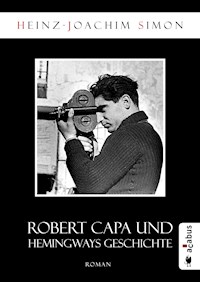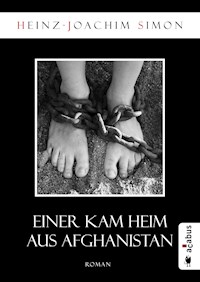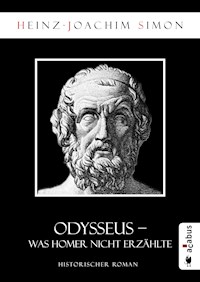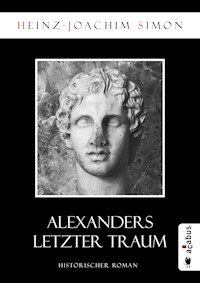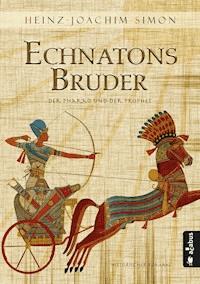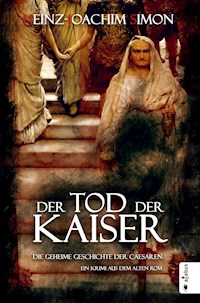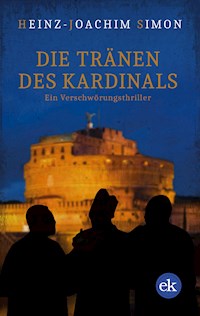Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Gier droht Châteauromain zu vernichten. Ein idyllischer Ort in der Provence. Die Zikaden lärmen, die Zypressen bewegen sich leicht im Wind. Am Nachmittag vertreibt die Sonne die Menschen aus den Straßen. Im Schatten vor dem Bistro sitzt man bei einem Pastis und diskutiert über die Zeitläufe. So war es seit Generationen – und so soll es bleiben, denken einige junge Leute. Aber der Bürgermeister hat anderes im Sinn und will neben dem Ort ein Luxusresort bauen lassen. Die Ortsansässigen spüren, dass ihnen die Heimat verlorengehen kann. Die Ruhe des kleinen Ortes ist jäh vorbei, als einer der Umweltschützer erschossen wird. Und dies bleibt nicht der einzige Tote. Eine Tragödie von archaischer Wucht bahnt sich an. Zwei Frauen nehmen den Kampf gegen die Geschäftemacher auf. Die Situation eskaliert. Der Privatdetektiv Peter Gernot aus Berlin wollte nur seinem Freund und Partner beim Renovieren seines Ferienhauses helfen und gerät unfreiwillig in den Sog der Ereignisse. Durch seine Liebe zur schönen Ismene wird er immer tiefer in das komplizierte Geflecht der Dorfgemeinschaft hineingezogen. In einem Kampf auf Leben und Tod gegen die globale Investmentmafia tritt Peter Gernot für die Umwelt ein. Ein Buch für das Urlaubsgepäck
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz-Joachim Simon
Der Schrei der Zypressen
Ein Provence-Umwelt-Krimi
Simon, Heinz-Joachim: Der Schrei der Zypressen, Hamburg, ACABUS Verlag 2014
Originalausgabe
PDF-ISBN: 978-3-86282-287-4
Epub-ISBN: 978-3-86282-288-1
Print-ISBN: 978-3-86282-286-7
Lektorat: Arne Schrothe, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: © Marta Czerwinski, ACABUS Verlag
Bildmotiv: © Aquarell: Angelika Simon
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2014
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Und er sprach:
Beschädigt die Erde nicht
noch das Meer noch die Bäume,
bis dass wir versiegeln die Knechte
unseres Gottes an ihren Stirnen.
Die Offenbarung des Johannes, 7.3.
Wir haben die Schönheit verbannt,
die Griechen griffen für sie zu den Waffen.
Albert Camus – Heimkehr nach Tipasa
Personenregister
Peter Gernot
Privatdetektiv und Freund französischer Lebensart, glaubt den weißen Ritter spielen zu müssen
Mario Paresi
Gernots Partner, ehemaliger Offizier der Vatikanpolizei
Ismene Céline
ein Mädchen mit einem Da-Vinci-Lächeln und festen Grundsätzen
Antigone
ihre Schwester, eine leidenschaftliche Verteidigerin ihrer Heimat
Cesare Kreone
Bürgermeister von Châteauromain, der mit einem Millionärsresort seine Stadt zu herrlichen Zeiten führen will
Henri
sein Sohn, der Verlobte von Antigone, hat Probleme mit seinem Vater
Charles de Belancourt
Verleger der Zeitung
Le Gardien
, Wohltäter des Departements
Pierre Claudel
Sprecher der Resortgegner, stirbt zu früh
Polizei-Sergeant Dejus
Polizist der
Police Municipale
, Kreones Arm des Gesetzes in Châteauromain
Capitaine
Salignac
Capitaine
bei der
Police Nationale
, bekommt mehr Arbeit, als ihm lieb ist
Xavier Saval
Töpfer und Künstler, macht sich verdächtig
Patrick Junot
Jurastudent mit einer großartigen Zukunft
Doktor Junot
sein Vater, der einst einen seltsamen Handel einging
Damien Gügli
Schweizer Investment-Manager mit Diplomatenpass
Philippe Lorrain
Autowerkstattbesitzer, der auf eine BMW-Vertretung hofft
Adrien Dupont
Bistrobesitzer, gibt an, im Streit um das Millionärsresort neutral zu sein
Fernand Dotti
Redakteur bei
Le Gardien
, ein Kämpfer gegen das ‚Establishment‘
Jean Giraud
ein pfiffiger Junge, der das Leben für Kino hält
1
Wenn die Lerche ruft
Sie kennen das Gefühl: Ich hätte am liebsten die ganze Welt vors Gericht geschleppt. Das Detektivgeschäft kann so aufregend sein wie eine Talkrunde im Fernsehen am Sonntagabend. Ich hatte mein Geschäft gründlich satt. Deswegen entschloss ich mich dazu, meinen Freund und Partner Mario Paresi in der Provence zu besuchen. Aber das ist nicht der Kern der Geschichte. Dass ich dabei mein Damaskus erlebte, war nicht vorauszusehen. Leute, die sich darin auskennen, haben einmal gesagt, dass unsere Erde eine Leihgabe ist. Sie verpflichtet uns, sie unversehrt an die nächste Generation weiterzugeben. Ein Gedanke fürs Poesiealbum. Stephane Hessel bringt es besser auf den Punkt: „Noch fünfzig Jahre weiter so, dann ist die Erde nicht mehr lebenswürdig.“ Dies impliziert die Frage: Was tust du dagegen? Meine Bilanz war nicht besonders gut.
Am Ende dieser Geschichte sollte sie aber schon besser aussehen. Sie veränderte mich und mit mir ein paar Menschen. Einige davon waren mir lieb und teuer. Und ich zahlte dafür, wie es sich gehörte. Alle werden zahlen. So oder so.
Es fing damit an, dass ich gleich am Anfang den weißen Ritter spielen wollte und ich diese Rolle dann nicht mehr loswurde.
Es passierte auf der Fahrt von Paris nach Nizza. Ich fahre nicht gern mit der Bahn. Wenn es einen Gott der Schienen gibt, dann meint er es nicht besonders gut mit mir. Was daran deutlich wird, dass einmal mein Zug hinter Frankfurt entgleiste und mich mit dem Glas geplatzter Fensterscheiben überschüttete. Ein verdammt mulmiges Gefühl, wenn man sieht, wie sich die Fenster nach innen wölben und wie Türen aus den Angeln springen. Welcher Unsinn einem dann durch den Kopf geht. Ich dachte an die Blues Brothers und den Augenblick, als ihr Haus von einer Panzerfaust getroffen wird. Das andere Mal stürzte ich lang hin, als der ICE in den Stuttgarter Bahnhof einfuhr. Ich hatte nicht bedacht, dass der Zug sich vorher noch in eine Kurve legte. In Hamburg verstauchte ich mir den Knöchel, als ich den Bahnsteig betrat und in Berlin holte ich mir eine schwere Erkältung, als ich zwei Stunden auf meinen Zug warten musste. Nein, die Bahn ist nicht das von mir bevorzugte Verkehrsmittel. Deswegen lege ich selbst weiteste Entfernungen lieber mit meinem guten alten Triumph zurück, einem englischen Oldtimer aus den sechziger Jahren. Serena, meine frühere Sekretärin, behauptete immer, dass ich die alte Kiste mehr lieben würde als die Frauen, was natürlich eine boshafte Übertreibung ist.
Doch diesmal hatte ich mich für den TGV entschieden – und alles kam ganz anders als erwartet. Es passierte etwas so Ungewöhnliches, dass ich auf dem Bahnhof von Lyon eine Lerche hörte. Richard Wagner hätte in einer Oper wenigstens durch den Chor angedeutet: Walle, walle, Unheil naht. Doch weder ein wagnerianischer Chor noch eine Wahrsagerin aus den griechischen Tragödien meldete sich. Stattdessen begegnete ich der ewigen Göttin, der Inkarnation von Isis, Aphrodite oder Athene. Wenn Sie damit nicht viel anfangen können, dann stellen Sie sich Penélope Cruz vor und Sie haben ein ungefähres Bild davon, was meine Verwirrung auslöste. Jedenfalls legte sich bei mir sofort ein Schalter um. Dabei gehöre ich nicht zu den schwärmerischen Typen, was schon mein Beruf verlangt. Mit fast vierzig Jahren kann man mich als gestandenes Mannsbild bezeichnen, das bereits ein paar Illusionen abgelegt hat. Meinen Körper habe ich mit einigen asiatischen Sportarten in Form gebracht. Wenn ich auch nicht wie Ken, der Partner von Barbie, aussehe, so bin ich doch der blonde Typ mit den grauen Augen, von dem sich alte und junge Damen gerne den Abfalleimer runterbringen lassen. Mit festen Beziehungen hatte es aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht geklappt, doch nun mischte sich eine der bereits angeführten Göttinnen ein. Die Überraschung gelang ihnen gründlich.
Ich hatte mir ein paar schöne Tage in Paris gegönnt. Louvre, Musée d’Orsay, Opéra, Harry’s Bar, das ganze Programm also. Von Paris kann ich nie genug bekommen. Ich hatte in bittersüßen Erinnerungen geschwelgt: An meinen ersten Parisbesuch, an die Zeit der schwarzen Gauloises und des knurrenden Magens, den ich mit Käse-Tomaten-Baguettes beruhigte, und an die unwiederbringlichen Momente in den Jazzkneipen im Quartier Latin. Heute wird dort kein Jazz mehr gespielt und statt Chet Baker hört man nur die Rufe von Griechen und Türken, die einen dazu ermutigen, ihr fettiges Gyros zu kaufen. Irgend so ein Wahnsinniger hat mir einmal ins Ohr geflüstert, dass die Erinnerungen die Pralinen des Alters sind. Vom Altern hatte der Typ keine Ahnung.
Nun saß ich im TGV nach Nizza, wo ich mir einen Wagen mieten wollte, um nach Châteauromain zu fahren, wo Mario Paresi, Partner, Philosoph und Bruder im Geist, sich ein Ferienhaus gekauft hatte. Ich wollte ihm dabei helfen, es wieder auf Vordermann zu bringen. Er hatte mir von einem himmlischen Tal vorgeschwärmt, umringt von Weinbergen unter einer Sonne, die sich niemals versteckte. Nicht mal eine Stunde von Aixen-Provence entfernt, sei es würdig, von Cezanne gemalt oder von Balzac besungen zu werden. „In Châteauromain ist die Welt noch in Ordnung. Man lebt in einer anderen Zeit“, waren seine Worte gewesen.
Um dies zu genießen, brachte ich die richtige Stimmung mit. Endlich brauchte ich mich nicht um Fremdgänger oder Industriespione zu kümmern, was das übliche Brot einer Detektei ist, auch wenn ich bereits in einige Fälle verwickelt gewesen war, die mich das Höllenfeuer hatten spüren lassen.
Nun kennen Sie meine Profession. Mein Name ist Peter Gernot, der uneheliche Sohn des Bau-Tycoons Gernot, der ein Hoch- und Tiefbauunternehmen zu einem mächtigen internationalen Konzern ausgebaut hat. Als mein Vater das Zeitliche segnete, habe ich mich geweigert, den Laden zu übernehmen und das Geschäft meiner Stiefschwester überlassen, was kein Fehler gewesen war. Sie macht ihre Sache sogar besser als mein Erzeuger und brauchte sich dafür nicht einmal mit dem Teufel einlassen. Ich lebe gut von der jährlichen Dividende, die Hoch- und Tiefbau abwirft und brauche deswegen nicht jeden Auftrag zu übernehmen, der mir angetragen wird. Kurz: Dank der Erbschaft bin ich nicht ganz mittellos, worüber sich einige Konkurrenten nicht beruhigen können. Da ich faul bin und auch sonst keine besonderen Fähigkeiten habe, verfiel ich auf den Gedanken, ein Detektivbüro in Berlin aufzumachen. Seit Mario dabei ist, der unsere Zweigniederlassung in Rom leitet, können wir beide sogar davon leben. Mario bringt seine italienische Schlitzohrigkeit und seine Beziehungen zu den Geheimdiensten dieser Welt in das Geschäft ein, ich meine zwei Meter und hundert Kilo Muskelmasse sowie, wie schon angeführt, ausreichende Kenntnisse in asiatischen Kampfsportarten. Entgegen übelwollender Kritik bin ich kein Rambo, sondern ein meist friedlicher Zeitgenosse, den ein schöner Satz von F. Scott Fitzgerald oder William Faulkner in Verzückung bringen kann. Nun wissen Sie, wes Geistes Kind ich bin, und Mario, als ehemaliger Chef der Vatikanpolizei, füttert mich mit den Weisheiten des Platon, Sokrates und Franz von Assisi, so dass ich durch ihn und viel Lesen eine gesunde Halbbildung erhalten habe. Den ‚Hamburger Jung‘ kann ich jedoch nicht verleugnen. Da mein Vater mich erst spät anerkannte, war meine Jugend in St. Pauli nicht gerade von bürgerlichen Idealen geprägt, wodurch ich mich schnell auf alle Milieus einstellen kann.
Zu meinen nicht so tollen Eigenschaften gehört, dass ich manchmal „Bauchentscheidungen“ fälle, die sich nicht so günstig auf mein Wohlbefinden auswirken. Es führte zum Beispiel dazu, dass ich mich nach Afghanistan begab, um meinen Halbbruder aus den Händen einiger Drogendealer zu befreien. Die Taliban sorgten dafür, dass ich meine Liebste und Faiz, meinen besten Freund verlor. Es befreite mich auch von ein paar Illusionen über den Sinn des Bundeswehreinsatzes am Fuße des Hindukusch. Nichts ist dümmer als die Begründung, dass dort die Freiheit der Bundesrepublik verteidigt wird.
Was mich außerdem zu einem nicht so ganz angenehmen Zeitgenossen macht, ist meine mangelnde Geduld und Toleranz. Ich kann mich nur schlecht verstellen und wen ich für einen „Sesselfurzer“ oder „Schlaumeier“ halte, der bekommt es auch zu spüren.
Ich weiß, dass Sie endlich wissen wollen, was nun zum Teufel auf der Fahrt nach Nizza passiert ist. Es geschah in Lyon. Wir hatten hier zehn Minuten Aufenthalt. Ich war aus dem Zug gestiegen, um mir am Kiosk den Spiegel zu kaufen. Bis dahin hatte ich allein im Abteil gesessen und mich mit Faulkners Absalom beschäftigt. Die Geschichte eines Mannes, der die Natur und die Menschen vergewaltigte und dem das Missgeschick zustieß, einen Sohn zu viel gezeugt zu haben. Er zahlte dafür. Am Ende meiner Geschichte werden Sie vielleicht zu der Erkenntnis kommen, dass wir alle auf einen Zahltag zusteuern. Machen Sie sich da nur keine Illusionen.
Ich wollte gerade wieder in meinen Waggon steigen, da sah ich ein Mädchen, dessen Anmut und Schönheit mich betroffen machte und in genau diesem Augenblick hörte ich über der in den Zug drängenden Menge eine Lerche. Ich weiß auch, dass dies ganz schön schräg klingt. Was haben Lerchen auf einem Bahnhof zu suchen? Die Schöne war gerade im Begriff, vor mir in den Waggon zu steigen, als ein baumlanger Kerl sie zur Seite drängte, so dass sie ins Stolpern kam und beinahe zwischen Bahnsteig und Zug auf die Schienen gefallen wäre. Ich riss den ungehobelten Kerl zurück und wollte ihm Manieren beibringen, aber er ließ sich auf keinen Kampf ein und verdrückte sich seitlich in der Menge. Leider machte keiner Anstalten ihn aufzuhalten. Ich zog das Mädchen hoch und bekam ein Lächeln, das jedem Papst die Abkehr vom Zölibat eingegeben hätte.
„Ist Ihnen etwas passiert?“, erkundigte ich mich etwas dümmlich.
Mein Französisch ist alltagstauglich, wenn man es auch in einem Salon gewiss naserümpfend als ‚cochon français‘ bezeichnen würde.
Sie schüttelte den Kopf und klopfte sich die Kleidung ab.
„Vielen Dank. Es geht schon.“
„Kannten Sie den Kerl?“
„Nein. Ich habe gar nicht gesehen, wie er aussah. Plötzlich fühlte ich einen Stoß und schon lag ich auf dem Bahnsteig. Manche Leute haben keine Manieren.“
„Er war nicht älter als dreißig. Sehr grobschlächtig. Leider hat er gleich das Weite gesucht.“
Ein Pfiff ertönte. Der Lautsprecher dröhnte. Wir mussten einsteigen.
„Nochmals vielen Dank, Monsieur.“
Im Gedränge auf dem Gang verlor ich sie aus den Augen. Ich ging in mein Abteil und blätterte im Spiegel. Ich vermochte mich nicht zu konzentrieren. Meine Gedanken glitten immer wieder ab, zu dem Augenblick, als ich glaubte, eine Lerche zu hören. Die Tür des Abteils glitt zur Seite. Sie trat ein und sah mich erfreut an.
„In der 2. Klasse ist alles besetzt. Darf ich mich zu Ihnen setzen?“
Ich stotterte ein „Oui, oui“, wies auf den Platz mir gegenüber und half ihr das Gepäck zu verstauen. Mein Blutdruck hätte jedes Messgerät außer Gefecht gesetzt. Ich habe keinen Zweifel, dass es Ihnen bei diesem Anblick nicht anders ergangen wäre. Ein Gesicht, das dem großen Leonardo den Gedanken an das Lächeln von Mona Lisa eingegeben hätte. Die alten Griechen wären für sie ein zweites Mal nach Troja gesegelt. Ein ovales Gesicht unter leicht welligem tiefschwarzem Haar. Eine gerade, vielleicht etwas zu lange Nase, große dunkle Augen und ein schön geschwungener Mund mit einer leicht vorgewölbten Unterlippe. Sie trug eine weiße Bluse und sah so frisch und unschuldig aus wie der Tau auf den Blättern der Olivenbäume früh am Morgen. Doch genug der Schwärmerei, sonst glauben Sie noch, dass mir die Pferde durchgegangen sind. Zugegeben, sie waren mir durchgegangen.
An den Füßen hatte sie Espadrilles. Unter dem langen schwarzen Rock verbargen sich endlose Beine. Sie mochte um die eins achtzig groß sein.
Der Zug nahm Fahrt auf. Es ging nun mit dreihundert Stundenkilometern dem Süden entgegen. Sie stand auf und ich half ihr, die große Tasche aus der Gepäckanlage zu heben. Sie belohnte mich mit einem Leonardolächeln und einem „Merci“, schnell und klar wie die Stimme von Patricia Kaas. Sie entnahm der Tasche ein Buch und gemeinsam hievten wir die Tasche wieder nach oben. Das Buch hieß Le premier homme, auf Deutsch Der erste Mensch, und war ein verdammt gutes Buch aus dem Nachlass von Camus. Ich lobte das Buch und sie nickte. Ihr Blick fiel auf meinen Faulkner auf der Fensterbank und ihr Urteil fiel genauso enthusiastisch aus. Wir mussten beide über die Übereinstimmung lachen.
„Sie sind Deutscher, nicht wahr?“, sagte sie in meiner Muttersprache. Dies ist mir schon öfter passiert. Jeder Ausländer, der mich sieht, identifiziert mich sofort als Deutschen. Kein Wunder. Deutscher kann man nicht aussehen. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich lieber der romanische Typ gewesen. Als Ausgleich verknallte ich mich stets in Frauen, die den italienischen Madonnen ähnelten.
„Sie können Deutsch?“, fragte ich überflüssigerweise.
„Meine Mutter war Bayerin, mein Vater ist Provenzale.“
Von einem bayerischen Mädchen hatte sie so rein gar nichts an sich. Ich war deswegen nicht unglücklich. Wir schwiegen eine Weile verlegen und sahen zum Fenster hinaus. Draußen veränderte sich das Landschaftsbild. Zypressen träumten in der Mittagssonne. Wir traten in die Welt der Griechen ein, die die Provence ja bereits lange vor den Römern kolonisiert hatten. Ich widmete mich wieder dem Spiegel. Seit ich in Frankreich war, schien nichts Aufregendes passiert zu sein. Ich legte das Heft beiseite und nahm das Buch wieder auf.
„Sie lieben Faulkner?“, fragte sie.
Ich nickte eifrig, glücklich, dass sie das Gespräch wieder aufnahm.
„Einer meiner Lieblingsautoren. Ich habe alle Bücher von ihm. Wie sagte Sartre: ‚Faulkner ist ein Gott‘.“
„Oh ja, Sartre sagte viel und manchmal war darunter Unsinn“, antwortete sie mit amüsiertem Lächeln. „Auch ich liebe Faulkner. Mein Lieblingsbuch von ihm ist Licht im August. Schon den Anfang finde ich wunderbar: Wie Lena sich darüber wundert, wie weit sie bereits gekommen ist, wirft einen Blick in ihre Seele. Ich liebe auch die Erzählung Der Bär.“
„Ja. Das ist eine großartige Geschichte. Obwohl es eine Jagdgeschichte zu sein scheint, ist es doch eine Aufforderung, der Natur respektvoll zu begegnen und für sie zu kämpfen.“
„Ja. Aber wir kämpfen nicht für sie.“ Sie seufzte.
Am liebsten hätte ich sie berührt.
„Ich war noch nie in Amerika“, setzte sie übergangslos hinzu. „Und Sie?“
„Ich kenne den Süden ganz gut. Alabama, Tennessee, Louisiana.“
„Sie kennen das Faulkner-Land?“, stellte sie überrascht fest.
Ihre Augen wurden immer größer. Wie gern tauchte ich in sie hinein. Mein Gott, betete ich, lass mich bei dieser Frau alles richtig machen. Dabei wusste ich nicht einmal ihren Namen, und ein Kirchgänger bin ich eigentlich nicht gerade.
„Dann waren Sie auch in Memphis?“
„Ja. Auch in Oxford, Mississippi, und in South Carolina, am Grab von Thomas Wolfe. Übrigens, darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Peter Gernot, aus Berlin.“
„Ismene Céline, wie der Schriftsteller, der …“
Sie brach ab und deutete mit dem Kopf an, dass sie über die Namensgleichheit nicht sehr glücklich war.
„Auch große Schriftsteller können sich schrecklich verirren. Ismene, was für ein schöner Name.“
„Es kommt noch besser: Meine Schwester heißt Antigone. Mein Vater ist ein Liebhaber der alten griechischen Dramen und wir müssen es ausbaden. Die ganze Stadt nennt uns die Griechinnen“, ergänzte sie lachend.
„Als ich Sie auf dem Bahnhof sah, glaubte ich eine Lerche zu hören“, gestand ich und hätte mich gleich darauf ohrfeigen können. Ich spürte förmlich, wie ich einen roten Kopf bekam.
„Eine Lerche auf dem Bahnhof?“, fragte sie ungläubig.
Ich nickte etwas blöde.
„Vielleicht hat das etwas zu bedeuten“, sagte sie hell lachend. „Waren Sie auch in New Orleans?“
Ich war froh, dass sie wieder auf Amerika zurückkam.
„Ja. Aber vor der großen Flut.“
„Ist es dort so wie in Faulkners Büchern?“
„Nein. Es ist schon interessant. Das schon. Aber Faulkner streicht nicht mehr durchs French Quarter. Es ist zu einer Amüsiermeile verkommen. Billige Bars, Sexshops. Selbst der Jazz klingt nicht mehr echt. Louis Armstrongs Trompete ist nicht mehr zu hören.“
„Alles vergeht!“, stimmte sie traurig zu, um dann trotzig hinzuzusetzen: „‚Nur die Erde bleibt ewiglich‘, sagte Faulkner. Aber selbst das ist nicht sicher“, korrigierte sie sich. „Wenn die Menschheit so weitermacht, wird sie in ein paar Generationen die Erde verlassen müssen. Deswegen sollten wir um sie kämpfen. Kennen Sie die Flugschrift Der kommende Aufstand?“
„Nein. Nie gehört.“
„Ein geheimes Komitee prophezeit den Untergang unserer Zivilisation, wenn wir so weitermachen. Man muss Partei ergreifen.“
„Und was kommt nach dem Aufstand?“, fragte ich, was gemein war, denn es konterkarierte ihren Enthusiasmus. Mach so weiter, schalt ich mich, so kommst du mit Sicherheit nicht weiter. Aber sie nickte nachdenklich.
„Das genau ist die Frage. Ich weiß es nicht. – Machen Sie Urlaub an der Côte d’Azur?“
„Nein. Mein Freund Mario Paresi hat ein Haus in Châteauromain gekauft. Ich will ihm beim Renovieren ein wenig zur Hand gehen.“
„Ach, welch ein Zufall!“, sagte sie und klatschte vor Freude in die Hände. „Ich bin aus Châteauromain. Mario Paresi ist Ihr Freund? Sie müssen wissen, in Châteauromain kennt jeder jeden. Mario ist schon jetzt sehr beliebt bei uns.“
Ich staunte wie ein kleiner Junge bei der Bescherung am Heiligen Abend. Sie kannte Mario. Ismene lachte über mein überraschtes Gesicht.
„Unsere Stadt ist nicht sehr groß. Wenn sich ein Fremder bei uns niederlässt, ist dies eine kleine Sensation, die tagelang für Gesprächsstoff sorgt.“
Ich brachte nichts Schlaueres heraus als ein „Wie klein doch die Welt ist!“. Doch ich fasste Mut und sah nun eine Möglichkeit unsere Bekanntschaft auszubauen.
„Ich miete mir in Nizza ein Auto. Gern nehme ich Sie nach Châteauromain mit.“
Manchmal kann selbst ich in Liebesdingen sehr fix sein. Ich hatte mich in diese Frau mit den dunklen Augen und dem Leonardolächeln Hals über Kopf verliebt. Ich wollte alles versuchen, ihr näher zu kommen.
„Sehr gern“, sagte sie schlicht.
„Hatten Sie beruflich in Lyon zu tun?“
„Nein. Ich bin nichts Besonderes. Ein Bauernmädchen halt. Mein Vater hat ein kleines Weingut. Ich bin für unseren Laden in Châteauromain zuständig. Ich verkaufe Wein, aber auch Olivenöl, Olivenseife, Lavendelhonig, Töpfereien. Alles, was Touristen so mögen. Ich war in Lyon bei den …“ Sie stockte und fuhr dann lächelnd fort: „Bei euch in Deutschland heißen sie Die Grünen. Ich wollte die copains für eine Demonstration in Châteauromain begeistern.“
„Demonstration?“, fragte ich erstaunt.
„Ja, mein Onkel Cesare Kreone will mit einer Investorengruppe ein Resort mit einem riesigen Golfplatz in Châteauromain bauen. Ein Resort für die Superreichen, ein Fünfsternehotel mit Spielcasino, Restaurants, Bungalows und Boutiquen. Es würde unsere Gegend total verändern … und wir würden uns verändern. Ein Fünfsternehotel mit Spielcasino wird Leute anziehen, die unsere kleine Stadt zu einem St. Paul de Vence machen. Alles Ursprüngliche würde verloren gehen. Zudem soll das Resort auf einem Hügel gegenüber der Stadt errichtet werden, wo die Reste eines alten Tempels stehen. Le Temple soll das Hotel heißen. Mein Onkel ist der Bürgermeister von Châteauromain. Er hat bei uns das Sagen. Er ist seine nicht mehr sehr ertragreichen Weinberge bereits an die Investoren losgeworden. Aber das Land reicht nicht für das, was sie vorhaben. Sie brauchen noch mehr Land, was unsere Stadt in zwei Parteien zerrissen hat. Die einen erhoffen sich von den Plänen Kreones gutes Geld für ihr Land oder bessere Geschäfte und zudem Arbeitsplätze, die anderen haben Angst, ihre Heimat zu verlieren. Denn allen ist klar, Châteauromain wird nach dem Bau des Resorts nie mehr so sein wie es einmal war. Es wird schwer sein ihn zu stoppen, weil er die Politik hinter sich hat.“
„Wenn er ihnen sein Land bereits verkauft hat, was treibt diesen Kreone dann noch an?“
„Er will für das Parlament aufgestellt werden. Dafür muss er sich in Paris als Mann des Fortschritts präsentieren und zeigen, dass er Arbeitsplätze geschaffen hat. Aber wir geben nicht auf. Wir kämpfen weiter.“ Ein zaghaftes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
„Das wird sicher nicht einfach werden.“
„Ja. Es ist nicht einfach. Meine Schwester ist mit Cesares Sohn verlobt. Henri ist natürlich auf unserer Seite!“, schob sie hastig nach.
„Könnte der Vorfall auf dem Bahnhof in Lyon etwas mit Ihrem Kampf in Châteauromain zu tun haben?“ Ein bisschen Paranoia ist bei uns Privatdetektiven Berufskrankheitf.
Ihre Augen weiteten sich. Erschrocken legte sie die Hand vor den Mund. „Sie glauben, dass …?“
„Wäre doch eine Erklärung.“
„Nein. Das glaube ich nicht. Wir sind doch alle Nachbarn.“
„Haben Sie bei den Grünen etwas erreicht?“
„Ja. Sie haben versprochen uns zu unterstützen. Aber ob sie es dann tatsächlich tun? Lyon ist weit weg. Antigone hätte sicher mehr erreicht als eine vage Zusage. Sie ist sehr stark. Sie bekommt immer, was sie will. Doch nun erzählen Sie mir doch mal, was Sie so tun.“
Ich gestand ihr nicht nur, was ich beruflich so trieb, sondern auch, warum ich nicht das Erbe meines Vaters angenommen hatte und ließ selbst meine Erlebnisse in Afghanistan nicht aus. Ich bin sonst nicht der Beichttyp, aber ihr gestand ich Dinge, die ich selbst Mario gegenüber nicht erwähnt hatte.
„Sie haben viel durchgemacht“, sagte sie mitleidig.
Auf Mitleid war ich eigentlich nicht aus. Trotzdem freute ich mich über ihr Mitgefühl.
Das Licht draußen wurde heller. Es erinnerte mich an Albert Camus’ Worte von dem mystischen Licht rund um das Mittelmeer. Aus dem braunen, sonnenverbrannten Land ragten dunkle Felsen wie Elefantenrücken heraus. Die Sonne hing rotgolden über den fernen Bergen, hinter denen ein Menschenschlag lebte, so knorrig, stark und unverwüstlich wie die Olivenbäume.
„Nun sind wir zuhause … in der Provence!“, sagte Ismene.
Es klang sehr feierlich und war mehr als eine Erklärung der Landschaft. Eine Einladung, sich mit etwas Besonderem einzulassen. Ich war bereit dafür.
Nizza empfing uns so huldvoll und strahlend, wie es sich für die Königin der Côte d’Azur gehörte. Es lag rotdachig unter einer gleißenden Sonne in einem türkisfarbenen Blau, so tief, dass man in das All hineinzusehen glaubte.
Ich gab meiner Leidenschaft für englische Autos nach und mietete einen Land Rover. Es schien mir das richtige Gefährt für die Provence zu sein. Normalerweise hätte ich noch einen Tag in der Stadt verbracht, um durch die Straßen zu bummeln, am Blumenmarkt in einem der Restaurants Muscheln zu essen und bitterschönen Erinnerungen an meine Jugend nachzuhängen. Doch Ismene machte es mir leicht darauf zu verzichten.
Als wir aus der Stadt fuhren, zerfloss die Sonne zu einem Vlies aus Gold. Immer wenn ich in der Provence war, glaubte ich den alten Griechen nahe zu sein. Das Licht, der stahlblaue Himmel, die Schatten der Zypressen und die Olivenbäume erinnerten mich an den hohen Mittag, wenn der große Pan aus dem Gebüsch tritt und auf seiner Flöte spielt. In der Provence fällt es einem leicht sich vorzustellen, wie es damals war, als die alten Götter noch lebten und die Griechen ihre Schiffe an Land zogen. Für mich ist die Provence eine tief heidnische Landschaft. Sie hat sich nie verändert. Man raunt zwar, dass Maria, die Mutter Jesu, hier an Land gegangen sei, aber ich glaube, dass ihr Name nur eine viel ältere Göttin ersetzte.
Während der Fahrt erzählte ich Ismene von Julian Apostata, jenem römischen Kaiser, den man den Abtrünnigen nannte, da er vergeblich versuchte, den heidnischen Göttern zur Renaissance zu verhelfen.
„Er hat es nicht geschafft“, stellte Ismene nachdenklich fest.
„Nein. Auf dem Feldzug in Mesopotamien traf ihn ein Speer in den Rücken. Ob der Speer von einem Perser oder von jemandem aus seiner Leibgarde geworfen wurde, ist nie bekannt geworden. Man sagt ihm die Worte nach: ‚Galiläer, du hast gesiegt‘. Von da an nannte man ihn den Abtrünnigen und zählte ihn zu den schlechten Kaisern. Er war ein Philosoph, Dichter und ein kluger Regent. Er war der letzte wahre Grieche auf dem Thron der Römer.“
„Griechenland muss schön sein.“
„Oh ja, Athen ist die Hauptstadt der Schönheit, wenn man die Stadt mit der Seele sieht.“
Ich schwärmte ihr von Athen vor, vom Lysikratous-Square und warum ich mich dort den alten Göttern immer sehr nahe gefühlt hatte. Dort hatte ich bei Rembetiko-Musik in einer Bar den alten Pan tanzen sehen. Ein uraltes Gesicht mit schlaffen Falten am Hals, doch mit jugendlichen Augen. Pan ist nie gestorben. Er hat sich uns nur entzogen und offenbart sich in seltenen Augenblicken an heiligen Orten. Zugegeben, wenn es um Griechenland geht, versteige ich mich zu den seltsamsten Fantasien. Ich bin wohl ein alter Heide.
Sie hörte mir konzentriert zu und spielte dabei gedankenvoll mit einer Locke ihres schwarzen Haares.
„Trotz Ihres seltsamen Berufes sind Sie ein Poet!“, sagte sie warm lächelnd. „Was für ein wundersamer Gedanke: Die alten Götter leben noch.“
„Durchaus. Man spürt sie im Licht rund um das Mittelmeer. Man spürt sie in Athen, auf dem Peleponnes in Naphlios, an der amalfitanischen Küste genauso wie unterhalb von St. Paul de Vence.“
„Sie haben schon so viel gesehen. Ich bin immer nur bis Cannes, Nizza und Nîmes gekommen. Stimmt nicht, einmal war ich in Paris. Ein Bauernmädchen eben“, fügte sie hinzu.
„Sie sind ja auch jünger als ich. Sie haben das alles noch vor sich. In Ihrem Alter bin ich auch nur bis Cannes und Nizza gekommen. Ich war hier mit unserer Band unterwegs.“
„Sie machen Musik?“, rief sie erfreut.
„Manchmal. Ich bin ein Drummer. Damals konnte ich ganz gut die Sachen der frühen Rolling Stones nachmachen, auch Bob Dylan und B. B. King, Bo Diddley und die anderen Bluesgrößen. Wir waren nichts Besonderes. Nur eine Bande von Rock’n’Roll-Verrückten. Aber es hat uns Spaß gemacht, und wir haben weiß Gott eine Menge davon gehabt.“
„Was Sie so erzählen, scheint aus einer längst vergangenen Welt zu kommen.“
„Sie haben ja so recht. Es war eine andere Welt und wir waren nicht einmal Zwanzig. Jeder hat wohl eine Zeit, die er verklärt. Wenn man genau hinsieht, war sie nur anders, weil man jung war.“
„Ein Philosoph auch noch?“, fragte sie mit leichtem Spott und wickelte die Locke um ihren Finger.
„Nein. Dafür sind andere zuständig.“
„Ich habe Angst um unsere Welt“, gestand sie. „Vielleicht sind wir die letzte Generation, die sie noch halbwegs unversehrt erlebt. Vielleicht wehrt sich die Natur mit Erdbeben, Tsunamis, Feuerstürmen und Epidemien. Die Menschen sind so dumm. Sie lernen nicht. Dabei haben wir nur diese eine Welt.“
Mir schien dieser plötzliche Ausbruch etwas übertrieben. Aber ich sagte nichts dazu, um sie nicht zu verärgern.
Die Gegend wurde felsiger. Nur noch selten tauchte ein Dorf oder eine Stadt auf. Wir waren nun im Herz der Provence, nicht unweit von Gordes. Wir fuhren in ein Tal und ich hielt beeindruckt den Wagen an.
„Wow! Ist das schön hier.“
„Hier lebe ich!“, sagte sie stolz.
Mir kam es wie Steinbecks Tal des Himmels vor und Châteauromain wie die Perle in einer Auster. Das Tal wurde von rotbraunen Felsen eingerahmt, die wie Wächter die Stadt umstanden. Aber es hatte nichts genützt. Die Investoren hatten die Schönheit dieser Gegend entdeckt und versuchten sie nun in eine Geldmaschine zu verwandeln. Im Talgrund leuchteten die roten Dächer von Châteauromain.
„Dort, gegenüber unserer Stadt, wo der Berghang in ein Plateau übergeht, soll der Golfplatz hinkommen. Bis zum Weinberg gegenüber, der uns gehört, werden sich kleine Bungalows hinziehen.“
„Was für ein Frevel“, stellte ich bedrückt fest.
„Verstehen Sie nun, warum wir revoltieren? Man nimmt uns unsere Heimat weg!“, sagte sie gepresst, als hätte sie Mühe Luft zu bekommen.
Ich schob den Gang wieder rein. Langsam, fast im Schritttempo fuhr ich das Tal hinunter, beeindruckt von der Schönheit, von den Farben.
„Wir sind keine große Stadt, aber es fehlt uns an nichts. Wir haben eine Pharmacie, ein Optikgeschäft, die Bank Crédit Agricole und sogar ein Collège.“
Die Häuser reihten sich an der Hauptstraße Rue de la Republique entlang. Ismene gab für mich den Touristenführer.
„Die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Leider wurde sie mehrmals überbaut. Doch innen kann man noch an den Bögen und den Säulen rund um den Kreuzgang den romanischen Baustil erkennen. Daneben liegt die Schule. Gegenüber der Kirche ist die Mairie, wo Cesare regiert. Da vorn ist unser Marktplatz, wo die alten Männer Boule spielen. Hier rechts ist das Bistro Cheval Blanc des Adrien Dupont. Mein kleiner Laden liegt gleich daneben, gegenüber dem Springbrunnen. Ich wohne allerdings auf unserem Weingut hinter der Stadt. Vor der Töpferei hat Doktor Junot seine Praxis. Am Ende des Dorfes ist das Restaurant Chez Anton. Dort ganz hinten, dicht am Felsmassiv, ist ein kleines Hotel. Sie können mich hier herauslassen.“
Ich hielt und bedauerte, dass die Fahrt schon zu Ende war. Ich hätte ihr stundenlang zuhören können. Ich fasste mir ein Herz und fragte schüchtern, ob wir uns wiedersehen könnten.
„Es ist unmöglich, dass wir uns nicht wiedersehen!“, erwiderte sie lachend. „Unsere Stadt ist dafür einfach zu klein.“
Sie gab mir die Hand und ich hielt sie länger, als dies schicklich war und sie verstand und errötete.
„Wir sehen uns ganz bestimmt wieder“, bekräftigte sie. „Kommen Sie doch morgen Abend ins Bistro Cheval Blanc. Wir versammeln uns dort jeden Freitag, um zu beraten, wie es weitergehen soll. Ich würde mich freuen.“
„Ich komme ganz bestimmt!“, versprach ich ihr. Nichts in der Welt würde mich davon abhalten. Sie würde sich freuen, hatte sie gesagt. Das war doch schon etwas, auf das sich aufbauen ließ.
„Sie fahren jetzt die Straße weiter, an der Boulangerie vorbei bis zur Töpferei und biegen dann rechts ab. Mario Paresis Haus ist das letzte am Ende der Stichstraße.“
Sie ging hochaufgerichtet zu dem Laden mit dem Schild „La Provence“. Mein Seufzer hätte Aphrodite gerührt.
Marios Haus war aus groben grauen Felssteinen und überragte wie eine Burg alle Häuser der Seitenstraße. Er hatte es frisch gedeckt. ‚Sanssouci‘ stand am Eingang. Wie der alte Gauner darauf gekommen war, wusste ich nicht. Das Haus hatte drei Stockwerke und eine große Terrasse, von der er die ganze Stadt übersehen konnte. Man musste eine Treppe hochgehen. Der Eingang befand sich in der ersten Etage. Auf dem Schild stand neben seinem auch mein Name. Er war wirklich ein Freund und ich hatte vor Rührung schwer zu schlucken. Ich drückte den Klingelknopf und das Läuten hörte sich sehr nach ‚O sole mio‘ an. Die Tür wurde aufgerissen und mein Bär drückte mich an sein stoppeliges Gesicht. Er sah aus wie Bud Spencer und wirkte auch meist sehr gemütlich. Doch war es nicht ratsam ihn zu verärgern. Außerdem war er ein Schlitzohr. Kein Wunder, immerhin stammte er aus Trastevere.
„Da bist du ja endlich! Ich hatte dich schon vorgestern erwartet. Konntest dich wohl wieder nicht von Paris trennen?“
„Du weißt doch: Paris ist ein Fest fürs Leben!“, zitierte ich Hemingway. „Im Übrigen könntest du dich mal wieder rasieren, alter Freund. Du siehst zum Fürchten aus.“
„Ich bin im Urlaub. Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“
„Von Goethe geklaut, du Gauner! Bist du mit dem Namen Sanssouci nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Der Alte Fritz in Potsdam würde dich einen verdammten Aufschneider nennen.“
„Meckere nicht! Du wirst schon noch kapieren, warum der Name absolut passend ist.“
Er führte mich in eine riesige Küche mit einem langen schweren Tisch. Über der Anrichte glänzten kupferne Töpfe und Pfannen.
„Hast du schon was gegessen?“
„Ein Sandwich im Zug. Aber ich konnte mich an etwas anderem sattsehen.“
„Was soll denn das schon wieder? Gab es eine Cezanne-Ausstellung im Zug?“, knurrte er und ging zum Kühlschrank, holte Wurst, Käse und einen Teller mit spanischem Schinken heraus und stellte alles mit einem Baguette auf den Tisch.
„Nun iss erst mal. Dann zeige ich dir das Haus.“ Er stellte Gläser und eine Flasche Rotwein dazu. „Der Wein ist von hier. Man bekommt ihn für ein paar Euro und er ist erstaunlich gut. Trink nur. Du wirst es nicht bereuen. Die Gegend hier war schon zu Römerzeit Weinland.“
Ich tat ihm den Gefallen und langte tüchtig zu. Essen war für ihn so wichtig wie die Luft zum Atmen. Ich erzählte ihm dabei von meiner Begegnung mit Ismene. Er grinste verständnisvoll.
„Ja, die beiden Céline-Schwestern können einen schon umhauen. Bis nach Aix-en-Provence hat sich die Schönheit der ‚Griechinnen‘ herumgesprochen und alle Kater streichen um ihr Haus.“
„Ist die Antigone auch so attraktiv?“
„Kann man wohl sagen. Aber auf eine herbere und sinnlichere Art. Sie ist die Kriegerin. Glaube nicht, dass ihr Verlobter bei ihr viel zu melden hat. Sie würde selbst den Staatspräsidenten strammstehen lassen.“
„Ich habe mich mit Ismene für morgen Abend im Bistro verabredet.“
„Ach, da spielen sie Verschwörung gegen Cäsar. Mach dir mit der Ismene keine zu großen Hoffnungen. Die ganze männliche Jugend der Provence hechelt hinter ihr her.“
„Die Hyänen weichen dem Löwen!“, erwiderte ich großspurig.
Aber ich war mir dessen nicht so sicher wie ich tat.
„Angeber! Sie soll mit dem Sohn vom Arzt liiert sein. Dorfklatsch. Und der Sohn vom Arzt zu sein, ist hier eine große Sache.“
Ich hatte nicht vor der Konkurrenz zu weichen, selbst wenn es sich um den Sohn von König Priamos handelte.
Nach dem Essen zeigte er mir das Haus. Er hatte einige Wände herausgebrochen und die Räume zu schönen großen Zimmern zusammengelegt. Das Haus hatte den ganzen Tag Sonne. Die Decken wurden von mächtigen Balken getragen, die er sorgfältig dunkelbraun gestrichen hatte. Es sah nicht aus, als wenn noch viel Arbeit für mich übriggeblieben wäre. Ich machte ihm Komplimente über den Zustand des Hauses und er freute sich wie ein kleines Kind.
„Wir haben jetzt ein schönes Refugium, wenn uns die Schnüffelei in Berlin und Rom mal zu viel ist.“
„Warum hast du gesagt, dass viel Arbeit auf mich wartet?“
„Na, sonst wärst du noch später gekommen. Im dritten Stock ist noch einiges zu tun. Malerarbeiten. Aber stimmt schon: Das Haus ist jetzt gut in Schuss. Kein Wasser in den Wänden. Es wurde im 18. Jahrhundert gebaut und wird noch einige Jahrhunderte aushalten. Mein ganzer Stolz ist die Terrasse. Komm, ich zeige sie dir. Man kann sie vom Wohnzimmer betreten. Sie thront wie ein Adlerhorst über der Stadt.“
„Wo hast du denn die schönen alten Möbel her?“
Sie sahen zwar etwas abgestoßen aus, passten aber gut zum rustikalen Charme des Hauses.
„Aus Antiquitätenläden in Aix und Gordes und von den Dachböden einiger Nachbarn. Man hilft sich hier.“
Die Terrasse ermöglichte nicht nur einen herrlichen Blick auf die Stadt, sondern auch auf die Berghänge mit den Weinfeldern und Olivenbäumen. Es war ein Ausblick, der süchtig machte.
„Es war eine gute Idee, dieses Haus zu kaufen“, sagte ich mit belegter Stimme. Vor so viel Schönheit hatte es mir schier den Atem verschlagen.
„Ja. Es ist wie bei San Gimignano, nur billiger. Und dieses schöne Fleckchen Erde will man mit einem Hotelresort mit Golfplatz verschandeln. Dort, hinter den Zypressen soll es gebaut werden. Dazu Luxusbungalows rund um den 18-Loch-Golfplatz. In der Mairie steht ein Modell. Noch hat die Investorengruppe nicht alles Land in die Hände bekommen, aber sie werden die guten Leute hier noch weichkochen und mit Geld zuschmeißen. Der Bürgermeister ist ganz besoffen von diesem Projekt.“
„Es scheint deswegen viel Ärger zu geben. Warum spielt der Bürgermeister dann das Spiel der Investoren?“
„Er redet davon, dass man mit der Zeit gehen müsse, von Arbeitsplätzen, Entwicklung der Infrastruktur und so weiter. Aber erstens ging es ihm darum, seinen Weinberg, der nicht so viel abwarf, zu einem horrenden Preis zu verkaufen. Zweitens will er für das Parlament kandidieren und muss etwas vorweisen. Das Resort würde gutes Geld nach Châteauromain bringen. Und drittens hat man ihn, was ich vermute, tüchtig geschmiert.“
„Aber er stößt auf Widerstand.“
„Kann man wohl sagen. Der Streit geht teilweise quer durch die Familien. Eins ist gewiss: Wenn das Golfhotel eröffnet ist, wird Châteauromain nie mehr so sein wie jetzt. Aber der Wert der Häuser wird sich vervielfachen und Boutiquen und reiche Deutsche, Engländer und Holländer werden hier einziehen.“
„Dann war das ja eine sehr gute Investition von dir!“
„Von wegen. Für mich würde sich der Wert der Immobilie vermindern. Die schöne Aussicht wäre verhunzt. Das Leben hier würde kostspieliger werden. Und ich will in einer urbanen Gemeinschaft leben und nicht in einem Luxusresort. Die Reichen passen nicht zu Mario Paresi. – Wie lange kannst du bleiben?“
„Du weißt doch, im Juli ist immer tote Hose. Ich höre jeden Tag das Telefon ab. Sollte ein anständiger Fall kommen, schwirre ich ab.“
„In Rom ist es ähnlich. Wir hatten eine Anfrage der Berlusconi-Gruppe. Aber man muss ja nicht jeden Auftrag annehmen.“
„Gut gemacht. Man muss sich nicht jeden stinkenden Fisch auf den Teller legen.“
Seit wir das Detektivbüro in Rom aufgemacht hatten, nannten wir uns etwas großspurig ‚Internationale Detektei‘. Ein bisschen Trommeln muss sein. Wir halfen uns aber gegenseitig: Wenn ich ihn brauchte, holte ich Mario nach Berlin und umgekehrt verhielt es sich genauso. Mittlerweile kannte ich Trastevere so gut wie Kreuzberg. Allerdings war in Rom das Wetter besser.
Wir gingen ins Wohnzimmer. Es hatte einen schönen Kamin und Mario schwärmte mir vor, wie anheimelnd wir es hier im Winter haben würden.
„Tja, vorne Sahara und hinten Grönland“, mäkelte ich. Seit ich einmal im Winter bei Freunden in Cornwall Ferien gemacht hatte, war ich gegenüber Kaminen und ihrer Wärmezufuhr etwas skeptisch.
„Du bist eine olle Frostbeule!“
Dem war nichts entgegenzusetzen. Ich war tatsächlich etwas kälteempfindlich.
„Nun los, wir könnten heute noch das Zimmer im dritten Stock fertig machen.“
Ich zog mich um und wir machten uns an die Arbeit. Nach kurzer Zeit sah ich in meinem Overall wie ein Harlekin aus. Wir strichen eine Wand in türkisblau, die andere in einem warmen Ockerton. Italiener mögen Kontraste. Wir tranken dabei einen schönen Rotwein aus dem Luberon, der kräftig und erdig war und im Abgang nach Vanille schmeckte.
Als wir die richtige Bettschwere hatten, beschlossen wir früh schlafen zu gehen. Am nächsten Tag wollten wir in Aix Möbel für mein Zimmer kaufen. Ich sollte im zweiten Stock wohnen, wo es neben dem Wohn- und Schlafzimmer noch zwei weitere Zimmer gab, die Mario als unsere Büros vorgesehen hatte. Wir gingen noch einmal auf die Terrasse, um den Farbgeruch aus der Nase zu bekommen, und atmeten die reine Luft ein.
Es war bereits dunkel. So dunkel wie in den Grotten des Minotaurus, wie Mario launig bemerkte. Nur in wenigen Häusern brannte noch Licht. Die Grillen übten sich an der Kleinen Nachtmusik. Irgendwo bellte ein Hund den Mond an. Verständlich. Wie ein schöner großer Goldtaler hing er am Himmel.
„Gib es zu, hier lässt es sich leben“, seufzte Mario glücklich.
Plötzlich sahen wir drüben, vor dem Schatten der Mairie, einen Blitz. Ein Knall zerriss die Stille. Noch einmal folgten Blitz und Knall. Allerdings hörte es sich nun anders an.
„Da hol mich doch …! Das sind Schüsse!“, stieß Mario hervor.
Es knallte noch einmal.
„Und das hier in Châteauromain“, stammelte mein Freund fassungslos.
Ich lief in mein Zimmer und holte meine Smith & Wesson. Wir trafen uns am Ausgang. Mario hatte seine Baretta in der Hand. Wir liefen die Seitenstraße hinunter auf die Rue de la Republique und zur Kirche hoch. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Überall stürzten Menschen aus den Häusern.
„Hier ist die Welt noch in Ordnung. Man lebt in einer anderen Zeit“, hatte Mario gesagt, als er mich drängte, nach Châteauromain zu kommen. Leider war dies nur bedingt richtig. Unsere Zeit war in die Provence eingebrochen.
2
Das Gelächter im Dunkel
Die halbe Stadt war zur Mairie unterwegs. Alles schrie hektisch durcheinander. Einige hatten Knüppel in der Hand. Auch an Flinten fehlte es nicht. Neben dem Brunnen, gegenüber von Ismenes Provence-Laden fanden wir ihn. Er lag mit ausgebreiteten Armen auf der Erde. Als hätte er sich hier zur Kreuzigung bereitgelegt. Ich drängelte mich zu ihm durch, beugte mich über ihn und legte die Hand an seine Halsschlagader. Seine Brust wies große Blutflecken auf. Da war nichts mehr zu machen. Der Mann war tot. Die Leute hinter mir hatten den Revolver in meiner Linken entdeckt und murmelten erregt durcheinander. Der Tote mochte kaum älter als fünfundzwanzig sein. Ein schmales junges Gesicht mit einer ungebärdigen schwarzen Haartolle. Der romantische Typ. Er hatte die Verwirklichung seiner Träume noch vor sich gehabt und manchen Traum noch nicht geträumt. Ich drückte ihm die Augen zu. Hinter mir sprach jemand laut ein Gebet. Ich drehte mich um. Ein breites rötliches Gesicht. Der Pfarrer der Kirche St. Gabriel.
„Ist er …?“
„Tot“, bestätigte ich ihm. Die Wunde in seiner Brust hätte auch einen Elefanten gefällt.
„Regt euch ab! Der Mann wurde mit einer Schrotflinte erschossen und nicht mit einem Revolver“, hörte ich Mario sagen.
„Wer ist der Junge?“, fragte ich Mario.
Mein Freund sprach mit einigen Einheimischen. Ich richtete mich auf und steckte den Revolver weg. Plötzlich stand Ismene vor mir.
„Es ist Pierre Claudel, der Sprecher unserer Vereinigung zum Schutz von Landschaft und Heimat“, stellte sie mit schreckensgeweiteten Augen fest. Neben sie trat eine Frau, die ihr ähnelte. Das Gesicht war jedoch voller und hatte einen leidenschaftlichen, entschlossenen Zug um den Mund. Das Haar war glatt zurückgekämmt.
„Das ist Kreones Werk!“, klagte sie an und sah sich Beifall heischend um. Aber die Zustimmung hielt sich in Grenzen.
„Unsinn! Dafür gibt es keinen einzigen Beweis“, sagte ein weißhaariger Mann, stellte seinen Koffer ab und kniete neben dem Toten nieder. Offensichtlich der Arzt Junot. Ein asketisches Gesicht mit klugen Augen.
„Da ist tatsächlich nichts zu machen“, bestätigte er meine Diagnose. „Er war sofort tot. Da hat einer gründliche Arbeit abgeliefert. Jemand muss die Gendarmerie benachrichtigen.“
„Habe ich bereits erledigt“, winkte ein kleiner Mann mit einer blauen Schürze ab, die das Firmenlogo von Jack Daniels zeigte.
„Adrien Dupont, der Inhaber des Bistros“, flüsterte mir Mario zu.
Die Gauloise im Mundwinkel, die Ärmel hochgekrempelt, die Hände in die Seiten gestützt, konnte ich ihn mir gut hinter der Theke vorstellen, das Urbild eines Bistro-Inhabers.
„Er kann hier nicht liegenbleiben“, sagte der Arzt und sah auffordernd um sich. Von dem Springbrunnen kam ein feiner Wasserschleier zu uns herüber.
„Lass ihn mal liegen!“, widersprach Dupont. „Im Fernsehen wartet man auch erst immer auf die Spurensicherung.“
Sein Blick war auf die Magnum in meinem Gürtel gerichtet. Ehe ein Missverständnis auftreten konnte, klärte ich ihn auf.
„Ich bin Privatdetektiv.“