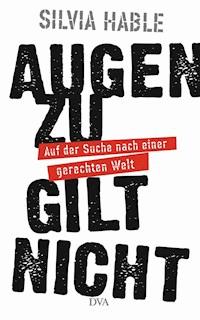Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Kapitel 1 - Vor dem Mobilfunkzeitalter
Copyright
Für ViolettaNur mutig gestritten, the future is unwritten
Vorwort
Ein autobiografisches Buch veröffentlichen - mit 25 Jahren? Ist das nicht etwas unangemessen? Oder geradezu vermessen? Zu allem Überfluss bin ich weder Popstar noch Topmodel, noch habe ich einen Nobelpreis in Aussicht. Da könnte ja jeder kommen und die Welt mit seinen Anekdötchen langweilen. Immerhin - im Fernsehen war ich schon einmal. »Ich war das perfekte Kind« hieß die fünfundvierzigminütige Dokumentation über mich, die im Juni 2005 in der ARD ausgestrahlt wurde, ein Film über ein nettes Mädchen, das zur renitenten Punkerin wird, mit ausführlichen Einsichten in mein Innenleben. Der Film endet mit dem bedeutungsschweren Satz: »Ich will nicht mehr die Welt verändern, sondern nur noch mich.«
Das war eine Momentaufnahme aus den letzten Drehtagen, im Herbst 2004. Seitdem hat sich einiges getan - in der Welt und bei mir. Ich habe halb Europa bereist, bin zeitweise ins Ausland gezogen und habe eine kleine Familie gegründet. Die Welt ist sich ihrer Widersprüchlichkeit bewusster geworden, in tiefe Krisen gestürzt und wartet noch immer auf den- oder diejenige, der/die den ganzen Schlamassel erklären und bei Gelegenheit wieder alles in Ordnung bringen kann. Die Welt ist geduldig, ich bin es nicht.
Als ich das Angebot bekam, ein Buch über mein Leben als Aktivistin zu schreiben, habe ich sofort zugesagt, ohne recht zu wissen, was dabei herauskommen könnte. Gerne wollte ich noch ein paar Sachen erklären, die mir in dem Film zu kurz angesprochen waren, vor allem die politische Dimension meines alternativen Lebens. Und dann wollte ich es auch einfach einmal ausprobieren, wie das so ist, einen großen Text zu schreiben. Ich vergrub mich in meinem Elternhaus und blätterte in alten Tagebüchern, linken Heftchen, recherchierte in Archiven, im Internet, trat mit längst in Vergessenheit geratenen Bekannten wieder in Kontakt und diskutierte das Projekt in internationalen Aktivistenkreisen. Und allmählich merkte ich, wie es mir immer wichtiger wurde, das Zeitgefühl meiner Jugend wieder einzufangen, diese Wut, dieses Unverständnis einer kalten Welt gegenüber und den unbremsbaren Aufbruchsgeist, und all das festgehalten und bewahrt zu wissen, was die Protestbewegung der Jahrtausendwende ausgemacht hat und weiterhin prägt.
Mehr als drei Jahre später hat das Buch seinen Abschluss gefunden.
Aber was ist das denn eigentlich für ein merkwürdiges Zeitgefühl, mag sich da so manch einer verwundert fragen. Sind Punks und Politisch-Sein nicht komplett aus der Mode? Die jungen Leute von heute wissen doch, wo es langgeht: Schnellstudium und danach der Karrieredurchstart. Protestieren, das war anno’68 in oder meinetwegen auch noch in den Achtzigern, diese Sache gegen Atomkraft und für mehr Frieden. Heutzutage schaut doch jeder für sich selbst, wo er bleibt, und nur noch ein paar Verwirrte kämpfen für eine in ihren Augen gerechtere Welt.
Ich kann das nicht bestätigen. Meine Erfahrung in den letzten Jahren sagt mir, dass die »Szene« Zuwachs bekommen hat, die Szene, die nicht mehr auf den- oder diejenige wartet, der/die uns die Welt erklärt und den Schlamassel beseitigt, die Szene, die nicht auf Scheinlösungen oder verkappte Reformen setzt, sondern klipp und klar sagt: »Es reicht! Haltet uns nicht mehr länger für dumm. Hört auf mit eurer Scheinheiligkeit, für Klimaschutz zu werben, und dann doch, bei jeder sich bietenden Möglichkeit, dem schnellen Profit den Vorrang zu geben.« Der Wahnsinn, auf Finanzkrise und Klimawandel mit Geldgeschenken für noch mehr Autos, Straßen und Parkplätze zu antworten, steht hier nur exemplarisch.
Allein beim G-8-Treffen 2007 in Heiligendamm waren über zehntausend, überwiegend junge Menschen auf den Beinen, um die Zufahrtsstraßen zum militärisch abgesicherten Tagungsort erfolgreich zu blockieren. Für viele war es der erste Berührungspunkt mit der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung und der gepanzerten Polizei, und es war die erste Erfahrung von einem starken Gemeinschaftsgefühl unter den Demonstranten. Sie dürften ähnlich ergriffen von den Ereignissen gewesen sein wie ich, als ich mich ein paar Jahre früher auf meiner ersten antifaschistischen Demonstration wiederfand und mich nicht zuletzt wegen der starken Verbundenheit innerhalb der Szene trotz aller Enttäuschungen und Rückschläge im Laufe der Jahre immer wieder auf unterschiedliche Weise für sie engagierte.
Dennoch, diese Szene ist kein deutlich wahrnehmbarer Einheitsblock mehr, wie es in Zeiten des Kalten Krieges letztmalig möglich gewesen ist. Diese Szene ist ein bunter Mischmasch an Konzepten, Kampagnen und Lebensentwürfen, sie verstrickt sich selbst in Widersprüche und verbringt die Hälfte ihrer Wachzeit auf Plenen, um horizontale Konsensentscheidungen zu ermöglichen. Trotz allem oder gerade deshalb bringt sie die Verhältnisse noch immer und wieder immer mehr zum Tanzen.
Meine Eindrücke und Erfahrungen, die ich hier in dem Buch festgehalten habe, bilden nur eine Stimme von vielen Hunderttausenden auf der ganzen Welt, die im globalisierten Kampf gegen die fatalen Auswirkungen der neoliberalen und egoistischen Politik einer kleinen selbstgefälligen Elite unterwegs sind. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität, rufe aber unverhohlen zur Nachahmung auf und natürlich zum Noch-besser-Machen.
Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der im Text vorkommenden Personen habe ich einzelne Namen und Orte geändert.
Ich danke all den Menschen, die mich in der Zeit des Schreibens begleitet und bei dem Projekt unterstützt haben, besonders Anton, ohne den ich gar nicht erst angefangen hätte, Korrekturleserin Natalie, allen, die mir bei der Titelsuche behilflich waren, Hanna für ihre Ausdauer, das Buch voranzubringen und mich (wenn auch nicht immer erfolgreich) von notwendigen Kürzungen zu überzeugen, meinen Eltern, die mit dem Text gewachsen sind, und Gualter für seine Engelsgeduld und Linuxfachkenntnisse. Und natürlich allen inspirierenden Menschen, Kollektiven und Gruppierungen, die sich ebenfalls auf die Suche gemacht haben und mal laut, mal leise dafür sorgen, dass nichts bleibt, wie es ist.
Silvia Hable Lissabon, im Januar 2009
1
Vor dem Mobilfunkzeitalter
»Natürlich bringe ich Ihnen Ihre Tochter wieder wohlbehalten zurück.« Kai gibt sich wirklich Mühe, und seinen Irokesenschnitt hat er sogar unter einer Baskenmütze versteckt. Er trägt ein sauberes T-Shirt und eine Hose ohne Löcher. Wo er die wohl herhat? Für meine Mutter steht außer Frage, dass Kai draußen vor der Haustür stehen bleibt, sie bittet ihn herein. »Du willst uns doch nicht deinen neuen Freund vorenthalten?« Mir ist das alles oberpeinlich.
Wir sitzen im Wohnzimmer auf der beigefarbenen Couch vor dem Siebziger-Jahre-Wandschrank, der aussieht, als würde er bald unter der Last verschiedener Lexika und anderer Fachbücher - erworben von meinem Vater und so gut wie nie benutzt - zusammenstürzen. Ich hoffe inständig, dass es nicht gerade ausgerechnet an diesem Tag im Frühling 1999 passiert. Mein Vater stellt extra den Fernseher leise, meine Mutter serviert Mineralwasser. Kai und ich nippen einmal dran. Unsere Rücken sind durchgestreckt wie in den Anleitungen der AOK-Gesundheitsschule, die Fußspitzen berühren nur leicht den Boden, die Hände liegen auf den Knien, die Beine sind zusammengepresst - das personifizierte Unbehagen.
»Was machen Sie denn so, oder darf ich Sie duzen?« Ich überlege, ob meine Mutter vielleicht die versteckten Schulverweise unter dem Sofa gefunden haben könnte oder die Blätter, auf denen ich die schwierige Unterschrift meines Vaters jeden Tag geduldig übe, um selbst Abwesenheitsentschuldigungen für die Schule schreiben zu können. Oder gibt es noch einen anderen Grund für ihre seltsam gestelzte Inszenierung? Ich bin etwas ratlos, sonst redet sie nie so förmlich.
Kai räuspert sich. »Natürlich können Sie mich duzen, ich mache gerade mein Abitur. Leistungskurs Chemie und Französisch.« Ich halte die Luft an. Ob meine Eltern ihm auf den Leim gehen? In Wirklichkeit hat Kai nur einen Hauptschulabschluss, besucht die Berufsschule und lernt Kfz-Mechaniker. Möglich, dass er bald wegen seines aufmüpfigen Verhaltens rausgeschmissen wird. Glücklicherweise steckt in Kai ein mir bislang verborgen gebliebenes Schauspieltalent. Jedenfalls reicht es für die heutige Aufführung, die sich da nennt: »Vernünftiger Umgang mit Erwachsenen«.
Anscheinend kommt meiner Mutter doch irgendetwas verdächtig vor. Sie vergewissert sich, ob wir tatsächlich zu einer Geburtstagsfeier von einem Bekannten wollen, was wir bestätigen. »Und jetzt müssen wir los.« Kai steht auf, um dem Spektakel ein Ende zu bereiten. Meine Eltern lassen es sich nicht nehmen, uns zu seinem Wagen zu begleiten. Während ich in den kleinen roten Polo, gespickt mit Aufklebern voll von Revolutionsparolen, einsteige, zieht meine Mutter die Stirn in Falten und meint: »Ach, ich weiß nicht so recht. Muss das wirklich sein? Du bist doch erst letzte Woche aus Frankreich zurückgekommen.«
»Immer auf die Walz gehen, warum bleibst du nicht einmal zu Hause?« Mein Vater mischt sich ebenfalls ein, dabei inspiziert er genau die Aufkleber auf dem Auto. Die Gardinen der umliegenden Häuser werden beiseitegezogen, die Rentner aus der Nachbarschaft wollen sich nichts entgehen lassen.
Bange Sekunden. Jetzt habe ich es fast geschafft, jetzt kann ich nicht einfach aufgeben. »Aber die Frankreichreise war doch eine schulische Zwangsmaßnahme, um besser Französisch zu lernen«, wende ich ein. »Jeden Tag musste ich die Hackfressen meiner Klassenkameraden sehen.«
»Wo hast du dir nur diese Ausdruckweise angeeignet!« Mein Vater schüttelt den Kopf.
Eigentlich war der zweiwöchige Schüleraustausch gar nicht so übel gewesen. Endlich war ich einmal der strengen Aufsicht meiner Eltern entkommen. Ich lernte eine Menge, wobei es weniger um Vokabeln ging, sondern mehr um Marihuana und wie man gekonnt auf Partys abhing. Höhepunkt und Abschluss der Fahrt war das Konzert einer coolen Punkband, zu der Franzosen und wir deutschen Austauschschüler herumhüpften, als hätte uns jemand zu viel Kaffee anstatt Dope eingeflößt. Ansonsten war es stinklangweilig. Ich war bei einer völlig bekloppten Tussi untergebracht, die wir Elisien nannten, weil sie Elise hieß und einen Alienkopf hatte. Sie wohnte mit ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester auf dem Gelände einer Schule für schwererziehbare Jungen. Abends wurde das Eingangstor aus massivem Eisen geschlossen, und ich war eingesperrt. Jeglicher Protest half nichts. Die Mutter? Verschollen. Einmal verbot Elisien mir, abends etwas zu essen, wenn ich nicht vorher meine Eltern anrufen und ihnen erzählen würde, wie toll es in Frankreich sei. Ich tat, was man von mir verlangte, sagte aber am Telefon, wie scheiße dort alles sei. Obwohl Elisien direkt neben mir saß und seit fünf Jahren Deutsch in der Schule lernte, war ich mir sicher, dass sie mich nicht verstand.
Für die Franzosen endete der Unterricht erst um fünf Uhr nachmittags, und danach hatten sie noch einen Berg von Hausaufgaben zu bewältigen, dennoch schien bei den gelangweilten und oft völlig bekifften Schülern noch weniger anzukommen als bei uns in Deutschland. Der einzige Sinn und Zweck des Schulmarathons schien darin zu bestehen, dass sie nicht wie Kai und seine Clique den Nachmittag lang an einer Mauer am Eingang der Innenstadt lehnen, Bier trinken und hochnäsige, in Pelze gehüllte Kurgäste anpöbeln konnten.
Auf meinem Schulweg gehe ich jeden Tag an dieser mit bunten Graffiti besprühten Mauer vorbei. »Nazis raus« ist daraufgesprayt, das erste A in einem Kreis eingeschlossen, davor ein zackiges N. Das hat Stil - im Gegensatz zum Rest der kleinen Kurstadt, in der ich wohne und in der die Todesursache Nummer eins nur eine sein kann: Langeweile. Irgendwann fiel mir auf meinem täglichen Weg zur Schule ein süßer Typ auf, Kai. Mit weißer Lackfarbe hatte er auf seine Lederjacke ganz groß »Freiheit hat etwas Ansteckendes« geschrieben. Ich fand sofort, dass er Recht hatte - und fühlte augenblicklich den Schnupfen der Unabhängigkeit in mir aufsteigen. Ein paar Leute aus seiner Clique kannte ich vom Sehen, sie gingen auf meine Schule und waren zwei, drei Jahre älter als ich. Alle waren in meinen Augen sehr kreativ gekleidet, ein paar Frauen hatten sich im Pulp-Fiction-Stil angezogen, trugen Lederminis und waren stark geschminkt. Lasziv lächelnd ließen sie sich von ihren Anbetern eine Zigarette nach der anderen anstecken. Gern wäre ich wie sie gewesen.
Kai wird langsam ungeduldig. Er will endlich losfahren und nicht länger herumdiskutieren. Meine Eltern wechseln einen dieser Blicke, den nur Eltern von pubertierenden Jugendlichen draufhaben. »Bitte! Nur dieses eine Mal!« Ich sehe sie flehend an. Schon so lange habe ich darauf gewartet, dass Kai mich endlich mitnimmt zu einer dieser angesagten Partys mit Punks, Hippies und Autonomen. Wenn es eine überirdische Gerechtigkeit gibt, denke ich, so senke sie sich jetzt bitte auf mich nieder. Ruhe bewahren. Tief durchatmen. »Na gut, aber sei um elf zu Hause! Du bist erst fünfzehn.«
Im Rückspiegel sehe ich, wie meine Eltern nebeneinander auf der Straße stehen und uns hinterherschauen. Wahrscheinlich schicken sie gerade ein Stoßgebet zum Himmel. Fast empfinde ich ein wenig Mitleid. Mein Leben fühlt sich zum ersten Mal wirklich lebenswert an, während es für sie schon fast gelaufen ist. Sie werden sich umdrehen, in ihre schöne Doppelhaushälfte zurückkehren und den Fernseher wieder lauter stellen. Meine Mutter wird die Wolldecke auf ihrem Sessel geradezupfen und danach mein Kaninchen Stefan aus dem Käfig holen, damit es sich auf ihrer großen Brust gemütlich machen kann. Ihren Kummer über die missratene Tochter werden sie während einer dieser pseudopolitischen Samstagabendcomedysendungen vergessen. Sie werden sich in ihren Sesseln kugeln. Mein Vater wird sagen: »Genauso ist es, das ist wirklich eine Riesensauerei« - aber ändern werden sie nichts, weder in ihrem Leben noch in der Gesellschaft. Schließlich werden sie zufrieden ins Bett gehen, dann aber anfangen, sich um ihre Tochter zu sorgen. »Wo die nur bleibt!«, wird mein Vater fragen, und ich kann mir vorstellen, wie seine Wangen dabei zucken. »Ich hab’s ja gleich gewusst, sie wird es mit der Uhrzeit nicht genau nehmen.« Beide werden ins Grübeln geraten, wann es anfing mit den Problemen mit ihrer Tochter, die doch aus einem sogenannten gutbürgerlichen Haushalt kommt, der Vater Ingenieur, die Mutter Lehrerin, und warum sie so schwierig wurde. War es der fortwährende Ehestreit, der ihr zusetzte, der Sauerstoffmangel bei der Geburt, etwa das Erbgut ihrer verrückten Großtante? Oder war es doch der Einfluss dieser Gestalten, mit denen sie neuerdings Umgang pflegte und ein »Umsonst & Draußen«-Festival vorbereiten wollte?
Unser rotes Auto gleitet durch die kleinstädtische Ödnis. Niemand ist mehr auf der Straße zu sehen. Um Punkt 20 Uhr werden, auch jetzt im Frühling, die Bürgersteige hochgeklappt. Die Fernseher in den Wohnzimmern gehen zeitgleich an und lassen die Fenster in einem diffusen bläulichen Licht auf flimmern. Dank der Tagesschau kann man auch in meiner Kleinstadt am Elend der Welt teilhaben, ohne direkt davon betroffen zu sein.
Kai und ich sammeln unterwegs noch ein paar andere Leute ein, die ich teilweise aus der Schule, teilweise aus der Vorbereitungsgruppe für das Festival kenne. Ich bin beeindruckt! Die Pulp-Fiction-Frauen sind noch besser geschminkt als sonst. Die Augen tiefschwarz umrandet, kirschroter Lippenstift, dazu tragen sie sexy Strapse oder haben mehrere Leggins übereinander kombiniert. Eine von ihnen hat ihre schwarzen kurzen Haare zu einer Igelfrisur umgestaltet, nur eine blaue Strähne hängt vorn frech ins Gesicht. Ein anderer Typ, der in der Schule immer mit einer Baseballkappe herumläuft, hat seine bunten Haare zu langen Stacheln aufgestellt, mindestens zehn Zentimeter lang. Gern würde ich sie mal anfassen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sie sich anfühlen. Aber ich halte meine Hände unter Kontrolle.
Alle lachen über Kais Aufmachung. Er deutet als Antwort auf mich. »Musste noch bei den Eltern der Lady vorsprechen.« Zum ersten Mal schenken mir die anderen Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie ich den Spruch von Kai zu deuten habe. Soll ich stolz sein oder bin ich in seinen Augen nur ein kleines Mädchen, das er gütigerweise ausführt? Wenn ich an mir herunterschaue, finde ich mich nicht gerade »heiß«. Ich trage eine weinrote, abgeschnittene Schlaghose. Weil ich durch das viele Weißbrot in Frankreich zugenommen habe, ist der Stoff über der linken Pobacke aufgeplatzt. Extrem trendy. Nun quillt mein halber Hintern heraus. An den Füßen trage ich alte Buffalostiefel. Modischer Fehltritt einer Jugendlichen, die angeblich zur Popgeneration gehört, bis vor kurzem aber nur B5 aktuell, den Nachrichtensender des Bayerischen Rundfunks, hörte, die anstatt grinsender Popstars über dem Bett ein überdimensional großes Poster vom Fall der Berliner Mauer hängen hat, niemals ein Tamagotchi besessen oder Sticker gesammelt, stattdessen in ihrer Freizeit gern Pläne von imaginären Städten gezeichnet hat: Rathaus, Schwimmbad, Spielplatz, das Leben zwischen Kirchallee und Hauptstraße ist so übersichtlich gewesen.
Außerdem habe ich ein langärmeliges T-Shirt an, auf das ich mit Edding in großen Buchstaben »Nihilist« geschrieben habe. Ich weiß zwar nicht genau, was ein Nihilist ist, aber mein Physiklehrer hat mich so genannt - und das Wort gefällt mir. Mein Outfit wird abgerundet durch einige billige Perlenketten, ein Geschenk von Elisien und ihrer Schwester. Geschminkt bin ich nicht, das passt nicht zu meinem Babyface, finde ich.
»Wir gehen auf ein Konzi im Hof von’nem Kumpel. Es werden Bands spielen«, teilt Kai uns allen mit.
»Wow«, entfährt es mir.
»Na ja, was Besseres geht heute nicht ab«, sagt der Typ mit den hohen Haaren, der, um seine Frisur nicht zu zerstören, den Kopf fast bis zu den Knien heruntergebeugt hält. Das muss ungemütlich sein. Ich begreife bei einem Blick in die übrigen, bemüht gelangweilten Gesichter: Meine Euphorie ist hier nicht angebracht. Mach dich bloß nicht zum Hanswurst, Silvia, ermahne ich mich selbst. Du sitzt inmitten der coolsten Leute deiner Stadt, überhaupt des gesamten Landkreises, und wir rumpeln bestimmt zur coolsten Party des Jahres.
Als wir auf dem Hof ankommen, bin ich entsetzt. Ich hatte ein großes Konzert erwartet, stattdessen liegen nur vollkommen abgedrehte Bauerntrampel auf einer kleinen Wiese vor einer selbstgezimmerten Bühne. Fast so schlimm wie bei den todlangweiligen Dorffestivitäten, bei denen man sich von Mai bis September unter Vorwänden wie »125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kleinkackdorf« oder »345 Jahre Gründung Großscheißkaff« günstig unter den jeweiligen Biertisch säuft und das lokale Rote Kreuz mit Alkoholvergiftungen in Schach hält. Dort hatte ich an Wochenenden - in Ermangelung von Alternativen - erst mit meinen Eltern, später allein einen beträchtlichen Anteil kostbarer Lebenszeit verschwendet, bis ich auf den Videoclip Pushed Again von den Toten Hosen und den Jahresbericht von Amnesty International aufmerksam wurde und mit all meiner jugendlichen Energie beschloss, ab sofort für Gerechtigkeit auf Erden zu sorgen. Und das würde mit den beschränkten Dorfpartybesuchern nichts werden.
Den größten gemeinsamen revolutionären Nenner sah ich bei Kai und seiner Clique - was leider nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Um auf mich und meine weltverbesserischen Intentionen aufmerksam zu machen, kritzelte ich »Zahme Vögel träumen von der Freiheit, wilde Vögel fliegen« auf meinen Schulordner. Und ich sammelte sämtliche Zeitungsartikel über Edmund Stoiber und seine Partei, um mir mein neues Feindbild zu bestätigen. Zudem schrieb ich für unsere Schülerzeitung einen kämpferischen Artikel, in dem es um mehr Mitspracherechte von Schülern im Allgemeinen und über die Notwendigkeit der Bereitstellung von mehr Käsebrötchen im Speziellen ging. Ich, als neue Vollblutvegetarierin, litt schwer unter dem großen Schinkenbrötchenangebot. Der Beitrag wurde leider nie gedruckt.
Nachdem niemand auf die flotten Sprüche auf meinem Ordner aufmerksam wurde, beschloss ich, andere Maßnahmen zu ergreifen. Ich fand heraus, dass dieser Kai im Jugendbeirat der Stadt arbeitete. Einfach perfekt! Ich sah uns beide schon, die rote Fahne schwingend, mit wehendem Haar den Marsch durch die Institutionen antreten und gewinnen. Natürlich war mir seit diesem Moment nichts wichtiger, als selbst in den Jugendbeirat zu kommen. Um ein erfolgversprechendes politisches Profil zu erlangen, glich ich meine Wahlversprechen an die von Kai an. Meine Ziele, für die ich schließlich gewählt wurde, waren die Einrichtung eines Bandprobenraums im Jugendzentrum, mehr Umsonst & Draußen-Partys, die Abschaffung der Sperrstunde bei Lokalen und Kneipen und die Herausgabe einer Jugendzeitung, in der natürlich auch meine Artikel veröffentlicht werden sollten. Kai wollte außerdem noch erreichen, dass es selbstverwaltete Räume in der Innenstadt gab.
Es wurde richtig lustig im Jugendbeirat, wenn auch nicht besonders politisch. Wir unternahmen ein paar Fahrten, bei denen wir uns in anderen Städten progressive Sozialarbeiterprojekte anschauten und abends auf dem Zimmer der jeweiligen Jugendherberge »Pflicht oder Wahrheit« spielten. Zur Belustigung aller durfte ich beispielsweise vortäuschen, wie es ist, mit einem Schrank zu masturbieren. Der Weg durch die Instanzen ist eben steinig, dachte ich mir und stöhnte laut, was die Runde noch mehr erheiterte. Die größten Projekte, die im Laufe unserer »Legislaturperiode« realisiert wurden, waren alkoholfreie Streetballnächte und der Verkauf von Kinderpunsch und Softdrinks in der Eisporthalle, wobei wir uns die Finger abfroren.
»Nein, wir haben keine Cola mehr!«, raunzte Kai einmal bei einer solchen Aktion in der Eissporthalle einen Elfjährigen an. Zufälligerweise waren wir zur gleichen Zeit für diesen Dienst eingeteilt. »Wieso? Die Flasche ist doch noch voll?« So verschüchtert der Kleine auch war, seine Cola wollte er haben. »Weil wir hier keine Getränke von Firmen verkaufen, die ihre Mitarbeiter abknallen, wenn die ihnen nicht in den Kram passen! Und die sind übrigens so alt wie du, müssen nachts arbeiten und gehen mir nicht auf den Sack.«
Ich musste mir ein Grinsen verkneifen, aber Kai war drauf und dran, reichlich genervt alles hinzuschmeißen, insbesondere, weil gerade aus den Lautsprechern neue Musik ertönte.
»Ich glaub’s ja nicht, jetzt spielen die auch noch Barbie Girl.«
»Was hast du denn, ist doch alles ganz nett hier?«, entgegnete ich.
Hübsche Dreizehnjährige kurvten zu heißem Discosound um uns herum, und ich hatte immerhin von meinen Eltern Ausgang bis Mitternacht bekommen, um meinen Job zu machen.
»Nett ist die kleine Schwester von scheiße«, giftete Kai zurück und sah mir zum ersten Mal ins Gesicht. Ich hatte das Gefühl, das Eis um meine Füße herum würde gleich schmelzen, so heiß wurde mir. »Merkste denn nicht, dass die im Jugendbeirat uns nur verarschen wollen?«
Diplomatisch meinte ich: »Na ja, ich bin noch nicht lange dabei, ich kann das noch nicht so beurteilen.«
»Wie viele deiner Wahlversprechen hast du denn schon einlösen können?«, fragte Kai.
Ich musste nicht lange überlegen. »Noch keins.«
»Siehste, das Ganze hier ist doch nur eine Zirkusveranstaltung, bei der sich die Stadt einen demokratischen Anstrich geben will. Doch wenn’s drauf ankommt, werden unsere Anträge abgelehnt. Und wir geben bei ihren Inszenierungen auch noch die billigen Arbeitskräfte ab!« Wütend leerte er die noch volle Colaflasche übers Eis aus. Die braune Schicht, die sich kurz danach auf der Fläche bildete, blieb mir in Erinnerung.
Ich wollte einwenden, dass manche Dinge Zeit bräuchten, aber im selben Moment ärgerte ich mich, keine radikalere Antwort parat zu haben. So würde ich Kai nie näher kennenlernen. Schließlich sagte ich: »Ich finde es auch doof, dass auf jeder Sitzung immer wieder ein Antrag auf Eröffnung einer McDonald’s-Filiale vorgebracht wird. Wenn das so weitergeht, machen die wirklich bald ihren Laden in unserer Stadt auf.«
Kai schnaubte: »Darauf kannst du wetten.« Ich nickte und setzte noch einen drauf. »Weißt du, ich habe mich schon sehr früh für Basisdemokratie interessiert.« Volltreffer! Was die Lektüre der Tageszeitung so alles bringt. Kai war ganz Ohr. »Schon mit sechs Jahren bin ich von Haus zu Haus in unserer Nachbarschaft gelaufen und habe Unterschriften gegen die Bebauung unserer schönen Wiese gesammelt, wo wir immer Schlitten fuhren. Meine Eltern haben nur gesagt: ›Da nutzt doch eh nichts.‹«
»Und hat es was genutzt?«
»Bis jetzt haben sie dort noch nichts gebaut. Aber es liegt auf der Wiese im Winter auch fast kein Schnee mehr. Klimawandel.«
»McDonald’s sei Dank«, knurrte Kai.
Anscheinend hatte er unser Gespräch im Eisstadion positiv in Erinnerung behalten, denn seit diesem Tag wurde ich plötzlich von ihm gegrüßt, wenn ich in der Innenstadt an der Mauer vorbeikam. Manchmal wechselten wir sogar ein paar Worte. Und seit wir beide in der Umsonst & Draußen-AG waren, war es überhaupt kein Problem mehr, Gesprächsstoff zu finden. Wir fingen auch an, uns allein zu treffen, nachmittags, weit weg von seinen coolen Leuten. Auf den in den Parks aufgestellten Bänken saßen wir natürlich auf den Rücklehnen, da einzig Spießer die Sitzfläche benutzen. Wir tranken Bier und träumten von einem selbstverwalteten Jugendzentrum. Es gab zwar ein derartiges Gebäude, aber da waren nur Aussiedler und frühreife Hauptschülerinnen unterwegs. Hinzu kam, dass es nicht selbstverwaltet war, sondern ein Team von engagierten Pädagogen ein strenges Auge auf alle Besucher warf. »Küssen erlaubt, aber die Hose bleibt zu« und ähnlich gefasste Regeln waren ein Produkt dieses Regiments. Bier ging bei ihnen natürlich nicht durch und Kiffen erst recht nicht. Dabei machte das doch am meisten Spaß und gehörte zur Pflicht eines jeden anständigen Hippies und Weltverbesserers. Am liebsten mochte ich die sogenannten Shots: Dabei nahm Kai den fast abgebrannten Glimmstängel falsch herum in den Mund, zog den Rauch tief ein und atmete ihn in meinen Mund aus. In der Praxis war das erotischer, als man annehmen könnte. Mir blieb dabei fast immer das Herz stehen, unter anderem auch deswegen, weil das Gras sehr stark war. Eine Weile dachte ich, dass wir uns noch näherkommen müssten, es passierte aber nichts. Immer fing er an zu quatschen, wenn es mal inniger wurde, und immer ging es um Politik, von der ich bislang noch nicht viel verstand.
»Ich guck’ mal rum.« Kai verabschiedet sich von mir. Wer wie ich gerne in Gedanken versunken ist, noch dazu über die Person, die lebendig vor einem steht, kann keine eloquente Gesprächspartnerin sein. Nachdem ich Kai nicht mehr sehen kann, mache ich mich auf in Richtung Hinterhof, wo gerade eine Band anfängt, Musik zu machen. Die Jungs grölen eher, als dass sie singen, und schlagen mehr oder weniger aggressiv auf ihre Instrumente ein. Von einem Spielen kann keine Rede sein. Dabei blicken sie verdammt grimmig. Sie stammen aus dem Nachbardorf, wie ich von einigen Umstehenden mitbekomme, und haben einen Ruf zu verteidigen, seitdem ihre Fußballmannschaft in der Kreisliga auf den Abstiegsplatz gerutscht ist. Ein paar gelangweilte Punks stehen am Rand der Bühne, auch sie sehen interessant aus, aber an »meine« Pulp-Fiction-Typen kommen sie nicht heran. Obwohl es ein lauer Frühlingsabend ist, schwitzen sie cool in ihren Lederjacken, die mit Abertausenden von kleinen Stacheln und winzigen bedruckten Stofffetzen aufgestylt sind. »Smash your TV« lese ich auf einer Jacke. Auf einer anderen ist ein Bild von Hitler gedruckt, der sich eine Pistole an die Schläfe hält. Darunter steht: »Follow your leader.« Alle tragen enge Röhrenjeans in Leoparden- oder Tigeroptik.
Eine Hippiefrau hat etwas weiter entfernt einen Stand mit selbstgemachtem Schmuck aufgebaut. Ich schlendere dorthin, kaufe mir ein Lederarmband und fasse den Entschluss, mich ab sofort in einer Mixtur aus Punk und Hippie zu kleiden. Wie genau das im Endeffekt aussehen soll, ist mir noch nicht klar, aber eines ist sicher: Die Buffalostiefel müssen weg. Unschlüssig halte ich ein paar Ledersandalen in den Händen. Mir kommen Zweifel. Sind DocMartens-Stiefel nicht doch hipper und passen besser zu mir? Wo kann man die Dinger eigentlich kaufen? Das weiß ich genauso wenig wie die Antwort auf die Frage, was ich hier mit mir anfangen soll. Außer Kai kenne ich niemanden, und der ist von der Bildfläche verschwunden.
»Hier, halt’ mal!« Ein Typ mit nacktem Oberkörper drückt mir eine halbvolle Bierflasche in die Hand und ist im nächsten Augenblick auch schon fast wieder in der Dunkelheit abgetaucht. Ich schaue ihm nach und sehe, dass er sich das Wort HATE, »Hass«, quer über den Rücken tätowiert hat. In kleinen Schlücken trinke ich von dem schon schalen Bier und beginne mich wohler zu fühlen.
Hass - jeden Tag wächst er in mir, insbesondere auf dem Schulweg, den ich seit neun Jahren gehe. Immer komme ich an denselben weißen Hausmauern vorbei, nie sprüht einer etwas darauf - Kais Mauer in der Stadt einmal ausgenommen - oder rammt einen Bulldozer hinein. Nie bewegt sich etwas, nie geht etwas voran - alles nur vorgeformte Langeweile.
Ich weiß überhaupt nicht, woher dieser Hass kommt oder wohin er noch will. Manchmal schaut er nur kurz vorbei, auf eine Tasse Tee oder einen Schnaps, sagt »Hallo« und verabschiedet sich wieder. Manchmal hat er aber Rucksack, Schlafsack und Zelt dabei und nistet sich für mehrere Tage in meinem Gehirn ein. Keine schöne Sache. In einer solchen Situation versuche ich, den Hass zu überreden, sich zu konzentrieren, damit er die Kraft einer Bombe entwickelt. Ich sehe mich zahnlos und mit schlohgrauen Haaren mit meinen Freunden in den Trümmern tanzen. Wir selbst sind resistent gegen diese Bombe - sie bringt nur Spießer um. Wir, der Hass stets dabei, ziehen in Wohnwagen übers Land und sammeln die restlichen Konservendosen ein, die noch in den Gemäuern der Supermärkte herumliegen, und lachen dabei furchtbar grässlich.
Irgendeiner drückt mir plötzlich einen Joint in die Hand. Zufrieden ziehe ich daran. Ein wohliges Gefühl macht sich breit, als ich auf einmal realisiere, dass ich gerade gar keinen Hass spüre. Hier ist kein Platz für ihn. Das weiß er auch, denke ich, und lasse mich nach hinten auf die Wiese fallen.
»Ey, biste breit.« Der halbnackte Typ ist wieder da. Ich habe keine Lust, mit ihm zu reden. Ich will Kai. Der Typ lässt jedoch nicht locker und setzt sich zu mir auf den Boden. »Hey, biste aber nicht von hier, hab’ dich noch nie hier gesehen.«
»Ich komm’ von weiter weg«, entgegne ich.
»Is ja interessant«, nuschelt er. »Was machste denn sonst so?«
»Nichts. Schule.« Das letzte Wort füge ich nach einer kleinen Pause hinzu.
»Alles klar, deine Alten lassen dich nur am Wochenende raus.« Der Typ grinst überlegen.
»Und wenn schon, was ist dabei?«
»Keinen Bock, alles zu schmeißen?«
»Hä?«
»Das kotzt dich doch alles an, oder? Schule, frühes Aufstehen, wenn die Arbeitslosen noch alle schlafen können.« Er streckt sich, anscheinend redet er von sich selbst.
»Es sind nur noch dreieinhalb Jahre, dann kann ich machen, was ich will.« So ganz überzeugt bin ich nicht von dem, was ich da erzähle. Natürlich habe ich schon darüber nachgedacht, die Schule hinzuschmeißen und einfach irgendwohin zu trampen. Sämtliche Bücher aus der Schulund Stadtbibliothek, die ich über jugendliche Ausreißer fand, habe ich in den letzten Monaten gelesen.
»Nicht alles in der Schule ist schlecht«, fahre ich fort, nicht wissend, ob es den Typen überhaupt interessiert. »Ich muss nicht viel machen und hab’ trotzdem gute Noten. Manche Lehrer mögen mich sogar, weil ich nicht so verschlafen bin wie die anderen, sondern mit ihnen diskutiere. Und vor kurzem sind wir nach Frankreich gefahren, nächstes Jahr geht’s nach Italien.«
Der Halbnackte schüttelt den Kopf. »Ganz schöner Hirnfick, was?« Selbstzufrieden lehnt er sich mit seinem Oberkörper zurück und mustert mich von oben bis unten. »Was ist denn für dich Freiheit?« Anscheinend hat ihn unser Gespräch nüchterner gemacht, denn er spricht auf einmal artikulierter als zuvor.
Ich will sofort weit ausholen, aber die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Schließlich sage ich: »Dass ich für mich selbst entscheiden kann, dass ich nach Hause kommen kann, wann ich will.« Peinlich berührt denke ich an die Auftritte meiner Eltern auf den Dorffestivitäten, wenn sie kamen, um mich abzuholen. Diese Feiern waren für mich die einzige Möglichkeit, mich anderen Jugendlichen zu nähern, im wahrsten Sinn des Wortes. Im Schulhof vor der Pausenaufsicht herumzuknutschen, das ging nicht. Bei den Dorffesten aber machten mir meine Eltern oft einen Strich durch die Rechnung, wenn sie schon vor der verabredeten Zeit aufkreuzten und laut brüllten: »Silvia, wir müssen los!« Das war so unangenehm, dass ich mich freiwillig aus der Umarmung des Typen löste, den ich oft erst ein paar Minuten vorher kennengelernt hatte. Diese wiederkehrenden Aktionen erhöhten meine Chancen auf dem Markt der begehrten Mädchen nicht sehr.
»Glaub’ mir, wenn du älter wirst, wird Freiheit für dich eine ganz andere Bedeutung erhalten.« Der Typ neben mir fängt an, klugzuscheißen.
»Mag sein.« Ich zucke mit den Schultern.
Er merkt, dass ich nicht sonderlich beeindruckt bin, und fügt hinzu: »Tut mir leid, Prinzesschen, wollte dich nicht zutexten. Manchmal nur überfällt mich der unstillbare Drang, meine nihilistischen Lebensweisheiten unschuldigen kleinen Mädchen mitzuteilen, immer in der Hoffnung, etwas Verständnis und einen Weg aus der Sackgasse zu finden.« Das Wort »nihilistisch« betont er so, dass ich endlich begreife, warum gerade ich das Opfer eines Spinners geworden bin. Er fängt nun an, umständlich in seinen Hosentaschen nach den notwendigen Utensilien für einen Joint zu suchen. »Haste’ne Kippe?«, fragt er mich, als es mit seinem Joint anscheinend nicht klappen will.
»Nein, ich rauche nicht. Höchstens einen Joint.«
Schließlich erwidert er: »Na gut, dann rauchen wir Erdloch.«
»Erdloch? Was ist denn das?«
Er bohrt mit einem Stock zwei Löcher in den Boden, die er unterirdisch mit einem Gang verbindet. In diese Höhle kippt er Wasser. Die Coladose teilt er mit einem Taschenmesser in zwei Hälften, die er auf die Löcher stellt. Auf das Unterteil, das er mit dem Messer mehrfach durchstochen hat, krümelt er Gras und zündet es an. Gleichzeitig zieht er durch das Mundstück den entstehenden Rauch gierig ein. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht. Als ich es probiere, bin ich angeekelt vom erdigen Geschmack, und die Dosenöffnung ist für meinen Mund auch zu groß. Der halbe Rauch zieht an mir vorbei. Dennoch reicht es, um ein schwummriges Gefühl zu bekommen. Ich muss dringend aufs Klo und gehe zum Badezimmer im Scheunenhaus. Es ist nicht abgeschlossen, und es sitzt schon jemand auf der Toilettenbrille. Mir ist das egal. Ich hocke mich in die Badewanne und lasse laufen, was nicht mehr zu halten ist. Die Wanne ist voller Erde, die sich nun mit meinem Urin vollsaugt. Interessiert verfolge ich den Weg des Rinnsals bis hin zum verstopften Ausguss. Erde, denke ich, alles ist Erde. Wir kommen aus der Erde und werden wieder zu Erde. Vielleicht ist das ja auch eine Leiche hier! Ich fange an zu kichern. Die Person, die auf der Klobrille sitzt, betrachtet mich irritiert. Ich spute mich, schnell wieder nach draußen zu gelangen. Die Band hat in der Zwischenzeit gewechselt. Jetzt sitzt einer von den Punkern meiner Schule am Schlagzeug und, ich traue meinen Augen nicht, Kai singt! Dass er eine Band hat - davon wusste ich bislang nichts. In meiner Achtung steigt er um ein Vielfaches, falls das überhaupt noch möglich ist. Natürlich will ich dazu tanzen. Aber wie? Ich kann nicht anders, als mich den Bewegungen der anderen anzupassen, und so hüpfe ich recht hilflos von einem Bein aufs andere, meist völlig aus dem Takt, rudere mit den Armen und versuche sexy zu wirken. Auf einmal kippe ich nach hinten, schlage hart mit meinem Po und dem unteren Teil des Rückens auf, über mir, neben mir überall Füße, schwere Stiefel, Schweißtropfen, Biergeruch. Ich versuche mich aufzurappeln, doch da strecken sich mir schon freundliche Hände entgegen. Der Tanz geht weiter, man lächelt mir anerkennend zu. Später helfe auch ich Gestrauchelten wieder auf die Beine.
Langsam geht mir die Puste aus. Ich stelle mich ganz vorne an die Lautsprecherbox und schubse einfach alle weg, die in meine Richtung geflogen kommen. Von hier aus kann ich den Schlagzeuger ganz gut beobachten. Ich bewundere seine Koordination, jede Hand und jeder Fuß machen etwas völlig Unterschiedliches, und er bearbeitet seine vielen kleinen Trommeln und Becken schneller, als mein Auge und mein Ohr diese Bewegungen synchronisieren und der Musik zuordnen können. Dabei wirkt er fast gelangweilt. Was gäbe ich dafür, an seiner Stelle zu sitzen und den Takt vorzugeben! Ich schließe die Augen und versuche es mir bildlich vorzustellen. Ach was! Ich kann ja noch nicht einmal meine ungelenken Tanzbewegungen im Rhythmus halten. Und meine zwei linken Hände konnte ich schon beim Klavierspielen kaum richtig koordinieren, obwohl ich bereits mit fünf Jahren angefangen habe, Unterricht zu nehmen. Schlagzeug - das würde mir gefallen, aber meine Eltern würden »einen solchen Krach« in ihrem Haus kaum erlauben.
Was Kai genau singt, kann ich leider nicht verstehen. Aber ich bilde mir ein, dass alle Songs mir gewidmet sind. Manchmal blickt Kai zu mir und schaut mir tief in die Augen. Es wird nun heftiger getanzt, die Menschen fliegen nur so über die Wiese. Und für diejenigen, die nicht mehr so recht stehen können, hat die Gruppe ein altes Sofa auf die Bühne gestellt. Jeder, der darauf sitzt, darf aus einem
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
Copyright © 2009 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten Die im Text zitierten Lieder stammen von tagtraum (»Trotz & Träume«, Vitaminepillen Records), S. 4¼2, Slime (»Schweineherbst« bzw. »Yankees raus«, Slime Tonträger), S. 74 bzw. S. 170, und S.Y.P.H. (»S.Y.P.H.«, Pure Freude), S. 82. Typografie und Satz: DVA/Brigitte Müller Gesetzt aus der Swift
eISBN : 978-3-641-02497-0
www.dva.de
Leseprobe
www.randomhouse.de