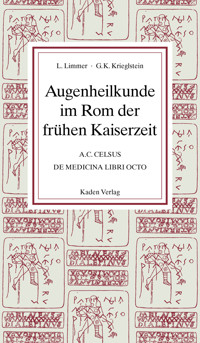
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kaden Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erstellung eines medizinischen Handbuches ist in der Hochzeit moderner Kommunikationstechnologien von gewissen Annehmlichkeiten begleitet. Computerassistierte Literatursuche macht es möglich, in kürzester Zeit die großen Datenbanken medizinischen Wissens weltweit abzufragen, Textverarbeitungssysteme erlauben es, beliebig oft auch große Textpassagen mit beliebig vielen Änderungen in perfekter Druckqualität zu reproduzieren. Die Festspeicherplatte eines Computers wird zur Geburtsstätte eines vielleicht bedeutsamen medizinischen Standardwerkes. Die vielfältige Wiedergabe identischer Inhalte in einer großen Anzahl von Lehrbüchern, selbst zu kleinsten medizinischen Sachgebieten, in einer großen Variabilität der textlichen und graphischen Gestaltung, zeugt von dieser Leichtigkeit der Wissensdokumentation, welche der Computer ermöglicht hat. Vielleicht macht es gerade die nicht mehr überschaubare Flut medizinischer Lehrbücher reizvoll, sich an jene Standardwerke zu erinnern, die weitaus mühseliger erarbeitet wurden und doch in mancherlei Hinsicht einen besseren Einblick in die Grundsätze ärztlichen Handelns ihrer Zeit geben, als dies heute der Fall sein kann. Eines dieser bewundernswerten Standardwerke der Medizin sind die acht Bände "De medicina" des Aulus Cornelius Celsus, eine umfassende Wissensdarstellung der alexandrinisch-hellenistischen Medizin, geschrieben zur Regierungszeit des Tiberius in Rom zwischen 25 und 35 nach Christus, von einem Autor, von dem man bis heute noch nicht weiß, ob er allein Schriftsteller oder auch praktizierender Arzt war. Neben der geradezu akribischen Darstellung einer bedeutsamen Epoche der Heilkunde hat Celsus auch in anderen Wissensbereichen mit seinem enzyklopädischen Gesamtwerk Erstaunliches geleistet (Landwirtschaft, Kriegswesen, Rhetorik, Philosophie, Jurisprudenz). Erhalten sind jedoch nur die acht Bände "De medicina", welche nach den drei großen therapeutischen Konzepten der damaligen Zeit strukturiert sind: Behandlung durch Diätetik und Modifizierung der Lebensweise (vielleicht eine frühe Variante der präventiven Medizin), medikamentöse Therapie und chirurgische Eingriffe. Dies reflektiert auch das medizinische Grunddenken der römischen Kaiserzeit, die Konzentration auf den Therapieerfolg, wobei der Erkenntnisgewinn nur zum Verstehen der Zusammenhänge als völlig nachrangig erachtet wurde. Der "Wissenschaftsselbstzweck" war der antiken Heilkunde weitgehend fremd. Trotzdem wurden erstaunliche Erfolge erzielt, denkt man nur an die fast 2000 Jahre alten Ausführungen zur Staroperation. Die Erstausgabe der "De medicina" des A. C. Celsus erfolgte 1478 in Florenz durch Bartholomaeus Fontius. 1846 wurde die erste deutsche Gesamtübersetzung von Eduard Scheller veröffentlicht, 1915 eine profunde textkritische Ausgabe durch den Bonner Philologen Friedrich Marx. In einer Zeit zunehmender Atomisierung der Wissensdokumentation, welche vorwiegend dem Superspezialisten entgegen kommt (der einem bissigen Aphorismus zufolge "nahezu alles" über "nahezu nichts" weiß), mag die Zusammenstellung der Augenheilkunde aus einem antiken, allgemeinmedizinischen Gesamtwerk vielleicht als tröstliche Lektüre wirken. Sich in Anbetracht der Leistungen hellenistisch-römischer Ärzte in der Augenheilkunde vor 2000 Jahren zum Staunen und Nachdenken anregen zu lassen, wäre über das wissenschaftliche Dokumentationsziel hinaus eine wünschenswerte Wirkung der vorliegenden medizingeschichtlichen Monografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingentibus vero et variis casibus
oculi nostri patent;
qui cum magnam partem ad vitae
simul et usum et dulcedinem conferant,
summa cura tuendi sunt.
De medicina VI,6
Vorwort
Die Erstellung eines medizinischen Handbuches ist in der Hochzeit moderner Kommunikationstechnologien von gewissen Annehmlichkeiten begleitet. Computerassistierte Literatursuche macht es möglich, in kürzester Zeit die großen Datenbanken medizinischen Wissens weltweit abzufragen, Textverarbeitungssysteme erlauben es, beliebig oft auch große Textpassagen mit beliebig vielen Änderungen in perfekter Druckqualität zu reproduzieren. Die Festspeicherplatte eines Computers wird zur Geburtsstätte eines vielleicht bedeutsamen medizinischen Standardwerkes. Die vielfältige Wiedergabe identischer Inhalte in einer großen Anzahl von Lehrbüchern, selbst zu kleinsten medizinischen Sachgebieten, in einer großen Variabilität der textlichen und graphischen Gestaltung, zeugt von dieser Leichtigkeit der Wissensdokumentation, welche der Computer ermöglicht hat. Vielleicht macht es gerade die nicht mehr überschaubare Flut medizinischer Lehrbücher reizvoll, sich an jene Standardwerke zu erinnern, die weitaus mühseliger erarbeitet wurden und doch in mancherlei Hinsicht einen besseren Einblick in die Grundsätze ärztlichen Handelns ihrer Zeit geben, als dies heute der Fall sein kann. Eines dieser bewundernswerten Standardwerke der Medizin sind die acht Bände „De medicina“ des Aulus Cornelius Celsus, eine umfassende Wissensdarstellung der alexandrinisch- hellenistischen Medizin, geschrieben zur Regierungszeit des Tiberius in Rom zwischen 25 und 35 nach Christus, von einem Autor, von dem man bis heute noch nicht weiß, ob er allein Schriftsteller oder auch praktizierender Arzt war. Neben der geradezu akribischen Darstellung einer bedeutsamen Epoche der Heilkunde hat Celsus auch in anderen Wissensbereichen mit seinem enzyklopädischen Gesamtwerk Erstaunliches geleistet (Landwirtschaft, Kriegswesen, Rhetorik, Philosophie, Jurisprudenz). Erhalten sind jedoch nur die acht Bände „De medicina“, welche nach den drei großen therapeutischen Konzepten der damaligen Zeit strukturiert sind: Behandlung durch Diätetik und Modifizierung der Lebensweise (vielleicht eine frühe Variante der präventiven Medizin), medikamentöse Therapie und chirurgische Eingriffe. Dies reflektiert auch das medizinische Grunddenken der römischen Kaiserzeit, die Konzentration auf den Therapieerfolg, wobei der Erkenntnisgewinn nur zum Verstehen der Zusammenhänge als völlig nachrangig erachtet wurde. Der „Wissenschaftsselbstzweck“ war der antiken Heilkunde weitgehend fremd. Trotzdem wurden erstaunliche Erfolge erzielt, denkt man nur an die fast 2000 Jahre alten Ausführungen zur Staroperation.
Die Erstausgabe der „De medicina“ des A. C. Celsus erfolgte 1478 in Florenz durch Bartholomaeus Fontius. 1846 wurde die erste deutsche Gesamtübersetzung von Eduard Scheller veröffentlicht, 1915 eine profunde textkritische Ausgabe durch den Bonner Philologen Friedrich Marx.
In einer Zeit zunehmender Atomisierung der Wissensdokumentation, welche vorwiegend dem Superspezialisten entgegen kommt (der einem bissigen Aphorismus zufolge „nahezu alles“ über „nahezu nichts“ weiß), mag die Zusammenstellung der Augenheilkunde aus einem antiken, allgemeinmedizinischen Gesamtwerk vielleicht als tröstliche Lektüre wirken. Sich in Anbetracht der Leistungen hellenistisch-römischer Ärzte in der Augenheilkunde vor 2000 Jahren zum Staunen und Nachdenken anregen zu lassen, wäre über das wissenschaftliche Dokumentationsziel hinaus eine wünschenswerte Wirkung der vorliegenden medizingeschichtlichen Monografie.
Langquaid, Köln, Oktober 2024
Ludwig Limmer
Günter K. Krieglstein
Einleitung
Es mag erstaunen, wenn man sich heute mit einem vielfach nicht einmal dem Namen nach bekannten Autor jener Zeit beschäftigt, in der das Imperium Romanum seinen politisch-wirtschaftlichen und wohl auch kulturellen Zenit erreicht hatte. Vergeblich sucht man die geniale medizinische Eigenleistung, die revolutionäre Neuerung: Aulus Cornelius Celsus bleibt eine schemenhafte Gestalt, nur mühsam wurden die Eckdaten seiner Biographie erschlossen, selbst der größte Teil seines Werkes ging in den Wirrnissen des zerfallenden römischen Reiches unter.
Ohnehin ist Römertum und medizinischer Fortschritt eine über lange Zeit hinweg eher konfliktträchtige Konstellation. Da gab es eine altitalische, stark etruskisch beeinflusste Volksmedizin, der die durch Auguren und Haruspizes interpretierten Omina mehr bedeuteten als eine von Empirie und Sachlichkeit geprägte Heilkunde. Für die höheren Schichten, dem archaischen Aberglauben zusehends entwachsen, brachte die Sorge um Erhalt oder Wiederherstellung der Gesundheit fast zwangsläufig eine Hinwendung zu griechisch-hellenistischen Errungenschaften mit sich: für viele traditionsbewusste Römer – Cato d. Ä. etwa als geradezu exemplarische Verkörperung – eine von Widerwillen und Abwehr bestimmte bloße Einsicht in die Notwendigkeit. Noch am Ende der Republik waren die meisten Ärzte griechische Sklaven, die bei besonderen Verdiensten nicht selten freigelassen wurden und dann selbständig als „liberti medici“ praktizieren konnten. Erst mit der zunehmenden kulturellen Öffnung verlor der Arztberuf allmählich den Makel des Unrömischen, Verweichlichten, ja Dekadenten. Immer noch stammten zwar die meisten Ärzte aus dem hellenistischen Kulturbereich, bevorzugt aus Alexandria, aber sie wanderten nun freiwillig ein und kamen – häufig als Spezialisten – in Rom zu Reichtum und hohem gesellschaftlichen Ansehen.
Die im frühkaiserzeitlichen Rom ausgeübte Medizin spiegelt facettenartig die Vielfalt einer von hippokratischen bis spätalexandrinischen Vorstellungen gekennzeichneten griechisch-hellenistischen Heilkunde wider, deren unterschiedliche Konzeptionen sich in ständigem Wettstreit um die Akzeptanz der römischen Oberschicht befanden. So kann denn auch die Beschäftigung mit Celsus nicht die Frage nach dessen originärem Beitrag in den Vordergrund rücken: „De medicina“ muss vielmehr als unschätzbares Zeugnis jener Blüte alexandrinisch-hellenistischer Medizin gesehen werden, deren Dokumente weitgehend verlorengegangen sind oder in schwer zugänglichen arabischen Übersetzungen bis heute größtenteils noch nicht erschlossen wurden. Dass man zugleich die ganze Fülle wissenschaftstheoretischer Ansätze der Antike vorfindet, von streng deduktiven bis objektbezogenen empirischen Radikalpositionen, geprägt von philosophischen Denkstrukturen, die bis zu den Vorsokratikern zurückreichen, dass sich diese reiche Gedankenwelt nie aufdrängt, sondern zurückhaltend, aber doch hartnäckig insistierend den vordergründig nüchternen, zweckgebundenen Duktus eines medizinischen Handbuches durchtränkt, macht nicht unwesentlich die Anziehungskraft des Celsus-Textes aus.
Ein besonderer Reiz speziell des ophthalmologischen Teils resultiert aus der Tatsache, dass ein unübersehbares Defizit an physiologischen Kenntnissen und pathogenetischem Wissen dennoch immer wieder – etwa im Fall des Starstichs – erstaunliche Behandlungsergebnisse zuließ.
So bot es sich denn auch an, – ganz im Gegensatz zur üblichen eher paraphrasierenden Begleitung eines alten Textes – explizit von den Kategorien und Begrifflichkeiten der modernen Augenheilkunde her sich dem Text zu nähern, sich also ohne Scheu und ohne historisierende Assimilation der heutigen Terminologie zu bedienen unter der Prämisse: Welche ophthalmologischen Erkrankungen werden in „De medicina“ angesprochen oder, wenn nicht als solche genannt, so doch de facto miteinbezogen?
Im Einzelfall mag dabei der Bruch zwischen moderner Sprachlichkeit und antiker Wahrnehmungsweise beachtlich, ja fast irritierend sein. Warum aber sollte man sich nicht aus heutiger Sicht der Dinge einem sachbezogenen antiken Text in einer Rezeptionshaltung nähern, wie sie im literarisch-künstlerischen Bereich durch die Jahrhunderte hindurch bis in neueste Zeit ganz selbstverständlich eingenommen wurde?
Dass der Originaltext1 weitgehend vollständig wiedergegeben wird, folgte beinahe zwangsläufig aus der eingeschlagenen Darstellungsweise – nur so blieben der gewünschte Kontrast zwischen moderner und antiker Perspektive sowie die interpretatorischen Schlüsse nachvollziehbar und überprüfbar. Die den Originalzitaten hinzugefügte Übersetzung von Eduard Scheller soll den allgemeinen Zugang zum Celsus-Text erleichtern, eine Aufgabe, die sie trotz etwas veralteter Ausdrucksweise im allgemeinen hinreichend zu leisten vermag.
1)Nach der Ausgabe von Friedrich Marx, Leipzig und Berlin 1915





























