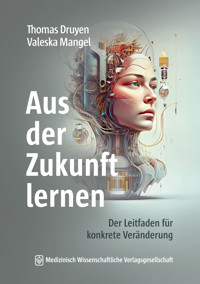
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Unsere Gesundheit, Psyche und Widerstandskraft stehen heute enorm unter Druck. Nicht nur unsere Arbeitswelt, auch die Privatsphäre verändern sich rasend schnell und diese Ungewissheit sorgt für Verunsicherung. Gleichzeitig versprechen neue Technologien und Künstliche Intelligenz ungeahnte Chancen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Die Zukunft erscheint paradox. Um in dieser historisch einmaligen Situation sicher und vorausschauend zu agieren und in der Zukunft handlungsfähig zu bleiben, hat Prof. Thomas Druyen die Zukunftspsychologie und die Zukunftsnavigation entwickelt. Es geht darum, aus der Zukunft und der eigenen Vorstellungskraft zu lernen, um das Richtige zu tun. Wie das funktioniert, zeigt dieses Buch anhand von Grundlagen und einer detaillierten Anleitung. Diesen anwendungsorientierten, praktischen Teil des Buches hat Co-Autorin Valeska Mangel entwickelt. Sie zeigt Schritt für Schritt, wie auch Teams und Unternehmen in Work- und Mindshops Zukunftskompetenz entwickeln, trainieren und für alle Beteiligten gewinnbringend einsetzen können. In der Zukunft ist fast alles möglich. Entscheidend und überlebenswichtig ist es jetzt, sie selbst proaktiv in die Hand zu nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Druyen | Valeska Mangel
Aus der Zukunft lernen
Der Leitfaden für konkrete Veränderung
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Das Verfasserteam
Prof. Dr. Thomas Druyen
Geschäftsführer und Präsident
opta data Zukunfts-Stiftung gGmbH
Berthold-Beitz-Boulevard 514
45141 Essen
Valeska Noemi Mangel
Zukunftswissenschaftliche Leitung & Service Designerin
Sigmund Freud PrivatUniversität
Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement
Freudplatz 3
1020 Wien
Österreich
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-809-0(eBook: ePDF)
ISBN 978-3-95466-819-9(eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2023
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfassenden haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Anna-Lena Spies, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Lektorat: Dr. Frank Unterberg, Essen
Layout, Satz und Herstellung: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
Cover: Das Titelbild wurde eigenständig von einer KI mit der Software Midjourney erstellt.
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Vorwort
Alle reden von Veränderung und Zeitenwende. Bundespräsident, Bundeskanzler, Ministerinnen und Minister, Medien, alle Generationen und alle Milieus. Das gilt auch für den Rest der Welt. Das Problem ist, die Zeiten ändern sich rasend schnell, aber der Mensch langsam. Zu langsam. Diese Gewissheit haben wir schon lange, aber es passiert wenig. Man hat das Gefühl, die Zukunft kommt immer rasanter und wir nicht hinterher. Also müssen wir uns ändern, schneller ändern, aber wie und was? Das Buch bietet für dieses Dilemma eine machbare Lösung.
Die im Folgenden angesprochenen Veränderungen betreffen unser Verhalten, unsere Gehirne und unsere geistige Gesundheit. Nennen wir es Mindset. Die Erneuerung unserer Denkweisen steht hier im Mittelpunkt, also unsere Zukunftsfähigkeit im privaten wie im beruflichen Leben. Die Zukunft ist unbegrenzt und immer entfesselter. Darauf Einfluss zu nehmen, ist komplex. Aber wie wir damit umgehen, dies liegt ganz allein in unserer Verantwortung und in unserer Macht.
Es ist kaum möglich, die Zukunft präzise vorherzusagen. Aber es gibt eine Art des vorausschauenden Lernens, in der man sich mit der eigenen Zukunft ganz konkret beschäftigen kann. Es scheint zwar spielerisch, ist aber durchaus sinnvoll, sich Fragen wie diese zu stellen: Was wird mit den Anforderungen meines Berufes, meines Lebens oder meiner Organisation in zehn Jahren sein? Was kann ich in fünfzehn Jahren am besten tun? Wer will ich in Zukunft sein? Diese und viele weitere Zukunftsfragen stellen wir regelmäßig Tausenden von Menschen.
Die Wissenschaft dazu heißt Zukunftspsychologie1. In ihr versuchen wir, die Gedanken und Gefühle der Befragten in Bezug auf ihre eigene oder die Zukunft ihres Unternehmens herauszuarbeiten. Wir erforschen also Mindsets und welchen Einfluss sie auf die jeweilige Gestaltung der Zukunft haben. Die Beobachtungen und Erkenntnisse dieser Forschung machen Sinn, wenn sie im privaten und beruflichen Leben Vorteile schaffen und auch trainiert werden können. Das ist der Fall. Diesen Prozess von der Fragestellung mit dem später zu erläuternden Zukunftskompass2 bis zur konkreten Umsetzung der jeweiligen Einsichten nennen wir Zukunftsnavigation. Es ist aus unserer Sicht daher legitim zu sagen, dass wir aus der Zukunft lernen können.
Bei unserer Arbeit haben wir definitiv festgestellt, dass Denkweisen die Treiber des Lebens und der Veränderung sind. Jeder Entschluss trägt die Färbung des eigenen Mindsets. Entscheidungen, die man trifft und dann auch realisiert, werden zu Bausteinen der Zukunft. Insofern haben wir alle sehr wohl Einfluss auf das Kommende. Dieser Gestaltungsprozess ist eine Form des präventiven Designs und die Gelegenheit, sein Handeln besser zu antizipieren und zu planen. Daher haben wir diese erlern- und trainierbare Zukunftsnavigation mit den englischen Ausdrücken Prethinking the Futures betitelt.
Ja, wir sprechen bewusst von Zukünften, denn jeder Mensch hat seine und ihre3 eigene. Die persönliche oder allgemeine Zukunft vorauszudenken und zu gestalten, ist das größte menschliche Vermögen. Leider ist die Menschheit meist von widersprüchlichen Interessen zerrissen – und folgt keiner gemeinsamen Strategie. Diese Unstimmigkeiten setzen sich bis in die Generationen, die Familien, ins Arbeitsumfeld und in die Unternehmen fort. Somit wird das Überwinden oder Nutzen der Gegensätze zwingend zu einer Zukunftskompetenz.
Aber woher kommt die Zukunft und wie können wir sie selbst machen? Dies zu klären und pragmatisch zu verdeutlichen, damit beschäftigen sich diese Publikation und dieses Projekt. Es geht darum, das Machbare und Wünschenswerte umzusetzen und dabei immer auch das Wohl der Gemeinschaft mitzudenken. Hierzu habe ich vor Jahren den Begriff Konkrethik geprägt:
„In diesem Sinne bedeutet konkrethisches Handeln, die möglichen Versionen der Zukunft mit gesundem Menschenverstand zu bedenken und ihren vorgestellten Ausgang zum Maßstab der eigenen Entscheidungen zu machen.“4
Im Rahmen der Zukunftspsychologie haben wir mentale Werkzeuge entwickelt, um die Digitalisierung und Komplexität der Gegenwart zu durchdringen. Aber wenn Wissenschaft nicht anwendbar ist und sich im Turm der Erkenntnis verbarrikadiert, macht sie in Anbetracht der rasend schnellen Veränderungen einen schlechten Job. Daher ist der Ausgangspunkt dieser Impulse das definitive Ziel, Zukunftsnavigation und Konkrethik in zahlreichen Lebensbereichen und Konstellationen für Menschen und Unternehmen anwendbar zu machen. Wissen ohne Umsetzung wäre bei unserer Absicht brotlose Kunst.
Bei der praktischen Umsetzung des zukunftspsychologischen Know-hows hat meine Co-Autorin Valeska Mangel einen grundlegenden Beitrag geleistet. Sie hat mit ihrem Designhintergrund die hier vorliegende Work- und Mindshop-Methode erlernbar und skalierbar gemacht. Aber nicht nur das: Sie wirkt hier auch als Vertreterin einer jungen Generation, die digital und global aufgewachsen ist. Ganz bewusst wollen wir das Thema Zukunft aus zwei Blickwinkeln und mit zwei Mindsets verfolgen.
Daher basiert der im Verlauf des Buches zu erwerbende ‚Machverstand‘ von vornherein auf zwei Generationenperspektiven. Wir sind alle gemeinsam in der unausweichlichen Situation, uns zukunftsfähig zu machen. Zukunftsfähigkeit ist die erlernbare Kompetenz, mit Unvorhersehbarkeit, mit Prävention und mit Experimentierfreude pragmatisch umzugehen. Die Zukunft ist das Ergebnis unserer Taten, also machen wir uns fit für unentwegte Veränderung, nutzen wir unsere Kreativität und überwinden wir den inneren Schweinehund. Mit dieser Anstrengung werden wir die Zeit zu unserem Vorteil wenden.
Prof. Dr. Thomas Druyen
Direktor und Gründer des Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien und Präsident der opta data Zukunfts-Stiftung
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
IGrundlagenThomas Druyen
1Zukunftspsychologie: Was ist sie und was kann sie?
2Zukunftspsychologie und Hirnforschung: Unsere Zukunft entsteht im Gehirn
3Wie zukünftig denken und handeln? Konkrethik als Mindset für die Zukunft
IIAnwendung: „Prethinking the Futures“ – Design-Workshops für ZukunftskompetenzValeska Mangel
1Einleitung: Die Rückerlangung von Selbstwirksamkeit
2Erster Überblick: „Prethinking the Futures“ – Design-Workshops für Zukunftskompetenz
3Design: Was bedeutet Gestaltung heute eigentlich?
4Zum theoretischen Hintergrund und Aufbau der „Prethinking the Futures“-Workshops
5Die Schritt-für-Schritt-Workshopanleitung
IIIVertiefung und Ausblick: Die Zukunft des Handelns
1Wie kommt die Zukunft zustande?Thomas Druyen
2Die Funktion der UnvorhersehbarkeitThomas Druyen
3Die Innovationsskepsis im 21. JahrhundertValeska Mangel
4Zukunftsängste am ArbeitsplatzValeska Mangel
5Die Organisation der Zukunft: Ein neues Denken für ein gesundes ArbeitenValeska Mangel
6Künstliche Intelligenz wird unser SchrittmacherThomas Druyen
NachwortThomas Druyen
DanksagungThomas Druyen
Literaturverzeichnis
IVAnhang: Materialien für die Workshop-Durchführung
1Das Verfasserteam
I
Grundlagen
Thomas Druyen
1
Zukunftspsychologie: Was ist sie und was kann sie?
Die Zukunft vorausdenken ist ein geistiger und gedanklicher Vorgang. Er spielt sich im Kopf und in der Fantasie ab. Jeder Mensch kann es versuchen. Die höchsten Leistungen der Menschheit fanden dort ihren Ursprung. Die unsterbliche schwedische Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren hat es auf den Punkt gebracht: Alles, was an Großem in der Welt geschah, vollzog sich zuerst in der Fantasie eines Menschen. Diese fantastische Quelle wollen und müssen wir nutzen. Das ist der gedankliche Ausgangspunkt der Zukunftspsychologie.
Wie uns das Unbewusste führt
Rufen wir uns kurz das Bild eines Skiläufers vor der Abfahrt oder dem Slalom vor Augen: Gedanklich geht er oder sie die schnelle Abfolge von Kurven und Toren durch, um sich die Strecke einzuprägen und das Kommende ins Bewusstsein zu holen. Je mehr der unbewusste Autopilot benutzt wird, desto schneller, desto souveräner, desto angstfreier geht es voran. Immer wieder hört man den Rat der Profis: Jetzt nicht denken! In diesem Moment, wenn der Mensch vollkommen mit sich selbst eins wird oder in seinem Tun völlig aufgeht, erreichen wir unseren Zenit, unser höchstes Gelingen. Es wäre doch grandios, wenn wir dieses in uns schlummernde Potenzial viel mehr in unserem Leben, in unserem Alltag und für die Gestaltung unserer Zukunft nutzen könnten. Leider ist der Zugriff auf unsere eigene Kraft gar nicht so einfach, da uns psychologisch eine undurchsichtige Gedankenmenge im Wege steht.
Wie wir ticken, wie wir uns fühlen und wie wir agieren, hat enorm viel mit unserem Unbewussten oder unserer emotionalen Innenwelt zu tun.
Wie wir ticken, wie wir uns fühlen und wie wir agieren, hat enorm viel mit unserem Unbewussten oder unserer emotionalen Innenwelt zu tun.
Der legendäre Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud hat die Welt gelehrt, dass dieses Unbewusste für unser Handeln maßgeblich verantwortlich ist. Das ist schon faszinierend, dass wir nicht wirklich über uns bestimmen können! Unsere bewusste und unsere unbewusste Persönlichkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Aber wir tun so, als ob unsere rationale Identität den Ausschlag geben würde, und das stimmt eben nicht. Wir sind ständig von inneren Zweifeln und Widersprüchen irritiert, deren Ursachen wir kaum erkennen.
Kommen wir zu unserem Skiläufer zurück: Er ist topfit, total gesund und optimal trainiert. Wenn er absolut synchron mit sich selbst fährt, wird er seine beste Leistung, die an diesem Tag möglich ist, abrufen. Denkt er aber ans Verlieren, an schlechte Wetterbedingungen, an die Konsequenzen einer Niederlage oder gar an die Enttäuschung seiner Fans, kann er eigentlich schon aufhören. All diese Bedenken, Zweifel und Grübeleien schwächen nicht nur ihn, sondern uns alle. Es ist so, als würden wir uns an einen Felsen fesseln, obwohl wir so schnell wie möglich vorankommen wollen. Wir bremsen und irritieren uns gedanklich selbst.
Die Irritation, die Skepsis und die Besorgnis kommen aus unserem Unbewussten. Vom Mutterleib bis zum jetzigen Moment sind alle Eindrücke, Empfindungen, Erlebnisse, Berührungen und Vorkommnisse in uns gespeichert: eine unglaubliche und unfassbare Bibliothek – oder anders gesagt: unser persönliches Universum. Das sind wir, da ist alles von uns drin, ungeschönt, authentisch, gleichzeitig und lückenlos. Leider können wir darauf nicht wie in einer Bücherei bei Bedarf zugreifen. Denn in jenem Moment, in dem wir auf eine Erinnerung oder ein Erlebnis zugreifen wollen, gibt es kein wahrhaftiges und objektives Ergebnis, sondern nur eine subjektive Einschätzung aus dem jeweiligen Moment heraus. Ob wir uns mit 30 oder 60 Jahren an unsere Kindheit erinnern, zieht völlig andere zeitbedingte Interpretationen nach sich. Insgesamt sind wir ohne Zweifel seit der Geburt maßgeblich und vordringlich durch die gesammelten Geschehnisse unserer Kindheit geprägt. Diese seelische Architektur wirkt wie ein innerer Kompass des Selbstwertes, der extremen Einfluss auf unser ganzes Leben hat.
Diese frühe und wegweisende Prägung wirkt wie erste Sätze auf einem weißen Blatt Papier, wie ein Bauplan für ein Haus oder wie der Businessplan für ein Unternehmen. Alles Weitere wird durch diese spezielle Selbstwahrnehmung, durch dieses Mindset, durch diese Brille aufgenommen und bewertet. Es liegt in der Natur des Menschen und auch in der Anlage unseres Gehirns, dass wir das Passende begrüßen und das Störende verdrängen. So hat sich Sigmund Freud mit seiner genialen Erfindung der Psychoanalyse auf den Weg in die Vergangenheit des einzelnen Menschen gemacht, um die unbewussten Spuren der Prägung offenzulegen und zu verstehen. Dieser Ansatz ist weltweit erfolgreich zum Einsatz gekommen und wird weiterhin praktiziert.
Aktuelle Herausforderungen – und wie unser Unbewusstes ihnen begegnet
Die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich verändert – und somit auch die Herausforderungen für unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Denkweise. Vieles, wie das Internet oder Künstliche Intelligenz, ist neu, so dass jahrhundertelange Errungenschaften diesbezüglich unwirksam geworden sind.
Was ist damit gemeint? Früher haben wir Karten benutzt, um Reisen oder Autofahrten zu planen. Heute nutzen wir Navigationssysteme, die uns eigenständig leiten und steuern. Früher haben wir Telefone benutzt, um ausschließlich mit Menschen zu sprechen, aber mit nur einer Bezugsperson. Heute haben wir Smartphones, die uns mit der Welt vernetzen und gleichzeitig Dutzende technische Geräte verkörpern. Sie wirken wie ganze Büros und lassen uns jederzeit und überall kommunizieren und arbeiten. Bei der jungen Generation sind sie das Fenster zur Welt, das ständig, fast organhaft im Einsatz ist – man könnte fast sagen, es ist ein digitales Körperteil. Diese und Millionen anderer technischer Umwälzungen verändern unseren Alltag immer wieder radikal.
Das wirkt auf unser Gehirn wie Hochwasser: Wir können uns gar nicht so schnell verändern und anpassen, wie Neues nachkommt.
Diese enorme und historisch einmalige Beschleunigung setzt uns unter Druck, und wir müssen neu lernen, damit umzugehen. Die Koordination dieses Tempos will gelernt und trainiert werden. Ein Beispiel: Jahrhundertelang übte man einen Beruf aus. Nach der Ausbildung hatte man so jahrzehntelang Ruhe und konnte das Erlernte umsetzen. Überschaubare Veränderungen wurden mit der Zeit integriert und verarbeitet. Schon seit zwei Jahrzehnten ist dieser ruhige Fluss in Bewegung geraten. Es gibt viele Berufswechsel, neue Berufe kommen ständig hinzu oder sterben aus. Heute und in Zukunft aber wird es noch schneller gehen, wird die Unübersichtlichkeit noch größer. Man studiert zum Beispiel Rechtswissenschaft oder auf Lehramt, aber niemand weiß, ob Anwälte und Lehrer in zehn Jahren in der klassischen Form noch benötigt werden. Allein das Homeschooling hat uns gezeigt, dass neue Anforderungen und Begabungen an die pädagogische Vermittlung gestellt werden, um überhaupt noch mit den Schülern angemessen kommunizieren zu können.
Was bedeutet das? Während früher das Wissen und die Kompetenz aus der Vergangenheit kamen, kommen heute die Impulse aus der Zukunft. Google, Amazon oder Facebook haben unser aller Leben mehr verändert als jeder staatliche Beschluss oder jeder professionelle Hinweis von Experten, Kulturträgern oder Ratgebern. Die digitale Technologie und ihre exponentiellen1 Möglichkeiten treiben den Wandel rascher voran, als wir dies in Routinen und Gewohnheiten verinnerlichen können. Die neue Praxis ist schneller als alle Theorie, so dass auch die junge Generation durch ihr spielerisches Einüben schon früh herausragende intuitive Kompetenzen im digitalen Umgang entwickelt hat. Früher war die Meisterschaft ein Resultat langer und umfassender Erfahrung, heute gibt es Gaming-Meister der virtuellen Fertigkeit, die erst 15 Jahre alt sind. All dies macht es notwendig, eine neue agile Fähigkeit zu entwickeln, die mit Unvorhersehbarkeit, mit Überraschungen und ständiger Verwandlung – also mit dem unbekannten Kommenden – vorausschauend umgehen kann. Sie werden sagen, dass es das Neue schon immer gab. Da haben Sie Recht. Allerdings gab es das Neue niemals so schnell, so gewaltig und in immer kürzeren Abständen.
Wie kann uns die Zukunftspsychologie helfen?
Vor diesem brisanten Hintergrund habe ich die Zukunftspsychologie etabliert, um eine Methode und ein Handwerkszeug für eine flexible Navigation der Zukunft zu schaffen. Während sich die Psychoanalyse in die Vergangenheit bewegt und an den biografischen Grundprägungen ansetzt, gehen wir zukunftspsychologisch auf die andere Seite des Spektrums – nach ganz vorne.
Wir wollen sozusagen bei der Prägung proaktiv mitwirken und Probleme antizipieren, damit sie erst gar nicht Gestalt annehmen und vorzeitig kanalisiert werden können.
Damit kommen wir wieder zum Anfang dieses Kapitels und zur Fantasie zurück. Sie und die Intuition sind die Architekten der Zukunftspsychologie. Indem wir uns mit unseren Möglichkeiten und Wünschen beschäftigen, heben wir ganz andere Potenziale, als uns immer nur reaktiv von Ängsten und Bedenken leiten zu lassen. In diesem Sinne unterscheiden wir auch zwischen Resilienz als Widerstandskraft und Prosilienz als Zukunftsfähigkeit. Indem wir uns gedanklich und imaginativ verschiedene Lebensbereiche in der Zukunft vorstellen, trainieren wir unser Vorstellungsvermögen, antizipieren neue Herausforderungen und ebnen Ideen den Weg in unserem Gehirn. Das Konstrukt, mit dem wir die Zukunft durchspielen und tatsächlich konkretisieren können, ist der 2016 von mir erfundene Zukunftskompass.
Wir haben bisher gesehen, dass sich die Psychoanalyse nach Sigmund Freud des Unbewussten bedient. Im Unbewussten liegt das ganze Ausmaß der Persönlichkeit und der Identität des Menschen. Im Unbewussten speichern wir alle unsere Erfahrungen und unser ganzes Sein. Diese Erinnerungen bringen uns an den Punkt unserer Biografie, an dem wir heute stehen – und an dem die Psychoanalyse bei Bedarf retrospektiv ansetzt: Nach dem Auftreten eines Problems oder einer Störung geht sie zurück an den Ursprung und an die ursächlichen Prägungen. Diese Methode ist höchst erfolgreich und hat Millionen Menschen Gesundung und eine neue Lebensperspektive ermöglicht.
Aber in Zeiten der Digitalisierung, der exponentiellen Beschleunigung und ständig hereinbrechender Überraschungen erleben wir eine massive Überforderung, die uns Menschen existenziell heimsucht. Diese Überbelastung kommt aber nicht aus unserer Vergangenheit oder unserem biografischen und gesellschaftlichen Vermächtnis, sondern aus einem sich seit Jahren beschleunigenden technischen Veränderungsbooster. Was da an Neuerungen ständig aus der Zukunft und dem Fundus Künstlicher Intelligenz auf uns einströmt, vom Internet bis zur Blockchain, von Viren bis zum Weltraumschrott, ist erst einmal unbekannt und ungefiltert, also uns in gewisser Weise absolut nicht bewusst. Vor uns und hinter uns liegen also riesige Strecken und schwarze Löcher des Unbekannten, des Unbewussten. Nachdem wir in der Bearbeitung unserer Vergangenheit schon große Fortschritte gemacht haben, sind wir bei der Zukunftsnavigation noch Laiendarsteller.
Natürlich gibt es weltweit viele intelligente und wissenschaftlich abgesicherte Zukunftsberechnungen. Natürlich gibt es fantastische und geradezu präzise Science-Fiction-Literatur. Gerade im Bereich der Umwelt begegnen wir seit Jahren glasklaren Prognosen, die von der Wirklichkeit immer deutlicher bestätigt werden. Selbst im Jahr 1972 hatte der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums in vielerlei Hinsicht weitsichtig und valide argumentiert. Aber im vorliegenden Zusammenhang geht es ausschließlich um individuelle und kollektive Zukunftsgestaltung – und in diesem Bereich sind wir noch bei Kaffeesatzleserei, Wahrscheinlichkeitsoptionen und interessegeleiteten Prognosen. Im Rahmen der Zukunftspsychologie haben wir daher den Zukunftskompass für Personen und Unternehmen entwickelt. Es geht um eine prospektive Methode, die eigene Zukunft vorherzubestimmen und aus dem Reich des Unbewussten zu entführen – mit allem Respekt: ein Post-Freud-Modell, das unsere Präventionsfähigkeit verbessert, und ein Zukunftstraining, das risikofrei die persönliche Zukunft und vorstellbare Problemlagen simuliert und imaginiert.
Unsere Form der Psychoprophylaxe will methodisch ins kommende Unbewusste und Unbekannte vordringen, ohne dabei die Vergangenheit einzubeziehen. Gezielte Fragen regen ausschließlich dazu an, in gedankliche Gebiete vorzudringen, in denen Befragte und Mitmachende noch nie oder ganz selten gewesen sind: die eigene, weiter entfernt liegende Zukunft. Es geht nicht um eine Prognose, sondern um ein persönliches Experiment. Durch Gedankenspiele und das Erträumen diverser Alternativen wird eben die Prosilienz gestärkt. Diese Prosilienz unterscheidet sich von der Prävention als Form der Vorbeugung dadurch, dass sie tatsächlich die Fähigkeit trainiert, das Undenkbare zu denken und sich das Unvorstellbare vorzustellen.
Nicht Reflexion wie bei der retrospektiven Analyse, sondern Imagination, Fantasie und Proflexion sind hierbei die Instrumente und treibenden Kräfte.
Es geht um die Stärkung des mentalen Immunsystems, mit Unvorhersehbarkeit umgehen zu lernen. Doch wie vermisst man dieses unbekannte Land ‚Zukunft‘, wie strukturiert man das Ungeahnte? Zu diesem Zweck habe ich den schon erwähnten Zukunftskompass entwickelt, ein psychologisches Navigationsinstrument.
Der Zukunftskompass als Instrument der Zukunftspsychologie
Der Zukunftskompass ist ein Tool mit speziellen Fragen zu den wichtigsten Lebensbereichen wie Beruf, Familie, Freizeit, Leidenschaft, Gesundheit oder Alter, die je nach Bedarf, Interesse oder Dringlichkeit individuell ausgewählt werden können. Im Themenpool finden sich ca. vierzig Aspekte, aus denen man maximal vierzehn in Anspruch nehmen sollte, da die Umsetzung sonst unüberschaubar wird. Abhängig vom Alter der Teilnehmenden richten diese Fragen den Blick auf einen zeitlichen Abstand von acht bis fünfzehn Jahren in die Zukunft – es braucht etwas Raum zwischen jetzt und übermorgen für das eigene Vorstellungsvermögen. Ebenso wichtig ist hierbei, dass der Zeitraum weit vom Jetzt entfernt ist, damit heutige Erfahrungen und Belastungen dem freien Imaginieren nicht im Wege stehen. Jeder einzelne Lebensbereich wird daraufhin aus sechs bis acht unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, um eine ganzheitliche Betrachtung und eine möglichst objektive Sicht auf das künftige Szenario zu gewährleisten. Diese Betrachtungsebenen reichen vom biografischen Rückblick aus der Perspektive des Lebensabschiedes über den Entwurf einer idealen Zukunftsbiografie – oder einer katastrophalen – bis hin zu einer Selbstbiografie durch die Brille von Kindern, Freunden oder Kontrahenten. Diese Perspektiven haben die Aufgabe, das jeweilige Thema ganzheitlich zu vertiefen und eine möglichst konkrete Zukunftsbiografie zu entwerfen.
Alle Antworten können in der Zukunft medial aufgezeichnet oder in der künftigen Praxis über ein Blockchain-Verfahren gesichert werden. So entsteht eine Bibliothek eigener Daten, eine Art Zukunftsbiografie, auf die der Mitwirkende jederzeit Zugriff hat, um sich im Heute Antworten auf das persönliche Morgen geben zu können. Diese Methode kann und soll in gewissen Abständen wiederholt werden, z.B. bei einer einschneidenden Veränderung im eigenen Leben oder in der Gesellschaft. Durch diese Selbstinterviews entstehen alternative Zukunftsbiografien und eine Dokumentation der eigenen Veränderungskompetenz. Dies gibt den Beteiligten das stärkende Gefühl, der Unvorhersehbarkeit nicht ausgeliefert zu sein, sondern sie als persönlichen Gestaltungsraum nutzen zu können. Er und sie werden so zu ihren eigenen Therapeuten, die aus der Zukunft denken und immer in der Lage sind, alternative Wege zu weisen.
Der Zukunftskompass ist die zukunftspsychologische Überwindung der Ausweglosigkeit: Er schafft für alle Macher und Macherinnen konkrete Möglichkeitsräume. Er trainiert unser Gehirn, flexibel und veränderungsbereit zu sein, und lässt eine Kompetenz entstehen, die uns allen fehlt: die Kompetenz, Unvorhersehbarkeit zu managen und unsere eigene Zukunft vorausschauend zu gestalten, nicht länger nur auf Einflüsse von außen zu reagieren, sondern aus der eigenen Perspektive heraus proaktiv zu handeln und schon heute konkrete Entscheidungen für morgen zu treffen.2
Die Wirkung der Vergangenheit hat noch eine weitere Schwächung erfahren: Je schneller sich die Dinge um uns herum verändern, desto geringer wird die Halbwertszeit von Wissen und Erfahrung. Daher bekommen Fehler im Handeln und Denken eine historisch neue Bedeutung. Früher hat man versucht, Fehler zu vermeiden. Das war auch sinnvoll, da ja das Machbare und Wirksame über lange Zeiträume gültig war. Mit dieser deutschen Sorgfalt hat unser Land größte Erfolge erzielt. Daher betreiben wir auch immer noch Bedenkenträgerei, um eben mögliche Fehler zu verhindern. In Zeiten des radikalen Wandels verkehrt sich diese Tugend aber oft ins Gegenteil: Was lange richtig war, kann heute über Nacht falsch werden. Ob Phishing-E-Mails oder Cyber-Attacken, früher konnten wir in Ruhe prüfen. Heute muss dagegen sofort gehandelt werden – oder der Schaden wächst immens. Wenn wir hier warten, um Fehler zu vermeiden, haben wir schon verloren. Das Wichtigste ist es jetzt, sofort (mit professioneller Unterstützung) aktiv zu werden.
Dass Fehler nun die neuen Bausteine des Lernens geworden sind, konnten wir im Laufe der Corona-Pandemie immer wieder beobachten. Homeoffice und Homeschooling brachen wie Gewitter über uns herein. Alle Welt hat sich so gut es ging darauf eingelassen und das erfolgreich praktizierte Motto lautete: Lernen durch Tun.
Im Ausprobieren, im Experimentieren und Fehlermachen sowie im wiederholten Ziehen weiterführender Schlüsse liegt die neue Anpassungsfähigkeit.
Im Ausprobieren, im Experimentieren und Fehlermachen sowie im wiederholten Ziehen weiterführender Schlüsse liegt die neue Anpassungsfähigkeit. Für eine Kultur, die ‚Fehler‘ jahrzehntelang als Feind betrachtet hat, ist diese Umstellung nicht leicht. Diese eingefleischte Denkweise muss verändert und aktualisiert werden. Unser Programm „Prethinking the Futures“ setzt genau hier an: Veränderung, Agilität und Adaptivität als zu erlernende Kompetenzen. Es sei noch einmal gesagt, dass wir daher von Zukünften (futures) und nicht von Zukunft sprechen. Jeder Mensch und jede Institution müssen sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Die Zukunftspsychologie ist also – resümierend – der Beipackzettel oder die Gebrauchsanweisung, um mit der existenziell gewordenen Transformation zurechtzukommen.
Kehren wir zum Zukunftskompass und zur Zukunftsnavigation zurück: In erster Linie dienen sie dem Individuum, der Einzelperson. Die generierten und anonymisierten Daten können aber nicht nur individuell, sondern auch für größere Gruppen oder Unternehmen ausgewertet werden. So kann der auf eine repräsentative Gruppe angewandte Zukunftskompass auch ein klares Bild von der Veränderungskompetenz und Zukunftsvorstellung einer Firma zeichnen. Wir haben dies mehrfach erfolgreich umgesetzt: Ein signifikantes Beispiel dafür ist die opta data Gruppe, die den Zukunftskompass vor drei Jahren mit fünfzig Führungskräften durchgespielt hat. Daraus entstanden eine Anamnese der Zukunftsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Abteilungen, ein konkreter Ideenpool für Innovationen und eine präzise Landkarte der psychischen Befindlichkeiten. Selten habe ich als Wissenschaftler erlebt, so experimentell und frei arbeiten zu können. Der Mut wurde belohnt, die Unternehmenskultur und auch die generelle Zukunftskompetenz wurden dynamisch verbessert und sind gewachsen.
2
Zukunftspsychologie und Hirnforschung: Unsere Zukunft entsteht im Gehirn
Jeder Gedanke und jede Tat machen unsere Zukunft aus. Wir sind die Zukunftsmacher und Zukunftsmacherinnen. Dies wird vor allem dann bemerkbar, wenn wir uns verändern wollen.
Da Wandel immer im Kopf beginnt, müssen wir unsere Gedanken auf diesen Ausgangspunkt richten: „Wer den Wandel also will, muss sich verwandeln.“3 Das klingt einfach, ist aber weit schwieriger, als die Dinge einfach laufen zu lassen. Natürlich möchten viele Menschen sowohl sich selbst als auch die Welt verbessern. Aber wie stellt man das an? Wo ist der konkrete Hebel, den man umlegen kann, um eine neue Richtung einzuschlagen? Wie bekomme ich meinen Willen in den Griff, damit er endlich das tut, was mir vorschwebt? In den letzten Jahrzehnten ist die Hirnforschung zu einem bedeutsamen Hoffnungsträger für unsere Selbsterkenntnis geworden. Leider steht eine leicht einsetzbare Gebrauchsanleitung für dieses zentrale Steuerungsorgan noch nicht zur Verfügung. Das umfassende Expertenwissen auf die Ebene des Alltäglichen zu übertragen und in unserem Mindset zu verankern, bleibt vorerst eine Kunst.4
Das Verständnis der komplexen Materie wird zusätzlich dadurch erschwert, dass sich viele professionelle Einschätzungen voneinander unterscheiden oder gar einander widersprechen. Haben wir nun einen eigenen Willen oder sind wir fremdbestimmt? Arbeitet das Gehirn wie ein Computer oder handelt es sich um ein nicht vergleichbares System? Kann die Hirnforschung unser Verhalten und Erleben tatsächlich erklären? Es bleiben Rätsel, die den bewussten Einsatz unseres außergewöhnlichsten Organs weiterhin erschweren. Ein zusätzliches Problem sind seit Langem gültige Erkenntnisse, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben, jedoch immer noch wirken. Hunderte von Jahren lang hielt man die einmal entstandenen Verschaltungen im Gehirn für unveränderbar. Das Gegenteil konnte zwar bewiesen werden, dennoch halten sich solche Mythen hartnäckig. Die unauflösbare Komplexität hat dazu geführt, dass wir nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist. Dies ist ohnehin der größte Angriff auf unser Mindset, dass alles nach subjektiven und interessenbedingten Faktoren interpretiert wird. In dieses Chaos möchte ich eine kleine narrative Lichtung schlagen, um eine gemeinsame Aussicht zu erzeugen.
Gehirn und Gesellschaft: Das Gehirn ist eine soziale Plattform
Mein Gehirn ist mein Garten.5 Ich habe ihn von meinen Eltern geerbt und bin mir bewusst, dass darin auch das Vermächtnis meiner Vorfahren liegt. Ihn bloß zu erhalten hieße, in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Ihn verwahrlosen zu lassen bedeutet, gar kein eigenes Leben zu führen. Die ersten bewussten Bilder dieses Gartens haben meine Vorstellungen geprägt. Sie sind wie die Konturen eines Malbuchs für Kinder, in ihnen habe ich das erste Mal gegärtnert. Zwei fundamentale Einsichten zeichnen sich ab: Jeder Mensch besitzt einen eigenen Garten, und keiner dieser Gärten ist ein Abbild der Welt, sondern lediglich eine Vorstellung davon. Jeder Schritt, jeder Gedanke und jede Handlung in diesem Garten haben Einfluss auf seine Landschafts- und Lebensarchitektur. Ob bewusst oder unbewusst – wir sind unentrinnbar die Gärtnerinnen und Gärtner. Wir können nicht wie auf einem fliegenden Teppich abheben und plötzlich anderswo ganz neu anfangen. Wie ein Mosaikstein sind wir in ein Fundament aus Natur, Kultur und Umgebung eingelassen, das mit unserem Wesen und allen einströmenden Herausforderungen interagiert.
Die Beschaffenheit meines Gartens richtet sich nach der Art und Weise, wie ich ihn benutze und gestalte. Darin liegt meine Freiheit. Ich kann kaum beeinflussen, was mir widerfährt, aber sehr wohl, wie ich darauf reagiere. Das Wetter, andere Menschen, die Verhältnisse und alles Unvorhersehbare sind Faktoren meiner Lebensbewältigung, die meine Gartenpflege beeinflussen. Insofern ist mein Garten kein Befehlsstand, in dem ich losgelöst agiere, sondern der zentrale Mittelpunkt für Koordination, Vermittlung, Beziehungen und lebenslanges Lernen. Mir ist es nicht möglich, den gesamten Garten in seiner Vielschichtigkeit zu überblicken. Die meisten Vorgänge vollziehen sich ohne meine bewusste Teilnahme, und dennoch bin ich hundertprozentiger Teil dieser Geschehnisse.
Leider ist das Erlernen dieser Gartenarbeit noch kein fester Bestandteil unserer Erziehung und Bildung, sodass wir weitgehend auf uns selbst zurückgeworfen sind. Dazu kommt, dass jeder Garten erheblich von Bedingungen abhängig ist, die uns maßgeblich vorbestimmen. Ob man auf dem Land, in unwirtlicher Umgebung, in armen oder reichen Ländern, in wohlhabenden oder prekären Verhältnissen geboren wird, definiert unsere Ausgangsbedingungen. Es ist müßig, in Bezug auf die Lebensquelle über Fairness oder Gerechtigkeit nachzudenken, denn wir haben keinen Einfluss darauf, wo unser Leben aus dem Boden wächst. Nur im Bauch der Mutter erlebt der Mensch offenbar jenes Gleichgewicht, das ihm Ruhe beschert. Danach finden wir uns alle im eigenen Garten wieder und müssen uns unserem Schicksal stellen.
Auf einer weißen, vorstrukturierten Fläche beginnt nun der Lauf der Dinge: Ob bürgerliche oder fürstliche Eltern, Flüchtlinge oder Kriegsopfer, überforderte oder begnadete Erzieherinnen und Erzieher, das Klima der ersten Jahre bestimmt unser Selbstwertgefühl. Wenn wir spüren, dass wir Einfluss nehmen können, entdecken wir den Garten als einen Raum der Veränderung. Erleben wir das Gegenteil, empfinden wir den Garten als Gefängnis. Über allem steht die Furcht, dass unsere Gärten von Krankheiten, Übergriffen und eigenen Unzulänglichkeiten bedroht sind. Diese Ängste sind ein immerwährender Angriff auf unser Gleichgewicht. Da wir das Ausmaß aller Gärten niemals überschauen können, halten wir den eigenen Garten für die Welt. Die Art und Weise, wie wir den Garten bestellen, entscheidet letztendlich, in welcher Realität wir leben. Je öfter wir den Keim der Abneigung säen, umso stärker wächst die Pflanze der Feindschaft. Je mehr wir den Setzling des Mitgefühls pflegen, desto kräftiger wächst die Blume der Achtsamkeit. Es bleibt ein endloser Kampf, den wir am Ende nicht gewinnen können, aber es sind kontinuierlich Siege möglich, und das Streben nach ihnen macht unser Leben sinnvoll. Sobald die Bereitschaft zu kämpfen nachlässt, droht die Verwilderung. In dieser Phase verlieren die Gärtnerinnen und Gärtner ihre Verantwortung an andere Mächte, die zu Schädlingen in ihrem Garten werden.Wenn wir begreifen, dass jeder von uns auf Gedeih und Verderb seinem Lebensgarten ausgeliefert ist, wächst die Einsicht, dass wir ohne die Wechselwirkung mit anderen keine gemeinsame Welt gestalten können. Die Struktur unseres Gehirns erscheint wie das Sinnbild einer idealen Demokratie – eine Metapher, die der südafrikanische Neurowissenschaftler Henry Markram entwickelt hat:
„Jede Nervenzelle ist einzigartig, und ein und dasselbe Signal wird von tausend Nervenzellen auf tausend unterschiedliche Arten verarbeitet. Doch zugleich respektieren sich die Neuronen vollständig und gleichen permanent ihre Interpretationen miteinander ab – ganz anders als eine menschliche Gesellschaft, in der einer sagt, er habe recht und alle anderen unrecht.“6
Was ist naheliegender, als von dieser lebendigen Vernetzung zu lernen, um die Welt zu verstehen? Wenn wir auf dem Plateau der Vergangenheit verharren, werden wir die Verheißungen dieser unwiderlegbaren Vision nicht erkennen. Es sind berechtigte Zweifel daran erlaubt, dass unsere traditionellen Hierarchien die Menschheit in die Zukunftsfähigkeit führen. In unserem Gehirn hingegen finden ständig Rückkopplungen statt, die in alle Richtungen und Dimensionen weisen. Da gibt es weder Präsidenten, Preisträger, Päpste, noch Diktatoren oder Experten, die Unfehlbarkeit beanspruchen. Stattdessen beobachten wir ständig wechselnde Autoritäten, die im jeweiligen Moment die richtige Antwort kennen. Noch haben wir nicht begriffen, was es heißt, infolge neuronaler Plastizität flexibel zu sein und sich nicht nur dem Recht der Stärkeren zu ergeben. Auch ein kollektives Bewusstsein repräsentiert innerhalb einer Kultur eine Mehrheitsintuition. Wir sollten die Hinweise, die sich hieraus ergeben, ernsthaft überprüfen, um den eigenen Garten mit dem der anderen zu vergleichen. Unser persönlicher Radius ist nur schwer zu erkennen, wenn wir die Rolle der uns umgebenden Personen nicht verstehen. Entscheidend ist die Tatsache, dass der Mensch den anderen grundsätzlich als Projektionsfläche benötigt. In unserem Gehirn arbeiten sogenannte Spiegelneuronen, die in der Lage sind, das Verhalten anderer Individuen vorwegzunehmen. Diese Spiegelfähigkeit unserer Nervenzellen für die Vorstellung von Empfindungen versetzt uns in die Lage, intuitiv und unmittelbar die Empfindungen einer anderen Person zu verstehen. Sobald wir also die Handlung eines anderen beobachten, wird in unserem Gehirn ein motorisches Schema aktiv, das auch zuständig wäre, wenn wir selbst die Handlung ausgeführt hätten.
Dieses System der Spiegelneuronen bietet die neurobiologische Basis, um überhaupt in nachvollziehbaren Dimensionen leben zu können. Ob wir uns auf einer stark befahrenen Autobahn, in einer ausverkauften Kinovorführung oder in einer überlaufenen Einkaufszone befinden – ohne die intuitive Vorwegnahme der Handlungen anderer kämen wir in arge Bedrängnis. Dieses Einfühlungsvermögen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Zukunftsfähigkeit. Aus neurobiologischer Sicht steht fest, dass keine andere Technik oder Methode den emotionalen Zustand einer anderen Person besser erfasst. Hier haben wir es mit einem Verständnis auf Augenhöhe zu tun, dass das Prinzip der Gegenseitigkeit fast organisch manifestiert. Im Vermächtnis und Verständnis der Spiegelneuronen liegt das nachhaltige Potenzial, die Fremdheit der anderen empathisch zu überwinden.
Wir können sicher sein, dass unser Gehirn neurobiologisch auf gute soziale Beziehungen eingestellt ist. Neben dem in der Evolutionstheorie verankerten Überlebenskampf sehen wir die permanente Suche des Menschen nach Spiegelung und Kommunikation. Dieses Bemühen kennen wir aus der gesamten Biologie. Vor allem die Erbsubstanz ist vom Bakterium bis zum Menschen auf Spiegelung angelegt. Dass wir durch die Wahrnehmung eines anderen Menschen dessen inneren Zustand unwillkürlich simulieren können, gehört zu den großen Wundern des Lebens. Im Alltag vergessen wir leicht, dass die zentralen Werte des menschlichen Lebens auf kooperativem Verhalten aufbauen. Liebe, Fürsorge und Mitgefühl werden in wirtschaftlicher Hinsicht als ‚weiche‘ Faktoren geringgeschätzt. Aber dort, wo sie fehlen, herrscht Leid. Das wird am Extrembeispiel offensichtlich: Menschen, die soziale Isolation, Vertreibung und Gewalt erlebt haben, tragen seelische und körperliche Schäden davon, die das erlebte Leiden noch verlängern.
Auf der anderen Seite begegnet uns ein phänomenales Talent: Wir können uns in das Verhalten anderer nicht nur hineindenken und es nachvollziehen, sondern häufig besitzen wir ein klareres Bild vom Beobachteten als dieser oder diese selbst. Eltern und Freunde können in unseren Gesichtern lesen, manchmal wie in einem offenen Buch. Selbst Fremde entwerfen innerhalb von Minuten eine intuitive Ansicht unserer Person, die uns oftmals in ihren Grundzügen verblüffend nahekommt. In jedem Unternehmen, in jeder Regierung, in jedem Büro, in jedem Verein wissen die Menschen Dinge von- und übereinander, über die nicht gesprochen wird. Nennen wir es Impressionen zweiter Ordnung. Es ist erstaunlich, mit welcher Präzision wir diese vordergründigen Informationen zu einer stimmigen Erkenntnis zusammenfügen können. Wir begegnen unzähligen Menschen, deren Los auf ihrer Stirn geschrieben zu stehen scheint. Von der Hemmung bis zum Größenwahn, von der Unterwürfigkeit bis zur Herrschsucht, es dauert nicht lange, bis wir die groben Züge des Gegenübers erfasst haben.
Das eigene Gesicht und das eigene Benehmen tragen die Spuren aller Wünsche, Enttäuschungen und Inszenierungen unseres Lebens. Eine Unausgewogenheit des Verhaltens, die man selbst eventuell nur vage spürt, kann für einen Außenstehenden unmittelbar erkennbar sein. Die tatsächliche Seelenverfassung perfekt zu überspielen, gelingt nur ganz wenigen. Auch die kleinen Selbstlügen, von denen man meint, sie tief im Inneren vergraben zu haben, äußern sich in Mimik und Gestik. Nicht nur die eigene seelische Diaspora hat etwas Beängstigendes, auch die unglaubliche Naivität, mit der man sich vor der Einsicht der anderen geschützt fühlt. Erneut offenbaren sich hier zwei zentrale menschliche Schwächen: das Fehlen einer verlässlichen Selbsteinschätzung und die mangelhafte Kenntnis der Funktionsweise unseres Denkens. Im Zuge der Digitalisierung und der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sind wir schon jetzt auf dem Wege, technisch ausgelesen zu werden. Unsere Ähnlichkeiten sind so groß und vorhersehbar, dass uns Algorithmen und Software wahrhaft auf den Grund gehen werden. Gott sei Dank bleibt das Unbewusste vorerst eine unüberwindbare Hürde für diese weitreichenden Vermessungen.
Unabhängig davon konstruieren wir bisher die uns umgebende Welt ausschließlich im eigenen Gehirn. Dementsprechend reden wir mit einem Anspruch auf Gültigkeit immer nur von dieser uns eigenen Welt. Die unfassbare Menge an subjektiven Erklärungsdefiziten ändert nichts an der Selbstverständlichkeit unserer Weltsicht. Vor dieser gravierenden Mangelbeschaffenheit erscheint die Künstliche Intelligenz zuweilen als Segen, die uns vielleicht aus dem Tal der Begrenztheit herausführen kann. Dazu müsste es ihr in einiger Zukunft gelingen, all unsere Taten, Worte und Gedanken gesamtheitlich zu scannen, um ein tatsächliches Porträt unseres Seins zu zeichnen. Noch ist auch das Bild, das wir uns von der Person machen, zu der wir uns entwickelt haben, lediglich eine Variation unserer Vorstellung. Denn paradoxerweise sind wir selbst das einzige Wesen, das wir nicht direkt anblicken können. Der Philosoph Frithjof Bergmann hat diesen Umstand wie folgt beschrieben:
„Wie sehr wir unseren Kopf auch drehen und wenden, mit unseren eigenen Augen können wir zwar das, was vor uns steht, ganz wunderbar sehen, aber es scheint uns physiologisch unmöglich zu sein, uns selbst anzuschauen. Was für eine groteske Behinderung ist doch die Tatsache, dass wir wie aus Bosheit den einen Punkt in der ganzen Welt, der für uns der wichtigste ist, nicht erkennen können.“7
Denken und Handeln: Gehirne konstruieren die Welt
Mit dieser Unmöglichkeit, uns selbst direkt anblicken zu können, sollte die Einsicht reifen, dass wir die anderen nicht nur zum Überleben benötigen, sondern auch zur Selbsterkenntnis. Wir sind schicksalhaft miteinander verbunden. Aus einer universalen Perspektive macht es Sinn, von einem umfassenden Organismus zu sprechen. Wenn wir die Welt als diesen einen großen, komplexen Organismus erkennen, erschließt sich uns eine konkrete Einsicht – nämlich die, dass wir einander auf die grundlegendste und fundamentalste Weise brauchen. Allein unsere Gehirne machen uns weltweit zu Brüdern und Schwestern, von denen jeder und jede für sich ein Bild der Welt erzeugen, die wir gemeinsam ständig bewegen. Vielleicht ist selbst der Gedanke, dass wir alle neuronale Bestandteile eines planetarischen Gehirns sind, gar nicht so abwegig. Zumindest wird deutlich, dass wir alle in einem voneinander abhängigen System vernetzt sind.
Wenn die anderen mit einfachen, uns allen zur Verfügung stehenden Mitteln hinter die individuellen Kulissen schauen können, dann sollte man auf diese Kompetenzen zurückgreifen. Dass man in dieser Hinsicht zumindest nahestehenden Menschen vertraut, scheint einleuchtend. Aber zwischen Einsicht und Umsetzung liegen wie immer nur mühsam überwindbare Hürden. Erinnern Sie mal jemanden daran, der mit seinem Übergewicht kämpft, er solle sich doch sportlich betätigen! Oder weisen Sie jemanden auf augenscheinliche Vorurteile hin, die ihm oder ihr längst zur manischen Gewissheit geworden sind – Corona lässt grüßen. Hier wie in anderen Fällen wollen die Leute nicht das hören, was mehrheitlich geteilt wird oder wissenschaftlicher Beweisbarkeit entspricht. Wir wissen, dass jeder Mensch sein Gehirn mit jenem Kraftstoff füllt, der ihm gefällt. Gerade in Beziehungen und Familien wird die Kunst der eigensinnigen Verdrängung gepflegt. Warum ist die Vorstellung so unangenehm, von anderen erkannt zu werden?





























